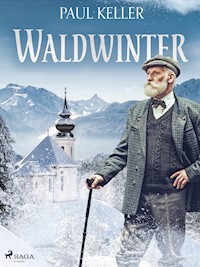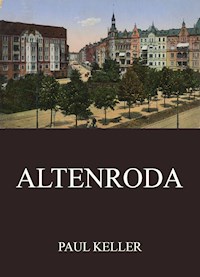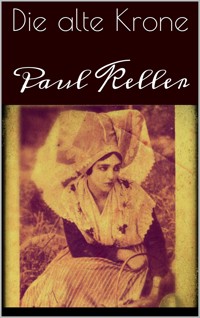Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Von den fünf Waldstädten will ich erzählen, in denen ich als Kind oft glücklich gewesen bin. Wir waren ihrer drei: meine beiden Freunde Ludwig, Heinrich und ich. Als Ludwig in jungen Jahren starb, waren Heinrich und ich die fast unumschränkten Herren der fünf Waldstädte." Diese Waldstädte sind natürlich keine "richtigen" Städte; es sind aber durchaus richtige, wichtige Orte, die von der jugendlichen Fantasie mit der ihnen gebührenden Bedeutung aufgeladen werden: "Ameisenfeld" und "Eichhofen" heißen sie, "Der Geistergrund", "Heinrichsburg" und, zuletzt am wichtigsten, "Die heilige Stadt", denn das ist der Ort, zu dem Ludwig, der Bruder vom Herrn der "Heinrichsburg", am Ende aufbrechen wird ... Neben der Titelerzählung enthält der Band auch die Texte "Der kleine General", "Der Schatz in der Waldmühle", "Der angebundene Kirchturm", "Das Abenteuer auf der Themse", "Die Ferienkolonisten", "Gedeon", "Hotel Laubhaus", "Mein Roß und ich" und "Die Räuber aus dem Riesengebirge", von denen hier nur noch einer exemplarisch herausgegriffen sei: Gedeon, die Hauptfigur der gleichnamigen Erzählung, ist der älteste Sohn der zehn Kinder Eduards, des Onkels des Ich-Erzählers. Als Ältester ist er der unanfechtbare Alleinherrscher, der als strahlender Held souverän über die Kinderschar regiert. Durch Demonstration seiner Tabakschnupfkünste gelingt auch dem Ich-Erzähler die Aufnahme in Gedeons illustren Ehrenkreis. Doch da geschieht das Unfassbare, und Gedeon muss beweisen, ob er wirklich jener unverwüstliche Held ist, für den ihn alle halten ... Paul Kellers "Buch für Menschen, die jung sind" fesselt mit seinen teils amüsanten, teils tragischen, immer aber unterhaltsamen Geschichten Junge und Junggebliebene nicht nur durch seinen köstlichen Humor und seine tiefe Ernsthaftigkeit, sondern auch durch die geradezu bezaubernde Sprache und überhaupt den unwiderstehlichen Zauber, den dieses einzigartige Werk um den Leser legt.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 187
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Keller
Die fünf Waldstädte
Ein Buch für Menschen, die jung sind
Mit Bildern von G. Holstein undReinhold Pfaehler von Othegraven
42. bis 49. Auflage.
Saga
Die fünf Waldstädte
© 1920 Paul Keller
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711517338
1. Ebook-Auflage, 2017
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Die fünf Waldstädte.
Von den fünf Waldstädten will ich erzählen, in denen ich als Kind oft glücklich gewesen bin.
Wir waren ihrer drei: meine beiden Freunde Ludwig, Heinrich und ich. Als Ludwig in jungen Jahren starb, waren Heinrich und ich die fast unumschränkten Herren der fünf Waldstädte.
Da war in der Gegend zwischen Frankreich und Russland ein Wald, der war so gross, dass ein lahmer Mann an die dreiviertel Stunden brauchte, ehe er um ihn herum war. In diesem Walde lagen die fünf Waldstädte: Ameisenfeld, Eichenhofen, Geistergrund, Heinrichsburg und die heilige Stadt. Alle fünf Städte waren von seltener Pracht und Herrlichkeit, und es gab Wunder über Wunder in ihnen zu sehen, obwohl gar keine grossen, steinernen Häuser in ihnen standen und unsere Städte nach Meinung dummer Knechte und alberner Mägde nur „ganz gewöhnlicher Busch“ waren. Wir aber wussten sicher, dass es Städte waren, und Heinrichs Mutter wusste es auch. An allen Frühlings- und Sommertagen, aber auch zur wilden Sturmzeit im Herbst reiste ich mit meinem Freunde durch das Gebiet der fünf Städte, und wenn einer etwas Neues entdeckte, dann war er glücklich, es unserer „lieben Fee“ zu sagen. Das war Heinrichs schöne Mutter. Die ging oft mit uns durch die fünf Waldstädte, und was wir selbst nicht sahen und fanden, das sah sie und fand sie und zeigte es uns. Sie erzählte und sang Lieder vom heiligen, deutschen Wald und machte ihn uns lieb und vertraut.
Da war also zunächst die Stadt
Ameisenfeld.
Sie war 90 Quadratmeter gross und hatte nach der letzten Volkszählung 567 319 Einwohner. Deshalb zählte sich Ameisenfeld mit Recht zu den Grossstädten. Die Bewohner von Ameisenfeld waren berühmt durch ihren Fleiss und ihre Betriebsamkeit. Sie beschäftigten sich damit, sich zu ernähren und Eier zu legen. In ihren freien Stunden prügelten sie sich. Ob dieser Eigenschaften galten die Ameisenfelder im ganzen Lande nicht nur als sehr fleissig, sondern auch als sehr intelligent. Man erzählte sogar, dass ein grosser Prophet unter ihnen erstanden sei, der folgende tiefsinnigen Lehren aufgestellt hatte:
„Wenn dir ein Hölzlein zu schwer zu tragen ist, nimm dir jemand zu Hilfe!“
„Wenn dir eine Blattlaus süssen Saft gibt, der dir sehr wohlschmeckt, dann beisse sie nicht tot.“
„Wenn dir jemand irgendwie nicht passt, so bespritze ihn mit einem ätzenden Saft, damit er schnell Reissaus nehme.“
Das waren die Grundsätze, nach denen die Ameisenfelder fortan lebten. —
Es geschah aber, dass eines Tages ein Igel durch das Stadttor von Ameisenfeld, das durch die Blätter einer grossen Schwarzwurz gebildet wurde, einzog und Quartier begehrte. Der Bürgermeister der Stadt liess sich schnell von seinen sieben Stadträten die Fühler abputzen und ging dem grossen Gaste entgegen. Als er ihn sah, knickte er vor lauter Ehrfurcht mit allen sechs Beinen vor ihm ein: und sagte:
„Hoher Herr, dir unsere Gefühle ob deines Einzugs in unsere Stadt auch nur annähernd zu schildern, geht leider über meine Kraft. Was uns vor allem bewegt, ist tiefe Beschämung. Denn siehe, Ameisenfeld ist nur eine Fabrikstadt. Unsere Strassen sind bestreut mit dem Schutt der Arbeit. Anlagen haben wir keine, ausser einer Distelplantage und einem kleinen Gundermannwäldchen. In deren Schatten würdest du dich nicht wohlfühlen. Und es fehlt uns leider auch an einem geeigneten Palast für dich.“
Der Igel zog die Stirn in Falten und sagte:
„Ich bin ein Forschungsreisender. Ehe ich nicht Ameisenfeld in- und auswendig kenne, kann ich nicht weiterziehen. Vor allen Dingen will ich hier einen wissenschaftlichen Vortrag halten.“
Der Bürgermeister legte über dieses Anerbieten eine gezwungene Freude an den Tag und liess den Vortrag für abends 6 Uhr ansagen. Da kein Eintrittsgeld erhoben wurde, erschien die ganze Stadt. Der Igel hub nun an zu reden von den schweren Gefahren, die dem Ameisenvolke drohten. In Südamerika lebe ein Tier, das trotz seines schlichten Namens Myrmecophaga jubata doch eine scheussliche Bestie sei. Es habe einen spitzen Rüssel und eine ellenlange, mit Leim bedeckte Zunge. Den Rüssel und die Zunge stecke es nun in die Ameisenhäuser und fange und morde, was es nur erwischen könne. Wenn man dagegen ihn, den Igel, betrachte, müsse man einsehen, dass er weder eine spitze Schnauze noch eine klebrige Zunge habe.
Die Ameisenfelder hatten der Erzählung zitternd zugehört. Als der Igel geendet hatte, brachte der Bürgermeister ein Hoch auf ihn aus, wobei er sich auf den Rücken legte, damit er bei dem Hoch alle sechs Beine in die Höhe strecken konnte. Der Igel nickte befriedigt und sagte: wenn sich also die Ameisenfelder über seine Ankunft so freuten, so wolle er gern das Opfer bringen und etwas bei ihnen bleiben.
Darauf aber erhob sich ein kecker Ameisenjüngling, welcher sagte:
„Was geht uns das Tier aus Südamerika an, wo doch unsere Waldstadt gar nicht in Südamerika liegt?“
Der Igel zog seine Stirnrunzeln bis zur Nase herab und rief:
„Habt ihr je solchen Unverstand gehört? Kann sich nicht alle Tage ein Myrmecophaga jubata auf einem Schiff ohne Pass einschmuggeln und zu uns kommen? Sind nicht auf solche Weise alle ausländischen Tiere zu uns gekommen?“
Die Menge nickte Beifall, sah voll Missbilligung auf den naseweisen Ameisling, und der Bürgermeister meinte: „Er muss streng bestraft werden!“
„Das muss er!“ nickte der Igel, „und um mich euch gefällig zu erweisen, werde ich ihn hinrichten!“
Darauf frass der Igel den Ameisenjüngling. Wie von ungefähr erwischte er auch noch dreissig Verwandte des Jünglings, die in dessen Nähe standen.
Darüber erschrak das Volk; der Bürgermeister aber zwinkerte ihm beruhigend zu: über so einen kleinen Fehlgriff eines grossen Herrn dürfe man keinen Lärm machen.
So blieb der Igel in Ameisenfeld, bis sich das Volk allgemach um 90 Prozent vermindert hatte. Da endlich versammelte der Bürgermeister eines Nachts heimlich die wenigen Überlebenden, und sie beschlossen, gemeinsam über den mörderischen Igel herzufallen und ihn zu töten.
Mit dem Heldenmute, der den Ameisenfeldern eigen und der im ganzen Lande berühmt ist, zogen sie aus.
Sie fanden den Igel tot. Er hatte sich den Magen überfressen und war an Ameisensäurevergiftung gestorben.
Der Bürgermeister atmete auf, trat auf seine Leiche und hielt eine Rede:
„Bürger, da liegt unser Feind! Tot! Er hat unserer Macht nicht zu widerstehen vermocht. An der starken inneren Kraft der Ameisenfelder ist er zugrunde gegangen. Der Ruhm unserer Stadt ist und bleibt unsterblich!“
Das Volk trampelte mit allen sechs Beinen Beifall und winkte mit den Fühlern.
Darauf wurde ein grosses Freudenfest gehalten. Alle Bürger zogen auf die grüne Alm, die in der Nähe von Ameisenfeld war. Dort wurde die grosse Fingerhutglocke geläutet. Dann wurden die Blattläuse gemolken. Alles Volk trank sich ein Räuschlein an, und schliesslich sprach man mit einer gewissen Liebe und Achtung von dem Igel, dem allein dieses fröhliche Fest zu verdanken war.
Eichenhofen.
Der grosse Baum, der Eichenhofen seinen Namen gab, war so schön und gewaltig, dass mein Freund Heinrich behauptete, das sei dieselbe Eiche, die Bonifacius einst bei den alten Hessen umgehauen habe. Ich glaubte dies eine Zeitlang, dann aber kam mir der Gedanke, unsere Eiche werde vielleicht doch nur der Sohn von jener berühmten Donarseiche sein. „Nein,“ sagte Heinrich, „Sohn ist viel zu jung; wenn sie es nicht selbst ist, dann ist sie ihr Vater!“
Dabei blieb es, und das war nun historisch.
Eine grimmige Feindschaft hegten wir gegen vier Waldarbeiter, die einst, um uns zu verspotten, sich die Hände reichten und einen gemütlichen Tanz um unsere Eiche ausführten, wo wir doch bestimmt festgestellt hatten, dass der Baum von sieben Männern nicht zu umspannen sei. Wir setzten uns über das höchst ärgerliche Vorkommnis nur dadurch hinweg, dass wir uns sagten, die Arbeiter seien betrunken gewesen und darum „gelte“ ihr Tanz nicht.
Eichenhofen war rings von Brombeer- und Himbeerhecken eingefasst; auch viele wilde Rosen blühten an seinen Grenzen. Da dachten wir oft an Dornröschens Schloss, und jeder brach gern und kühn durch die Dornenhecke, zumal zur Spätsommerzeit, wenn die Beeren reiften. —
Die „Traumstadt“ nannten wir Eichenhofen auch manchmal. Da gab es einen Moosplatz, auf dem die Käferlein stolzierten und eitel ihre funkelnden Röcke zeigten, eine Rosenstrasse, wo unter lauter lieblichen Heckenröslein sich das Volk der hastenden Bienen und der sammetröckigen, vornehmen Hummeln tummelte, eine Hirschstrasse, die tief ins Dunkel des Waldes ging und auf der wir einmal zu seinem und unserem Schrecken dem König des Waldes begegneten.
In Eichenhofen ersann ich mein erstes Märlein, dort klangen die ersten Verse in meiner Seele. Ich erfand eine Geschichte von dem Brünnlein, dessen Wasser im Mondschein zu goldgelbem Wein wird, von dem die Gnomen ihr Schöpplein trinken, und wenn Heinrich und ich fortan aus dem Brünnlein tranken, sahen wir uns oft an und sagten: es schmeckt wirklich wie Wein. Ich konnte das um so eher sagen, als ich damals noch nie einen richtigen Tropfen Wein getrunken hatte.
Einmal, als ich ein Gedicht gemacht hatte, das ich Heinrichs Mutter, unserer „Fee“, vorlas, küsste sie mich auf die Stirn, flocht einen Eichenkranz, setzte ihn mir auf den Kopf und sagte: „Gott segne dich!“ Da war es wirklich, als ob ein tiefer Segenstrom von dem grünen Kranz aus durch meine Seele ränne; ich stand ganz still da und ging dann bald nach Hause. Dort hängte ich das Kränzlein über mein Bett, rund um das kleine Kreuz herum, das dort war, und wenn ich fortan mein Abendgebet sprach und den Kranz sah, betete ich immer einen Satz mit: „Lieber Gott, lass mich ein Dichter werden.“ Ich sprach aber die Worte nie aus, ich dachte sie nur; ich schämte mich, sie zu sprechen.
Heinrich war mein treuer Freund. Er neidete mir meinen Kranz nicht; aber er sehnte sich danach, auch einen zu erhalten. Er bekam ihn erst, als er sich ihn verdient hatte. Ehrlich verdient! Er hatte ein kleines Mädchen mit Gefahr seines eigenen Lebens aus dem Wasser gezogen. Damals hatte die Fee wohl ihren glücklichsten Tag, als sie ihrem Jungen den Eichenkranz flocht. —
Sonst war es mit unserer Tapferkeit nicht übermässig gut bestellt; ja, es gab Fälle, wo wir eine traurige Rolle spielten.
Einmal machten wir einen schauerlichen Fund. Wir entdeckten im Dorngestrüpp die Leiche eines Eichkätzchens. Erschüttert betrachteten wir das herrliche Tier, seufzten laut und lange und zergrübelten uns die Köpfe, was seinem jungen, lustigen Leben ein so jähes Ende bereitet haben könne.
„Vielleicht hat es der Marder gefressen,“ sagte Heinrich tiefsinnig.
„Oder eine Eule hat es fortgeschleppt,“ meinte ich bedächtig.
Darauf war eine Pause. Plötzlich machte ich ein spöttisches Gesicht und sagte: „Wie kann es dein Marder gefressen haben, wenn es doch noch hier liegt?“ Worauf sich Heinrich höhnisch an die Stirn tippte und sprach: „Kann es wohl deine Eule weggetragen haben, wenn es noch hier liegt?“
So machten wir uns gegenseitig unsere Überlegenheit klar, und einer ärgerte sich über die Dummheit des anderen. Endlich glaubte ich es zu haben: „Es ist jedenfalls fehlgetreten, heruntergestürzt und hat den Hals gebrochen.“
„Nein,“ sagte Heinrich, „der Hals ist noch ganz. Es hat gewiss einen giftigen Pilz gefressen.“
Da schrie ich: „Nein, siehst du, es ist totgeschossen!“
Das Eichkätzchen war wirklich erschossen; wir sahen nun deutlich die Schusswunde.
Heinrich erbleichte.
„Das ist ein Wilddieb gewesen,“ sagte er.
Ich sah ihn an, nickte mit dem Kopfe und rannte ohne weiteres davon. Und er rannte hinterher. Wir rannten so lange, bis wir in der Nähe von Feldarbeitern waren, und blieben dann mutig stehen.
„Wir müssen den Mörder fangen,“ sagte Heinrich ganz laut.
„Ja, wir müssen ihn fangen,“ rief ich und ballte die Faust. Darauf beschlossen wir, zum Förster zu gehen und ihm die verbrecherische Tat zu melden. Wir rieten, wo der Förster zu dieser Stunde sein könne, und fanden die grösste Wahrscheinlichkeit schliesslich darin, dass er in der Schenke sei. Und so war es auch. Er hörte unseren fast atemlosen Bericht an und machte ein bitterernstes Gesicht.
„Der Wilddieb muss augenblicklich gefangen werden,“ meinte er zornig, spielte mit zwei anderen Männern noch eine halbe Stunde lang Karten und ging dann mit uns.
Ganz in der Nähe hatte Heinrich seine Vogelflinte und ich meine Armbrust aufbewahrt. Diese Waffen holten wir, nahmen sie schussbereit unter den Arm und folgten dem Förster, der sagte, nun sei ihm vor dem Wilddieb weiter nicht bange.
Ich für meinen Teil gestehe, dass ich diese lobende Anerkennung meiner Männlichkeit und Tapferkeit nur mit gemischten Gefühlen aufnahm. Eine Armbrust einem mörderischen Wilddieb gegenüber ist immer so eine eigene Sache. Man muss aufs Auge oder vielleicht auch auf die Schläfe zielen, wenn man einen Erfolg haben will. Aber ich war nun einmal eine Person, auf die sich der Förster in seinem schweren Beruf verliess, und so wollte ich in der Stunde der Gefahr nicht kneifen.
Wir durchsuchten den ganzen Busch. Ein paarmal entdeckten wir Fussspuren, den Wilddieb aber fanden wir nicht. Von Minute zu Minute wuchs unser Mut, und in grosser Tollkühnheit riefen wir laut, er solle nur zum Vorschein kommen, der elende, feige Kerl. Er kam nicht, und schliesslich sagte der Förster: „Wahrscheinlich ist der Wilddieb mal auf einen Augenblick weggegangen. So’n Mann hat ja auch mal was anderes vor.“
Das bedauerten wir sehr, und wir verachteten den Wilddieb, der nicht auf seinem Posten geblieben war. Der Förster machte den Vorschlag, wir könnten ja unterdes das Eichhorn beerdigen. Darauf gingen wir mit Freuden ein. Das tote Tierchen wurde in eine Erdgrube gelegt, und wir drei standen mit feierlichen Angesichtern an seinem Grabe. Der Förster befahl mir, mit meiner Armbrust den Trauersalut zu schiessen. Darauf schoss ich meinen Rohrpfeil über das Grab hinweg, und der Förster machte mit seinem Munde „Plaff!“ dazu. Das veranlasste mich, ihn scharf anzusehen, ob er die ganze Sache auch ernst nehme.
Er nahm sie aber sehr ernst. Mit geradezu verbissenem Gesicht stand er da, und mit dumpfer Stimme sprach er:
„Heinrich, halte eine Leichenrede! Aber vergiss das ‚Amen!’ nicht.“ Heinrich und ich waren beide ausgezeichnete Redner. So war es kein Wunder, dass Heinrich, ohne sich’s erst lange zu überlegen, folgende schöne Rede hielt:
„Liebes Eichhörnchen, du bist leider tot. Von wegen eines Schuftes! Er hat jetzt gerade etwas anderes zu tun, sonst täten wir ihn erschiessen. Liebes Eichhörnchen, du warst das schönste Tier auf der ganzen Welt. Du hast so niedliche Pfoten. Jedes Jahr zu Weihnachten werde ich dir drei grosse, vergoldete Nüsse in dein Grab stecken. Amen.“
Der Förster drückte die Augen zu, dann wies er auf mich.
„Jetzt halte du eine Leichenrede!“
Ich hustete, bis ich rot wurde, dann sagte ich:
„Liebes Eichhörnchen, du bist leider tot. Von wegen eines Schuftes!“
„Du leierst ja wieder dasselbe her!“ fuhr mir der Förster dazwischen. Ich sagte verlegen, es komme schon noch, hustete noch einmal lange und inbrünstig und sagte dann: „Liebes Eichhörnchen, du warst das allernützlichste Tier. Hoch auf der Eiche hast du dein Haus gehabt, und es hatte immer die Tür dort, wo kein Wind ging. Und, und im Winter hast du geschlafen. Und, und du konntest so fix turnen. Und du hattest einen schönen Schwanz und vier schöne, weisse Nagezähne. Amen.“
Nun hustete der Förster, stützte sich auf seine Büchse und sprach:
„Jetzt werde ich eine Leichenrede halten!“
„Liebes Eichhörnchen, du warst also sozusagen das allerschönste und allernützlichste Tier. Wenn ein Vogelnest auf der Eiche war, dann bist du gleich fix angeturnt gekommen. Da hast du mit deinen niedlichen Pfoten die Eierchen genommen und hast sie ausgesoffen. Und dann, liebes Eichhörnchen, wenn kleine Vögelchen im Neste waren, dann hast du sie mit deinen schönen, weissen Nagezähnen zerbissen und gefressen. Wenn ein Baum im Frühjahr frische Sprossen trieb, hast du sie hübsch zierlich abgenagt, du liebes Eichhörnchen, du! Und darum ist ein ‚Wilddieb’ gekommen und hat dich tot geschossen, du Rabenvieh, du Kanaille! Und der Wilddieb war ich selbst, und ich habe das alles gemacht, um mal zwei Schafsköpfen eine Lehre zu geben. Amen.“
Damit machte er Kehrt und stapfte davon.
Heinrich und ich standen mit offenen Mäulern da. Ich fand zuerst die Sprache wieder und sagte: „Das ist eine Gemeinheit.“ Heinrich aber meinte: „Er hat was von zwei Schafsköpfen gesagt!“
„Damit sind wir gemeint,“ sagte ich zornig. „Und er hat das Eichhörnchen selbst erschossen.“
Heinrichs Stirn zog sich in Falten.
„Wenn ich mal unser Gut erbe,“ sagte er, „setze ich ihn ab.“
„Das tue aber bestimmt,“ rief ich, „er hat es verdient!“
Von fernher scholl das fröhliche Lachen des Försters.
Der Geistergrund.
Der Geistergrund war der einzige Ort im Gebiet der fünf Waldstädte, von dem die Leute im Dorfe etwas Genaueres wussten. Während so ein Bauer achtlos durch Ameisenfeld stapfte und dort nicht einmal den Bürgermeister kannte, während er an der tausendjährigen Donarseiche dumm und achtlos vorüberging, ja selbst nach den Herrlichkeiten von Heinrichsburg kaum hinüberschielte, ging sein träges Herz sofort rascher, wenn er in die Nähe von Geistergrund kam.
Was spielten auch dort für schauerliche Geschichten an dem dunklen Moor und dem Graben mit dem schwarzen Wasser, Geschichten, die Hunderte von Jahren alt waren und an den Winterabenden beim flackernden Kienspanfeuer erzählt wurden, bis alle Wangen rot und alle Herzen bange waren.
Da war die Geschichte von der Bäuerin, die ihren Mann umgebracht hatte, indem sie ihm ein Mahl von giftigen Pilzen bereitete. Noch am gleichen Tage kam die schwere Übeltat ans Tageslicht, und am anderen Morgen errichtete die Obrigkeit einen Galgen und hängte die Bäuerin auf. Aber ihr Leichnam verschwand, und auch der Leichnam des Mannes verschwand, und lange Zeit wusste niemand, wohin beide gekommen seien, bis eine Frau im Geistergrund einen grossen giftigen Pilz sah, der den Hut vor ihr abnahm und sagte: „Erbarme dich meiner, erbarme dich meiner!“ Als die Frau sich vor Schreck nicht rühren konnte, kam eine Schlange gekrochen und wickelte sich dem Pilz ums Bein. Und die Schlange sprach: „Ich fresse den Pilz; ich fresse den hässlichen, geizigen Pilz!“ Sie funkelte dabei mit den Augen.
Da ist die Frau schreiend davongelaufen und hat im Dorfe alles erzählt, und es hat sich lange Zeit niemand an den Geistergrund herangewagt.
Als aber einmal der Schuster Humpel erzählte, er habe nun die beiden auch gesehen, nur hätte diesmal der Pilz die Schlange gefressen, glaubte ihm niemand; denn die Leute waren sehr aufgeklärt, und Humpel war oft betrunken. — — —
Da war die andere Geschichte von dem Müller Eisert. Der war in der Zeit, da der alte Fritz Krieg führte, ins Lager der Russen übergegangen und war ein so schlechter Kerl geworden, dass er gegen seinen eigenen König kämpfte. Eisert besiegte auch den alten Fritz in der Schlacht bei Cunnersdorf und zog dann mit seinen Russen als ein prahlender Kriegsheld bis vor sein Heimatsdorf. Dort liess er Kanonen auffahren und alles zusammenschiessen und in Brand stecken. Dann ritt er auf einem pechschwarzen Ross durch das brennende Dorf und verhöhnte die Leute und zwang sie: „Gnädiger Herr!“ und „Euer Wohlgeboren!“ zu ihm zu sagen. Für diese Missetat wurde er bestraft. Als er wieder fortritt, begann auf dem Turme die Glocke zu läuten. Den Turm und die Kirche hatten die Russen, weil sie Christen sind, verschont.
O, wie drang der Ton der Heimatglocke dem argen Sünder so anklagend ins Ohr! Sie dröhnte ihm in die Seele wie Posaunenton des jüngsten Gerichts und versetzte sein Herz in eine ganz schreckliche Angst. Und plötzlich wandte sich das Ross, jagte zurück auf das Dorf zu, warf den bösen Mann am Eingang des Dorfes auf die Erde und galoppierte ganz allein in die finstere Nacht hinaus.
Der Müller schlich sich an den Turm, um zu sehen, wer da so schrecklich an der Glocke zöge. Da sah er, dass niemand in dem Turm war, dass die Glocke ganz von selber läutete. Darüber wurde er ganz unsinnig vor Angst. Schreiend und winselnd lief er um das Dorf herum, fand auf dem Wege einen Strick und erhängte sich in der Verzweiflung seines Herzens im Geistergrund, wie sich Judas erhängte, als er den Herrn Jesus verraten hatte.
Jetzt noch stand die Weide im Geistergrund, an der der Verräter sein elendes Leben selbst beendet hatte. — —
Das waren unfreundliche Geschichten. Und da war noch eine Geschichte, von der wir Kinder etwas gehört hatten, ohne sie recht zu verstehen. Und eben, weil ich sie nicht verstand, machte ich ein Gedicht darüber. Das Gedicht aber war so!
Das Mädchen.
Weil sie so schwer gesündigt hat,
Da wurd’ sie in den Sumpf gesenkt,
Nun wohnt sie in der Geisterstadt,
Wo niemand ihrer denkt.
Sie hatte ein so weisses Kleid,
Doch einen schwarzen Fleck darauf;
Da steht sie um die Sternenzeit
Oft aus dem Modergrabe auf
Und wäscht mit heisser Tränen Flut
Sich aus dem Kleid den schwarzen Fleck;
Passt auf, Ihr Leute, Gott ist gut:
Das Kleid wird weiss, der Fleck geht weg!
Das war das Gedicht, für das mir unsere gute Fee drüben in Eichenhofen den Kranz schenkte. —
Es gab Zeiten, wo Heinrich und ich uns sehr vor dem Geistergrund fürchteten. Um die Dämmerzeit wären wir nicht hingegangen, und auch wenn die Nebelmänner zwischen den Erlen hin und herkrochen, wagten wir uns nicht in diese Gegend. Heinrich machte sogar einmal den Vorschlag, den Geistergrund abzusetzen. Was ihm nicht passte, wollte er immer „absetzen“: den Förster, den Geistergrund, die Kreuzottern und die lateinische Grammatik. Es ist aber leider alles bestehen geblieben.
Unsere Fee hatte im allgemeinen nichts dagegen, wenn wir uns mal etwas fürchteten. Wenn wir sie fragten, ob es Räuber gebe, sagte sie „Ja!“, und wenn wir wissen wollten, ob wohl die Räuber je in unsere Gegend kommen könnten, sagte sie auch „Ja“! Dann bekamen wir allemal knallrote Backen, und unsere Stimmen wurden weniger krähend, als sie sonst waren. —
Einmal, als wir mit dem Förster zufällig wieder auf freundschaftlichem Fusse lebten, hätten wir ihm gar zu gern eine zahme Dohle abgebettelt, die er in seinem Forsthause hielt. Er machte eine geheimnisvolle Miene und sagte:
„Die kann ich euch nicht geben. Die ist ein ganz seltsamer Vogel. Ich habe sie auf der Judasweide gefangen. Dort hatte sie ihr Nest. Und sie ist eine verwunschene Prinzessin.“
Wir Jungen versuchten, ein ungläubiges Gelächter anzuschlagen, aber es klang ganz meckrig, und wir sahen mit Unbehagen auf den Vogel, der plötzlich auf uns zukam, so dass wir einige Schritte zurückwichen. Die Dohle funkelte uns mit ihren Äuglein an, schlug mit den beschnittenen Flügeln und schrie: „Beatrice! „Beatrice!“
Da sagten wir schnell: „Guten Abend“ und gingen davon. Der Förster kam uns nach.