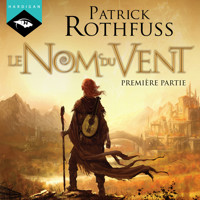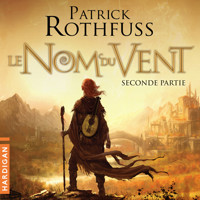19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Königsmörder-Chronik
- Sprache: Deutsch
Erleben Sie, wie Kvothe im Feenreich der betörenden Felurian begegnet, die ihn durch ihre märchenhafte Schönheit fast willenlos macht. Nur durch eine List kann er sich aus ihren Armen befreien. Und sein Weg führt ihn weiter zu den stillen Kriegern der Adem, von denen er die hohe Kunst des Lethani erlernt und das Schwert Saicere verliehen bekommt. Mit ihm und einem von Felurian gewobenen Schattenmantel tritt er die Reise zurück zum Hof des mächtigen Maer an, doch unterwegs wartet entsetzliches Unheil auf ihn … Dieser 2. Teil des Nachfolgebands von »Der Name des Windes« steckt wieder voller neuer Geschichten und Ideen von Patrick. Der Band ist daher so umfangreich geworden, dass man ihn teilen musste in zwei Bände - »Die Furcht des Weisen 1« und »Die Furcht des Weisen 2«. Mit »Die Furcht des Weisen« legt Patrick Rothfuss den zweiten Teil der Königsmörder-Chronik-Trilogie vor, der in den USA bei Kritikern und Fantasylesern begeistert aufgenommen wurde und schon bald einen der vorderen Plätze in der New York Times Bestsellerliste belegte. 2007 wurde Patrick Rothfuss für seinen Roman »Der Name des Windes« mit dem Quill Award sowie dem Pulishers Weekly Award für das beste Fantasy-Buch des Jahres ausgezeichnet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 765
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
PATRICK ROTHFUSS
Die Furcht des Weisen 2
Die Königsmörder-Chronik
Zweiter Tag / Teil 2
Roman
Aus dem Englischen vonJochen Schwarzerund Wolfram Ströle
KLETT-COTTA
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Hobbit Presse
www.hobbitpresse.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »The Wise Man’s Fear«
im Verlag Daw Books, Inc., New York
© 2011 by Patrick Rothfuss
Für die deutsche Ausgabe
© 2011/2012 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte sowie die Nutzung des Werkes für Text und Data Mining i.S.v. § 44b UrhG vorbehalten
Cover: HildenDesign, München, www.hildendesign.de
Unter Verwendung einer Illustration von Kerem Beyit
Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Printausgabe: ISBN 978-3-608-93926-2
E-Book: ISBN 978-3-608-10227-7
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
… Wie Taborlin der Große, dachte ich.
Und schlief lächelnd ein.
Kapitel 93
Egoisten und Halsabschneider
Nach vierzehn Stunden Schlaf war ich wieder munter wie ein Fisch im Wasser. Meine Gefährten staunten nicht schlecht. Schließlich hatten sie mich bewusstlos aufgefunden. Ich war völlig kalt gewesen und über und über mit Blut verschmiert. Sie hatten mich ausgezogen, mir Arme und Beine massiert und mich in Decken gewickelt und in das einzige noch vorhandene Zelt der Banditen gebracht. Die anderen fünf waren entweder verbrannt oder unter Ästen begraben worden, als ein gewaltiger, grellweißer Blitz die Eiche, die in der Mitte des Lagers stand, gespalten hatte.
Am folgenden Tag war es bewölkt, aber zum Glück regnete es nicht. Zuerst versorgten wir unsere Wunden. Hespe war von einem Pfeil ins Bein getroffen worden, als sie zusammen mit Dedan von dem Wachposten überrascht worden war. Dedan hatte eine tiefe Schnittwunde auf der Schulter und konnte noch von Glück sagen, denn er hatte den Posten praktisch mit bloßen Händen angegriffen. Auf meine Fragen sagte er nur, er habe keine Zeit gehabt, sein Schwert zu ziehen.
Marten hatte über einer Augenbraue eine tiefrote Beule, vielleicht von meinem Fußtritt oder weil ich ihn über den Boden geschleift hatte. Sie schmerzte, wenn man sie berührte, doch er meinte, er habe sich bei Wirtshausschlägereien schon oft Schlimmeres eingehandelt.
Mir ging es, nachdem ich mich vom Binderfrost erholt hatte, wieder gut. Meine Gefährten waren wie gesagt über die plötzliche Genesung des Todgeweihten sichtlich überrascht und ich entschied mich, sie nicht aufzuklären. Ein kleines Geheimnis konnte meinem Ruf nicht schaden.
Ich verband die Wunde auf meiner Schulter, an der mich der Pfeil gestreift hatte, und versorgte einige Prellungen und Kratzer, an deren Ursache ich mich nicht erinnern konnte. Der lange Schnitt im Arm, den ich mir selber zugefügt hatte, ging nicht tief, ich brauchte ihn deshalb nicht zu nähen.
Tempi war unverletzt. Sein Gesicht ließ wie immer keine Regung erkennen.
Unsere zweite Aufgabe bestand darin, uns um die Toten zu kümmern. Während ich bewusstlos gewesen war, hatten die anderen die verbrannten Leichen am Rand der Lichtung zusammengetragen. Zu den Toten gehörten:
Der Wachposten, den Dedan getötet hatte.
Die beiden Posten, die Tempi im Wald überrascht hatten.
Drei Banditen, die den Einschlag des Blitzes überlebt und zu fliehen versucht hatten. Marten hatte einen von ihnen getötet, Tempi die anderen beiden.
Siebzehn Banditen, die durch den Blitz erschlagen, verbrannt oder sonstwie zu Tode gekommen waren. Acht davon waren schon vorher tot oder tödlich verwundet gewesen.
Wir fanden Fußspuren eines weiteren Postens, der den Kampf vom nordöstlichen Abschnitt der Anhöhe beobachtet hatte. Sie waren allerdings schon einen Tag alt, und keiner von uns verspürte die geringste Lust, den Mann zu verfolgen. Dedan gab außerdem zu bedenken, er könnte uns lebend nützlicher sein, wenn er anderen, die ebenfalls ein Leben als Bandit in Betracht zogen, vom schrecklichen Ende seiner Kameraden berichtete. Darin stimmten wir ausnahmsweise einmal überein.
Die Leiche des Anführers fanden wir nicht unter den Toten. Das große Zelt, in dem er verschwunden war, lag unter einem dicken Ast der gespaltenen Eiche begraben. Da wir genug anderes zu tun hatten, suchten wir nicht weiter nach seinen Überresten.
Statt dreiundzwanzig Gräber oder ein Massengrab für dreiundzwanzig Leichen auszuheben, errichteten wir einen Scheiterhaufen und zündeten ihn an, solange der Wald noch vom Regen nass war. Ich sorgte mit meiner Magie dafür, dass das Feuer lichterloh brannte.
Es gab allerdings noch eine Leiche: den Posten, den Marten erschossen und den ich für meine Zwecke benützt hatte. Während meine Gefährten eifrig Holz für den Scheiterhaufen sammelten, ging ich über die Südseite des Hügelkamms zurück und fand auch bald die Stelle, an der Tempi ihn versteckt und mit Zweigen zugedeckt hatte.
Ich betrachtete die Leiche lange und trug sie dann weiter nach Süden. Unter einer Weide fand ich einen geeigneten ruhigen Platz. Darüber errichtete ich einen Haufen aus Steinen. Nach all dem kroch ich ins Gebüsch und übergab mich leise, aber heftig.
Der Blitz? Das ist schwer zu erklären. Ein Gewitter über uns. Eine Art galvanischer Bindung mit Hilfe zweier einander ähnlicher Pfeile. Der Versuch, den Baum stärker zu erden als einen Blitzableiter. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob ich mir Ort und Zeit des Einschlags als Verdienst anrechnen darf. Jedenfalls erzählt man sich seither, ich hätte den Blitz gerufen und er sei gekommen.
Den Berichten der anderen zufolge schlug der Blitz nicht einmal, sondern mehrmals in rascher Folge ein. Dedan beschrieb ihn als »Säule aus weißem Feuer« und sagte, der Boden habe heftig gebebt und ihn umgerissen.
Wie auch immer, jedenfalls blieb von der mächtigen Eiche nur ein verkohlter Stumpf in Höhe eines Grausteins übrig. Überall lagen Trümmer des Baums. Auch einige kleinere Bäume und Büsche hatten Feuer gefangen, das jedoch vom Regen gelöscht worden war. Die meisten der langen Bretter, mit denen die Banditen ihr Lager befestigt hatten, waren in tausend Splitter zerborsten oder zu Kohle verbrannt. Vom Fuß des Baums aus durchzogen tiefe Furchen die Erde. Die Lichtung sah aus, als habe ein Wahnsinniger sie umgepflügt oder ein riesiges Tier sie mit seinen Klauen verwüstet.
Trotzdem blieben wir nach unserem Sieg drei Tage lang im Lager der Banditen. Der Bach versorgte uns mit Wasser, außerdem konnten wir, was vom Proviant der Banditen noch übrig war, gut brauchen. Wir konnten auch einiges Segeltuch und Holz aus den Trümmern retten, so dass jeder in den Genuss eines Zelts oder wenigstens Schutzdachs kam.
Nachdem wir unseren Auftrag ausgeführt hatten, lösten sich auch die Spannungen innerhalb unserer Gruppe. Es hörte auf zu regnen, und wir konnten nach Herzenslust Feuer machen, ohne fürchten zu müssen, von den Banditen entdeckt zu werden. Martens Husten besserte sich, Dedan und Hespe zankten sich nicht mehr, und Dedan hatte nur noch vergleichsweise selten etwas an mir auszusetzen.
Trotz unserer Erleichterung, dass alles vorbei war, blieben einige Schatten. Abends wurden keine Geschichten mehr erzählt, und Marten mied mich, so gut es ging. Ich konnte es ihm angesichts dessen, was er gesehen hatte, nicht verdenken.
Nicht zuletzt deshalb vernichtete ich bei der ersten Gelegenheit die Wachspuppen, die ich angefertigt hatte. Ich brauchte sie nicht mehr, und meine Gefährten sollten sie auf keinen Fall in meinem Reisesack finden.
Tempi schwieg darüber, was ich mit der Leiche des Banditen gemacht hatte, und schien es mir auch nicht übel zu nehmen. Erst im Rückblick wird mir klar, wie wenig ich den Adem in Wirklichkeit verstanden habe. Damals merkte ich nur, dass er mir nicht mehr so oft beim Üben des Ketan half und stattdessen mehr unsere Sprache lernte und mit mir über Lethani sprach, das mir allerdings nach wie vor in vielem rätselhaft blieb.
Am zweiten Tag holten wir die Sachen aus unserem alten Lager. Ich war erleichtert, meine Laute wieder zu haben, und doppelt froh, dass Dennas wunderbarer Kasten trotz des endlosen Regens dicht gehalten hatte.
Und da wir ja nicht mehr leise sein mussten, spielte ich. Einen ganzen Tag lang tat ich kaum etwas anderes. Ich hatte seit fast einem Monat keine Musik mehr gemacht und darunter mehr gelitten, als ihr euch vorstellen könnt.
Anfangs hatte ich den Eindruck gehabt, dass Tempi sich nichts aus Musik machte. Ich hatte ihn einmal aus einem mir unklaren Grund durch meinen Gesang beleidigt, und er verließ regelmäßig das Lager, wenn ich meine Laute herausnahm. Doch dann bemerkte ich, dass er mir beim Spielen zusah, wenn auch aus sicherer Entfernung und meist hinter Büschen versteckt. Auf ihn aufmerksam geworden, stellte ich fest, dass er mir jedes Mal beim Spielen zuhörte. Er stand bewegungslos wie ein Stein und hatte die Augen aufgerissen wie eine Eule.
Am dritten Tag erklärte Hespe, sie könne mit ihrem Bein wieder gehen. Wir mussten also überlegen, was wir mitnehmen und was wir im Lager lassen wollten.
Die Entscheidung war leichter als erwartet. Die meiste Habe der Banditen war durch den Blitz, den umstürzenden Baum und das Unwetter zerstört worden. Doch die Ruinen des Lagers bargen auch noch manchen wertvollen Gegenstand.
Das Zelt des Anführers hatten wir bisher nicht durchsuchen können, weil es unter einem dicken Ast der Eiche begraben war. Der Ast war mit über zwei Fuß Durchmesser dicker als so mancher Baum. Am dritten Tag hatten wir ihn endlich so weit zerkleinert, dass wir ihn von dem zerstörten Zelt herunterrollen konnten.
Ich wollte mir unbedingt die Leiche des Anführers genauer ansehen, denn etwas an ihm war mir vom ersten Augenblick an vage bekannt vorgekommen und ließ mir seitdem keine Ruhe. Meine Neugier hatte aber auch noch einen praktischeren Grund: Sein Kettenhemd war mindestens ein Dutzend Talente wert.
Doch er blieb spurlos verschwunden, was uns vor ein großes Rätsel stellte. Marten hatte nur eine Spur gefunden, die vom Lager wegführte, die des geflohenen Wachpostens. Wo aber war der Anführer?
Ich war verwirrt und ärgerte mich zugleich, denn ich hatte sein Gesicht sehen wollen. Dedan und Hespe glaubten, er sei in dem auf den Blitzschlag folgenden Chaos entkommen und vielleicht durch den Bach gewatet, um keine Spuren zu hinterlassen.
Marten machte dagegen, als wir die Leiche nicht fanden, einen beklommenen Eindruck. Er murmelte etwas von Dämonen und hielt sich von dem zerstörten Zelt so weit wie möglich fern. Ich führte das auf seinen Aberglauben zurück, muss aber zugeben, dass das Verschwinden der Leiche mir selbst auch nicht geheuer war.
In dem zerstörten Zelt fanden wir einen Tisch, ein Feldbett, einen Schreibtisch und zwei Stühle, alles zerbrochen und zu nichts mehr zu gebrauchen. Die Schublade des Schreibtisches enthielt einige Papiere. Ich hätte viel darum gegeben, sie lesen zu können, doch die Nässe hatte ihnen zu sehr zugesetzt und die Tinte war verlaufen. Außerdem fanden wir eine Kassette aus einem schweren, harten Holz, die nur wenig kleiner war als ein Brotlaib. Der Deckel trug das Familienwappen Alverons, und sie war fest verschlossen.
Sowohl Hespe als auch Marten gaben zu, eine gewisse Erfahrung mit dem Knacken von Schlössern zu haben, und da ich neugierig auf den Inhalt der Kassette war, ließ ich sie gewähren, solange sie das Schloss nicht beschädigten. Sie versuchten es beide, doch vergeblich.
Nachdem Marten zwanzig Minuten an dem Schloss herumgefummelt hatte, warf er die Hände in die Luft. »Ich krieg es nicht hin, wie es geht.« Er streckte sich und stützte die Hände ins Kreuz.
»Dann werde ich mal mein Glück versuchen«, sagte ich. Ich hatte eigentlich gehofft, einer der beiden könnte die Kassette öffnen. Schlösser zu knacken gehört nicht zu den Fähigkeiten, derer sich ein Arkanist rühmen sollte. Es passte auch nicht zu dem Ruf, den ich mir aufzubauen hoffte.
»Im Ernst?« Hespe zog die Augenbrauen hoch. »Du bist ja wirklich ein kleiner Taborlin.«
Ich dachte an die Geschichte, die Marten einige Tage zuvor erzählt hatte. »Natürlich«, lachte ich. Dann rief ich mit meiner besten Taborlin-der-Große-Stimme »Edro!« und schlug mit der Hand auf die Kassette.
Der Deckel sprang auf.
Ich war genauso überrascht wie die anderen, verbarg es aber besser. Offenbar hatte Marten oder Hespe das Schloss bereits geknackt, aber der Deckel klemmte. Wahrscheinlich war das Holz in der tagelangen Feuchtigkeit aufgequollen und hatte sich erst auf meinen Schlag hin gelöst.
Aber das wussten die anderen nicht. Sie starrten mich an, als hätte ich die Kassette soeben vor ihren Augen in Gold verwandelt. Sogar Tempi hatte die Augenbrauen hochgezogen.
»Guter Trick, Taborlin«, sagte Hespe, offenbar unsicher, ob ich mir einen Scherz mit ihnen erlaubte.
Ich entschied mich, nichts zu sagen, und steckte meine behelfsmäßigen Dietriche wieder zurück in eine Tasche meines Mantels. Wenn ich ein Arkanist werden wollte, dann am besten gleich ein berühmter.
Mit großer Geste hob ich den Deckel und blickte hinein. Als Erstes sah ich einen dicken, zusammengefalteten Bogen Papier. Ich nahm ihn heraus.
»Was ist das?«, fragte Dedan.
Ich hielt ihn hoch, damit alle ihn sehen konnten. Es handelte sich um eine sorgfältig gezeichnete Karte der Gegend, auf der nicht nur der genaue Verlauf der Straße, sondern auch Bauernhöfe und Flüsse verzeichnet waren. Im Westen waren die Dörfer Crosson und Fenhill und das Wirtshaus ZUM GÜLDENEN PENNY eingetragen und namentlich beschriftet.
»Und was ist das?«, fragte Dedan und zeigte mit seinem dicken Finger auf ein unbeschriftetes Kreuz tief im Wald südlich der Straße.
»Ich glaube, das ist das Lager«, antwortete Marten. »Direkt an diesem Bach.«
Ich nickte. »Wenn das stimmt, liegt Crosson näher, als ich dachte. Wenn wir von hier geradewegs nach Südosten gehen, sparen wir uns mehr als einen Tagesmarsch.« Ich sah Marten an. »Einverstanden?«
»Lass mich die Karte sehen.« Ich gab sie ihm und er studierte sie aufmerksam. »Sieht so aus«, nickte er. »Ich hätte nicht gedacht, dass wir so tief im Süden sind. Auf dem direkten Weg sparen wir uns mindestens zwei Dutzend Meilen.«
»Das wäre mir sehr recht«, warf Hespe ein und rieb ihr verbundenes Bein. »Oder will einer der Herren mich tragen?«
Ich wandte meine Aufmerksamkeit wieder der Kassette zu. Sie war mit kleinen, fest in Stoff eingewickelten Päckchen gefüllt. Ich nahm eines heraus. Etwas glänzte golden.
Die anderen murmelten ehrfürchtig. Ich überprüfte die restlichen Päckchen. Auch sie enthielten Münzen, alle aus Gold. Die Kassette enthielt grob geschätzt gut zweihundert Royals. Ich hatte noch nie eine solche Münze in der Hand gehabt, wusste aber, dass eine einzige achtzig Bits wert war, fast so viel, wie der Maer mir für die ganze Unternehmung mitgegeben hatte. Kein Wunder, dass er den Banditen unbedingt das Handwerk hatte legen wollen.
Ich überschlug im Kopf einige Zahlen, rechnete den Inhalt der Kassette in eine mir vertrautere Währung um und kam auf über fünfhundert Silbertalente. Davon konnte man ein ganzes Wirtshaus kaufen oder einen Bauernhof mitsamt Vieh und allem Drum und Dran. Oder einen niederen Adelstitel, eine Stellung bei Hof oder ein Offizierspatent.
Ich sah, dass auch die anderen ihre Berechnungen anstellten. »Wie wär’s, wenn wir einen kleinen Teil davon unter uns verteilten?«, fragte Dedan, wenn auch nicht allzu hoffnungsvoll.
Ich zögerte und griff dann in die Kassette. »Wärt ihr mit einem Royal für jeden einverstanden?«
Die anderen schwiegen, während ich ein Päckchen auswickelte. Dedan sah mich ungläubig an. »Meinst du das im Ernst?«
Ich überreichte ihm eine Goldmünze. »Ich denke, weniger ehrliche Menschen würden das ganze Geld unterschlagen oder einfach damit verschwinden. Ein Royal ist eine angemessene Belohnung für unsere Ehrlichkeit.« Ich warf Marten und Hespe je eine Münze zu.
»Außerdem«, fügte ich hinzu und gab auch Tempi eine, »lautete mein Auftrag, die Banditen zu finden, nicht ein befestigtes Lager zu stürmen.« Ich hielt meinen Royal hoch. »Das ist unser zusätzlicher Lohn für Dienste, zu denen wir nicht verpflichtet waren.« Ich steckte die Münze in die Tasche und klopfte darauf. »Alveron braucht davon nicht zu erfahren.«
Dedan lachte und schlug mir auf den Rücken. »Du bist doch nicht so viel anders als wir.«
Ich lachte ebenfalls und drückte den Deckel der Kassette wieder zu. Das Schloss rastete mit einem Klicken ein.
Meine Großzügigkeit hatte noch zwei weitere Gründe, die ich allerdings verschwieg. Zum einen erkaufte ich mir damit die Loyalität meiner Gefährten. Denn natürlich mussten sie auf den Gedanken kommen, dass sie die Kassette ganz leicht klauen und damit verschwinden konnten. Auch ich hatte das kurz überlegt. Mit fünfhundert Talenten konnte ich zehn Jahre lang an der Universität studieren und hatte noch einiges übrig.
Jetzt dagegen waren sie um einiges Geld reicher und hatten trotzdem das Gefühl, ehrlich gehandelt zu haben. Die Goldmünze in ihrer Tasche würde sie von dem Gold ablenken, das ich bei mir trug. Dennoch nahm ich mir vor die verschlossene Kassette nachts unter mein Kopfkissen zu schieben.
Zweitens konnte auch ich das Geld gut gebrauchen. Den Royal, den ich ganz offen eingesteckt, und auch drei weitere Royals, die ich beim Verteilen des Geldes heimlich für mich abgezweigt hatte. Wie gesagt, Alveron würde den Unterschied nicht bemerken und mit vier Royals konnte ich an der Universität die Studiengebühren für ein ganzes Trimester bezahlen.
Ich steckte die Kassette des Maer zuunterst in meinen Reisesack. Dann überlegten wir, was wir von der Ausrüstung der Banditen mitnehmen wollten.
Die Zelte ließen wir aus demselben Grund zurück, aus dem wir keine eigenen mitgebracht hatten: Sie waren zu sperrig zum Tragen. Dagegen packten wir so viel Proviant ein, wie wir befördern konnten. Je mehr wir hatten, desto weniger mussten wir unterwegs kaufen.
Ich beschloss, auch ein Schwert mitzunehmen. Zwar hätte ich mir nie eins gekauft, da ich nicht damit umgehen konnte, aber wenn es eins umsonst gab …
Tempi beriet mich bei der Auswahl aus dem Arsenal der Banditen. Zunächst engten wir die Wahl auf zwei Schwerter ein. Dann fragte er unvermittelt: »Du kannst nicht mit einem Schwert umgehen?« Mit einem Handzeichen bedeutete er mir, dass ihm die Frage ein wenig unangenehm war.
Die Vorstellung, jemand könne nicht mit einem Schwert umgehen, war für ihn offenbar nicht nur peinlich, sondern ähnlich abwegig wie der Gedanke, jemand könne nicht mit Messer und Gabel essen. »Nein«, antwortete ich zögernd. »Aber ich hatte gehofft, du könntest es mir zeigen.«
Tempi erstarrte. Wenn ich ihn nicht besser gekannt hätte, hätte ich es als Weigerung verstanden. Aber seine Bewegungslosigkeit bedeutete nur, dass er nachdachte.
Pausen sind in Gesprächen auf Ademisch von entscheidender Bedeutung, deshalb wartete ich geduldig. Stumm standen wir nebeneinander, erst eine, dann zwei Minuten, dann fünf, dann zehn … Zuletzt musste ich mich zwingen, weiter nur dazustehen. Vielleicht bedeutete Tempis Schweigen in diesem Fall doch eine höfliche Ablehnung.
Ich hielt mich ja für so schrecklich klug. Ich kannte Tempi jetzt seit fast einem Monat und hatte rund tausend Wörter und fünfzig Handzeichen des Ademischen gelernt. Außerdem wusste ich, dass die Adem nichts Anstößiges an Nacktheit oder gegenseitigen Berührungen fanden, und drang ganz langsam in die Geheimnisse des Lethani ein.
Oh ja, ich hielt mich für sehr schlau. Hätte ich wirklich etwas über die Adem gewusst, ich hätte nie gewagt, eine solche Bitte an Tempi zu richten.
»Bringst du mir dafür das bei?« Er zeigte auf meinen Lautenkasten, der an einem Baum lehnte.
Die Frage traf mich unvorbereitet. Ich hatte noch nie jemanden im Lautenspiel unterrichtet. Vielleicht wusste Tempi das ja und gab mir dadurch zu verstehen, dass es ihm mit dem Schwertunterricht ähnlich ging. Ich wusste, dass er gerne versteckte Andeutungen machte.
Aber was er wollte, war nur recht und billig. Ich nickte. »Versuchen kann ich es.«
Tempi nickte ebenfalls und zeigte auf eins der beiden Schwerter, die wir in die engere Wahl gezogen hatten. »Nimm das. Aber kämpfe nicht damit.« Er wandte sich ab und ging. Damals schrieb ich das seinem wortkargen Wesen zu.
Wir durchsuchten das Lager den ganzen Tag lang nach brauchbaren Dingen. Marten sammelte mehrere Pfeile ein und alle Bogensehnen, die er finden konnte. Außerdem nahm er noch vier vom Blitz nicht beschädigte Langbögen mit, nachdem er uns zuvor gefragt hatte, ob wir sie wollten. Sie waren sperrig, doch hoffte er sie in Crosson für gutes Geld zu verkaufen.
Dedan wählte ein Paar Stiefel und eine gepanzerte Weste, die ansehnlicher war als die, die er trug, außerdem ein Kartenspiel und einen Satz elfenbeinerne Würfel.
Hespe nahm sich eine Panflöte und ein Dutzend Messer, die sie zuunterst in ihrem Bündel verstaute und später verkaufen wollte.
Sogar Tempi fand etwas nach seinem Geschmack: einen Schleifstein, ein Salzfässchen aus Messing und leinene Hosen, mit denen er gleich zum Bach ging, um sie in dem vertrauten Blutrot zu färben.
Ich selber nahm weniger als die anderen. Ein kleines Messer als Ersatz für das abgebrochene und ein Rasiermesser mit einem Griff aus Horn. Ich brauchte mich zwar nicht oft zu rasieren, hatte es mir am Hof des Maer aber angewöhnt. Natürlich hätte ich wie Hespe weitere Messer einstecken können, aber mein Reisesack war aufgrund der Kassette des Maer auch so schon unangenehm schwer.
Man mag es makaber finden, wie wir das Lager plünderten, aber das ist nun mal der Lauf der Welt. Aus Räubern werden Beraubte, und die Zeit macht uns alle zu Egoisten und Halsabschneidern.
Kapitel 94
Über Stock und Stein
Wir beschlossen, der Karte, die wir gefunden hatten, zu vertrauen, und marschierten geradewegs nach Westen durch den Wald in Richtung Crosson. Selbst wenn wir das Dorf verfehlten, mussten wir früher oder später auf die Straße treffen, und wir ersparten uns dadurch viele Meilen Fußmarsch.
Wegen Hespes verletztem Bein kamen wir nur langsam voran. An jenem ersten Tag schafften wir nur sechs oder sieben Meilen. Während einer unserer vielen Pausen begann Tempi mich in den Übungen des Ketan zu unterrichten.
Narr, der ich war, hatte ich geglaubt, er hätte das bereits früher getan. In Wirklichkeit hatte er nur meine schlimmsten Fehler korrigiert, weil sie ihn geärgert hatten, so wie ich jemandem, der auf einer verstimmten Laute klimperte, die Laute weggenommen und sie gestimmt hätte.
Der Unterricht war dagegen etwas ganz anderes. Wir fingen am Anfang des Ketan an, und Tempi verbesserte meine Fehler. Alle meine Fehler. Allein in der ersten Übung fand er achtzehn, und der Ketan besteht insgesamt aus über hundert solchen Übungen. Ich bekam schon nach kurzem Zweifel an meinen Fähigkeiten.
Im Gegenzug begann ich Tempi im Lautenspiel zu unterrichten. Ich spielte im Gehen verschiedene Noten und sagte ihm ihre Namen. Dann zeigte ich ihm einige Akkorde.
Wir hofften, Crosson bis Mittag des folgenden Tages zu erreichen. Doch am Vormittag gelangten wir an einen öden, übel riechenden Sumpf, der nicht auf der Karte verzeichnet war.
Die nächsten Stunden waren eine einzige Plackerei. Bei jedem Schritt mussten wir den Untergrund prüfen, und wir kamen nur noch im Schneckentempo voran. Einmal erschrak Dedan furchtbar und fiel hin. Er schlug wie wild mit den Armen um sich und bespritzte uns alle mit der stinkenden Brühe. Danach erklärte er, er habe eine Stechmücke gesehen, die größer gewesen sei als sein Daumen und einen Stachel wie die Haarnadel einer Frau gehabt habe. Ich erwiderte, es habe sich wahrscheinlich um einen Flittich gehandelt, woraufhin er einige unflätige Dinge sagte, die ich bei erster Gelegenheit mit mir selber tun sollte.
Im weiteren Verlauf des Nachmittags gaben wir es auf, so schnell wie möglich zur Straße zu gelangen, und konzentrierten uns stattdessen auf naheliegendere Ziele wie einen trockenen Platz, an dem man nicht gleich einsank. Doch der Sumpf schien kein Ende nehmen zu wollen. Ein Wasserloch folgte auf das andere, und ganze Wolken sirrender Stechfliegen und Mücken hüllten uns ein.
Die Sonne ging bereits unter, als wir den Sumpf endlich hinter uns ließen, und die schwüle Wärme schlug rasch in eine feuchte Kälte um. Wir marschierten weiter, bis das Gelände endlich anstieg. Obwohl wir müde und durchnässt waren, beschlossen wir einstimmig, noch eine Weile zu gehen, bis wir die Insekten und den fauligen Gestank der Pflanzen endgültig hinter uns gelassen hätten.
Der Vollmond leuchtete uns den Weg zwischen den Bäumen, und trotz der Strapazen des Tages besserte sich unsere Laune. Hespe musste sich auf Dedan stützen, so erschöpft war sie. Als der schlammbespritzte Söldner den Arm um sie legte, sagte sie, er habe seit Monaten nicht so gut gerochen. Dedan antwortete, dem Urteil einer so überaus anmutigen Frau müsse er sich wohl oder übel fügen.
Ich, der ich hinter den beiden ging, wartete angespannt darauf, dass ihr Geplänkel wieder in Streit ausartete. Doch dann sah ich, dass Dedan Hespe geradezu zärtlich umfasste und Hespe sich umgekehrt nur ganz vorsichtig auf ihn stützte und ihr verletztes Bein kaum entlastete. Ich warf Marten einen Blick zu. Der alte Fährtenleser grinste, und seine Zähne leuchteten weiß im Mondlicht.
Wenig später gelangten wir an einen Bach und säuberten uns, so gut es ging. Auch unsere Kleider wuschen wir und zogen trockene an. Ich holte meinen verschlissenen Mantel aus dem Reisesack und hängte ihn mir um, in der vergeblichen Hoffnung, er könnte die nächtliche Kälte abhalten.
Wir waren gerade mit allem fertig, da hörten wir bachaufwärts leisen Gesang. Wir lauschten angestrengt, konnten aber wegen des plätschernden Bachs nichts Genaueres ausmachen.
Doch wo gesungen wurde, waren Menschen: Wir befanden uns also in der Nähe von Crosson oder vielleicht sogar des Wirtshauses ZUM GÜLDENEN PENNY, falls wir im Sumpf zu weit nach Süden abgekommen waren. Das einfachste Bauernhaus erschien uns verlockender als eine weitere Nacht im Freien.
Obwohl wir müde waren und uns alle Glieder wehtaten, verlieh uns die Hoffnung auf ein weiches Bett, eine warme Mahlzeit und ein kühles Getränk neue Kraft. Also nahmen wir unser Gepäck auf und wanderten weiter.
Wir folgten dem Bach. Dedan und Hespe gingen wie zuvor Arm in Arm. Der Gesang ertönte in Abständen immer wieder. Der Bach war wegen des Regens der vergangenen Tage stark angeschwollen und rauschte manchmal so laut, dass wir nicht einmal unsere eigenen Schritte hörten.
Doch dann wurde er breiter und ruhiger. Das dichte Unterholz endete und wir traten auf eine Lichtung.
Der Gesang war verstummt. Weder eine Straße noch ein Wirtshaus waren zu sehen, nicht einmal ein Feuer, nur eine große, vom Mond hell beschienene Lichtung. Der Bach verbreiterte sich zu einem glitzernden Teich. Und auf einem glatten Felsen am Ufer dieses Teichs saß jemand.
»Tehlu der Herr beschütze mich vor den Dämonen der Nacht«, murmelte Marten mit tonloser Stimme. Doch er klang eher ehrfürchtig als ängstlich. Und er wandte den Blick nicht ab.
»Das ist doch …«, ächzte Dedan. »Das ist …«
»Ich glaube nicht an Feen«, wollte ich sagen, aber aus meinem Mund kam nur ein undeutliches Flüstern.
Vor uns saß Felurian.
Kapitel 95
Die Jagd
Wie erstarrt standen wir da. Die kleinen Wellen des glitzernden Teichs warfen helle Reflexe auf die schöne Gestalt Felurians. Sie saß dort nackt im Mondschein und sie sang:
cae-lanion luhial
di mari felanua
kreata tu ciar
tu alaran di
dirella. amauen.
loesi an delian
tu nia vor ruhlan
Felurian thae.
Mit ihrer Stimme hatte es eine seltsame Bewandtnis. Sie war so sanft und leise, dass wir sie eigentlich gar nicht hätten hören können, erst recht nicht durch das Murmeln des Wassers und das Rauschen der Blätter. Trotzdem hörte ich sie. Ihre Worte klangen so deutlich und süß wie die steigenden und fallenden Töne einer fernen Flöte. Sie erinnerten mich an etwas, das ich nicht benennen konnte.
Dedan hatte damals in seiner Geschichte dieselbe Melodie gesungen. Abgesehen von Felurians Namen in der letzten Zeile verstand ich kein Wort. Trotzdem fühlte ich mich auf unerklärliche Weise wie magnetisch davon angezogen, als greife mir eine unsichtbare Hand in die Brust und ziehe mich an meinem Herzen auf die Lichtung hinaus.
Ich widersetzte mich. Ich wandte den Blick ab und stemmte mich mit der Hand gegen den Baum neben mir.
Hinter mir hörte ich Marten fortwährend »nein« murmeln, als wolle er sich etwas ausreden. »Nein, nein, nein. Nicht für alles Geld der Welt.«
Ich sah mich zu ihm um. Er starrte mit fiebrig glänzenden Augen auf die Lichtung, doch schien seine Angst größer zu sein als seine Erregung. Auf Tempis sonst so unbewegtem Gesicht zeigte sich Überraschung. Dedan stand wie erstarrt und mit angespannter Miene da, während Hespe zwischen ihm und der Lichtung hin und her sah.
Dann begann Felurian erneut zu singen. Ihr Gesang klang wie das Versprechen eines warmen Feuers in einer kalten Nacht, wie das Lächeln eines Mädchens. Ich musste an Losi vom Wirtshaus ZUM GÜLDENEN PENNY denken, an ihren wilden feuerroten Lockenschopf, an ihre schwellenden Brüste und daran, wie sie mir mit der Hand über das Haar gestrichen hatte.
Felurian sang und ich fühlte einen Sog, der stark war, doch nicht so stark, dass ich ihm nicht hätte widerstehen können. Ich blickte wieder auf die Lichtung hinaus. Felurians Haut schimmerte silbrigweiß durch die Nacht. Mit der Anmut einer Tänzerin beugte sie sich vor und tauchte eine Hand in das Wasser des Teichs.
Plötzlich erfüllte mich eine große Klarheit. Wovor hatte ich Angst? Vor einem Märchen? Hier ging es um Magie, um wirkliche Magie, ja mehr noch, um die Magie des Gesangs. Ich würde es mir nie verzeihen, wenn ich diese Gelegenheit nicht nutzte.
Ich wandte mich zu meinen Gefährten um. Marten zitterte sichtlich, Tempi wich langsam zurück, Dedan hatte die Hände an seiner Seite zu Fäusten geballt. Wollte ich mich wie sie von Furcht und Aberglauben beherrschen lassen? Nein, niemals. Ich gehörte dem Arkanum an, ich war ein Namenskundiger und ein Edema Ruh.
Wildes Lachen stieg in mir auf. »Wir sehen uns in drei Tagen im GÜLDENEN PENNY«, rief ich und betrat die Lichtung.
Ich spürte die Anziehungskraft Felurians jetzt noch stärker. Ihre Haut leuchtete im Mondlicht, ihr langes Haar hüllte sie wie ein Schatten ein.
»Verdammt«, hörte ich Dedan hinter mir sagen. »Wenn er geht, gehe ich auch …« Es folgte ein kurzes Handgemenge, das damit endete, dass etwas auf dem Boden aufschlug. Ich drehte mich um. Dedan lag mit dem Gesicht nach unten im niedrigen Gras. Hespe drückte ihm ein Knie ins Kreuz und hatte ihm einen Arm auf den Rücken gedreht. Dedan wehrte sich nur noch schwach, fluchte dafür aber umso lauter.
Tempi sah den beiden unbewegt zu, wie ein Schiedsrichter bei einem Ringkampf. Marten winkte mir wie von Sinnen. »Komm zurück, Junge!«, rief er aufgeregt. »Komm sofort zurück!«
Ich drehte mich wieder zum Teich um. Felurian hatte sich mir zugewandt. Trotz der Entfernung von etwa dreißig Metern sah ich den neugierigen Blick ihrer schwarzen Augen. Sie verzog die Lippen zu einem breiten, gefährlichen Lächeln, dann lachte sie in wildem Entzücken auf. Es war kein menschliches Lachen.
Flink wie ein Spatz und anmutig wie ein Reh flog sie über die Lichtung davon. Die Jagd begann. Trotz des schweren Reisesacks und des Schwerts an meiner Hüfte rannte ich so schnell, dass mein Mantel sich wie eine Fahne hinter mir blähte. Nie zuvor und auch nie danach bin ich so gerannt. Ein Kind rennt so, leichtfüßig und geschwind und ohne die geringste Angst zu fallen.
Felurian verschwindet vor mir in den Büschen. Ich erinnere mich vage an Bäume, den Geruch der Erde, das Grau der vom Mond beschienenen Felsen. Felurian lacht, weicht mir aus, tanzt, eilt voraus. Sie wartet, bis ich sie fast berühre, dann springt sie weg. Sie leuchtet im Mondlicht auf. Äste zerren an mir, Wasser spritzt mir ins Gesicht, warmer Wind weht mir entgegen …
Dann halte ich sie. Ihre Hände vergraben sich in meinen Haaren und ziehen mich näher. Ihr Mund kommt mir entgegen, ihre Zunge züngelt scheu, ihr Atem erfüllt meinen Mund, meinen Kopf. Ihre warmen Brustspitzen streifen meine Brust. Sie duftet nach Klee, nach Moschus, nach reifen zu Boden gefallenen Äpfeln …
Und dann gibt es kein Zögern mehr, keinen Zweifel. Ich weiß genau, was ich zu tun habe. Meine Hände streichen über ihren Nacken, ihr Gesicht, vergraben sich in ihren Haaren, gleiten an ihren glatten Schenkeln entlang, fassen sie fest an der Seite, umschließen ihre schmale Taille, heben sie hoch und legen sie hin …
Lustvoll windet sie sich unter mir und seufzt wohlig. Umschließt mich mit den Beinen, krümmt den Rücken, fasst mich mit warmen Händen an Schultern und Armen, packt mich am Kreuz …
Dann sitzt sie mit gegrätschten Beinen auf mir. Sie bewegt sich wild und ihre langen Haare gleiten über meine Haut. Sie wirft den Kopf in den Nacken, zittert am ganzen Leib und schreit etwas in einer Sprache, die ich nicht kenne. Ihre scharfen Nägel graben sich in die flachen Muskeln meiner Brust …
Und ich höre Musik: die wortlosen Schreie, mit denen sie sich hebt und senkt, ihre Seufzer, mein hämmerndes Herz. Ihre Bewegungen werden langsamer, und ich umklammere wie von Sinnen ihre Hüften. Unser Rhythmus ist wie ein stummes Lied, wie plötzlicher Donner, wie das unbewusst gehörte Rollen einer fernen Trommel …
Dann bleibt alles stehen. Mein Körper krümmt sich, ich bin gespannt wie eine Lautensaite. Zittere vor rasendem Sehnen. Ich bin zu straff gespannt und reiße …
Kapitel 96
Das Feuer selbst
Eine Erinnerung streifte die Ränder meines Bewusstseins und ich erwachte. Ich öffnete die Augen. Über mir streckten sich Bäume zum dämmrigen Himmel. Seidene Kissen umgaben mich und neben mir lag nackt und mit vom Schlaf gelösten Gliedern Felurian.
Sie sah so glatt und vollkommen aus wie eine Statue. Doch dann seufzte sie im Schlaf, und ich schalt mich für diesen Gedanken. Wusste ich doch, dass sie mitnichten aus kaltem Stein bestand, sondern warm und geschmeidig war und der glatteste Marmor im Vergleich zu ihr ein rauher Schleifstein.
Ich streckte die Hand aus, um sie zu berühren, und hielt inne. Ich wollte den vollkommenen Anblick nicht stören. Ein ferner Gedanke regte sich in mir, aber ich verscheuchte ihn wie eine lästige Fliege.
Felurians Lippen öffneten sich und sie seufzte. Es klang wie das leise Gurren einer Taube. Ich erinnerte mich an die Berührung dieser Lippen. Schon stieg die Sehnsucht wieder in mir auf, doch ich zwang mich, den Blick von dem weichen, wie ein Blütenblatt geformten Mund abzuwenden.
Felurians geschlossene Augenlider trugen wie die Flügel eines Schmetterlings ein Muster aus ineinander verschlungenem tiefen Rot und Schwarz, durchzogen von blassgoldenen Flechten, die mit der Farbe ihrer Haut verschmolzen. Wenn sie die Augen sanft im Schlaf bewegte, veränderte sich das Muster, als bewege der Schmetterling die Flügel. Schon dieser Anblick war wahrscheinlich den Preis wert, den die Männer dafür bezahlen mussten.
Ich verschlang Felurian mit den Augen. Alle Lieder und Geschichten, die ich je über sie gehört hatte, wurden ihr nicht annähernd gerecht. Sie war das, wovon Männer träumen. Unter all den Frauen an all den Orten, an denen ich gewesen war, hatte ich nur einmal eine Frau kennengelernt, die ihr gleich kam.
Wieder meldete sich in meinem Kopf ein Gedanke, aber eine Bewegung von Felurians geschlossenen Augen lenkte mich ab. Felurian schürzte die Lippen, als wollte sie mich noch im Schlaf küssen. Verärgert verscheuchte ich den störenden Gedanken erneut.
Dann würde ich eben verrückt werden oder sterben.
Aber dann drang der Gedanke doch in mein Bewusstsein, und ich spürte, wie sich mir alle Haare sträubten. Ich erlebte einen Moment der vollkommenen Klarheit, wie wenn man nach Luft schnappend aus dem Wasser auftaucht und einatmet. Schnell schloss ich die Augen, um mich in das Steinerne Herz zu versenken.
Doch vergebens. Zum ersten Mal in meinem Leben gelang es mir nicht auf Anhieb, diesen Zustand einer weltabgewandten Kälte herzustellen. Felurian lenkte mich trotz meiner geschlossenen Augen ab. Ihr süßer Atem, ihre weichen Brüste, die drängenden, halb verzweifelten Seufzer, die ihren hungrigen, blütenzarten Lippen entschlüpften …
Stein. Ich hielt die Augen geschlossen und hüllte mich in die Ruhe und Vernunft des Steinernen Herzens wie in einen Mantel. Erst dann wagte ich es, wieder an Felurian zu denken.
Was wusste ich? Ich rief mir die hundert Geschichten ins Gedächtnis, die ich über Felurian kannte. Was waren die ständig wiederkehrenden Themen? Felurian war schön. Sie verzauberte sterbliche Männer. Die Männer folgten ihr in das Reich der Fae und starben in ihren Armen.
Woran starben sie? Die Antwort war leicht zu erraten: an körperlicher Erschöpfung. Auch mir hatte die Begegnung alles abverlangt und schwächere Menschen mochten darunter mehr leiden als ich. Jetzt, da ich nicht mehr auf sie achtete, fühlte ich mich am ganzen Leib wie ein gründlich ausgewrungener Lumpen. Meine Schultern schmerzten, meine Knie brannten und mein Hals war vom rechten Ohr bis hinunter zur Brust wund von den süßen Bissen der Liebe.
Eine Hitzewallung erfasste mich und ich versenkte mich rasch tiefer in das Steinerne Herz, bis mein Puls sich wieder verlangsamte und ich den Gedanken an Felurian ein wenig zur Seite schieben konnte.
Ich kannte vier Geschichten, in denen Männer lebend von den Fae zurückgekehrt waren. Aber ihr Verstand war über ihren Erlebnissen zerbrochen wie eine Schale aus Ton. Was kennzeichnete ihren Wahnsinn? Zwanghaftes Verhalten, Entfremdung von der Wirklichkeit, die für sich schon zum Tod führen konnte, und Entkräftung durch äußerste Melancholie. Drei der Männer starben innerhalb einer Spanne, der vierte nach einem knappen halben Jahr.
Doch eines verstand ich nicht. Felurian war gewiss eine betörende Erscheinung. Eine geschickte Geliebte? Zweifellos auch das. Aber so geschickt, dass die Männer unweigerlich starben oder verrückt wurden? Nein, kaum vorstellbar.
Ich will den Eindruck meiner Erlebnisse keineswegs schmälern. Ich zweifle auch keinen Augenblick daran, dass sie in der Vergangenheit so manchen Mann all seiner Kraft und seines Verstandes beraubt hat. Doch hielt ich mich keineswegs für verrückt.
Einen kurzen Moment lang stellte ich mir vor, ich sei es doch und merke es nur nicht. Dann erwog ich die Möglichkeit, ich sei es schon immer gewesen. Letzteres kam mir wahrscheinlicher vor, doch dann schob ich beide Überlegungen zur Seite.
Mit geschlossenen Augen lag ich da, von einer mir bis dahin unbekannten wohligen Mattigkeit erfüllt. Ich schwelgte noch einen Moment lang darin, dann schlug ich die Augen auf, um Vorbereitungen für meine Flucht zu treffen.
Ich sah mich in der Laube, in der ich lag, um. An den Öffnungen hingen seidene Vorhänge, und um mich waren Kissen verstreut. All das war nur die Bühne für die in der Mitte liegende Felurian mit ihren runden Hüften und schlanken Beinen und der glatten Haut, unter der hin und wieder ein geschmeidiger Muskel spielte.
Felurian beobachtete mich.
Sie war schon schlafend schön, doch wach war sie es doppelt. Schlafend ähnelte sie dem Gemälde eines Feuers, wach war sie das Feuer selbst.
Ihr findet es vielleicht seltsam, wenn ich sage, dass ich in diesem Augenblick auf einmal Angst verspürte. Es mag sonderbar klingen, dass ich mich nur eine Armeslänge von der schönsten Frau der Welt entfernt plötzlich an meine Sterblichkeit erinnert fühlte.
Felurian lächelte wie ein in Samt gehüllter Dolch und räkelte sich wie eine Katze in der Sonne.
Ihr Körper schien wie geschaffen für solche Streckübungen. Ihr Rücken krümmte sich, ihr glatter Bauch straffte sich. Ihre vollen, runden Brüste hoben sich durch die Bewegung ihrer Arme, und ich fühlte mich auf einmal wie ein brünstiger Hirsch. Mein Körper reagierte auf Felurian, und mir war, als hämmere jemand mit einem glühenden Schürhaken auf den Panzer des Steinernen Herzens ein, mit dem ich mich gewappnet hatte. Für einen Moment bekam mein Panzer Risse, und unwillkürlich begann ich ein Lied auf Felurian zu dichten.
Ich hatte keine Kraft, diesen Impuls zu unterdrücken, so sehr war ich damit beschäftigt, mich in der Sicherheit des Steinernen Herzens zu verschanzen. Ich verdrängte also einfach den Anblick ihres Körpers und den geschwätzigen Teil meines Bewusstseins, der angefangen hatte, Reime zu schmieden.
Leicht fiel es mir nicht. Die Anstrengungen der Sympathie waren dagegen ein Kinderspiel. Hätte ich mich nicht an der Universität darin geübt, ich wäre daran zerbrochen und meiner Faszination hilflos erlegen.
Felurian entspannte die gestreckten Glieder langsam wieder und sah mich mit uralten Augen an. Augen, wie ich sie noch nie gesehen hatte, in einem höchst ungewöhnlichen Farbton …
Des Sommerabends Farbe, warm und weich.
… einem dämmrigen Blau, das den Betrachter unwillkürlich in seinen Bann schlug. Augen …
Darüber Lider, Schmetterlingen gleich.
… die keinerlei Weiß enthielten.
Und Abendrot auf ihren Lippen, tief und reich.
Ich verbannte mein dichtendes Ich entschlossen in den fernsten Winkel meines Bewusstseins und umgab es mit Mauern, hinter denen es unbeachtet vor sich hin singen mochte.
Felurian neigte den Kopf zur Seite. Ihre Augen blickten mich so aufmerksam und ausdruckslos an wie die eines Vogels. »warum bist du so still, mein flammender liebhaber? habe ich dich gelöscht?«
Ihre Stimme klang merkwürdig. Sie hatte keinerlei Ecken und Kanten, sondern war glatt wie makellos poliertes Glas. Trotzdem jagte sie mir einen Schauer über den Rücken wie einer Katze, der man bis zum Schwanz über den Rücken streicht.
Ich zog mich noch tiefer in das Steinerne Herz zurück und spürte es kalt und beruhigend um mich. Doch während ich mich noch mit aller Kraft darin verschanzte, meldete sich das wie im Fieberwahn dichtende Stimmchen zu Wort: »Ganz und gar nicht. Obwohl ich meine Glut in dir gelöscht habe, brenne ich. Jede deiner Bewegungen ist für mich Musik. Ist wie ein Funke, ist wie ein Atemhauch, der ein Feuer in mir entfacht, das um sich greift und deinen Namen brüllt.«
Felurian sah mich beglückt an. »ein dichter! ich hätte es an der art deiner bewegungen erkennen müssen.«
Wieder überraschte mich der sanfte Klang ihrer Stimme. Nicht dass sie auf billige, affektierte Art gehaucht oder sonst irgendwie lasziv getan hätte. Doch sobald sie sprach, meinte ich zu spüren, wie ihr Atem aus ihrer Brust gedrückt an ihrer lieblichen Kehle vorbeistrich und von Lippen, Zähnen und Zunge sorgsam geformt wurde.
Sie kam auf Händen und Knien durch die Kissen näher. »du siehst so feurig und schön aus wie ein dichter.« Ihre Stimme war nicht lauter als das Geräusch des Atems. Sie nahm mein Gesicht in ihre Hände. »dichter sind sanftmütige menschen und sagen schöne dinge.«
Ich kannte nur einen Menschen, dessen Stimme der ihren ähnelte: Elodin. Seine Stimme erfüllte zuweilen den Raum, als sei die ganze Welt lauschend um ihn versammelt.
Felurians Stimme klang nicht voll, sie war auf der Lichtung kaum zu vernehmen. Sie erinnerte an die Stille vor einem sommerlichen Gewitter und war so weich wie eine über die Haut streifende Feder. Mein Herz tat einen Sprung, wenn ich sie hörte.
Deshalb ärgerte oder kränkte es mich auch nicht, dass sie mich einen Dichter nannte. Aus ihrem Mund klang es wie das höchste Lob, das je ein Mann erhalten hat. Von solcher Macht war ihre Stimme.
Felurian strich mit den Fingerspitzen über meine Lippen. »dichter küssen am besten. dein kuss ist wie die flamme einer kerze.« Sie führte die Hand an ihre eigenen Lippen zurück, und ihre Augen glänzten in seliger Erinnerung.
Zärtlich ergriff ich ihre Hand und drückte sie. Ich war immer stolz auf meine schlanken Finger gewesen, doch neben den ihren wirkten sie plump und dick. Beim Sprechen atmete ich in ihre Handfläche. »Deine Küsse wärmen meine Lippen wie das Licht der Sonne.«
Sie senkte den Blick unter den Schmetterlingslidern. Sofort ließ mein besinnungsloses Sehnen nach, und ich konnte wieder klar denken. Hier war Zauberei im Spiel, allerdings einer ganz anderen Art, als ich sie kannte. Mit Sympathie oder Sygaldrie hatte das nichts zu tun. Felurian machte die Männer verrückt vor Verlangen, so wie ich Körperwärme abstrahlte. Es geschah auf eine ganz natürliche Art, die sie allerdings steuern konnte.
Sie ließ den Blick über meine unordentlich am Rand der Lichtung verstreuten Kleider wandern, die neben den Seidenstoffen und zarten Farben seltsam fehl am Platz wirkten. An meinem Lautenkasten blieb ihr Blick hängen, und sie erstarrte.
»ist meine flamme denn ein dichter der musik? singt er?« Ihre Stimme bebte und ich spürte, wie sich ihr Körper anspannte, während sie auf meine Antwort wartete. Sie sah mich an und ich lächelte.
Übermütig sprang sie auf und kehrte mit dem Kasten zurück wie ein Kind mit einem neuen Spielzeug. Als ich ihn nahm, wurden Felurians Augen groß und … feucht?
Ich erwiderte ihren Blick, und in blitzartigem Erkennen stand ihr Leben vor mir. Tausend Jahre alt war sie und immer wieder einsam. Wenn sie einen Gefährten wollte, musste sie ihn anlocken und verführen. Doch wozu? Um einen Abend, eine Stunde lang Gesellschaft zu haben? Wie lange hielten die Männer im Durchschnitt aus, bevor ihr Wille brach und sie zu schwanzwedelnden Hunden wurden? Lange jedenfalls nicht.
Und wen konnte sie im Wald kennenlernen? Bauern und Jäger? Welche Unterhaltung konnten solche Menschen ihr bieten, sklavisch an ihre Leidenschaft gefesselt? Einen Augenblick lang verspürte ich Mitleid. Ich weiß, was Einsamkeit ist.
Ich nahm die Laute aus dem Kasten und stimmte sie. Dann schlug ich versuchsweise einen Akkord an und stimmte nach. Was sollte ich für die schönste Frau der Welt spielen?
Im Grund fiel mir die Entscheidung nicht schwer. Von meinem Vater hatte ich gelernt, mein Publikum einzuschätzen. Ich stimmte also das Lied von den Schwestern Flin an. Wahrscheinlich kennt ihr es nicht. Es ist ein lebhaftes, fröhliches Lied über zwei Schwestern, die sich über den Preis der Butter streiten und dabei allerlei Klatsch austauschen.
Die meisten Menschen hören am liebsten Lieder über legendäre Liebende oder Abenteurer. Aber was spielt man für eine Frau, die selbst eine Legende ist? Über die seit undenklichen Zeiten Liebeslieder geschrieben werden? Ein Lied, das von ganz gewöhnlichen Menschen handelt. Jedenfalls hoffte ich es.
Als ich geendet hatte, klatschte Felurian begeistert. »mehr bitte, ja?« Sie lächelte hoffnungsvoll, legte bittend den Kopf schräg und sah mich mit großen Augen voller eifriger Bewunderung an.
Ich spielte Larm und der Bierhumpen und Die Töchter des Hufschmieds. Anschließend spielte ich ein albernes kleines Lied über einen Priester, der einer Kuh hinterher jagt. Ich hatte es mit zehn Jahren geschrieben und ihm nicht einmal einen Titel gegeben.
Felurian lachte und klatschte. Dann wieder schlug sie erschrocken die Hand vor den Mund oder hielt sich verlegen die Augen zu. Je länger ich spielte, desto mehr erinnerte sie mich an eine junge Frau vom Land, die zum ersten Mal einen Jahrmarkt besucht und auf deren Gesicht sich reinste Freude, unschuldiges Entzücken und Staunen über das Gesehene malen.
Wie schön sie dabei aussah. Ich konzentrierte mich auf meine Finger, um mich abzulenken.
Jedes Lied belohnte sie mit einem Kuss, nach dem es mir schwer fiel zu entscheiden, was ich als Nächstes spielen sollte. Nicht dass mich das weiter gestört hätte. Mir wurde schnell klar, dass mir Küsse noch lieber waren als Geld.
Ich spielte Tinker Tanner für sie, und ich sage euch eins: Ich werde das Bild Felurians und die leise, flötengleiche Stimme, mit der sie den Refrain meines liebsten Trinklieds mitsang, nie vergessen. Bis an das Ende meiner Tage nicht.
Beim Spielen spürte ich, wie der Zauber, in dem sie mich gefangen hielt, langsam verging. Ich bekam wieder Raum zum Atmen. Meine Anspannung ließ nach, und ich wagte mich ein wenig aus meinem Panzer des Steinernen Herzens hervor. Ein Zustand der leidenschaftslosen Ruhe kann sehr nützlich sein, ist aber bei einem mitreißenden Vortrag eher hinderlich.
Ich spielte stundenlang, und danach war ich wieder ich selber. Anders ausgedrückt, ich konnte Felurian ansehen, wie man eben die schönste Frau der Welt ansieht.
Ich erinnere mich noch genau, wie sie nackt zwischen den Kissen saß und in der Luft zwischen uns nachtblaue Schmetterlinge tanzten. Natürlich erregte mich der Anblick, wie hätte es anders sein können, aber mein Verstand gehörte Gott sei Dank wieder mir.
Als ich die Laute in den Kasten zurücklegte, murmelte Felurian enttäuscht etwas. »bist du müde?«, fragte sie mit einem feinen Lächeln. »wenn ich das gewusst hätte, süßer sänger, hätte ich dich mehr geschont.«
Ich lächelte entschuldigend, so gut ich konnte. »Tut mir leid, aber es scheint schon spät zu sein.« Am Himmel war noch dasselbe purpurne Dämmerlicht zu sehen wie beim Aufwachen. Trotzdem fuhr ich fort: »Ich muss aufbrechen, wenn ich die anderen …«
Ich verstummte wie betäubt, als hätte mir jemand einen Schlag auf den Hinterkopf versetzt. Zugleich verspürte ich ein heftiges, unersättliches Begehren. Ich wollte Felurian besitzen, ihren Körper an mich pressen, die wilde Süße ihres Mundes schmecken.
Nur meine Ausbildung als Arkanist rettete mich vor vollkommener Besinnungslosigkeit. Mühsam klammerte ich mich an einen letzten Rest eigener Identität.
Felurian saß mir mit gekreuzten Beinen gegenüber. Auf ihrem Gesicht lag ein schrecklicher Zorn, und ihre Augen blickten so kalt und hart wie ferne Sterne. Ganz langsam strich sie sich einen flügelschlagenden Schmetterling von der Schulter. In dieser einfachen Handbewegung lag eine solche Wut, dass sich mir der Magen zusammenzog.
Eines begriff ich nun: Niemand verließ Felurian, niemand. Sie fesselte die Männer an sich, bis sie unter der Anstrengung der Liebe zu ihr körperlich und geistig zerbrachen. Sie ließ die Männer erst gehen, wenn sie ihrer müde war, und wenn sie sie dann wegschickte, trieb die Trennung die Männer in den Wahnsinn.
Ich war machtlos. Ich war nur Felurians Spielzeug – das liebste, weil neueste. Es mochte eine Weile dauern, bis sie meiner überdrüssig wurde, aber die Zeit würde kommen. Und wenn sie mich dann entließ, würde ich vor lauter Sehnsucht nach ihr den Verstand verlieren.
Kapitel 97
Blut und bittere Reue
Ich saß zwischen seidenen Kissen und war drauf und dran, die Selbstkontrolle zu verlieren. Kalter Schweiß brach mir aus, und ich presste die Lippen zusammen. Zorn regte sich in mir. Mein Verstand war im Lauf meines bisherigen Lebens das Einzige gewesen, auf das ich mich immer hatte verlassen können, das Einzige, über das ich uneingeschränkt verfügt hatte.
Ich spürte, wie meine Gefasstheit ins Wanken geriet und an ihre Stelle eine animalische Lust trat, die jeden anderen Gedanken verdrängte.
Zwar wehrte sich der Teil von mir, der noch Kvothe war, verzweifelt dagegen, doch mein Körper reagierte unwillkürlich auf Felurians Gegenwart. Getrieben von einer schrecklichen Faszination sah ich mich durch die Kissen zu ihr kriechen. Mein Arm schlang sich um ihre schlanke Taille, und ich beugte mich gierig über sie, um sie zu küssen.
Entsetzt heulte ich innerlich auf. Man hat mich geschlagen und ausgepeitscht, mit Messern angegriffen und dem Hunger preisgegeben. Aber mein Verstand gehört mir, egal was mit meinem Körper oder darum herum passiert. Ich warf mich gegen die Stäbe eines unsichtbaren Käfigs aus Mondlicht und Verlangen.
Und irgendwie gelang es mir, mich zurückzuhalten. Mein Atem stürzte aus meinem Mund, als wollte er in Panik daraus entfliehen.
Felurian sank auf die Kissen zurück und hob das Gesicht zu mir. Ihre blassen Lippen waren vollkommen, die von Lidern verschatteten Augen hungrig.
Ich zwang mich, den Blick von ihrem Gesicht abzuwenden, doch wohin hätte ich blicken sollen? An Felurians glattem, zartem Hals zitterte ihr erregter Puls. Ihre eine Brust stand mir rund und voll entgegen, die andere fiel der Neigung ihres Körpers folgend ein wenig zur Seite. Beide Brüste hoben und senkten sich im Rhythmus ihres Atems und zeichneten im Kerzenschein sanft bewegte Schatten auf ihre Haut. Hinter dem hellen Rosa ihrer Lippen sah ich ihre makellos weißen Zähne …
Ich schloss die Augen, aber das machte alles nur noch schlimmer. Die Hitze ihres Körpers schlug mir entgegen wie die Glut eines Feuers. Ich spürte die Haut ihrer Hüften weich an meiner Hand. Felurian bewegte sich unter mir, und ihre Brust streifte ganz leicht die meine. Ich spürte ihren Atem an meinem Hals, erschauerte und begann zu schwitzen.
Ich öffnete die Augen wieder. Felurian starrte mich an. Ihre Miene war unschuldig, fast gekränkt, als könne sie nicht verstehen, warum ich sie zurückwies. Ich versuchte den Zorn anzufachen, der sich in mir regte. Niemand durfte mir so mitspielen, niemand. Mühsam beherrschte ich mich. Felurian runzelte leicht die Stirn, als sei sie verärgert oder wütend oder als müsse sie sich konzentrieren.
Sie hob die Hand und berührte mein Gesicht, den Blick unverwandt auf mich gerichtet, als versuche sie etwas zu lesen, das tief in mir geschrieben stand. Ich wollte vor ihrer Berührung zurückweichen, allein ich zitterte am ganzen Körper. Schweißtropfen fielen von meiner Haut auf die seidenen Kissen und auf ihren flachen Bauch unter mir.
Zärtlich berührte Felurian meine Wange, zärtlich beugte ich mich zum Kuss hinunter. Da zerbrach etwas in mir.
Die letzten vier Jahre meines Lebens waren auf einmal verschwunden, und ich befand mich wieder auf den Straßen von Tarbean. Drei Jungen mit fettigen Haaren und gemeinen Augen, die alle größer waren als ich, hatten mich aus dem Versteck gezerrt, in dem ich geschlafen hatte. Zwei hatten mich an den Armen gepackt und drückten mich auf den Boden. Ich lag in einer eiskalten Pfütze. Es war früher Morgen und die Sterne waren verschwunden.
Der eine Junge hielt mir den Mund zu, aber das war nicht nötig. Ich lebte bereits seit einigen Monaten in der Stadt und hätte sowieso nicht um Hilfe gerufen. Im besten Fall wäre niemand gekommen. Im schlimmsten Fall wäre jemand gekommen, und ich hätte einen Gegner mehr gehabt.
Zwei hielten mich also fest, und der dritte schnitt mir die Kleider vom Leib. Dabei schnitt er auch mich. Sie sagten, was sie mit mir anstellen wollten. Ich spürte ihren Atem schrecklich warm an meinem Gesicht. Sie lachten.
Doch wie ich hilflos und halb nackt am Boden lag, überkam mich plötzlich besinnungsloser Zorn. Ich biss zwei Finger von der Hand ab, die mir den Mund zuhielt. Der Junge fuhr mit einem Aufschrei hoch. Dann versuchte ich den Jungen abzuwerfen, der noch auf mir saß. Ich hörte, wie mein Arm brach, und sein Griff sich lockerte, und ich begann zu brüllen.
Ich warf ihn ab und stand brüllend auf. Die Kleider hingen mir in Fetzen vom Leib. Ich schlug den Jungen nieder, bekam einen losen Pflasterstein zu fassen und brach ihm damit das Bein. Ich höre das Geräusch heute noch. Wie besessen schlug ich auf ihn ein, bis ich ihm auch die Arme gebrochen hatte, und dann zerschmetterte ich ihm den Schädel.
Als ich aufblickte, sah ich, dass der Junge, der mich geschnitten hatte, verschwunden war. Der dritte hockte an einer Mauer, drückte seine blutende Hand an die Brust und stierte mich mit aufgerissenen Augen an. Ich hörte Schritte näherkommen, ließ den Stein fallen und rannte weg.
Jetzt, Jahre später, verwandelte ich mich plötzlich wieder in diese Bestie. Ich warf den Kopf in den Nacken und fletschte innerlich die Zähne. Ich spürte etwas tief in mir und griff danach.
Eine gespannte Ruhe ähnlich der Ruhe vor einem Gewitter erfüllte mich, und die Luft um mich gefror.
Mir war kalt. Wie unbeteiligt sammelte ich, was ich über mich wusste, und fügte es zusammen. Ich war der fahrende Schauspieler Kvothe, ein gebürtiger Edema Ruh, der Student Kvothe, Re’lar unter Elodin, und der Musiker Kvothe. Ich war Kvothe.
Ich stand auf und blickte auf Felurian hinab.
Mir war, als sei ich zum ersten Mal in meinem Leben ganz wach. Alles erschien mir so deutlich und scharf umrissen, als sähe ich es mit neuen Augen. Oder als sähe ich es statt mit den Augen direkt mit dem Bewusstsein.
Der schlummernde Geist schläft nicht mehr, dachte ich und lächelte.
Ich sah Felurian an, und sie lag auf einmal vor mir wie ein aufgeschlagenes Buch. Sie gehörte zu den Fae. Richtig und Falsch kümmerten sie nicht, sie war wie ein Kind, völlig von ihren Wünschen bestimmt. Ein Kind denkt nicht an die Folgen, genauso wenig wie ein Gewitter es tut. Felurian ähnelte sowohl dem Kind wie dem Gewitter und war doch ganz verschieden. Sie war alt, unschuldig, mächtig und stolz.
Sah Elodin die Welt auf diese Art? War dies die Magie, von der er sprach? Die Magie Taborlins des Großen, die nicht aus irgendwelchen geheimen Tricks bestand und die immer da war, die ich aber bisher nicht gesehen hatte?
Es war schön.
Ich begegnete Felurians Blick, und die ganze Welt schien auf einmal stillzustehen. Mir war, als wäre ich unter Wasser gestoßen worden und als sei alle Luft aus meinem Körper gewichen. Für die Dauer einer Sekunde war ich wie betäubt, wie vom Blitz getroffen.
Doch der Moment verging, und die Welt bewegte sich wieder. Als ich jetzt in Felurians dämmrig blaue Augen blickte, sah ich bis auf ihren tiefsten Grund. Ihre Augen waren wie vier Zeilen aus Musik, die ich deutlich vor mir sah. Unvermutet erfüllte mich ihre Musik. Ich holte Luft und sang vier Töne.
Felurian setzte sich auf. Sie führte die Hand an den Augen vorbei und sprach ein Wort, das so scharf war wie eine Glasscherbe. Ich spürte Schmerzen im Kopf wie von einem Donnerschlag. An den Rändern meines Blickfelds flackerte Dunkel. Ich schmeckte Blut und bittere Reue.
Dann sah ich wieder klar und fing mich, bevor ich stürzte.
Felurian runzelte die Stirn, straffte sich und stand auf. Mit angespannter Miene ging sie einen Schritt.
Stehend war sie weder besonders groß noch furchterregend. Sie reichte mir mit dem Kopf kaum bis ans Kinn. Ihre Haare hingen wie ein schwarzer Schatten kerzengerade bis zu ihren runden Hüften hinab. Sie war schlank, hell und vollkommen. Nie habe ich ein so anmutiges Gesicht gesehen, nie einen Mund, der so sehr zum Küssen geschaffen war. Sie runzelte nicht länger die Stirn und lächelte auch nicht. Ihre weichen Lippen waren leicht geöffnet.
Sie machte wieder einen Schritt. Die einfachste Bewegung ihres Beins glich einem Tanz, der ruhige Schwung ihrer Hüften war hinreißend wie der Anblick eines Feuers. Die Wölbung ihres nackten Fußes war erregender als alles, was ich in meinem jungen Leben bis dahin gesehen hatte.
Noch einen Schritt. Sie lächelte wild und wonnevoll und war schön wie der Mond. Ihre Macht hüllte sie ein gleich einem Mantel, der die Luft aufrührte und sich hinter ihr ausbreitete wie ein gewaltiges, unsichtbares Flügelpaar.
Sie stand so dicht vor mir, dass ich sie berühren konnte, und ich spürte das Vibrieren ihrer Macht in der Luft. Verlangen stieg um mich auf wie die See im Sturm. Felurian hob eine Hand und berührte meine Brust. Ich erschauerte.
Sie erwiderte meinen Blick, und im dämmrigen Violett ihrer Augen sah ich wieder die vier Notenzeilen.
Ich sang sie. Sie brachen aus mir heraus wie Vögel, die ins Freie fliehen.
Plötzlich konnte ich wieder klar denken. Ich atmete tief ein und hielt Felurians Blick fest. Wieder sang ich, diesmal voller Zorn. Ich schrie die Töne förmlich. Sie klangen so hart und scharf wie Eisen, und ich spürte, wie Felurians Macht unter ihrem Klang erzitterte und schließlich zerbrach. Zurück blieb eine nur von Schmerz und Unbehagen erfüllte Leere.
Felurian schrie erschrocken auf und setzte sich so abrupt hin, dass sie fast zu stürzen schien. Sie zog die Knie an die Brust und sah mit großen, ängstlichen Augen zu mir auf.
Ich blickte mich um und sah den Wind. Nicht wie man etwa Rauch oder Nebel sieht, nein, ich sah den unaufhörlich sich wandelnden Wind selbst. Er war mir vertraut wie das Gesicht eines vergessenen Freundes. Ich lachte und breitete die Arme aus, voller Staunen über seine sich verändernde Gestalt.
Ich legte die hohlen Hände aneinander, atmete einen Seufzer hinein und sprach einen Namen. Dann zog ich meinen Atem spinnwebfein auseinander. Er blähte sich auf, hüllte Felurian ein und züngelte in einer silbernen Flamme auf, die Felurian fest in seinem sich wandelnden Namen einsperrte.
Ich hielt sie über dem Boden. Sie betrachtete mich mit ängstlicher und ungläubiger Miene, und ihr schwarzes Haar tanzte wie eine zweite Flamme innerhalb der ersten.
Da wusste ich, dass ich sie töten konnte. Es wäre so einfach gewesen wie ein Blatt Papier in den Wind zu werfen. Doch der bloße Gedanke verursachte mir Übelkeit. Es wäre gewesen, als hätte ich einem Schmetterling die Flügel ausgerissen. Ich hätte etwas Fremdartiges und zugleich Wunderbares zerstört. Ohne Felurian wäre die Welt ärmer gewesen, hätte sie mir weniger gefallen. Als hätte ich Illiens Laute zerstört, als hätte ich nicht nur ein Leben beendet, sondern eine ganze Bibliothek niedergebrannt.
Andererseits standen meine Sicherheit und mein Verstand auf dem Spiel. Ich glaubte, dass die Welt mit Kvothe auch interessanter war.
Doch ich konnte Felurian nicht töten. Nicht so. Nicht indem ich meine neu gefundene Zauberkraft einsetzte wie ein Seziermesser.
Ich sprach wieder, und der Wind drückte Felurian auf die Kissen nieder. Ich machte eine Bewegung, als zerreiße ich etwas, und die silberne Flamme, die mein Atem gewesen war, wurde zu drei Tönen einer Melodie und verklang unter den Bäumen.
Ich setzte mich, Felurian lehnte sich zurück, und wir blickten einander lange an. Die Angst in ihren Augen wurde zu Vorsicht und zuletzt Neugier. Ich sah mich im Spiegel ihrer Augen nackt zwischen den Kissen sitzen. Meine Macht leuchtete wie ein weißer Stern auf meiner Stirn.
Dann spürte ich, wie etwas verging, wie Vergessen einsetzte. Der Name des Windes erfüllte nicht länger meinen Mund, und als ich mich umblickte, sah ich nur Leere. Ich versuchte äußerlich ruhig zu bleiben, aber mir war zumute wie einer Laute, deren Saiten durchtrennt wurden. In mir krampfte sich alles zusammen angesichts eines Verlusts, wie ich ihn seit dem Tod meiner Eltern nicht mehr empfunden hatte.
Die Luft um Felurian begann zu schimmern, als ein kleiner Rest ihrer Macht zurückkehrte. Ich achtete nicht darauf und versuchte