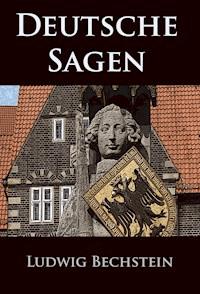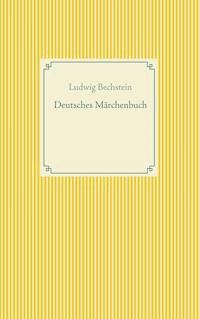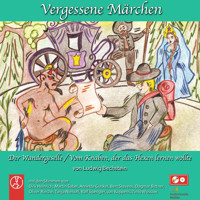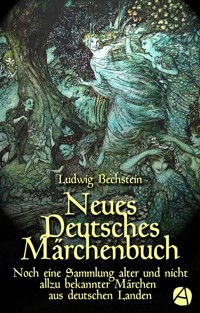Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Heute Abend findet der Abendzirkel statt. Es ist eine Zeremonie, bei der sich alte und neue angesehene Leute begrüßen. An der Zeremonie nehmen viele Menschen teil, darunter Chemiker, Ärzte, Chirurgen, Bedienstete und junge Studenten. Die Leute reden und trinken. Plötzlich kommen der Professor und Frau Schlözer ins Gespräch. Sie interessiert sich dafür, wie man mit Kunst echtes Gold machen kann. Der wunderliche Professor bleibt im weiblichen Kreis, wodurch es zu diversen interessanten Gesprächen kommt.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 236
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ludwig Bechstein
Die Geheimnisse eines Wundermannes - Dritter Teil
Saga
Die Geheimnisse eines Wundermannes - Dritter Teil
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1856, 2021 SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788726997200
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
Dieses Werk ist als historisches Dokument neu veröffentlicht worden. Die Sprache des Werkes entspricht der Zeit seiner Entstehung.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - ein Teil von Egmont, www.egmont.com
1. Die Sibylle unter der Asseburg.
Der Professor hatte lange, nachdem sein Pathe Gottfried ihn verlassen, im stillen Sinnen und im schmerzlichen Nachdenken auf seinem Zimmer verweilt. Mächtig stürmten Erinnerungen auf ihn ein, und an ihnen zählte er die Reihen seiner Jahre. Er war jetzt fünfundsechzig Jahre alt, Jahre, deren Zahl von vielen Lebenden nicht erreicht werden, und neben das, was er erstrebt und glänzend erreicht hatte, weil er es mit eiserner Beharrlichkeit und Willenskraft gewollt – traten zertrümmerte Hoffnungen und trotz allen Strebens unerreichte, verfehlte Wünsche. Und wer, der, selbst im Glück, zu solchen Jahren gelangte, wird nicht die gleiche schmerzliche Erfahrung dennoch auch machen? Der Mensch kann nicht alles, was er will, durchführen, auch wenn er will was er kann, das heißt, wenn er nur das will wozu seine Kräfte ausreichen, denn die Ungunst der Menschen, der Zeiten und des Schicksals können ihm die Erreichung jener Ziele unmöglich machen, an die er mit berechtigtem Vertrauen seine Kräfte setzte. So vollendet ein befähigter Meister eine Arbeit, von der er sich reichen Lohn seiner Mühen und seines Fleißes verspricht, er vollendet sie tadellos, zum Beispiel der Maler ein Gemälde, der Plastiker ein Bildwerk, der Autor ein Buch – aber die Zeiten sind ungünstig, oder das Urtheil fällt scheelblickend und neidisch aus, das Kunstwerk ist da, aber der Zweck, um dessentwillen der Künstler die Arbeit unternahm, wird nicht, oder doch zu ganz anderer Zeit erreicht, als da, wo der Vortheil in die Augen springend gewesen wäre, und die alte Klage: Oleum et operam perdidi , findet ihr trauriges Echo.
Da weilte er nun, der reiche arme Mann, im Schooße der Schätze, im Glanze erstrebten Ruhmes, in voller Anerkennung seiner Verdienste; beneidet um die Gaben des Glückes, um die Wohnung selbst, um die Sammlungen, um die Geheimnisse, um Talente und Wissenschaften – da weilte er, bei alle dem einsam, und drückte kein Kind ans Herz, und fand für sich – er, der so vieler Sprachen kundig war, das eine Wort nicht, das sein Herz erfreut hätte, das eine werthe Wort, ohne das der Christenglaube selbst Gott nicht denken kann, das Wort fand er nicht, daß sein Herz es liebend ausspreche, wenn er es auch für den Mund, für die Gedanken fand – das einzige kleine Wort Sohn – es mangelte ihm, dem reichen armen Manne.
Es wühlte den Professor zerfleischend in der Seele, wie das Messer des Anatomen in einem Leichnam, daß er gegen sich selbst in dieser trüben Stunde bekennen mußte, so oft eine Unwahrheit behauptet zu haben.
»Der Mensch kann alles was er will! Eine Lüge ist's! Eine jämmerliche Lüge, und ein Verrückter war der, der diesen Gemeinplatz zuerst aufstellte. Warum kann ich denn nicht, was ich so gern wollte, auftreten und der Welt offen und frei einen Sohn zeigen? Warum kann ich nicht, was ich so gern wollte, einen Sohn mit der Fülle aller väterlichen Liebe umarmen und beglücken? Kann ich, was ich gern thäte, und doch nicht vermag, die Macht der Verhältnisse brechen? Kann ich mit Fingern auf mich deuten lassen? Kann ich von der Phiole meines so lange Jahre tief verschleierten und tief vergrabenen Geheimnisses das hermetische Siegel lösen? Kann ich, auch wenn ich wollte, zerbrechen und zerschlagen, was ich mühsam bildete? Nein, ich kann es nicht, ich vermag es nicht – es ist mir, dem so vieles zu vollbringen und zu erstreben gelang, dieß eine versagt, und nur darum versagt, weil ich früher zu schwach und verzagt und kleinmüthig war, dem Gespötte der Welt zu trotzen. Nun rächt sich die Unnatur, nun rächt sich der Kaltsinn, nun liegt der Acker meiner Hoffnungen brach, und spräche ich nun das Wort, so würde es zuletzt nicht einmal verstanden, nicht mit der Liebe aufgenommen, nicht mit dem Entzücken, das mein Herz verlangt. Schwer rächt sich die wissentliche Täuschung, die jahrelange Verläugnung eines Kindes, das hingegeben wird an fremde Miethlinge, in dessen Innerem die Stimme der Natur zum verstummen gezwungen wird, und niemals sprechen lernt. Wollt ihr ihm dann für diese Stimme erst im reifen Alter die Zunge lösen – dann ist's zu spät. – Sprachen lernen sich schwer im Alter – die Liebe, die Anhänglichkeit, der Kindessinn, die sind dahin, sind tod – und nur die Verwunderung, die Ueberraschung, das Erstaunen würde mir aus einem Antlitz entgegenblicken, dessen Träger ich sagen würde: Komm an mein Herz, Du bist mein Sohn! – und das mich fragen würde: Ist denn das auch in der That so, mein alter Herr?« –
Es war tiefe Dämmerung geworden um den von schmerzlichen Gedanken gequälten alten Mann, und es blieb still in seinem Zimmer – und es wurde später und später, und der Mond ging auf – und es hatte schon neun Uhr geschlagen. Draußen lag die klare Herbstnacht, innen leuchtete nur der Krystall mit dem räthselhaften Phosphorglanze, und streute grünlichen Schimmer auf Bücher und Geräthe.
Da gab eine Saite der alten italienischen Laute, die an der Wand hing, einen leisen Ton an, wie bisweilen zu geschehen pflegt bei solchen ruhig hängenden Instrumenten, ohne daß man weiß, hat eine Wirbel sich verzogen, hat ein Insekt die Saite mit bebenden Flügel berührt, oder übt Veränderung der Lustbeschaffenheit diese eigenthümliche Wirkung?
Der Professor fuhr empor und lauschte nach der Laute hin. Und horch – noch einmal derselbe Ton. –
Ein Schauer durchzitterte den alten Mann.
Und noch einmal das leise, feine Tönebeben in der lautlosen Stille des dämmerhellen Zimmers. »Du zeigst mir eine feierliche Stunde an, Regina!« flüsterte unhörbar der Professor.
Und kaum hatte der einsame Mann dieß gesprochen, so begann an ihrer Stelle zwischen dem Hause und dem Garten hängend, die Aeolsharfe im Abendlufthauche ihr tiefes summen und dieß summen erhob sich zu melodischer Fülle heller und reiner Töne, die zu Accorden verklangen, welche aus den Strahlen des Mondes die Skala auf und nieder zu schweben schienen.
»Ha Regina! Deine Stimme! Deine Engelnähe! Du mein Genius umwehst mich mit Deinen Geisterfittichen! Du bist bei mir, ich bin bei Dir! Sol und Luna reichen sich die reinen Hände, neigen gegen einander die keuschen Lilien, und über ihnen schwebt weihend der Geist in Taubengestalt, aber auf Adlerflügeln! –«
»Sol und Luna steigen in das Flammenbad der Liebe, und aus den Lilien werden Lotoskelche des Vergessens, des süßen Vergessens, die sie mit den Händen erfassen.«
»In purpurnen Fluthen schwimmend einen sich Sol und Luna, König und Königin im glühenden umfangen, sie sterben seligen Tod.«
»Die irdischen Elemente scheiden sich von einander, Himmelsthau sinkt in Feuertropfen nieder, und läutert das vergängliche und irdische zum überirdischen und unvergänglichen.«
»Und die Königin Luna gebiert den Sohn, den göttlichen Hermes.«
»Aber der Königin Luna Leben sinkt in Todesnacht, und der Sohn schwingt sich eilend empor zum glühenden Aether. Er geht zum flammenden Sol zurück, zum lebenden, Leben spendenden Vater, und raubt ihm das rothe Feuer, ein kühner Prometheus – und trägt es nieder, und giebt es den Menschen zum Eigenthume.« –
In dieser adeptischen Bildersprache, die nur wenigen oder niemand würde verständlich geworden sein, wäre sie auch zu Menschenohren gedrungen, hüllte der Professor seine Erinnerungen ein, erging er sich in dem Hesperidengarten seiner Jugendträume und einstiger schönerer Zeiten.
________________________________________
Als Leonhard in das dunkle unterirdische Gewölbe der Asseburg eingetreten war, verlöschte plötzlich des Führers Leuchte, und er fand sich in nachtschwarzer Finsterniß allein – doch nur einen Augenblick. Er fühlte neben sich ein wehen, vernahm ein leises athmen, eine weiche warme Hand faßte seine Rechte, ein füllereicher Arm schlang sich kräftig um seinen Leib, und so fühlte er sich vorwärts geführt durch das nächtige Dunkel, eine weite Strecke, mindestens dünkte sie ihm weit, und er faßte Muth, das Abenteuer ganz zu bestehen.
Nach einer Weile wurde es mählich heller um Leonhard, ohne daß er ein Licht gewahrte. Ein bleicher Schein umfloß ihn, er fand sich in einer Grotte, welche fast rund war, und von deren Kuppel die Helle ausströmte, wie Ampellicht durch Milchglas. Es standen Sessel an den Wänden von uralter Form, welche mit Teppichen bedeckt waren, sonst mangelte jedes Geräth, durch das etwa die Absicht, phantastische Eindrücke hervorzurufen oder überwältigend auf die Sinne einzuwirken, hätte hervorleuchten können.
Auf einem dieser Sessel saß jene alte Frau, welche Leonhard hieher beschieden hatte, und jene jüngere, deren Tochter, war Leonhards Führerin gewesen. Diese leitete ihn zu einem der Sessel, ihrer Mutter gegenüber, und setzte sich dann zu den Füßen der Greisin.
Leonhard erwartete eine Anrede – da diese aber nicht erfolgte, vielmehr eine peinliche Stille herrschte, die des Mannes Erwartung steigerte, so nahm er das Wort: »Ihr seht, ich bin zur Stelle. Löset nun das mir gegebene Versprechen ein. Ihr sagtet, wenn es mich nach Auskunft über meine Abkunft, wie über meine Zukunft dränge, sollte ich nach der Asseburg kommen, und euch fragen, ihr räthselhaften Sibyllen. Nun denn, diese Zeit ist da; ich stehe im Begriff, den wichtigsten, ernstesten Schritt meines Lebens zu thun, und möchte das im Innern sicher und gefestet. Ihr wißt, so scheint es mir, mehr von mir und über mich, als ich selbst weiß, und zeigtet Neigung, es mir mitzutheilen. Ob mir durch Euch eine frohe Kunde wird, bezweifle ich, doch auch auf die unfrohe bin ich gefaßt, nur gebt mir, wenn ihr könnt, volle und reine Wahrheit. Trug traue ich euch nicht zu; es steht nun ganz bei euch, mir zu sagen, in welchem Verhältnisse wir zu einander stehen.«
Die Alte, die in gebückter Stellung, schweigend, unbeweglich, wie ein Steinbild gesessen hatte, richtete ihr Haupt empor, das von greisen Haaren umflossen war – und antwortete: »Des Mondes Scheibe füllte sich, und die Lunaria steht in voller Blätterzahl; sie bringt ihre Blume, welche leuchtet, wie ein Licht. Du bist gegangen zum grauen Markstein, der des Silbers Zeichen trägt, und hast angeklopft an unsere Pforte mit dem Schlüssel, den ich Dir gegeben, und hast dadurch Einlaß begehrt, und hast Einlaß gefunden.«
»Was zu wissen Du verlangst, sollst aus meinem Munde Du hören; Du wirst, was ich Dir erzähle, fassen und deuten. Fassest Du es nicht, so deutest Du es nicht, und wirst dann im Finstern wandeln Dein Lebenlang. So höre denn eine Geschichte. Es ist eine ziemliche Zeit her, so wandelte ein wälscher Mann über die deutschen Gebirge, das Erzgebirge, den Thüringerwald, den Harz. Sein Name war Antonio Dersto, und er war ein Sohn jenes Bastiano Dersto aus Venedig, dessen Namen man noch nennt im Erzgebirge und im schlesischen Riesengebirge. Dieser letztere Mann war kundig vieler tiefer Geheimnisse, und aller Erzgänge im Gold- und Silberlager, und wußte die Edelsteine zu finden im Schooße der Berge, und sammelte großen Reichthum. Er hatte zu Venedig einen herrlichen Palast am Canale grande, nahe am Rialto, und einen Laden voll Juwelen aller Art, Goldschmuck und die feinen gesuchteren Arbeiten von gesponnenem Gold und Silber, das sie Filigrana nennen, und ließ mehr zu seiner Lust, als um zu gewinnen, fort und fort Juwelen schleifen, die er in Menge roh gesammelt hatte, und ließ sie zu köstlichem Schmucke verarbeiten, den er in das Morgenland, wie in das Abendland verkaufte. – Dieses Mannes Sohn Antonio hatte auch Lust am gleichen Geschäfte, und obschon er genug gehabt hätte an des Vaters Erbe, so wollte er doch auch die Wege wandeln, die sein Vater gewandelt war, und selbst sein Glück versuchen, aber der Vater wollte ihn nicht von sich lassen. Gleichwol lehrte Bastiano den Sohn alle Künste der Scheidung und Bereitung der Metalle, und schrieb ihm alle Orte auf in Deutschland und der Schweiz, von denen noch etwas zu hoffen war, und machte ihm alle Bergwerke namhaft, so wie alle Höhlen und Grotten und die unterirdischen geheimen Gänge in verfallenen Schlössern, wie das alles zum Theil auch aufgezeichnet ist in den Büchern der Walen; so nennen nämlich die Deutschen jene Männer, die aus Wälschland kommen, und mehr wissen, wie sie, und ihrem Lande schon unermeßlich vielen Reichthum enttragen haben.«
»Da nun Antonio, der ein schöner und herrlicher Jüngling geworden, die Liebe eines armen Mädchens gewann, so zürnte ihm der Vater heftig, und drohte ihn zu enterben. Antonio aber faßte einen raschen Entschluß. Er sprach zu seiner Geliebten: Harre mein – ich gehe. Ich weiß selbst zu finden und zu erwerben, was wir bedürfen. Und die Geliebte hielt ihn nicht mit weichen Thränen, sondern sie gedachte ihrer Zukunft, und ließ Antonio willig ziehen. Es vergingen zwei Jahre, innerhalb deren sich zu Venedig Schreckliches zutrug. Bastiano Dersto wurde von heimlichen neidischen Feinden angeklagt der Ketzerei und der Zauberkunst, und vom Inquisitionsgerichte gesetzt in einen der Kerker des Dogenpalastes. Nie hat man ihn wieder erblickt. Er mußte die Seufzerbrücke überschreiten. Seine Habe verfiel der Republik – sein Sohn wurde geächtet. Ahnungslos über alles Unheil, das ihn während seiner Abwesenheit betroffen, nahete Antonio der Heimath, voll Sehnsucht nach der Geliebten, und meldete ihr in einem Briefe aus Mailand sein baldiges kommen, und wünschte Kunde von ihr, wie es in der Heimath stehe. Von Angst erfüllt, ließ die Geliebte ihm schreiben, er möge nicht wagen zu nahen – und riß sich los von allen Banden der Liebe und der Familie, und eilte zu ihm, und sank weinend in seine Arme, und enthüllte ihm das grause Schicksal, das seinen Vater betroffen, und das ihn bedrohe, so wie er nur den Boden der Republik betrete. Antonio stand erschüttert, doch faßte er sich wie ein Mann, und sprach: »Ich habe Dich! das ist genug. Schätze habe ich nicht erworben, aber ich könnte deren gewinnen. Erfahren habe ich viel. Unruhig wird fortan unser Leben sein, doch werden wir nicht Mangel leiden.«
»Die Geliebte Antonio's, die um seinetwillen Aeltern, Geschwister, Freunde und Heimath verlassen, warf sich an seine Brust und schwur, ihm zu folgen wohin er immer gehe, mit ihm zu wohnen über der Erde und unter der Erde, mit ihm zu fahren über Land und Meer, wohin er sie führe; und so knüpfte sich das Leben dieser beiden eng und fest aneinander, und nur der Tod sollte und konnte sie trennen. In einer schlichten Dorfkapelle empfingen sie den Segen der Kirche und wurden ein treues Ehepaar. Weite Wanderungen wurden nun angetreten, vieles wurde erkundet, nach geheimem Wissen strebte Antonio unablässig, und tagelang durchstreifte er die Gebirge, während sein Weib in irgend einer Hütte eines Dorfes verweilte. In Gold-, Silber- und Kobaltbergwerken war Antonio Dersto am liebsten thätig, er ließ sich da und dort als Obersteiger gebrauchen und erlangte mannigfaltige Kenntniß. In einem Gewerken-Dorfe am Thüringer Walde, sein Name ist Glücksbrunn, lernte Antonio, der den dortigen lange Zeit danieder gelegenen Bergbau wieder emporbringen half, die Blaufarbenbereitung aus dem Kobalt, und diese brachte des Bergwerks Eigenthümern einen jährlichen Gewinn von vierzigtausend Thalern nach Abzug aller Kosten ein. Dort wurde ihm eine Tochter geboren, die er Regina nannte, und aus Freude darüber heißt ein damals durch ihn neu eröffneter Schacht in jenem Kupfer- und Kobaltbergwerke der Regina-Schacht. Es vergingen zehn Jahre – Antonio war mit seinem Weibe und seinem Kinde aus Thüringen auf den Harz gezogen, dessen zahlreiche Werke und Gruben reiche Arbeit gewährten. Die kleine Regina bekam eine Schwester, die den Namen Bianca empfing.«
»Mancherlei Verhältnisse bewogen Antonio, in dessen Wesen die Neigung zu stetem Wechsel des Aufenthaltes lag, Deutschland zu verlassen, und mit Frau und Töchtern nach der Schweiz zu ziehen; dort wohnten sie, während Regina zu einer wunderlieblichen Jungfrau erblühte. In demselben Orte wohnte ein reicher und in allen geheimen Künsten gründlich erfahrener Mann, sein Name war Benjamin Teelsu. Dieser lernte Antonio kennen und einer diente dem andern mit seinem Wissen und mit seiner Kunst eine geraume Zeit. Teelsu räumte Antonio in seinem großen Hause für sich und die Seinen sogar eine schöne Wohnung ein, und die Männer und deren Frauen lebten als eine befreundete Familie zusammen. Teelsu hatte nur einen einzigen Sohn, und diesen hatte er nach Ostindien zu einem ungeheuer reichen Verwandten gesendet; ein zweiter Sohn war ihm mittlerweile wieder gestorben; er hatte daher Freude an den Töchtern Antonio's, der lieblichen Regina und der noch ganz kindlichen Bianca, die zehn Jahre jünger war als ihre Schwester. Da kam ein junger Mann in den Ort, in welchem Teelsu und Antonio wohnten, welcher von deren Kunst und Wissenschaft gehört hatte. Er besaß die größte Neigung, solcher Geheimnisse theilhaft zu werden, und hatte in seiner Persönlichkeit so viel feines, angenehmes und anziehendes, daß er jedes Herz für sich gewann, welches er gewinnen wollte. Er zeichnete, malte, focht, ritt, tanzte, und übte jede dieser Künste in höchster Vollendung. Er sang und spielte auch die Laute vortrefflich, und diese war Regina's Lieblingsinstrument. Dieser junge Mann war aus Thüringen, aus einer Stadt, die zwischen dem Thüringerwalde und dem Harzwalde liegt, gebürtig, und trieb mit Eifer Naturwissenschaften und Arzneikunde. Der bejahrte Herr Teelsu sowohl, wie nicht minder Antonio gewannen ihn lieb; er wurde ein täglicher Besucher des Hauses; er schmolz Metalle mit den Männern, und half Farben bereiten, wobei er seine Kenntnisse auf das wesentlichste bereicherte. Den Frauen wußte er zu schmeicheln durch sinnreiche Malereien oder Gedichte; mit der kleinen Bianca tändelte er liebkosend, und Regina zog er mit der Magie seiner Liebenswürdigkeit das Herz aus dem Busen. Beide liebten sich gegenseitig und suchten sich, wie Flamme die Flamme. Doch hütheten sie sorglich die auflodernde Gluth ihrer Leidenschaft vor jedem fremden Blick. Dieser junge Deutsche begleitete eine Zeitlang in Gesellschaft Antonio's den berühmten Genfer Naturforscher Horace Benedikt de Saussure auf dessen Alpenreisen, und erlernte von ihm die Anfertigung und Behandlung der durch diesen großen Gelehrten erfundenen physicalischen Instrumente. Er trennte sich aber von Saussure, um ganz im Stillen der Wissenschaft und seiner Liebe zu leben, ja er vergaß über der Liebe eine zeitlang fast die erstere. Sein Geist war schön und reich, aber mit Glücksgütern war der junge Mann nicht gesegnet. Er wollte sich erst, ehe er ein dauerndes Band knüpfte, ein Vermögen erwerben; dieser Wunsch zog ihn nach der Ferne, das Herz hielt ihn bei Regina zurück, bei ihren wunderlieblichen Reizen, bei ihrer wonnesüßen Stimme, bei ihrem seelenvollen Spiele. Nie blühte auf Erden ein holderes Angesicht, nie lächelte ein Mädchen so zauberhaft. O Regina! Regina!«
Die Erzählerin wurde durch einen Thränenguß unterbrochen, Bianca hatte ihr Haupt in den Schooß der alten Frau gedrückt, und die Erschütterung ihres ganzen Körpers zeigte Leonhard, daß sie schluchzte und heftig weinte. Er selbst saß wie umfangen von einem Traume, und regte sich nicht, um nicht aus demselben zu erwachen. Immer aufmerksamer, immer gespannter hatte er zugehört. Vergessen hatte er ganz alle das eigenthümliche, das seltsame seiner gegenwärtigen Lage. Daß er in einem Gruftgewölbe der alten Asseburg saß, vielleicht in demselben, aus dem einst eine begrabene Asseburgerin der Sage nach lebendig wieder hervortrat an das Licht des Tages – die Erzählung umspann ihn so märchenhaft, so abenteuerlich. Wol hatte er auf seinen Gebirgswanderungen und im Verkehr mit allen Schichten des Volkes häufig sprechen gehört von erz- und steinesuchenden Venetianern, aber nie war ihm deren geheimnißvolles Treiben so nahe vor Augen gerückt, wie in dieser Erzählung – ja, er hatte, wenn er nicht irrte, in der reichen Büchersammlung seines Pathen selbst ein altes geschriebenes Walenbuch gesehen, darinnen von zahlreichen Oertlichkeiten des schlesischen Gebirges, wie des Harzes und des Thüringerwaldes, die besonderen Stellen angeführt waren, an denen sich versprochene Schachte, oder reiche gold- und silberhaltige Minen finden sollten. Folglich war diese Sache keine leere Sage, wie so viele glaubten und darüber spotteten. Aber was sollte das alles ihm? Welchen Zusammenhang konnten die Erlebnisse eines wälschen Ehepaars mit seinem Leben haben? Was hatten sie mit seiner Vergangenheit, mit seiner Zukunft zu schaffen? –
Diese Fragen wogten wie ballendes Nebelgewölke um ragende Berggipfel durch Leonhards Gedanken, da fiel ein bleicher Strahl hindurch – der kam von der Geistersonne, welche Ahnung heißt. Es überlief ihn. –
Die Alte sprach weiter.
»Der junge Mann schied, er schied von uns allen mit Schmerz, von Regina mit blutendem Herzen; noch wußten wir alle nicht, wie stark diese Liebe sei. Ich sage wir, und rede von uns, denn warum sollte ich es vor Dir ein Hehl haben, daß ich Antonio Dersto's Weib war? Wir blieben, wir hofften drei Jahre auf Nachricht – es kam nie eine Botschaft. Jetzt brachen Liebe und Leidenschaft allgewaltig aus Regina's Innerem, das arme Kind wollte verzweifeln, und bestand darauf, nach Deutschland zu ziehen, den treulos geglaubten zu suchen, die Spuren zu verfolgen, die er uns angedeutet. Treulos war er nicht, aber er hatte sich gebunden – nachdem er erst kaum von großen weiten Reisen, bis nach Ostindien und China, erfuhren wir später, zurückgekehrt war. Er hatte sich gebunden durch den Dienst an einem kleinen deutschen Hofe, in einer nicht großen Stadt – wir naheten ihm nicht persönlich, aber unsere Mahnung traf ihn. Es lag in seiner Hand, ob wir ihm liebend oder rächend nahen sollten. Wir waren in dem Lande, dahin er sich gewandt, nicht ganz fremd. Ueber den Harz reisten wir, wo wir lange genug gelebt, um jeden Pfad, jede Bergschlucht, jede Burgtrümmer und jede Höhle zu kennen. Unter der Erde zu wohnen, waren wir alle gewohnt worden; das weckt nur im Anfang Schauer, später giebt es ein Gefühl von traulichem geborgensein, von einer sichern Stätte – wie jedes Grab auch eine solche ist. Wir mußten den Tag meiden, nicht weil wir Unthaten verübten, blos weil wir fremd waren, und für fähig gehalten wurden, solche verüben zu können. Bald sollten wir Zigeuner sein, auf die man häufig streifte, bald heimathlose Juden, bald Spione fremder, feindlichgesinnter Länder. Der siebenjährige Krieg führte vieles Gesindel durch die deutschen Gaue, wir mußten alles aufbieten, nicht gleich jenen, aufgegriffen zu werden, und nach einer Heimath von Lande zu Lande gewießen zu werden, die nirgend lag.«
»Da traf uns ärmste Frauen ein entsetzliches unermeßliches Unglück. Wir hatten alle ein schönes Asyl gefunden. Tief einsam, mitten im dichten Walde, südwärts von der Asseburg liegt ein kleines Gehöft, ein Vorwerk, ehemals eine zur Burg gehörende Kemnate, bewohnt von einem alten kinderlosen Jäger und dessen Frau, bei dem wir einmal Schutz und Obdach gesucht vor einem starken Gewitter. Das Häuschen ist ganz ärmlich, sieht der Wildhütte einer Fütterung ähnlicher als einer Menschenwohnung, uns aber gefiel es, denn wir entdeckten einen Mauerrest, an den die Rückseite des Häuschens angebaut war, und einen verfallenen Keller, und im Keller eine schmale Oeffnung, die in einen unterirdischen Gang führte, und dieser Gang, noch ziemlich wohl erhalten und sogar trocken, leitete bis unter die Trümmer der Asseburg, bis in diese Gewölbe. Die Furcht und der Aberglaube mieden diese Burgruinen, kaum traute ein beerensuchendes Weib oder ein vogelstellender Bursche der um die Asse liegenden Dörfer sich einmal am Tage hinein, geschweige Nachts. Da schlugen wir unsere Wohnung auf, und das alte Ehepaar war es zufrieden, wir gaben ihm genug, daß es zufrieden sein konnte.«
»Da wollte es das Unglück, daß ein ganz junger Mensch, ein Vetter des alten Jägers, ein müßiggängerischer Tagedieb, zu diesen in das Haus kam, sich mit jagen zu erlustiren. Wir hielten uns vor seinem Auge verborgen, bis eines Tages, an welchem sie ihn fern glaubte, Regina sich im Waldesgrün erging, und der freche Mensch sie fand, erstaunt, ein überirdisch schönes Mädchen in dieser Wildniß zu erblicken, und ihr sogleich mit unziemlicher Vertraulichkeit nahte. Bestürzt entriß sie sich ihm, er verfolgte sie – Antonio, ihr Vater, hörte ihren Hülferuf, stürzte hervor und rieß den Frechen wüthend zu Boden – der sein Gewehr auf der Schulter trug. Jener riß im liegen die Büchse herum, spannte er den Hahn, oder spannte dieser sich selbst, genug – ein Schuß krachte, und Antonio sank lautlos zusammen, die mordende Kugel war ihm mitten durchs Herz gegangen. Wahnsinnig war unser Schmerz!«
Wieder schlug, von wehvollster Erinnerung auf das leidenschaftlichste bewegt, die Erzählerin ihre Hände vor das Gesicht und schluchzte, doch bezwang sie rasch ihr aufwallendes Gefühl, und vollendete in kurzen abgebrochenen Sätzen: »Der Mörder entfloh – wir sahen ihn niemals wieder. Unser dreifacher Fluch heftete sich an seine Fersen. Mit Hülfe des alten Jägers begruben wir den Todten in ein grünes Bette. – Ich blieb mit den Töchtern in dem sichern Verstecke. Regina's Geliebter kam zu uns; er erklärte uns sein langes schweigen durch sein fernsein von Deutschland. Am Hofe wollte man ihn festhalten, ob seiner Kenntnisse, mit Frauenliebe ihn fesseln – er hatte nur dadurch ohne Nachtheil für sich das Netz zerreissen können, daß er schwur, er könne, wolle und werde sich nie vermählen. – Regina erschrak nicht über diese Nachricht; sie, die Walentochter, hätte doch nicht gepaßt zu einer deutschen Hausfrau. Der Geliebte entsagte dem Dienste des Hofes und begab sich in den der Wissenschaft, in der er es zu hohem Ansehen brachte. Die Heimath seines Herzens fand er heimlich hier. Regina wurde Mutter eines Sohnes – hier. – Sie zahlte die Wonne ihrer überschwänglichen Liebe und die erste Mutterfreude mit dem Leben. Ihre Hülle ruht – hier. Unsere Heimath ist nun hier. Mir blieb nur Bianca. Meine Zeit ist um und ich folge Regina bald. Das ist meine Geschichte, Gofredo – das ist Deine Geschichte, Gofredo! –«
2. Der Sohn.
Mit dem Professor erging sich an einem Herbsttage der Bergrath von Crell. Der erste hatte zu Emmerstädt, einem Helmstädt nahen Dorfe, einen Krankenbesuch machen müssen, und der Freund hatte ihn begleitet, um auf eine mineralogische Entdeckung auszugehen. Es hatte sich das abenteuerliche Gerücht verbreitet, man habe im Sande eines durch jene flachen Feldfluren rinnenden Bächleins, das seine Quelle bei dem lutherischen Frauenkloster Marienberg und ohnweit dem Stifte St. Lutgeri hat, bei Süplingen und Suplingenburg vorbeizieht, Campen berührt und endlich unter dem Fluß-Namen die Schunter eine Meile unter Braunschweig in die Ocker fällt – Diamanten gefunden. Ein Umstand, der einen Mineralogen allerdings zu näherer Nachforschung berechtigte, in dem Professor aber alle Spottlust erweckte, die er so gern gegen vertraute Freunde übte.
»Du hast nichts gefunden, armer Lorenz Florenz, als einige erbärmliche Kiesel, Kiesel von Emmerstädt – hebe sie ja gut auf in Deiner mineralogischen Sammlung.«
»»Ich will sie Dir in Dein Kabinet verehren, Verehrtester!«« spöttelte Crell dagegen.
»Solltest mir kommen! Ich wollte Dich jagen!« rief der Professor mit komischem Zorne. »Hättest bis nach Walen wallen und in Wenden umwenden sollen, da hättest Du vielleicht in der Schunter, wenn keinen Diamanten, doch einen Frosch fangen können, oder eine Kröte, die den Krötenstein im Kopfe trägt.«
»»Du hast gut lachen und spotten, alter Gottfried«« – entgegnete Crell.
»Wenn man von geschliffenen Diamanten ganze Schachteln voll, und ungeschliffene so groß wie die größten Hühnereier besitzt, braucht man freilich keine im Sandbette der Schunter bei Emmerstädt zu suchen. Aber ist Dir nicht auch schon aufgefallen, warum man zwei nahe beisammen liegenden Dörfern, wie Walen und Wenden, zwei Namen von Volksstämmen gegeben hat?« –
»»Von Wenden wissen wir ja, daß der Ort mitten im alten Sachsenlande seit frühen Zeiten wirklich Wenden-Wohnsitz ist. Ob aber das Dorf Walen von, Walen angebaut wurde, wissen wir nicht,«« erwiederte der Professor.
»Diese Walen spielten doch im Bergwesen der mittleren und späteren Zeiten merkwürdige und eigenthümliche Rollen!« nahm Crell aufs neue das Wort. »Wir sind noch gar nicht klar über sie, ob sie blos Wälsche, Wälische waren, ob sie aus dem Walliserlande und dem Valtelin stammten, oder ob sie aus dem Wallonenlande kamen?«
»»Ich glaube das erstere,«« entgegnete der Professor. »Das Volk nennt diese Leute Venetianer, das hat gewiß ganz guten Grund, der mit dem Vorwalten der Neigung zur Verfertigung schöner und kostbarer Schmucksachen der kunstreichen Bewohner Venedigs in enger Beziehung steht.« –
»Damit wollen wir es sein Bewenden haben lassen!« fügte der Sprechende noch hinzu, dem es innerlich nicht lieb war, selbst den Anlaß zu solcher Erörterung durch seinen Scherz hervorgerufen zu haben, und begann sogleich wieder auf das abgebrochene Thema überzugehen.