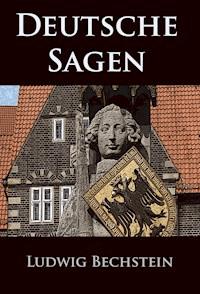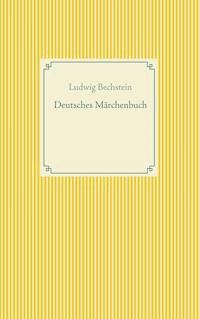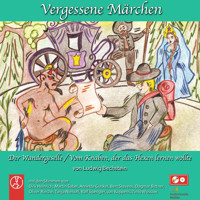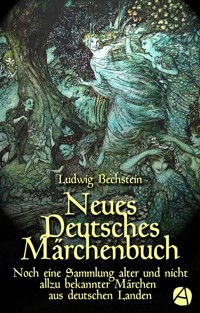Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine junge Frau mit goldbraunem Haar ist mit ihrer Näharbeit beschäftigt. Genauso wie der Professor und seine Studenten sitzt auch sie im wunderschönen Botanischen Garten. Die schöne Frau sieht ausländisch aus, sie ist sicher nicht aus der Gegend. Je näher die Nacht kommt, desto größer wird der Wunsch der jungen Frau, eine Strophe aus einem schönen Lied zu singen. Werden der Professor und die Studenten dieser schönen, verführerischen und exotischen Frau begegnen und wenn ja, wie wird das Treffen? -
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 227
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ludwig Bechstein
Die Geheimnisse eines Wundermannes - Zweiter Teil
Saga
Die Geheimnisse eines Wundermannes - Zweiter Teil
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1856, 2021 SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788726997194
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
Dieses Werk ist als historisches Dokument neu veröffentlicht worden. Die Sprache des Werkes entspricht der Zeit seiner Entstehung.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - ein Teil von Egmont, www.egmont.com
1. In China.
Mit Staunen hörte der Hofkreis Herzog Carls II. zu Braunschweig die Erzählung des Helmstädter Professors. Man hatte wol früher schon oft davon vernommen, daß dieser vorgebe, eine Reise nach China gemacht zu haben, hatte aber immer die Glaubwürdigkeit seiner Angaben stark in Zweifel gezogen; jeder Zweifel schwand indeß, sobald man ihn selbst sprechen hörte, mit dem Gefühle der Würde, dem Ausdrucke der Wahrhaftigkeit, dem lebendig strahlenden Blicke lebhaftester Erinnerung und Vergegenwärtigung des erlebten. Was war sonderlich zu bezweifeln? Große und weite Reisen hatte der Professor durch mehrere Jahre hindurch in entlegenen Ländern gemacht, das war bekannt. Daß Portugal jene Gesandtschaft nach China entsendete, war ebenso bekannt, wie deren sehr geringer Erfolg; daß ein junger strebsamer Arzt eine so ungesucht sich darbietende Gelegenheit, seine Kenntnisse in weit entlegenen Ländern zu erweitern und zu bereichern, freudig ergriff und benutzte, war etwas so sehr natürliches. Man konnte sich dabei gern des deutschen Dichters Paul Flemming erinnern, der aus gleichem Triebe vor Jahren eine russische Gesandtschaft nach Persien begleitet hatte. Man fand daher in des Professors Erzählung durchaus nichts erdichtetes oder unglaubliches mehr, und gab sich derselben mit um so größerem Antheile hin, als dem Erzähler alle Anmaßung und Aufschneiderei gänzlich fern lag, und er nur wirklich erlebtes zu schildern schien.
»Ich würde allzuweitläuftig werden,« fuhr der Erzähler fort, »wollte ich den höchsten Herrschaften die tausend und aber tausend Mühen, Beschwerden und Umständlichkeiten schildern, die es der portugiesischen Gesandtschaft kostete, trotz dem, daß sie nun in Peking war, zur Audienz bei Seiner chinesischen Majestät zu gelangen. Eingesperrt in das Labyrinth eines kaiserlichen Palastes, dessen Ausgänge ohne Führer Niemand fand, bewacht mit tausend und mehr Argusaugen, dem Mißtrauen, und dem Uebermuthe der Mandarinen und ihrer Dienerschaft Preis gegeben, die uns in Schaaren umringten, glichen wir recht eigentlich Gefangenen, und wahrhaftig, ohne mein geringes Sprach- und Dolmetschertalent hätte die ganze Gesandtschaft so schief als nur immer möglich ablaufen können. Wesentlichen Vorschub leistete mir indeß der Umstand, daß ich mich in die Gunst eines kleinen Mandarins setzte, der eine große Vorliebe für Geschenke zeigte. Um nur eine geringe Probe des Verkehrs mit diesen kahlköpfigen, langbezopften Schlauköpfen zu geben, theile ich mein erstes Gespräch mit diesem, an sich freundlichen und gutmüthigen Manne, der jedoch verschmitzt genug war, mit. Er hieß Wan-Sing. Er machte vor mir außerordentliche Bücklinge, nachdem er wahrgenommen, daß ich mich in seiner Sprache mit ihm zu unterhalten im Stande war, und sprach ohngefähr mit näselnder Stimme das Folgende zu mir: »Würdiger Mann – ich bin nicht würdig, Dein würdiges Antlitz zu erblicken, das gewürdiget worden ist, das hochbeglückte und von den Göttern gesegnete himmlische Reich der Mitte zu schauen. Ich bin der kleine Mandarin Wan-Sing; die großen Mandarinen, welche Du zu sprechen verlangst, und zu sprechen gewiß äußerst würdig wärest, wirst Du nicht sprechen, da sie zu dieser Herablassung erst die Erlaubniß des allerglorreichsten Herrschers der Welt, des gottgleichen Kaisers von China, auf ihren Knieen liegend, mit den Stirnen die Erde berührend und anbetend – erflehen müßten.«
»Wir suchen« – erwiederte ich trocken: »o würdiger Mandarin Wan-Sing, gar nicht die Ehre, Vieles mit den großen Mandarinen zu sprechen, sondern einfach die, Deinen ungleich größeren und erhabeneren Kaiser höchstselbst und in eigener Person, um ihm unsere Ehrfurcht nach unserer Sitte und Landesart darzubringen, begleitet von den Geschenken, welche wir mitgebracht haben, und von denen wir ein schönes Theil auch denjenigen würdigen Mandarinen zudenken, die uns den Weg bahnen werden, das Antlitz des glorreichsten Beherrschers von China zu erblicken.«
»Würdiger Mann – entgegnete Wan-Sing: Ihr begehret ein Glück, das nur in den seltensten Fällen selbst den bevorzugtesten und würdigsten Unterthanen unseres erhabensten Herrschers zu Theil wird – es wird schwer, ja ich fürchte, es wird unmöglich sein, doch will ich meinen Einfluß nicht unversucht lassen. Du nanntest, würdiger Mann – eure Geschenke –«
»Ich nannte sie nicht, ich erwähnte ihrer nur, würdiger Wan-Sing, entgegnete ich: – aber sie werden euch in Erstaunen setzen und befriedigen.«
»Genug, ich gewann im hohen Grade das Vertrauen Wan-Sings; dieser führte mich bei dem alles geltenden Obermandarin Hong-Li, einem der Großwürdenträger und Vertrauten des Kaisers von China ein, welcher Anfangs noch tiefere Complimente machte und noch mehr nichtssagende Schmeicheleien vergeudete, zum Beispiel, daß er nicht würdig sei, das Taschentuch eines so würdigen Mannes wie unser Gesandter oder auch ich abzugeben, dann aber dem Dom Pacheco e Sampayo und dessen Umgebung, der ich ganz unentbehrlich geworden war, vieles Herrliche zeigte, und die gesammte Gesandtschaft zur Tafel lud. Diese Tafel wage ich vor hochfürstlichen Ohren nicht ausführlich zu schildern; bekanntlich ist der Geschmack verschieden, und man speist in China so Manches als Leckerbissen, vor dem man in Europa zurückschaudert. Jede chinesische Stadt hat ihren Katzen- und Hundemarkt für die Küche, und man sieht dort, wie bei uns die gerupften Leipziger Lerchen, abgehäutete und ausgeweidete Ratten an Hölzer aufgereiht, Frösche an Stäbe gespießt, Schlangen in Rouladenform gerollt; sieht auch Spinnen mit Bäuchen so groß wie eine wälsche Nuß die Stellen unserer Kibitzeier vertreten.«
Ein Schauer des Abscheues ergoß sich bei dieser Schilderung über die Damen des Zuhörerkreises; nur Prinzessin Caroline schlug ein Gelächter des Beifalles auf, für das ihr allseits strafende Blicke genug zu Theil wurden. Der Erzähler lenkte rasch ab von dieser kleinen episodischen Nebenbemerkung, und fuhr fort: »Unsere Geschenke für die Mandarinen wurden ausgepackt und ausgelegt, sie befriedigten und es wurden uns sehr annehmbare Gegengaben zu Theil. Auf meinen Antheil kamen zwölf Kisten voll chinesische Seidenzeuge, zwölf Kisten voll feine Flechtwerke, Körbchen, Arbeitsbeutel, Taschen und dergleichen, zwölf Kisten voll Porzellan, chinesisches nicht nur, sondern auch japanisches, in allen Formen, zwölf Kistchen chinesische Tusche, Pinsel, andere Farben, Gemälde, Fächer, Stickereien, zwölf Kistchen chinesischer Thee, ebenso viele mit chinesischen Zuckerwaaren und Confitüren, ebenso viele Töpfe mit eingemachtem Ingwer, ebenso viele Kistchen mit allerliebsten chinesischen Feuerwerkstücken.«
»Nach glücklicher Ueberwindung und Beseitigung aller Umständlichkeiten erschien endlich der so lange ersehnte Tag und Augenblick der mühevoll genug erlangten Audienz bei dem erhabenen Herrscher des himmlischen Reiches Kien-Long, in aller Pracht mit allem Pomp, mit aller Würde. Ich war der Glückliche, der den Inhalt des Briefes Seiner Majestät des Königs von Portugal, den Dom Pacheco e Sampayo mit einer Kniebeugung zu höchsten Händen überreichte, in das chinesische laut übertragen zu dürfen, und sparte nichts, dieß in chinesischen Redewendungen zu thun, wodurch der hervorgerufene Eindruck um so lebhafter wurde. Nur eins war Schade. Höchst-Seine chinesische Majestät und höchst derselben Großrath waren in keiner Weise geneigt, dem Ansinnen Portugals bezüglich größerer Glaubensduldung gegen die Christen Folge zu geben. Der Gesandte wurde mit größeren Ehren ausgezeichnet, als je einem Europäer am chinesischen Kaiserhofe widerfahren sind; der Kaiser erbat sich sogar dessen Bildniß, um dasselbe als ein Andenken an dem Throne aufzuhängen; der schmeichelhafteste Gegenbrief an den König von Portugal wurde abgefaßt, und mit Goldbuchstaben gemalt; die reichsten Gegengeschenke wurden gegeben – aber so wie die Audienz vorüber war, erhob sich wieder, gleich der chinesischen Mauer, die unübersteigliche Schranke der förmlichsten und peinlichsten Etikette, und alles beeiferte sich, den Wegzug der Gesandtschaft zu beschleunigen. Nur mir blühte für mein geringes Dolmetscherverdienst ein besonderes Glück. Wan-Sing hatte dem Groß-Mandarin vertraut, daß ich nicht nur ärztliche Kenntnisse besitze, sondern auch physikalische, und ich wurde daher ganz im Geheimen zu einer Privataudienz zugelassen. Meine Anamorphosen machten ungeheueres Glück, über meine tanzenden Glasteufelchen geriethen die Chinesen außer sich vor Lachen und Freude; das meiste Aufsehen aber machte die von mir erfundene Schminke, welche ich dem Kaiser zeigen durfte. Sie war es, die mir den großen Diamanten eintrug, nächstdem ich noch viele überkostbare und werthvolle Geschenke empfing, so daß was ich für meine Person aus China hinwegführte, in der That wo nicht die Hälfte, doch ein gutes Dritttheil einer Schiffsladung ausmachte.«
Der Hofrath schwieg, der Hof erstaunte.
»Er schoß also den Vogel ab!« rief beifällig der Herzog. »Das heiß' ich Glück haben! Aber was in aller Welt fing Er mit den Unmassen von chinesischen Sachen an?«
»»Das Werthvollere, Euer Durchlaucht behielt ich für meine Sammlung«« – erwiederte der Hofrath: »das minder Werthvolle machte ich zu Gelde. Vieles diente mir zu Geschenken, die mir auf der weiten Rückreise erstaunliche Vortheile brachten.«
»»Was war denn davon nächst dem Diamanten das Wichtigste, mein lieber Hofrath?«« fragte der Herzog Oheim mit leutseligem Blicke.
»Euer Durchlaucht unterthänigst zu dienen« – erwiederte der Gefragte: »so war dieß eine unscheinbare dünne Wurzel.«
»Wie? Eine Wurzel? Und die kommt gleich nach dem Diamanten?« fragte gespannt die Herzogin Mutter.
»Wollen Ihre königliche Hoheit gnädigst geruhen Höchstsich diese Wurzel zu betrachten?« entgegnete der Hofrath, und zog aus der Westentasche ein drei Pariser Zoll langes niedliches Kistchen mit Schiebedeckel, von feinem schwarzgebeiztem Schildkrot, das er auf einen Silberteller legte, und mit devotem Anstande der alten Herzogin darbot.
»Ei? Er hat die Wurzel gleich bei sich! Das ist ja charmant!« rief die Fürstin gnädig, und entnahm das Kästchen, das sie alsbald öffnete. Es war dasselbe innen mit Goldblättchen von grünlicher Farbe ausgelegt und enthielt einen kleinen Wurzelstengel, dessen Farbe ockergelb war, und der halbdurchsichtig erschien, ohngefähr wie recht reine Salepwurzel, die aber stets rundliche Knöllchen bildet.
»Und aus diesem Stückchen unbedeutender Wurzel macht der Herr Hofrath so ein Weltwunder?« fragte Herzogin Philippine Charlotte.
»Königliche Hoheit halten zu Gnaden!« entgegnete der Hofrath diese Frage. »Unbedeutend werden Höchstdieselben diese Wurzel nicht nennen, wenn ich deren Tugenden genannt habe. Es ist die hochberühmte Wurzel Sum, holländisch Som, chinesisch Gin-Seng. Sie ist ein kaiserliches Regale; sie aus dem himmlischen Reiche auszuführen, ist bei Todesstrafe untersagt. Sie ist das allerwichtigste Heilmittel; in den gefährlichsten Krankheiten, wo alle Medicamente ihre Wirkung versagen, leistet sie oft noch unerwartete, überraschende Hülfe.«
»»In der That!«« rief die Herzogin Mutter verwundert aus. »Und hat Er schon viele Kuren mit dieser Wurzel Smum oder wie sie sonst heißt, gemacht?«
»»Nur wenige, Königliche Hoheit! Meine Kunst bedarf, Dank und Preis sei Gott, zur Heilung meiner Kranken keiner chinesischen Wurzel. Mein Gin-Seng ist die Wissenschaft. Nur einige male in ganz verzweifelten Fällen, gab ich etwa einen halben Gran davon als Pulver mit Zucker abgerieben, ein, und dann that sie allerdings Wunder, und rettete, wo unsere Kunst aufgeben mußte.««
»Dann mag die Wurzel wohl stark giftig sein,« bemerkte Herzog Ferdinand: »wenn ihre Wirkung in so geringer Menge sich also kräftig äußert. Hat man darüber keine nähere Kenntniß?«
»»Die Chinesen, durchlauchtigster Herzog«« – antwortete der Hofrath: »widerrathen, jemals mehr als einen Gran anzuwenden, ich habe es daher auch nie gethan; Proben an Thieren mit ihr zu machen, dazu ist die Wurzel zu werthvoll; dieses kleine, kleinfingerlange Stückchen ist nach der Schätzung in China selbst über zweihundert Reichsthaler werth. Was ist aber gegen diesen an sich scheinbar hohen, und doch geringen Geldwerth der eigentliche innere Werth dieses Stückchens Wurzel, wenn wir erwägen, wie viele Menschenleben mittelst derselben noch vom Tode gerettet werden können. – Ich besitze noch das schriftliche Zeugniß Wan-Sings über die Aechtheit dieses Stückchens Sum, dem ich mit einem Eide geloben mußte, niemand in China, und selbst in Indien nicht, anzuvertrauen, daß ich im Besitze einer so großen arzneilichen Seltenheit sei.«
»»Verliert aber das Ding nicht durch die Zeit seine Wirkung, gleich anderen Wurzeln und Kräutern?«« fragte der regierende Herzog.
»Nein, hochgnädigster Herr!« erwiederte der Hofrath: »Sie gewinnt vielmehr durch das altwerden, wie das Rosenpflaster, oder, um ein schöneres Bild zu gebrauchen, wie der Wein.«
»Was kann so sehr wenig helfen?« warf der Hofmarschall von Münchhausen die Frage auf.
»Mein gnädiger Herr Hofmarschall,« versetzte der Hofrath: »das bekannte Sprichwort: viel hilft viel, taugt nichts in der Arzneikunst. Wenn Sie eine Quente Brechweinstein einnehmen, werden Sie nicht brechen, wol aber, wenn Sie zwei Graue, also den dreißigsten Theil einer Drachme nehmen. Es wird eine Zeit kommen, wo mit einem halben Grane Arzneistoff, ja mit noch weniger, Heilungen gemacht werden, während alle Bullen und großen Pillen- und Pulverschachteln hülflos uns im Stiche lassen. Unsere Aerzte versehen es heutzutage noch gar sehr damit, daß sie gegen den kranken Organismus mit solchen Katapulten gleichsam Sturm laufen, und die Krankheit erzürnen, statt mit weniger Medizin, als ein Rosenblatt trägt, sie zu beschwichtigen. Jedes Recept, das ein Arzt einem Leidenden verschreibt, sollte nichts sein, als ein Friedensbrief an die Krankheit, statt dessen ist's meist eine Kriegserklärung, oder ein Pasquill auf unsere Kunst, und macht im Körper nichts als Aufruhr und Meuterei rege.«
»»Der Herr Hofrath macht seinen Herren Collegen allerliebste Complimente!«« rief lachend Prinzessin Caroline aus. »Da wird derselbe bald einen guten Stein im Brete bei der gnädigsten Mama haben, denn diese geruht sehr, die Arzenei zu verschmähen, und selbst was ein Rosenblatt trägt, dürfte hochderselben noch zu viel sein, wenn es garstig schmeckt!«
Für diese Bemerkung flogen der guten Prinzessin Caroline wieder mehrere strafende Blicke zu, besonders von der gnädigen Großmama und dem Herrn Vater, und beide genannte hohe Personen verständigten sich durch Blicke, die Tafel aufzuheben, was auch alsobald erfolgte.
________________________________________
Eine halbe Stunde später saß der mit einem schönen Geschenke entlassene Hofrath und Professor wieder in dem fürstlichen Wagen, und rollte in demselben unaufhaltsam Helmstädt zu. Er empfand ein Gefühl der Behaglichkeit und der Zufriedenheit mit sich selbst, indem er, wie er zu thun gewohnt war, die Thätigkeiten des verflossenen Tages noch einmal in umgekehrter Reihe überdachte. Es war von seinem herzoglichen Hofe ausgezeichnet worden, hatte denselben angenehm und spannend unterhalten, hatte rasch und glücklich eine Heilung vollbracht und dadurch seinen so oft bewährten Ruf als Arzt aufs neue im hohen und höchsten Vertrauen begründet. Das kleine Schildkrotkästchen mit der Wurzel Sum ruhte wieder nächst seinem Herzen, und erinnerte ihn an Erlebnisse, an welche er gern dachte, von denen er gern sprach, und die reichhaltig genug waren, mit einer Fülle von Erinnerungen solche Stunden zu kürzen, wie die gegenwärtigen, viele Stunden weite Fahrten durch flache und einförmige Gegenden, wie deren der Professor heute zweimal zurücklegen mußte.
Auch des heutigen Morgens wurde gedacht und Leonhards; Leonhards, dieses jungen Menschen, der nicht ganz nach des Professors Sinn sich geartet hatte, und den man nicht so zu erziehen verstanden hatte, daß er das werde, was man wünschte. Erziehungskunst ist auch eine Gabe, die nicht jedem verliehen ward. Ein göttlicher Funke muß den Erzieher geistig beleben, die Lehrbücher thun es nimmermehr. Wie die fachgelehrten Scholarchen wol trefflich Metrik lernen, und Verse bauen, nach Schnuren und Regeln, Hexameter, die nicht mit einem einzigen Fuße hinken, Disticha, die viel regelrechter sind, als die, welche Goethe und Schiller je gedichtet – es ist doch nur ein Machwerk; die so nach der Grammatik aufgebauten Verse erbauen niemand, die Hexameter bleiben bei ihren Füßen, bis zu Herz und Kopf erheben sich ihre Gedanken nicht; die »flüssigen Säulen« sind eben nur flüssig, sie steigen gar nicht hoch empor, und die Melodie des Geistes fehlt ihnen ganz. Daher kommt es, daß die Menschen Goethe und Schiller lieber lesen, weil diese Dichter waren, als die Verskünsteleien der Metriker von Profession, die in den meisten Fallen keine Dichter sind.
Dieses Beispiel, auf die Erziehungslehre angewendet, spricht die unliebsame Wahrheit aus, daß es viel mehr Erzieher giebt, als Erzogene, weil ein Jeder Erzieher sein will, sein muß, wenn Gott ihm Kinder anvertraute, die meisten und tüchtigsten Menschen aber sich dennoch selbst erst nach vollendeter sogenannter Erziehung nacherziehen mußten und müssen. Und wie die gelehrtesten Männer, wenn sie auf den unglücklichen Gedanken verfallen, Verse zu schreiben, insgemein sehr verunglückte Verse zur Welt bringen, ebenso vermögen sie auch nicht zu erziehen, weil sie zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind, und ungleich mehr das todte Werk der Bücher, die sie schreiben, im Auge haben, als das lebendige Werk der Menschenbildung, der Bildung junger Menschen.
Der Professor mußte sich selbst sagen, daß mehr als Gründe, daß Pflichten vorhanden waren, für die Erziehung Leonhards zu sorgen. Diese Pflichten hatte er nicht im vollen Maaße erfüllt. Er hatte gesorgt für das leibliche Wohl des Kindes; er hatte es zwar nur in die Pflege von Leuten untergeordneter Lebensstellung gegeben, doch hatte er es täglich im Auge; er durfte sich des Wohlgedeihens des kleinen Pfleglings jener Leute freuen. Der Knabe, Gottfried Leonhard geheißen, war fast immer gesund, entwickelte sich zu einer etwas sehr länglichen Gestalt, spielte seine Spiele, wurde zu fleißigem Schul- und Kirchenbesuche angehalten, raufte sich mit Kameraden, warf mit Spiel- und Schneebällen Fenster ein, und empfing das volle Maaß gesunder und herzstärkender Prügel, ohne die nun einmal seine Zeit mit der Bildung des Geschöpfes, das Gott nach seinem Bilde geschaffen, nicht fertig zu werden wußte, welches letztere selbst in unserer erstaunlich aufgeklärten Zeit immer noch erstaunlich schwer fällt.
Der academische Lehrstuhl des Professors, dessen weitverbreitete ärztliche Praxis, sein chemisches Laboratorium, seine Farbenbereitung – das alles waren Beschäftigungen, die den beschränkten Stundenkreis des Tages völlig ausfüllten; auch war der junge Gottfried durch seine Knaben und die sogenannten unvermeidlichen Flegeljahre hindurch von ziemlich eckigem und selbst etwas täppischem Wesen, hatte nichts anziehendes, herzgewinnendes an sich, war nicht zärtlich, nicht liebevoll geartet, legte nicht genug Dankbarkeit und unterwürfigen Sinn an den Tag, wurde daher ungleich mehr gescholten und bestraft, als gelobt und belohnt. Es schlummerten schöne Fähigkeiten in des werdenden Jünglings Seele, aber sie schlummerten etwas lange, und sie zeitig zu wecken, dazu fehlten eben das rechte Geschick, fehlte vor allem die Zeit, sich mit Gottfried abzugeben, seinen Geist anzuregen, seine besseren Keime zur Blüthe zu bringen. Daher war Gottfrieds Lebensfrühling ein kühler, frostiger, bis in seinen Mai hinein; erst als er lieben lernte, brachen die Blüthen edlerer Gefühle in ihm auf, entfalteten sich Talente. Aber alles dieß, wie es so kam, kam dem Professor ungelegen, unerfreulich. Was Gottfried, sein Pathe, werden sollte, das versprach er nicht zu werden, eigene Bahnen schien er mit Vorliebe einschlagen zu wollen, und die Jünglinge, die dieß thun, bedenken so häufig nicht, daß sie sich damit oft eine schöne Zukunft verscherzen – wer aber kann der Bestimmung gebieten, die höherer Lenkung anvertraut ist, die uns lenkt, während wir immer noch glauben, uns selbst zu lenken? – »Was hat der Affenschwanz jetzt schon Liebschaften anzuzetteln?« murrte der Professor in seinem Wagen, als er durch die mehr und mehr sich niedersenkende Nacht fuhr, und seine Gedanken sich auf das lebhafteste mit seinem Pathen beschäftigten. Nun – ich denke, mein heutiges Billet soll gewirkt haben, und die grüne thüringische Florfliege, die ihm den Kopf umflirrte, nach ihrem Gebirge zurückschweben. – Und dabei – wie trotzig und übermüthig ist der junge Mensch geworden! Rückt mir seine erfrorenen Finger vor – macht mir zum Vorwurf, daß er wenig lernte – will auf eigenen Beinen durch die Welt laufen – will dem Kalbfelle folgen. Ob er gehen wird? – Ich glaube es nicht, er wird nicht gehen! – So dachte der Professor und mit diesen letzten Gedanken suchte er ein Gefühl zu beruhigen, das ihm im Herzen aufwallte, das ihn mit ungleich mehr ängstlichen Besorgnissen um Gottfried erfüllte, als er sich selbst eingestehen mochte. Wie sehr er innerlich unzufrieden mit letzterem war, zuletzt mußte er sich doch selbst eingestehen, daß Gottfried anders als jetzt sein würde, wenn er anders, wenn er besser geleitet worden wäre, und mußte sich auch fragen, wie es denn werden solle, wenn Gottfried auf seinem Sinn beharrte, wenn er wirklich den tollen Schritt thue, Soldat zu werden, jetzt, wo Krieg in nächster Aussicht stand, wo vielleicht bald genug eine feindliche Kugel ihm – dem Sohne – –, ein Ende machte. – Schrecklicher Gedanke für ein Herz – für ein – – Herz! – Ermüdung spann ihr Schlummernetz über den einsamen Reisenden durch die Düsterniß des Elm, und er ahnete nicht, daß seine Zuversicht auf einem Trugschluß beruhte. »Er wird nicht gehen!« hatte diese Zuversicht ihm zugeflüstert – und Gottfried war auch nicht gegangen, davon geritten war er auf dem schnellsten Rosse, das die Universitätsstadt darbot, und während eine Besorgniß, von der er keine Ahnung hatte, das Herz des alternden Mannes unruhiger klopfen machte, stürzte sich der noch daheim geglaubte in Nacht und Abenteuer, und hatte dem Aelternhause, seinem, des Professors Hause, schon eine Reihe von Stunden Valet gesagt auf eine lange und unbestimmte Zeit. –
Es war just Mitternacht, als der herzogliche Wagen vor dem Hause des Professors hielt. Das annahende Rollen hatte das Leonhard'sche Ehepaar aus halbschlummernder Ermüdung geweckt, die Flur ward kerzenhell, die Thüre geöffnet.
»Guten Abend! Da wären wir wieder und wohlbehalten, Gott sei Dank!« sprach der Professor zu seiner greisen Dienerschaft. »Wo ist Gottfried?«
»Fort ist er, Herr Professor, auf und davon!« erwiederte im zürnenden Tone der alte Leonhard.
»Fort, sagst Du?« rief erschreckend und erbleichend der Professor. »Was soll das heißen: fort?« –
»»Er hat eingepackt und ist heute gegen Abend mit Schmidts Schimmel weggeritten, nachdem er von uns kurzen Abschied genommen.««
Der Professor schwieg und ging stumm auf sein Zimmer. Jede Erquickung wieß er ab. – »Fort! Fort!« –
2. Eine Prophezeihung.
Gottfried Leonhard wanderte am Morgen des folgenden Tages betrübten Herzens aus Halberstadt; es war noch früh, Nebel dampften über den Wiesen, durch welche die Holzemme sich schlängelte, die sanft von Derenberg herabschlich. Zur Linken des frühen Wanderers hob sich das Harzgebirge in seiner ganzen Pracht; anmuthig wechselten buntgefärbte Laubwälder mit dem tiefen Grün der Tannenforste, und mächtige Sehnsucht zog dort hinüber, wo oft im Schoose der stillen und erhabenen Natur des Gebirges der Jüngling in Einsamkeit große Gedanken gedacht, und das Wehen des Weltgeistes empfunden hatte. Mit schmerzlicher Wehmuth gedachte heute Gottfried jener Tage; er war noch so jung und schon lag die beste Zeit – so glaubte er, und so redet sich's gar mancher Jüngling ein, dem es nicht gleich nach seinem Sinne geht – hinter ihm – und heute, dünkte ihn, sei ihm ein Stück Lebensfaden gekürzt und abgeschnitten. Dort lag auf seiner Höhe über dem friedsamen Städtchen Schloß Blankenburg, und glühte im Frühstrahl, weithin leuchtend, wie eine Purpurrose über dem feinen Dunst, der über den Flächen lag; dort starrte schwarz, vom Sonnenkuß noch nicht berührt, die Teufelsmauer. Dort ragten die Thürme von Heimburg, dort hob sich riesig über alle Höhen und Berggipfel des Brocken kahler Riesenscheitel, auch rosig angestrahlt von der Herbstsonne. Jeder Schritt des Wanderers, der in sinnenden Gedanken, doch rüstig fürbaß ging, stets das Flüßchen Holzemme und meist dicht zur Rechten, brachte ihm dem Gebirge näher, bis nach einer Wanderung von vier guten Stunden des Harzwaldes unmittelbarer Fuß und das Städtchen Wernigerode erreicht war, dessen altes Stolbergisches Grafenschloß schon lange entgegengeleuchtet hatte. Dort wurde dem Körper Rast geboten und überlegt, ob das Harzgebiet zum Zwecke einiger naturwissenschaftlicher Ausbeute betreten werden sollte, oder lieber auf geradem Wege geblieben? Wernigerode lag so recht da wie eine Pforte zum Labyrinthe zahlloser, waldiger Thalschluchten, die sich zumeist nach dem Gebirgshaupte empor zogen, so konnte Leonhard den Hochgipfel in wenigen Stunden erreichen; er brauchte nur der Thalrinne der Holzemme immer aufwärts über Friedrichsthal und Hasserode unmittelbar zu folgen, und die Hölle zu durchwandern, die Hohne-Klippen zur Rechten zu lassen, die Zeter-Klippen zur Linken, und von da zur hochgelegenen Glashütte Heinrichshöhe emporzusteigen, deren Flammenlohe das Fegefeuer versinnbilden konnte, und dann von da nach kurzer Zeit den Himmel zu gewinnen, den Himmel des Brockengipfels mit seiner unendlichen Fernsicht und seinem Bergesodem, der das Herz mit Lust schwellt und das Gefühl der Freiheit in die Seelen der Wanderer gießt.
»Heute nicht« – grollte Leonhard; »heute mag ich nicht hinauf, obgleich der Tag so schön ist. Was soll ich mich müde laufen? Wenn ich heute noch bis Goslar kommen will, habe ich ohnehin noch ein gutes Stück Weges vor mir. War es mir doch ohnehin kein rechter Ernst, als ich der guten Sophie sagte, ich wolle Naturalien im Harze sammeln; was brauche ich Stufen und Steine, Vögel oder seltene Pflanzen-Exemplare? – Ich bin selbst ein rares, hochstengliches Exemplar, und werde bald genug im Herbarium des Jägerregimentes einrangirt sein. – Tiro! Tiro! – Vielleicht Flügelmann!«