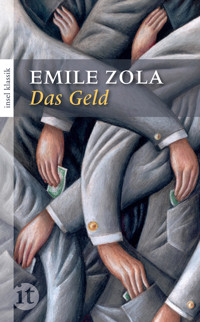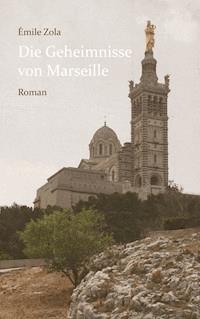
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Marseille zur Zeit der Julimonarchie: Das Fieber der Industrialisierung, politische Ränke, die Gier nach Reichtum, Luxus und Macht und die Suche nach dem kleinen und dem großen Glück halten die Stadt in Atem. Bis auch sie im Februar 1848 von der Revolution erfasst wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 674
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Übersetzer dankt Denise Lößer und Heinrich Rudolf Bruns, ohne deren Hilfe diese Arbeit nicht möglich gewesen wäre.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Zwei Briefe Émile Zolas an den Leiter des
Messager de Provence
Erster Teil
Worin gezeigt wird, dass Blanche de Cazalis mit Philippe Cayol flieht
Man macht Bekanntschaft mit dem Helden Marius Cayol
Die Kirche hält sich Knechte
Wie Herr de Cazalis die Entehrung seiner Nichte rächt
Blanche legt sechs Meilen zu Fuß zurück und sieht eine Prozession vorüberziehen
Die Jagd nach dem Liebespaar
Blanche folgt dem Beispiel des Heiligen Petrus
David gegen Goliath
Die Klatschgeschichten des Herrn de Girousse
Ein skandalöser Prozess
Blanche und Fine stehen sich gegenüber
Welches beweist, dass das Herz eines Gefängniswärters nicht immer aus Stein ist
Ein Bankrott, wie man ihn des Öfteren sieht
Welches zeigt, dass man dreißigtausend Franc pro Jahr ausgeben kann, obwohl man nur eintausendachthundert verdient
Philippe lehnt ab zu fliehen
Die Herren Wucherer
Zwei beschämende Persönlichkeiten
Ein Strahl der Hoffnung bricht durch
Aufschub
Zweiter Teil
Herr Sauvaire, Lastträgermeister
Eine Marseiller Lorette
Frau Mercier zeigt ihre Krallen
Welches zeigt, dass das Gewerbe einer Lorette seine kleinen Unannehmlichkeiten hat
Douglas, der Notar
Marius sucht vergeblich nach einem Haus und einem Mann
Die Kutte macht noch keinen Mönch
Die Spekulationen des Notars Douglas
Worin gezeigt wird, dass ein hässlicher Mann schön werden kann
Der Kampf beginnt von neuem
Am Pranger
Marius verliert den Kopf
Die Marseiller Spielhöllen
Marius gewinnt zehntausend Franc
An Marius' Händen klebt Blut
Fräulein Claires Gebetbuch
Sauvaire nimmt sich vor, für sein Geld zu lachen
Abbé Donadéi entführt eine ihm verwandte Seele
Philippes Lösegeld
Die Flucht
Dritter Teil
Das Komplott
Herrn de Cazalis' Plan
Man sieht, welche Wirkungen der Zipfel eines weißen Fetzens zu entfalten vermag
Herr de Cazalis verliert durch den Verlust seines Großneffen beinahe den Kopf
Blanche sagt der Welt Lebewohl
Ein Geist
Herr de Cazalis möchte seinen Großneffen in die Arme schließen
Ayasse, der Gärtner
Begnadigung! Begnadigung!
Februar 1848
Mathéus wird Republikaner
Die Republik in Marseille
Mathéus' Strategie
Der Aufruhr
Mathéus vollendet die Katastrophe
Die Barrikaden auf der Place aux Œufs
Was der vorausschauende Mathéus nicht vorhergesehen hat
Der Angriff
Mathéus hält endlich Joseph in seinen Armen
Der Aufständische Philippe feuert einen letzten Schuss ab
Das Duell
Die Strafe
Epilog
Anmerkungen
Vorwort
Der Roman hat eine Geschichte, die zu erzählen womöglich nicht unnötig ist.
Es war im Jahre 1867, zu den schwierigen Zeiten meiner Anfänge, in denen ich ständig Mühe hatte, meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Nun aber, in einem dieser Momente des finsteren Elends, schlug mir der Leiter eines kleinen Marseiller Blattes, dem Messager de Provence, ein Geschäft mit einer Idee von ihm vor, mit der er beabsichtigte, seine Zeitung bekannt zu machen. Unter dem Titel Die Geheimnisse von Marseille sollte ein Roman entstehen, dessen historische Elemente er liefern sollte, indem er selbst die Gerichtskanzleien von Marseille und Aix-en-Provence durchforsten würde, um dort die Akten der großen lokalen Affären zu kopieren, die diese Städte seit fünfzig Jahren fasziniert hatten. Die Idee des Journalisten war nicht dümmer als irgendeine andere, und das Unglück war wahrscheinlich, dass er über keinen Hersteller von Fortsetzungsromanen gestolpert war, der die Veranlagung zu einer mächtigen, romanhaften Maschinerie besaß.
Ich akzeptierte den Vorschlag, ohne eine besondere Hingabe oder die dazu nötigen Fähigkeiten zu verspüren. Zu der Zeit machte ich sehr viele andere abstoßende Arbeiten im journalistischen Gewerbe. Man musste mir zwei Sous pro Zeile zahlen und ich hatte errechnet, dass mir die Arbeit neun Monate lang etwa zweihundert Franc pro Monat einbringen sollte – alles in Allem war es schließlich ein unerwartet großer Glücksfall. Sobald ich die Dokumente hatte – eine beachtliche Anzahl von gewaltigen Akten –, machte ich mich an die Arbeit. Es befriedigte mich, für die zentrale Handlung einen der spektakulärsten Prozesse zu verwenden, und ich bemühte mich, die anderen Fälle zu ordnen, um sie in diesen einzubinden und zu einer einheitlichen Geschichte zusammenzufügen. Zugegeben, das Verfahren ist schwierig. Aber wenn ich an die harte Zeit dieser Tage zurückdenke, so ist es das Schicksal gewesen, das mich, in einem Augenblick, in dem ich mich noch selbst suchte, diese Arbeit eines reinen und eines üblen Handwerks mittels einer ganzen Fülle an genauen Dokumente schreiben ließ. Später habe ich für meine literarischen Werke keine andere Methode angewandt.
So habe ich also neun Monate lang zweimal pro Woche mein Feuilleton gemacht. Zur selben Zeit schrieb ich Thérèse Raquin, was mir fünfhundert Franc im Artiste einbringen sollte. Als ich morgens manchmal vier Stunden für zwei Seiten dieses Romans benötigte, schluderte ich nachmittags in einer Stunde sieben oder acht Seiten der Geheimnisse von Marseille hin. Mein Tag war gerettet – ich konnte abends essen.
Nun, warum nach achtzehn Jahren ein solches Werk aus seinem Nichts zurückholen? Warum es nicht im Schlafe des Vergessens belassen, zu welchem es zwangsläufig bestimmt ist? Hier die Gründe, die mich dazu bewogen, diese erneuerte Ausgabe herauszugeben:
Ich beabsichtige eine der Legenden zu zerstören, die um meine Person entstanden sind. Manche Leute glauben, ich hätte ob meiner ersten Arbeiten zu erröten. Obendrein haben mir Marseiller Buchhändler erzählt, dass manche meiner Kollegen – welche hier zu nennen nutzlos wäre – ihre Geschäfte durchsucht haben, um eines der Exemplare der ersten Ausgabe aufzuspüren, die sehr rar geworden ist. Selbstverständlich hofften die Kollegen, dort eine verdeckte Schwäche, einen literarischen Fehler zu entdecken, dessen Spur ich entfernen wollte. Und wenn man sie, wie man mir gesagt hat, dreißig Franc für ein Exemplar hat zahlen lassen, so bedaure ich sie ob dieses abscheulichen Raubs, da sie sicherlich nichts entsprechend ihren Ausgaben davon gehabt haben. Die Idee, ich hätte eine Leiche zu verstecken, ist so verbreitet, dass ich auch heute noch, von Zeit zu Zeit, von einem Marseiller Antiquar einen Brief erhalte, in welchem er mir für eine horrende Summe ein wiedergefundenes Exemplar anbietet – ein Angebot, auf das ich mich beeile nicht zu antworten.
Die einfachste Art, die Legende zu zerstören, ist daher, den Roman wieder zu veröffentlichen. Ich habe immer in aller Öffentlichkeit geschrieben, habe immer laut ausgesprochen, was ich glaubte, sagen zu müssen, und ich habe weder ein Werk noch eine Anschauung zurückzuziehen. Man denkt, mich sehr zu bekümmern, wenn man von dem enormen Berg der Prosa, die ich zehn Jahre lang von Tag zu Tag hatte schreiben müssen, die schlechten Seiten wieder ausgräbt. Diese ganze journalistische Arbeit hat keinen großen Wert, ich weiß es; aber sie war nötig, um mir meinen Lebensunterhalt zu verdienen, da ich nicht mit einer Vermögensrente in die Literatur hineingeboren wurde. Wenn ich in sehr schwierigen Zeiten jede Arbeit angenommen habe, so ist dies eine, derer ich mich nicht schäme, und ich gestehe sogar, dass ich ein wenig stolz bin. Die Geheimnisse von Marseille gehören für mich zu der üblichen Arbeit, zu welcher ich mich gezwungen sah. Warum sollte ich ihretwegen erröten? Sie haben mir in einem der hoffnungslosesten Momente meiner Existenz das täglich Brot gesichert. Trotz ihrer nicht wieder gutzumachenden Dürftigkeit habe ich ihnen eine Dankbarkeit bewahrt.
Es gibt noch einen Grund, den ich anführen würde, wenn man mich ein wenig dazu drängte. Ich bin der Meinung, dass sich ein Schriftsteller ganz und gar öffentlich geben muss, ohne selbst unter seinen Werken zu wählen, da das schwächste oft das dokumentarischste bezüglich seines Talents ist. Die Auswahl entsteht durch die natürliche Auslese der totgeborenen Bücher. In der Erwartung, dass der Roman der Geheimnisse von Marseille als einer der ersten unter den anderen untergeht, missfällt es mir nicht, wenn er von so dürftiger Qualität ist, da er den Leser erkennen lässt, welche Menge an Willenskraft und Arbeit ich aufbringen musste, um mich von diesem niederen Werk zu der literarischen Anstrengung der Rougon-Macquart zu erheben.
Médan, im Juli 1884
Émile Zola
Zwei Briefe Émile Zolas an den Leiter des Messager de Provence
Paris, 27. Februar 1867,
Mein lieber Direktor,
Sie haben den Geheimnissen von Marseille den Titel "historischer Gegenwartsroman" gegeben, und der Titel passt ausgezeichnet zu ihnen. Nur kommen mir in letzter Minute Bedenken: Ich fürchte, die Leser könnten den Charakter eines solcherart angekündigten Werkes falsch einschätzen, und ich glaube, eine eindeutige und aufrichtige Erklärung abgeben zu müssen, die jegliches Missverständnis zwischen der Öffentlichkeit und mir verhindern wird.
Die Geheimnisse von Marseille sind ein historischer Gegenwartsroman, insofern als ich dem realen Leben all die Ereignisse entnommen habe, die sie enthalten; ich habe hier und da die notwendigen Dokumente ausgewählt, ich habe zwanzig Geschichten verschiedener Quellen und Arten zu einer einzigen Geschichte zusammengesetzt, ich habe einer Figur die Züge mehrerer Individuen verliehen, die zu kennen und zu untersuchen mir erlaubt gewesen ist. So habe ich also ein Werk schreiben können, in dem alles wahr ist, in dem alles in der Natur beobachtet worden ist.
Mir hat indes nie der Sinn danach gestanden, der Geschichte Schritt für Schritt zu folgen. Ich bin vor allem Romanschriftsteller, ich nehme nicht die große Verantwortung des Historikers an, der weder ein Ereignis durcheinanderbringen noch einen Charakter verändern kann, ohne sich dem schrecklichen Vorwurf der Verleumdung auszusetzen.
Ich habe mich nach eigenem Gutdünken der tatsächlichen Ereignisse bedient, die quasi zum Gemeingut geworden sind. Den Lesern steht es frei, zu den Dokumenten zurückzukehren, die ich gebraucht habe. Ich für meinen Teil erkläre im Voraus, dass meine Figuren nicht die Portraits dieser oder jener Personen sind; die Figuren sind Typen und keine Individuen. Dasselbe gilt für die Ereignisse: Ich habe realen Ereignissen Folgen gegeben, die sie in der Wirklichkeit womöglich nicht gehabt haben, sodass dieses mit Hilfe mehrerer wahrer Geschichten geschriebene Werk, welches man lesen wird, ein Werk der Fantasie geworden ist, historisch in seinen Episoden, nach Belieben erfunden in seiner Gesamtheit.
Ich kann die Öffentlichkeit nicht daran hindern, unter den Masken Gesichter zu suchen, ich kann ihr nicht untersagen, teilweise bestimmte Ereignisse wiederzuerkennen, aber ich gebe mein Wort, nicht versucht zu haben, irgendeine Persönlichkeit darzustellen, und ich denke, diese Erklärung wird reichen, meine Schriftstellerwürde gegen bösartige Annahmen zu schützen.
Nun, mein lieber Direktor, das ist, was ich Sie bitte ganz laut zu sagen; oder besser noch: Veröffentlichen Sie diesen Brief in der Ausgabe, die mein erstes Feuilleton beinhalten wird. Der Titel "historischer Gegenwartsroman" wird auf die Art gerechtfertigt und erläutert sein.
Ich verbleibe ergebenst,
Ihr Émile Zola
Paris, 8. April 1867,
Mein lieber Direktor,
mir ist zu Ohren gekommen, dass in Marseille sogenannte Schlüssel kursieren, die sich auf den Roman beziehen, den ich im Messager de Provence veröffentliche. Gewisse findige Geister hätten sich den Kopf zerbrochen und behaupteten, die Gesichter hinter den Masken gefunden zu haben. Meine Figuren, Herr de Cazalis, Philippe Cayol, Abbé Donadéi, wären keine anderen als diese und jene Personen, die man beim Namen nennt. Die Ereignisse selbst wären ebenfalls wiedererkannt worden. Kurz, mein romanartiges Werk würde zu einem Pamphlet werden, wenn man den findigen Geistern glauben darf, von denen ich spreche.
Ich hatte gehofft, all diesen bösartigen Gerüchten zuvorzukommen, indem ich Ihnen den Brief schrieb, welcher meinem ersten Feuilleton beigefügt war. Ich zählte darauf, dass eine einfache Erklärung meinerseits reichen würde und die Leser – angesichts meiner aufrichtigen Erläuterungen – dem Text meiner Arbeit keine Gewalt antun würden, um ihm einen Sinn zu geben, an den ich niemals gedacht habe.
Da man entgegen meinen Wünschen unbedingt skandalöse Absichten in den Geheimnissen von Marseille finden möchte, muss ich von neuem erklären, dass es nicht meine Absicht gewesen ist, irgendein Portrait zu entwerfen, und ich das ausdrücklichste Dementi abgebe gegenüber jenen, die mir den Gedanken unterstellen, ich hätte bestimmte bekannte Gesichter schildern wollen. Ich habe bereits das Verfahren erläutert, das ich angewandt hatte, um den Roman zu schreiben – hier und da Charakterzüge übernehmend, Typen und keine Individuen darstellend, die Realität je nach meinen Launen eines Romanschriftstellers verbiegend.
All die kursierenden Schlüssel sind daher falsch. Ich protestiere aufs Schärfste gegen die Interpretationen, die aus jeder meiner Figuren eine Persönlichkeit machen würden. Ich widerspreche allem, was man hat sagen können, und allem, was man vielleicht noch sagen wird. Ich betone, dass ich einfach nur ein dramatisches und ergreifendes Werk habe schreiben wollen, indem ich die Schanden und die Tugenden einer Großstadt zur Schau stellen wollte, die den Hemmungslosigkeiten der modernen Industrie ausgeliefert ist.
Das sei nun ein für alle Mal gesagt.
Ich bitte noch darum, etwas Persönliches sagen zu dürfen. Trotz all Ihrer Sorgfalt, mein lieber Direktor, haben sich in einigen meiner Feuilletons Druckfehler eingeschlichen, die manchmal den Sinn meiner Sätze verfälscht haben. Ich lege Wert darauf, die Öffentlichkeit darauf hinzuweisen, dass ich mir auf zweihundert Meilen Entfernung die Druckfahnen der Geheimnisse von Marseille nicht noch einmal ansehen kann und dass ich nicht Schuld trage an den Druckfehlern, auf die man in den Feuilletons stoßen kann.
Ich verbleibe ergebenst,
Ihr Émile Zola
ERSTER TEIL
I
Worin gezeigt wird, dass Blanche de Cazalis
mit Philippe Cayol flieht
Gegen Ende Mai des Jahres 184_ ging ein um die dreißig Jahre alter Mann schnell durchs Saint-Joseph-Viertel nahe der Aygalades1. Sein Pferd hatte er dem Pächter eines nahegelegenen Stückchen Lands anvertraut und bewegte sich nun in Richtung eines großen, quadratischen Hauses. Dies, solide gebaut, war eine Art ländliches Schloss, wie man es oft an den Hanglagen der Provence findet.
Der Mann machte einen Umweg, um dem Schloss auszuweichen, und setzte sich ganz am Ende eines Pinienhaines nieder, der sich hinter der Behausung erstreckte. Indem er die Zweige zur Seite schob, blickte er in seiner fiebrigen Unruhe prüfend auf die Wege und schien voller Ungeduld jemanden zu erwarten. Von Zeit zu Zeit stand er auf, machte ein paar Schritte, um sich von neuem zitternd zu setzen.
Der Mann, groß und von seltsamer Erscheinung, trug große schwarze Koteletten. Sein längliches, von energischen Zügen durchdrungenes Gesicht war von einer Art hitziger und lebhafter Schönheit. Plötzlich trat eine Milde in seine Augen und seine kräftigen Lippen nahmen ein liebevolles Lächeln an. Eine junge Frau – ein Mädchen von gerade einmal sechzehn Jahren – kam aus dem Schloss und eilte, wie um sich zu verstecken, gekrümmt zu dem Pinienhain. Keuchend, ganz rosig kam sie an unter den Bäumen. Zwischen den blauen Bändern ihres Strohhuts lächelte ihr junges Gesicht mit einem fröhlichen und zugleich aufgeschreckten Ausdruck. Ihr blondes Haar fiel ihr über die Schultern; ihre kleinen Hände hatte sie gegen die Brust gedrückt, um die Schläge ihres Herzens zu dämpfen.
»Wie Sie mich haben warten lassen, Blanche!«, sagte der junge Mann. »Ich hatte schon die Hoffnung aufgegeben, Sie zu sehen.« Und er ließ sie sich neben ihn auf das Moos setzen.
»Verzeihen Sie mir, Philippe«, antwortete das junge Mädchen. »Mein Onkel ist nach Aix gegangen, um ein Anwesen zu kaufen, aber ich konnte mich nicht von meiner Gouvernante freimachen.« Sie gab sich einer Umarmung des Menschen hin, den sie so sehr liebte, und die beiden Verliebten hatten eine dieser langen Plaudereien – so albern und so süß. Blanche war ein großes Kind, das mit seinem Liebhaber spielte, wie es mit einer Puppe gespielt hätte. Philippe, leidenschaftlich und stumm, drückte und betrachtete das junge Mädchen mit all den Sehnsüchten des Ehrgeizes und der Leidenschaft.
Wie sie dort so saßen, verloren in ihren Gedanken, bemerkten sie, als sie den Kopf hoben, dass sie von den Bauern, die dem Nachbarweg folgten, lachend betrachtet wurden. Blanche erschrak und machte sich los von ihrem Liebhaber. »Ich bin verloren!«, sagte sie ganz blass. »Diese Leute werden meinen Onkel warnen. Ach, Philippe, ich bitte Sie ... Retten Sie mich!«
Bei diesem Schrei erhob sich der junge Mann mit einer schroffen Bewegung. »Wenn Sie möchten, dass ich Sie rette, müssen Sie mir folgen«, antwortete er voller Feuer. »Kommen Sie, flüchten wir gemeinsam. Morgen wird Ihr Onkel in unsere Heirat einwilligen ... Wir werden auf ewig unsere Zärtlichkeiten stillen.«
»Fliehen, fliehen!«, wiederholte das Kind. »Ach, ich habe nicht den Mut dazu, ich bin zu schwach, zu ängstlich ...«
»Ich werde dich stützen, Blanche ... Wir werden ein Leben voller Liebe führen.«
Ohne zu hören und ohne zu antworten, ließ Blanche ihren Kopf auf Philippes Schulter sinken. »Ach, ich habe Angst, ich habe Angst vor dem Kloster«, hob sie leise wieder an. »Wirst du mich heiraten, mich immer lieben?«
»Ich liebe dich ... Schau, ich knie nieder vor dir.«
Die Augen schließend gab sich Blanche hin und stieg mit großen Schritten an Philippes Arm den Hang hinab. Als sie sich entfernte, schaute sie noch ein letztes Mal zu dem Haus, welches sie verließ, und eine stechende Ergriffenheit trieb ihr dicke Tränen in die Augen. Eine Minute der Verwirrung hatte gereicht, sie gebrochen und gutgläubig in die Arme des jungen Mannes zu werfen. Sie liebte Philippe mit all der ersten Inbrunst ihres jungen Blutes, mit all der Torheit ihrer Unerfahrenheit. Sie entfloh wie eine Internatsschülerin, freiwillig und ohne die schlimmen Folgen ihrer Flucht zu bedenken. Philippe nahm sie siegestrunken mit, zitterte, als er sie an seiner Seite keuchend marschieren spürte.
Zunächst wollte er mit ihr nach Marseille gehen, um sich eine Pferdedroschke zu besorgen. Aber er fürchtete, Blanche auf der Hauptstraße allein zurückzulassen und zog es vor, mit ihr zu Fuß zum Haus seiner Mutter auf dem Land zu gehen. Sie waren eine gute Meile entfernt von dem Haus, das sich im Viertel Saint-Just befand. Philippe musste sein Pferd zurücklassen, und die beiden Verliebten marschierten mutig los. Sie überquerten Wiesen, Ackerböden, Pinienwälder, kürzten querfeldein ab, marschierten zügig dahin. Es war etwa vier Uhr. Während eine Sonne von glühendem Blond vor ihnen weite Lichtschwaden warf, gingen sie durch die warme Luft und wurden vorangetrieben von der sie ins Herz beißenden Torheit. Als sie vorübergingen, hoben die Bauern den Kopf und betrachteten mit Erstaunen, wie sie flüchteten.
Sie brauchten keine Stunde, um zum Haus von Philippes Mutter zu gelangen. Blanche war erschöpft und setzte sich auf eine Steinbank nahe der Tür, während der junge Mann gegangen war, ein paar Neugierige wegzuschicken. Dann kam er zurück und ließ sie in sein Zimmer hinaufgehen. Er hatte Ayasse, einen Gärtner, der seine Mutter an diesem Tag unterstützte, gebeten, aus Marseille eine Droschke zu holen. Beide verharrten im Fieber ihrer Flucht und warteten stumm und ängstlich auf die Droschke. Philippe ließ Blanche sich auf einen kleinen Stuhl setzen; vor ihr kniend betrachtete er sie lange und beruhigte sie, indem er ihr sanftmütig die Hand küsste, die sie ihm überließ.
»Du kannst nicht in dem leichten Kleid bleiben«, sagte er ihr endlich. »Würdest du dich wie ein Mann kleiden?« Blanche lachte. Sie verspürte die Freude eines Kindes bei dem Gedanken, sich zu verkleiden.
»Mein Bruder ist klein«, fuhr Philippe fort. »Du wirst seine Kleidung tragen.«
Das wurde ein Fest. Das junge Mädchen entschlüpfte lachend seiner Hose. Es war von einer charmanten Unbeholfenheit und Philippe küsste begierig die Rötung seiner Wangen. Als Blanche umgekleidet war, sah sie wie ein kleiner Mann aus, wie ein Lausbub von zwölf Jahren. Sie hatte alle Mühe der Welt, ihr fülliges Haar unter dem Hut zu halten. Die Hände ihres Liebhabers zitterten beim Zurückdrängen der widerspenstigen Locken.
Endlich kam Ayasse mit der Droschke zurück. Er war einverstanden, die beiden Flüchtenden in seiner Wohnung in Saint-Barnabé aufzunehmen. Philippe nahm all sein Geld, und alle drei stiegen in den Wagen, den sie am Pont du Jarret wieder verließen, um zu Fuß zum Wohnsitz des Gärtners zu gelangen. Die Dämmerung war gekommen. Klare Schatten fielen vom blassen Himmel, während herbe Gerüche von der von den letzten Strahlen noch warmen Erde aufstiegen. Eine entfernte Furcht bemächtigte sich Blanches. Nun, zur hereinbrechenden Nacht, in den Genüssen des Abends, fühlte sie sich allein. In den Armen ihres Liebhabers stiegen in ihr all die erschreckenden Schamgefühle von jungen Mädchen auf, sie erzitterte und war von einem undeutlichen Unbehagen ergriffen. Sie ließ sich gehen, war glücklich und erschrocken, sich nun der Leidenschaft Philippes ausgesetzt zu fühlen. Sie wurde schwach, wollte Zeit gewinnen.
»Hör zu«, sagte sie. »Ich werde an Abbé Chastanier schreiben, meinen Beichtvater ... Er wird zu meinem Onkel gehen, um zu erreichen, dass er mir vergibt und unserer Heirat zustimmt ... Ich glaube, ich würde weniger zittern, wenn ich deine Frau wäre.«
Philippe lächelte über die zärtliche Naivität des letzten Satzes. »Schreib an Abbé Chastanier«, antwortete er. »Und ich werde meinem Bruder unseren Zufluchtsort mitteilen. Er wird morgen kommen und deinen Brief mitnehmen.«
Es wurde Nacht, eine warme und sinnliche Nacht – Blanche wurde Philippes Gattin. Sie hatte sich von selbst hingegeben, hatte keinen Schrei der Auflehnung ausgestoßen, war sündig durch Ahnungslosigkeit, so wie Philippe sündig war durch Ehrgeiz und Leidenschaft. Ach, süße und schreckliche Nacht! Sie musste die Liebenden ins Elend stürzen und ihnen eine Existenz voll Leid und Trauer bringen.
So kam es also, dass Blanche de Cazalis mit Philippe Cayol an einem klaren Maiabend floh.
II
Man macht Bekanntschaft mit dem Helden Marius Cayol
Marius Cayol, der Bruder von Blanches Liebhaber, war etwa fünfundzwanzig Jahre alt. Er war klein und dürr, von schmächtigem Aussehen. Sein von schwarzen Augen durchbohrtes, hellgelbes Gesicht, lang und dünn, klärte sich zeitweise auf zu einem netten Lächeln von Ergebenheit und Resignation. Er lief etwas gekrümmt, mit dem Zögern und der Schüchternheit eines Kindes. Wenn ihn der Hass des Bösen, die Liebe des Gerechten wieder aufrichteten, war er beinahe schön. Während er den beschwerlichen Teil der Aufgaben in der Familie übernommen hatte, ließ er seinen Bruder dessen ehrgeizigen und leidenschaftlichen Instinkten folgen. Er machte sich ganz klein an dessen Seite, er sagte normalerweise, er sei hässlich und müsse in seiner Hässlichkeit verbleiben; er fügte hinzu, man müsse Philippe dessen Zurschaustellen seiner großen Gestalt und der kräftigen Schönheit seines Gesichts nachsehen. Ansonsten konnte er sich bei Gelegenheit sehr ernst zeigen, wenn es um dieses große aufbrausende Kind ging, welches sein älterer Bruder war und das er mit Ermahnungen und Nachsichten eines Vaters behandelte.
Ihre Mutter war Witwe. Sie hatte kein Vermögen und lebte mit Müh und Not von den Überresten ihrer Mitgift, die ihr Mann mit Handelsgeschäften aufs Spiel gesetzt hatte. Dieses bei einem Bankier angelegte Geld gab ihr eine kleine Rente, die ihr reichte, die beiden Söhne großzuziehen. Als die Kinder groß geworden waren, zeigte sie ihnen ihre leeren Hände, konfrontierte sie mit den Schwierigkeiten des Lebens. In die Kämpfe des Daseins geworfen, nahmen die beiden Brüder aufgrund ihres unterschiedlichen Temperaments zwei gegensätzliche Wege.
Philippe, dem der Sinn nach Geld und Freiheit stand, konnte sich nicht der Arbeit unterwerfen. Er wollte auf einen Schlag zu Vermögen kommen und träumte davon, reich zu heiraten. Das war in seinen Augen ein exzellenter Ausweg, ein schnelles Mittel, um an Jahreszinsen und eine schöne Frau zu kommen. Alsbald lebte er in der Sonne, verliebte sich und wurde sogar ein bisschen Lebemann. Er empfand ein grenzenloses Vergnügen dabei, gut gekleidet zu sein und mit seiner eleganten Schroffheit, mit seiner Bekleidung originellen Schnitts, seinen Blicken und Liebesworten durch die Straßen Marseilles zu spazieren. Seine Mutter und sein Bruder, die ihn verwöhnten, versuchten ihm seine Launen zu ermöglichen. Überdies war Philippe gutgläubig: Er war vernarrt in Frauen, es erschien ihm nur natürlich, eines Tages von einem jungen Mädchen – adlig, reich und schön – geliebt und entführt zu werden.
Während sein Bruder seine Schönheit zur Schau stellte, war Marius in Funktion eines Gehilfen bei Herrn Martelly eingetreten, einem Reeder aus der Rue de la Darse. Im Dunkel seines Arbeitszimmers fühlte er sich wohl, sein ganzer Ehrgeiz bestand darin, einen bescheidenen Wohlstand zu erwerben und unauffällig und in Frieden zu leben. Darüber hinaus empfand er heimliche Wonnen, wenn er seiner Mutter oder seinem Bruder half. Das Geld, das er verdiente, war ihm lieb und teuer, weil er es geben und damit Freude spenden konnte, wodurch er selbst das tiefe Glück der Aufopferung genoss. Er hatte im Leben den rechten Weg gewählt, den beschwerlichen Weg, den Weg, der zur Eintracht, zur Freude, zur Würde emporsteigt.
Der junge Mann verließ gerade sein Büro, als man ihm den Brief übergab, in dem ihm sein Bruder dessen Flucht mit Fräulein de Cazalis mitteilte. Er war von einem schmerzhaften Erstaunen ergriffen, ermaß mit einem Blick den Abgrund, in dessen Tiefe sich die beiden Liebenden soeben geworfen hatten. In aller Eile begab er sich nach Saint-Barnabé.
Das Haus des Gärtners Ayasse hatte vor dem Tor ein Spalier, das ein kleines Gewölbe bildete; zwei zu einem Sonnenschirm zugeschnittene Brombeersträucher streckten ihre knorrigen Zweige aus und warfen ihre Schatten auf die Schwelle. Marius fand Philippe unter dem Spalier, wo dieser Blanche de Cazalis, die neben ihm saß, liebevoll betrachtete. Das junge Mädchen, bereits ermüdet, war in die dumpfe Reue über das, was es gemacht hatte, versunken.
Die Unterredung war voll von Angst und Scham. Philippe hatte sich erhoben. »Du verurteilst mich?«, fragte er und streckte seinem Bruder die Hand entgegen.
»Ja, ich verurteile dich«, antwortete Marius energisch. »Du hast eine böse Tat begangen. Der Hochmut hat dir den Kopf verdreht und die Leidenschaft hat dich ins Unheil gestürzt. Du hast nicht bedacht, welches Unglück du damit über dich und die Deinen bringen wirst.«
Philippe machte eine Regung des Aufbegehrens. »Du hast Angst«, sagte er bitter. »Ich habe es nicht geplant. Ich liebe Blanche und Blanche liebt mich. Ich habe ihr gesagt: ›Möchtest du mit mir kommen?‹, und sie ist mitgekommen. Das ist die ganze Geschichte. Wir sind keine Schuldigen, weder sie noch ich.«
»Warum lügst du?«, fuhr Marius mit größerer Strenge dazwischen. »Du bist kein Kind. Du weißt genau, dass es deine Pflicht war, das junge Mädchen gegen sich selbst zu verteidigen; du hättest es vor diesem Fehler bewahren müssen, es hindern müssen, dir zu folgen. Ach, erzähl mir nichts von Leidenschaft. Ich kenne nur die Leidenschaft der Gerechtigkeit und der Pflicht.«
Philippe lachte herablassend und zog Blanche an seine Brust. »Mein armer Marius«, sagte er. »Du bist ein lieber Junge, aber du hast nie geliebt, du kennst das Feuer der Liebe nicht ... So, das ist meine Verteidigung.« Und er ließ sich von Blanche umarmen, die sich zitternd an ihn klammerte. Das arme Kind war sich sehr wohl im Klaren, dass seine ganze Hoffnung nur noch auf diesem Mann ruhte. Es hatte sich hingegeben und gehörte ihm – hing nunmehr fast wie eine Sklavin an ihm, verliebt und ängstlich.
Marius war hoffnungslos und verstand, dass er mit weisen Reden bei den beiden Verliebten nichts erreichen würde. Er nahm sich vor, selbst zu handeln, wollte alle Ereignisse des traurigen Abenteuers erfahren. Folgsam antwortete Philippe auf seine Fragen.
»Ich kenne Blanche seit fast acht Monaten«, sagte er. »Ich habe sie das erste Mal auf einem Volksfest gesehen. Sie lächelte zur Menge, und mir schien, ihr Lächeln gelte mir. Seit diesem Tag habe ich sie geliebt, ich habe nach Gelegenheiten gesucht, mich ihr zu nähern, mit ihr zu sprechen.«
»Hast du ihr nicht geschrieben?«, fragte Marius.
»Und ob, mehrere Male.«
»Wo sind die Briefe?«
»Sie hat sie verbrannt ... Jedes Mal kaufte ich ihr bei Fine, dem Blumenmädchen auf dem Cours Saint-Louis, einen Blumenstrauß und schob meinen Brief zwischen die Blumen. Marguerite, die Milchfrau, brachte die Sträuße zu Blanche.«
»Und deine Briefe blieben ohne Antwort?«
»Am Anfang hat Blanche die Blumen abgelehnt. Dann hat sie sie angenommen; und schließlich antwortete sie mir. Ich war verrückt vor Liebe. Ich träumte, sie zu heiraten, sie für immer zu lieben.«
Marius zuckte mit den Schultern. Er zog Philippe ein paar Schritte zur Seite und führte die Unterredung mit größerer Härte in der Stimme fort. »Entweder du bist ein Blödian oder ein Lügner«, sagte er ruhig. »Du weißt doch, dass Herr de Cazalis Abgeordneter und Millionär ist, er ist allmächtig in Marseille, er hätte seine Nichte nie Philippe Cayol gegeben, der arm, titellos und Republikaner ist, was die Gewöhnlichkeit noch vollendet. Gib zu, dass du auf den Skandal um eure Flucht gebaut hast, um Blanches Hand von ihrem Onkel zu erzwingen.«
»Und wenn dem so wäre!«, antwortete Philippe ungestüm. »Blanche liebt mich, ich habe ihren Willen nicht vergewaltigt. Sie hat sich frei für mich als ihren Mann entschieden.«
»Ja, ja, ich weiß schon. Du wiederholst es so oft, dass ich nicht mehr weiß, was ich glauben soll. Aber du hast nicht an Herrn de Cazalis' Wut gedacht, die schrecklich auf dich und deine Familie zurückfallen wird. Ich kenne den Mann; heute Abend wird er seinen beleidigten Stolz in ganz Marseille herumgeführt haben. Am besten bringst du das junge Mädchen zurück nach Saint-Joseph.«
»Nein, das will ich nicht, ich kann das nicht ... Blanche würde sich nie nach Hause zurückwagen ... Sie war kaum eine Woche auf dem Land; ich sah sie bis zu zweimal am Tag in einem kleinen Pinienhain. Ihr Onkel wusste nichts, und der Schlag muss hart für ihn gewesen sein ... Wir können uns dort jetzt nicht blicken lassen.«
»Nun gut, hör zu, gib mir den Brief für Abbé Chastanier. Ich werde den Priester treffen, und wenn es sein muss, werde ich mit ihm zu Herrn de Cazalis gehen. Wir müssen den Eklat verhindern. Ich habe eine Aufgabe zu erfüllen, die Aufgabe, deinen Fehler wieder gutzumachen ... Schwöre mir, dass du das Haus nicht verlassen und hier meine Anordnungen abwarten wirst!«
»Ich verspreche dir zu warten, wenn mir keine Gefahr droht.«
Marius nahm Philippes Hand und schaute ihm treu ins Gesicht. Auf Blanche zeigend sagte er mit tiefer Stimme: »Hab dieses Kind gern! Du wirst niemals die Beleidigung wiedergutmachen, die du ihm bereitet hast.«
Er war im Begriff, sich zu entfernen, als Fräulein de Cazalis an ihn herantrat. Sie faltete flehend die Hände und versuchte ihre Tränen zu unterdrücken. »Mein Herr«, stammelte sie. »Wenn Sie meinen Onkel sehen, sagen Sie ihm, dass ich ihn liebe ... Ich kann mir nicht erklären, was geschehen ist ... Ich will Philippes Frau bleiben und mit ihm nach Hause zurückkehren.«
Marius verneigte sich leicht. »Hoffen Sie!«, sagte er.
Und er ging dahin, bewegt und betrübt; wusste er doch, dass er log, dass die Hoffnung dumm war.
III
Die Kirche hält sich Knechte
Als Marius in Marseille ankam, begab er sich zur Kirche Saint-Victor2, der Abbé Chastanier zugeteilt war. Saint-Victor ist eine der ältesten Kirchen Marseilles; ihr schwarzes, gewaltiges, mit Zinnen versehenes Gemäuer lässt sie wie eine Festung erscheinen. Das derbe Hafenvolk hegt für sie eine ganz besondere Verehrung.
Der junge Mann fand Abbé Chastanier in der Sakristei. Der Priester war ein großer Greis mit wachsblassem, langen und ausgemergelten Gesicht; seine traurigen Augen waren gezeichnet von der Starre des Leids und der Not. Er kam von einer Beerdigung zurück und zog geruhsam sein Chorhemd aus.
Seine Geschichte war kurz und voller Schmerzen. Als Sohn eines Bauern war er mit seiner kindlichen Sanftmut und Naivität, den frommen Wünschen seiner Mutter folgend, Priester geworden. Indem er für sie Priester wurde, hatte er einen Akt der Humanität, der völligen Ergebenheit begehen wollen. Von einfachem Geist, glaubte er, ein Gesandter Gottes habe sich in die Unendlichkeit der göttlichen Liebe zurückzuziehen, sich dem Ehrgeiz und den Intrigen der Welt zu entziehen und in der Tiefe des Altarraums zu leben, mit der einen Hand Sünden vergebend und mit der anderen Almosen spendend. Ach, der arme Abbé! Und wie man ihm zeigte, dass die einfach Gestrickten nur dazu gut sind zu leiden und in der Finsternis zu verharren! Er lernte schnell, dass der Ehrgeiz eine priesterliche Tugend ist, und dass die jungen Priester Gott oft nur für die gesellschaftlichen Begünstigungen liebten, die seine Kirche verteilte. Er sah, wie sich all seine Seminarkameraden schier beißend und kratzend bekämpften. Er erlebte die intimen Kämpfe mit, die geheimen Intrigen, die aus einer Diözese ein wildes kleines Königreich machen. Und wie er demütig auf Knien blieb, wie er nicht danach trachtete, den Damen zu gefallen, wie er nichts erbat und den Anschein einer stumpfsinnigen Frömmigkeit erweckte, warf man ihm eine elende Pfarrei zu, so wie man einem Hund einen Knochen zuwirft.
So blieb er mehr als vierzig Jahre in einem kleinem Dorf, gelegen zwischen Aubagne und Cassis. Seine Kirche war eine Art gekalkter Scheune von frostiger Kahlheit. Wenn im Winter der Wind eine Fensterscheibe zerbrach, hatte es der liebe Gott für mehrere Wochen kalt, da der arme Pfarrer nicht immer die paar nötigen Sous3 besaß, um die Scheibe reparieren zu lassen. Außerdem beklagte er sich nie, er lebte in Frieden im Elend und der Einsamkeit. Er empfand sogar tiefe Freude, es zu ertragen, sich als Bruder der Bettler seiner Gemeinde zu fühlen.
Er war sechzig Jahre alt, als eine seiner Schwestern, die in Marseille Arbeiterin war, invalid wurde. Sie schrieb ihm und flehte ihn an, er möge in ihre Nähe kommen. Der alte Priester opferte sich auf und erbat von seinem Bischof einen kleinen Winkel in einer Kirche in der Stadt. Mehrere Monate ließ man ihn auf diesen kleinen Winkel warten und berief ihn schließlich doch nach Saint-Victor. Dort musste er gewissermaßen all die beschwerlicheren Arbeiten, all die weniger glanzvollen und weniger profitablen Tätigkeiten verrichten. Er betete über den Särgen der Armen und führte sie zum Friedhof; bei Gelegenheit ersetzte er sogar den Küster. Zu der Zeit begann er tatsächlich zu leiden. Solange er in seiner Einöde geblieben war, hatte er schlicht sein können; arm und alt fühlte er sich wohl. Nun spürte er, dass man ein Verbrechen machte aus seiner Armut und seinem Alter, seiner Sanftmut und seiner Einfältigkeit. Es zerriss ihm das Herz, als ihm klar wurde, dass es in der Kirche Knechte geben konnte. Er sah sehr wohl, dass man ihn mit Spott und Mitleid betrachtete. Er senkte sein Haupt noch mehr, wurde noch demütiger, war tief traurig zu spüren, wie sein Glaube durch die Handlungen und Worte der verweltlichten Priester, die ihn umgaben, ins Wanken geriet.
Zum Glück hatte er abends, wenn er seine Schwester pflegte, schöne Stunden. Er tröstete sich auf seine Weise durch diese Aufopferung. Er umgab die arme Invalide mit tausenderlei kleinen Befriedigungen. Dann hatte er eine andere Freude erhalten: Herr de Cazalis, der den jungen Abbés misstraute, hatte ihn als Beichtvater seiner Nichte erwählt. Der alte Priester hielt normalerweise kein Beichtkind und nahm fast nie die Beichte ab. Er war von dem Vorschlag des Abgeordneten zu Tränen gerührt, er stellte Fragen und gewann Blanche lieb wie sein eigenes Kind.
Marius übergab ihm den Brief des jungen Mädchens und achtete genau darauf, ob sich in seinem Gesicht die Emotionen widerspiegeln würden, die der Brief in ihm auslösen musste. Er erkannte, wie sich darin ein schmerzhaftes Leid abzeichnete. Im Übrigen schien er nicht sonderlich verblüfft, wie man es für gewöhnlich beim Vernehmen einer unerwarteten Nachricht zu sein pflegt. Marius nahm an, Blanche habe bei der Beichte die Beziehung bereits gestanden, die sich zwischen ihr und Philippe entwickelte.
»Sie taten gut daran, auf mich zu zählen, mein Herr«, sagte Abbé Chastanier zu Marius. »Aber ich bin sehr schwach und ungeschickt ... Ich hätte mehr Kraft zeigen müssen.« Der Kopf und die Hände des armen Mannes hatten das milde und traurige Zittern der Greise.
»Ich stehe zu Ihrer Verfügung«, fuhr er fort. »Wie kann ich dem unglücklichen Kind zu Hilfe kommen?«
»Mein Herr«, antwortete Marius. »Ich bin der Bruder des jungen Narren, der mit Fräulein de Cazalis geflohen ist, und ich habe geschworen, diesen Fehler wieder in Ordnung zu bringen, einen Skandal zu verhindern. Ich bitte Sie, sich mir anzuschließen ... Die Ehre des jungen Mädchens ist verloren, wenn sein Onkel die Angelegenheit bereits der Justiz übergeben haben sollte. Suchen Sie ihn auf, versuchen Sie seine Wut zu dämpfen, sagen Sie ihm, dass ihm seine Nichte zurückgegeben wird.«
»Warum haben Sie das Kind nicht mitgebracht? Ich kenne Herrn de Cazalis’ Unbändigkeit. Er wird Gewissheit wollen.«
»Es ist genau diese Unbändigkeit, die meinen Bruder erschrocken hat ... Aber wir können jetzt nicht weiter debattieren. Wir stehen vor vollendeten Tatsachen, die uns quälen. Glauben Sie mir ... Ich bin empört, genau wie Sie, mir ist die schlechte Tat meines Bruders völlig bewusst ... Nur, bei Gott, beeilen wir uns.«
»Gut«, sagte der Abbé einfach. »Ich werde gehen, wohin Sie wollen.«
Sie folgten dem Boulevard de la Corderie und gelangten zum Cours Bonaparte, wo sich das Stadthaus des Abgeordneten befand. Am Tag nach der Entführung war Herr de Cazalis schon morgens nach Marseille zurückgekehrt, einer schrecklichen Wut und Hoffnungslosigkeit ausgeliefert.
Abbé Chastanier hielt Marius an der Haustür zurück: »Gehen Sie nicht hinein«, sagte er ihm. »Ihr Besuch könnte wie eine Beleidigung aussehen. Lassen Sie mich machen, und warten Sie auf mich.«
Fiebrig ging Marius eine gute Stunde auf dem Bürgersteig auf und ab. Er wäre am liebsten hineingegangen, um selbst den ganzen Sachverhalt zu erklären und in Philippes Namen um Vergebung zu bitten. Während das Unglück seiner Familie in dem Haus erörtert wurde, musste er dort bleiben, müßig und voller Erwartungsängste.
Endlich kam Abbé Chastanier herunter. Er hatte geweint; seine Augen waren gerötet und seine Lippen zitterten. »Herr de Cazalis möchte nichts hören«, sagte er mit irritierter Stimme. »Ich habe ihn in einer blinden Gereiztheit angetroffen. Er ist bereits zum königlichen Staatsanwalt gegangen.«
Was der arme Pfarrer nicht sagte, war, dass ihn Herr de Cazalis mit den schwersten Vorwürfen empfangen hatte; er ließ seine ganze Wut an ihm aus, beschuldigte ihn in seinem Zorn, seiner Nichte schlechte Ratschläge erteilt zu haben. Der Abbé hatte den Rücken gekrümmt; er war fast auf die Knie gefallen, verteidigte sich überhaupt nicht, bat nur für andere um Erbarmen.
»Sagen Sie mir alles!«, rief Marius verzweifelt.
»Es scheint, dass der Bauer, bei dem Ihr Bruder sein Pferd gelassen hatte, Herrn de Cazalis bei seiner Suche unterstützt hat«, antwortete der Priester. »Schon heute Morgen ist Klage eingereicht und sind Hausdurchsuchungen durchgeführt worden – in Ihrer Wohnung in der Rue Sainte und im Haus Ihrer Mutter im Viertel Saint-Just.«
»Mein Gott, um Himmels Willen!«, seufzte Marius.
»Herr de Cazalis schwört, er werde Ihre Familie vernichten. Ich habe vergeblich versucht, ihn milder zu stimmen. Er spricht davon, Ihre Mutter verhaften zu lassen ...«
»Meine Mutter! ... Warum das?«
»Er behauptet, sie wäre eine Komplizin, sie hätte Ihrem Bruder geholfen, Fräulein Blanche zu entführen.«
»Aber was tun, wie die Unrichtigkeit von all dem beweisen? ... Ach, ungeschickter Philippe! Unsere Mutter wird daran sterben.« Marius begann, mit in den Händen vergrabenem Gesicht zu schluchzen. Abbé Chastanier betrachtete diese Verzweiflung mit gerührtem Mitgefühl. Er spürte die Güte und Aufrichtigkeit des armen Jungen, der auf offener Straße weinte.
»Nur Mut, mein Kind«, sagte er.
»Sie haben Recht, mein Vater«, rief Marius. »Ich muss mutig sein. Heute Morgen bin ich feige gewesen. Ich hätte das junge Mädchen aus Philippes Armen reißen und es ihrem Onkel zurückbringen müssen. Eine Stimme gab mir ein, diesen Akt der Gerechtigkeit auszuführen, und nun werde ich dafür bestraft, nicht auf die Stimme gehört zu haben ... Sie haben von Liebe, Leidenschaft, Hochzeit gesprochen, und ich habe mich erweichen lassen.«
Sie bewahrten einen Moment des Schweigens.
»Hören Sie«, sagte Marius plötzlich. »Kommen Sie mit mir. Wir beide werden die Kraft haben, sie zu trennen.«
»Ich bin dabei«, antwortete Abbé Chastanier.
Und ohne auch nur daran zu denken, einen Wagen zu nehmen, folgten sie der Rue de Breteuil, dem Quai du Canal, dem Quai Napoléon, und gingen wieder die Canebière4 hinauf. Sie gingen schnellen Schrittes, ohne zu sprechen. Als sie am Cours Saint-Louis ankamen, ließ sie eine frische Stimme den Kopf wenden. Es war das Blumenmädchen Fine, das Marius rief.
Joséphine Cougourdan, die man einfach bei der zärtlichen Kurzform Fine rief, war eines dieser dunkelhaarigen Kinder Marseilles, klein und pummelig, deren feine Gesichtszüge die ganze zarte Reinheit des griechischen Typs bewahrt haben. Ihr runder Kopf heftete sich auf die ein wenig herabhängenden Schultern; ihr blasses Gesicht, zwischen den Bändern ihrer schwarzen Haare, drückte eine Art verächtlichen Spotts aus; in ihren großen dunklen Augen las man eine leidenschaftliche Kraft, die durch ein Lächeln für Augenblicke erweicht wurde. Sie mochte vielleicht zweiundzwanzig bis vierundzwanzig Jahre alt sein.
Mit fünfzehn Jahren wurde sie Waise und hatte die Verantwortung für ihren gut zehn Jahre alten Bruder übernommen. Wacker hatte sie das Handwerk ihrer Mutter fortgeführt, und drei Tage nach der Beerdigung – noch völlig in Tränen – hatte sie in einem Kiosk gesessen, um unter dem Ausstoßen schwerer Seufzer Sträuße zu fertigen und zu verkaufen. Bald wurde das kleine Blumenmädchen das Hätschelkind von Marseille. Es besaß die Beliebtheit der Jugend und der Schönheit. Fines Blumen, so sagte man, hätten einen süßeren Duft als die der anderen. Die Liebhaber kamen einer nach dem anderen; sie verkaufte ihnen ihre Rosen, ihre Veilchen, ihre Nelken und nichts mehr. So konnte sie ihren jüngeren Bruder aufziehen und mit achtzehn Jahren bei einem Lastträgermeister einführen. Die beiden jungen Leute wohnten an der Place aux Œufs, mitten im Arbeiterviertel. Cadet war jetzt ein großes Mannsbild, das am Hafen arbeitete; die schöner gewordene Fine war nun eine Frau und hatte das lebhafte Aussehen und die ungezwungen schmeichlerische Art der Marseillerinnen.
Sie kannte die Cayols, da sie ihnen Blumen verkauft hatte, und sie sprach mit ihnen in der liebevollen Vertraulichkeit, die der warme Eindruck und das süße Idiom der Provence vermitteln. Und wenn man alles offenbaren soll: Philippe hatte in der letzten Zeit oft bei ihr Rosen gekauft, sodass sie schließlich ein leichtes Zittern in seiner Gegenwart verspürte. Der junge Mann, ein instinktiver Liebhaber, lachte mit ihr, sah sie an, bis sie errötete, machte sie im Vorbeigehen ein wenig an, und all das, um nicht die Gewohnheit des Liebens zu verlieren. Und die arme Kleine, die bis dahin die Liebhaber sehr schlecht behandelt hatte, war auf das Spiel hereingefallen. Nachts träumte sie von Philippe und fragte sich voller Angst, wohin wohl all die Blumen gehen mochten, die sie ihm verkaufte.
Als Marius näherkam, fand er sie errötet und irritiert. Sie verschwand halb hinter ihren Sträußen. Sie war von einer reizenden Frische unter den breiten Bändern ihres kleinen Spitzenhäubchens. »Herr Marius«, sagte sie mit zögerlicher Stimme. »Ist wahr, was man seit heute Morgen um mich herum so erzählt? ... Ihr Bruder ist mit einer jungen Dame geflohen?«
»Wer sagt das?«, fragte Marius lebhaft.
»Aber alle ... Dieses Gerücht geht um.«
Und als der junge Mann genauso irritiert schien wie sie und ohne zu sprechen stehen blieb, fuhr Fine mit einer leichten Bitterkeit fort: »Man hatte mir schon gesagt, dass Herr Philippe ein Schürzenjäger sei. Er hatte zu süße Worte, um nicht zu lügen.« Sie war dem Weinen nahe, doch sie unterdrückte ihre Tränen. Mit einer schmerzerfüllten Resignation und einem milderen Ton fügte sie hinzu: »Ich sehe sehr wohl, dass Sie Kummer haben. Wenn Sie mich brauchen, kommen Sie zu mir.«
Marius schaute ihr ins Gesicht und glaubte die Angst ihres Herzens zu erkennen. »Sie sind ein anständiges Mädchen!«, sagte er. »Ich danke Ihnen, vielleicht werde ich Ihre Dienste in Anspruch nehmen.«
Er schüttelte ihr wie einem Kameraden kraftvoll die Hände und eilte zu Abbé Chastanier zurück, der am Rand des Bürgersteigs auf ihn wartete. »Wir haben keine Zeit zu verlieren«, sagte er. »Die Sache macht schon in ganz Marseille die Runde ... Nehmen wir eine Droschke.«
Die Nacht war hereingebrochen, als sie in Saint-Barnabé ankamen. Sie fanden nur die Frau des Gärtners Ayasse, die in einem kleinen Raum strickte. Sie teilte ihnen in aller Ruhe mit, dass der Herr und das Fräulein Angst gehabt hätten und zu Fuß in Richtung Aix abgereist seien. Sie fügte hinzu, dass sie ihren Sohn mitgenommen hätten, damit er ihnen als Führer in den Hügeln diene.
So war also die letzte Hoffnung dahin. Marius kehrte niedergeschlagen nach Marseille zurück, ohne die aufmunternden Worte Abbé Chastaniers zu hören. Er dachte nach über die unabwendbaren Folgen von Philippes Torheit; er lehnte sich auf gegen das Unglück, das dabei war, seine Familie zu befallen.
»Mein Kind«, sagte ihm der Priester, als er ihn verließ. »Ich bin nur ein armer Mann. Verfügen Sie über mich. Ich werde zu Gott beten.«
IV
Wie Herr de Cazalis die Entehrung seiner Nichte rächt
Die Verliebten waren an einem Mittwoch geflohen. Am darauffolgenden Freitag wusste ganz Marseille von dem Abenteuer; die Klatschbasen vor den Türen schmückten den Bericht mit dramatischen Kommentaren aus; der Adel war empört, die Spießbürger machten sich darüber lustig. In seinem Zorn hatte Herr de Cazalis nichts unversucht gelassen, den Wirbel zu vergrößern und aus der Flucht seiner Nichte einen entsetzlichen Skandal zu machen. Die scharfsichtigen Leute durchschauten mühelos, woher all die Wut kam. Als Abgeordneter der Opposition war Herr de Cazalis in Marseille nominiert worden von einer aus einigen Liberalen, Priestern und Adligen zusammengesetzten Mehrheit. Einen der ältesten Namen der Provence tragend, widmete er sich der legitimistischen Sache5, verneigte sich demütig vor der Allmacht der Kirche und hatte tiefe Abscheu empfunden, den Liberalen zu schmeicheln und ihre Stimmen anzunehmen. Diese Leute waren für ihn Bauernlümmel, Knechte, die man auf öffentlichem Platz hätte auspeitschen müssen. Sein unbezähmbarer Hochmut litt bei dem Gedanken, sich zu ihnen herabzulassen.
Es war dennoch nötig gewesen sich zu beugen. Die Liberalen hatten sich ihre Dienste gut honorieren lassen. Als man einmal eine Geringschätzung ihrer Hilfe mimte, sprachen sie davon, die Wahl zu vereiteln und einen der Ihren zu nominieren. So sah sich Herr de Cazalis gezwungen, all seinen Hass in der Tiefe seines Herzens einzuschließen, er nahm sich fest vor, eines Tages Rache zu nehmen. Alsdann fanden unbeschreibliche Ränke statt; der Klerus startete einen Wahlkampf, die Stimmen hatte man sich, dank tausender Ehrerbietungen und Versprechungen, von rechts und von links geholt. Herr de Cazalis wurde gewählt.
Und nun fiel ihm Philippe Cayol in die Hände, einer der Führer der Liberalen Partei! Jetzt stand er endlich kurz davor, seinen Hass auf einen dieser Bauernlümmel stillen zu können, die mit ihm um seine Wahl gefeilscht hatten. Er sollte für alle bezahlen; seine Familie würde ruiniert und in die Verzweiflung gestoßen sein, ihn würde man in ein Gefängnis werfen und von der Höhe seines Liebestraums hinab stürzen auf das Stroh eines Kerkers. Was? Ein kleiner Bürger hatte es gewagt, sich von der Nichte eines Cazalis’ lieben zu lassen. Er hatte sie mit sich genommen; und nun waren sie beide unterwegs, machten blau, liebten sich. Das war ein Skandal, den man ausschlachten musste. Ein gewöhnlicher, unbedeutender Mann hätte es womöglich vorgezogen, die Angelegenheit zu vertuschen, das bedauerliche Abenteuer so still wie möglich verborgen; aber ein Cazalis – ein Abgeordneter, ein Millionär – hatte genügend Einfluss und Stolz, um ganz laut und ohne zu erröten die Schande der Seinen herauszuschreien.
Was bedeutete schon die Ehre eines jungen Mädchens! Die ganze Welt konnte wissen, dass Blanche de Cazalis die Geliebte von Philippe Cayol gewesen war, aber wenigstens würde niemand sagen können, dass sie seine Frau wäre, dass sie nicht standesgemäß geheiratet hätte, indem sie einen armen Teufel ohne Titel zum Mann nahm. Der Stolz wollte, dass das Kind entehrt bleiben und seine Entehrung auf den Mauern Marseilles plakatiert werden sollte. Herr de Cazalis ließ an den Straßenecken der Stadt Aushänge kleben, auf denen er demjenigen eine Belohnung von zehntausend Franc versprach, der ihm seine Nichte und den Verführer an Händen und Füßen gefesselt bringen würde. Wenn man einen Rassehund verliert, sucht man ihn auch mittels Anschlagzetteln. In den höheren Klassen verbreitete sich der Skandal mit noch größerer Heftigkeit. Herr de Cazalis führte seine Wut überall spazieren. Er nutzte all den Einfluss seiner Freunde – Priester und Adlige. Als Vormund Blanches, die Waise war und deren Vermögen er verwaltete, trieb er die Nachforschungen der Justiz voran und bereitete den Kriminalprozess vor. Es schien, er habe es sich zur Aufgabe gemacht, für die kostenlose Vorstellung, die bald beginnen sollte, die breitest mögliche Werbung zu machen.
Eine der ersten von ihm ergriffenen Maßnahmen war es, Philippe Cayols Mutter festnehmen zu lassen. Als sich der königliche Staatsanwalt bei ihr zeigte, antwortete die arme Frau auf alle Fragen, dass sie nicht wisse, was aus ihrem Sohn geworden sei. Ihre Aufregung, ihre Ängste, ihre Befürchtungen als Mutter, die sie stammeln ließen, wurden wahrscheinlich als Beweise der Mittäterschaft angesehen. Man sperrte sie ein und sah in ihr ein Faustpfand. Man hoffte vielleicht, dass ihr Sohn käme, sich zu ergeben, um sie zu befreien. Die Nachricht über die Festnahme seiner Mutter ließ Marius schier durchdrehen. Er wusste um ihre angeschlagene Gesundheit, mit Schrecken stellte er sie sich auf dem Boden einer kahlen, eisigen Zelle vor; sie würde dort sterben, dort von all den Ängsten des Schreckens und der Verzweiflung gequält sein.
Marius wurde selbst für einen Moment behelligt. Aber seine festen Antworten und die Bürgschaft seines Chefs, des Reeders Martelly, die der für ihn gab, bewahrten ihn vor der Inhaftierung. Er wollte frei bleiben, um für die Rettung seiner Familie zu arbeiten. Schritt für Schritt sah sein aufrechter Geist die Tatsachen deutlich. Im ersten Moment war er von der Schuld Philippes übermannt worden, er hatte nur den nicht wiedergutzumachenden Fehler seines Bruders erkannt. Und er hatte sich erniedrigt, dachte einzig und allein daran, Blanches Onkel zu beruhigen, ihm alle nur erdenklichen Genugtuungen zu verschaffen. Aber angesichts der Strenge Herrn de Cazalis’ und des Skandals, den dieser aufwirbelte, hatte sich der junge Mann empört. Er hatte die Geflohenen gesehen, wusste, dass Blanche Philippe freiwillig folgte; und er war entrüstet, als er hörte, dass man Letzteren der Entführung bezichtigte. Die Schimpfwörter schwirrten wild um ihn herum: Sein Bruder wurde Schurke genannt, seine Mutter kam kaum besser weg. Aus Wahrheitsdrang begann er nun die Liebenden zu verteidigen und gegen die Justiz selbst für die Schuldigen Partei zu ergreifen. Dann widerten ihn Herrn de Cazalis’ lärmende Klagen an. Er sagte, das wahre Leid sei stumm. Daher ließe sich eine Angelegenheit, in der die Ehre eines jungen Mädchens auf dem Spiel stehe, nicht mitten auf öffentlichem Platz ins Reine bringen. Er sagte das nicht etwa, weil er sich gewünscht hätte, dass sein Bruder der Strafe entkäme, sondern weil sein Feingefühl verletzt war aufgrund all der zur Schande eines Kindes erzeugten Wirbel. Übrigens wusste er, was es mit der Wut Herrn de Cazalis’ auf sich hatte: Wenn er Philippe traf, traf er den Republikaner, mehr noch als den Verführer selbst.
Marius fühlte sich nun selbst von Zorn ergriffen. Man beleidigte seine Familie, sperrte seine Mutter ein, machte Jagd auf seinen Bruder wie auf ein wildes Tier, schleifte seine teuren Zuneigungen durch den Dreck, klagte sie böswillig und leidenschaftlich an. Nun richtete er sich wieder auf. Der Schuldige war nicht länger nur der ehrgeizige Liebhaber, der mit einem jungen, reichen Mädchen floh, der Schuldige war auch jener, der Marseille aufhetzte und all seine Macht nutzen würde, um seinen Hochmut zu befriedigen. Da es die Justiz übernahm, den Ersten zu bestrafen, schwor Marius, dass er früher oder später den Zweiten bestrafen würde; und das erwartend würde er seine Pläne behindern und versuchen, seinen Einfluss als reichen und geadelten Mann ins Wanken zu bringen.
Von dem Moment an legte er eine fieberhafte Energie an den Tag, er widmete sich ganz der Rettung seines Bruders und seiner Mutter. Leider konnte er nicht in Erfahrung bringen, wie es Philippe erging. Zwei Tage nach der Flucht hatte er von dem Flüchtigen einen Brief erhalten, in dem er ihn inständig bat, einen Betrag von eintausend Franc zu schicken, um für die Kosten der Reise aufzukommen. Der Brief trug als Ort Lambesc.
Philippe war dort für einige Tage von Herrn de Girousse aufgenommen worden, einem alten Freund der Familie. Herr de Girousse, Sohn eines früheren Mitglieds des Parlamentes in Aix, war mitten in der Revolution geboren. Schon mit dem ersten Atemzug hatte er die feurige Luft von 89 eingeatmet, sein Blut hatte immer ein wenig des revolutionären Fiebers bewahrt. Er fühlte sich nicht wohl in seinem Patrizierhaus auf dem Cours in Aix6; der Adel dieser Stadt schien ihm einen so maßlosen Hochmut zu haben, eine so erbärmliche Trägheit, dass er mit ihm hart ins Gericht ging und lieber fern von ihm lebte. Sein aufrechter Geist, seine Liebe zur Logik hatten ihn den unausweichlichen Lauf der Zeit akzeptieren lassen, und er reichte dem Volk gern die Hand, er passte sich den neuen Tendenzen der modernen Gesellschaft an. Da er spürte, dass es heutzutage keinen anderen Adel mehr gebe als den Adel der Arbeit und des Talents, hatte er für einen Augenblick davon geträumt, eine Fabrik zu gründen und seinen Grafentitel abzugeben, um den Titel eines Industriellen anzunehmen. Weil er vorzog allein zu leben, fern von seinesgleichen, bewohnte er während des größten Teils des Jahres ein Anwesen, das er nahe der kleinen Stadt Lambesc besaß. Dort hatte er die Flüchtenden empfangen.
Marius wurde von Philippes Bitte niedergedrückt. Seine Ersparnisse gingen über sechshundert Franc nicht hinaus. Er machte sich auf und versuchte zwei Tage lang, den restlichen Betrag zu leihen.
Eines Morgens, als er der Verzweiflung nahe war, kam Fine zu ihm. Am Vortag hatte er dem jungen Mädchen, welchem er seit Philippes Flucht auf Schritt und Tritt begegnete, seinen Kummer anvertraut. Fine fragte ihn ständig nach Neuigkeiten über seinen Bruder und schien vor allem darauf Wert zu legen zu erfahren, ob das Fräulein noch immer bei ihm sei.
Sie legte fünfhundert Franc auf einen Tisch. »So, hier!«, sagte sie errötend. »Sie werden es mir später zurückgeben ... Das ist von dem Geld, das ich zur Seite gelegt hatte, um meinen Bruder freizukaufen, falls ihn das Los treffen7 sollte.«
Marius wollte nicht annehmen.
»Sie bringen mich um meine Zeit«, antwortete Fine mit charmanter Schroffheit. »Ich gehe schnell zu meinen Sträußen zurück. Nur, wenn Sie nichts dagegen haben, werde ich jeden Morgen kommen und Sie nach Neuigkeiten fragen.« Und schon entschwand sie.
Marius schickte die eintausend Franc. Dann erfuhr er nichts mehr, zwei Wochen lang lebte er in völliger Unkenntnis der Geschehnisse. Er wusste, dass man seinen Bruder erbittert verfolgte, doch das war auch alles. Überdies wollte er den grotesken oder beängstigenden Versionen, die unter den Leuten umgingen, keinerlei Glauben schenken. Er hatte wahrlich genug mit seinen Schrecken zu tun, ohne sich auch noch vom Tratsch einer Stadt verängstigen zu lassen. Nie zuvor hatte er so sehr gelitten. Die Angst spannte seinen Verstand zum Zerreißen; das geringste Geräusch erschreckte ihn; er war ständig auf der Lauer, so als stünde er kurz davor, irgendeine schlechte Nachricht zu erfahren. Er wusste, dass Philippe nach Toulon gegangen und dort beinahe verhaftet worden war. Man sagte, die Flüchtenden seien dann nach Aix zurückgekehrt. Dort verliefen sich ihre Spuren. Hatten sie versucht, die Grenze8 zu überschreiten? Waren sie in den Hügeln versteckt geblieben? Man wusste es nicht.
Marius sorgte sich umso mehr, als dass er zwangsläufig seine Arbeit beim Reeder Martelly vernachlässigte. Wenn er sich nicht aus Pflichtgefühl an sein Büro gebunden gefühlt hätte, wäre er Philippe zu Hilfe geeilt und hätte sich persönlich um dessen Rettung bemüht. Aber er wagte nicht ein Haus zu verlassen, in dem man seiner bedurfte. Herr Martelly brachte ihm eine vollkommen väterliche Zuneigung entgegen. Er war seit einigen Jahren Witwer und lebte mit einer seiner Schwestern – sie war dreiundzwanzig Jahre alt – zusammen; er betrachtete Marius als seinen Sohn.
Am Tag nach dem von Herrn de Cazalis aufgewirbelten Skandal hatte er Marius in sein Arbeitszimmer gerufen. »Ach, mein Freund«, hatte er ihm gesagt. »Das ist eine sehr böse Sache. Ihr Bruder ist verloren. Niemals werden wir mächtig genug sein, um ihn vor den schrecklichen Folgen seiner Torheit zu retten!«
Herr Martelly gehörte der Liberalen Partei an und fiel dort auf durch eine typisch südländische Heftigkeit. Mit Herrn de Cazalis hatte er schon so manche Meinungsverschiedenheit gehabt, er kannte den Mann. Seine hohe Redlichkeit, sein enormes Vermögen stellten ihn über jeglichen Angriff. Er hatte jedoch den Stolz seines Liberalismus und trug eine Art von Hochmut auf, seine Macht nie zu gebrauchen. Er riet Marius ruhig zu bleiben, die Ereignisse abzuwarten; er werde ihn mit all seiner Macht unterstützen, wenn der Kampf eröffnet sei.
Marius, der vor Fieber brannte, wollte sich gerade entschließen, ihn um Urlaub zu bitten, als Fine eines Morgens ganz in Tränen zu ihm geeilt kam. »Der Herr ist verhaftet!«, schrie sie schluchzend. »Man hat ihn gefunden, mit dem Fräulein in einem kleinen Landhaus im Viertel Trois-Bons-Dieux, eine Meile von Aix entfernt.«
Als Marius voller Unruhe rasch hinunterging, um sich die Neuigkeit – die der Wahrheit entsprach – bestätigen zu lassen, hatte Fine, noch tränengebadet, ein Lächeln auf den Lippen und sagte leise: »Zumindest ist das Fräulein nicht mehr bei ihm!«
V
Blanche legt sechs Meilen zu Fuß zurück und sieht eine Prozession vorüberziehen
Blanche und Philippe verließen zur Dämmerung, so gegen halb acht, das Haus des Gärtners Ayasse. Im Laufe des Tages hatten sie auf der Landstraße Gendarmen gesehen. Man versicherte ihnen, man werde sie wohl bis zum Abend verhaftet haben. Die Angst vertrieb sie daher aus ihrem ersten Unterschlupf. Philippe trug einen Bauernkittel. Blanche lieh sich von der Frau des Landpächters eine landesübliche Tracht eines Mädchens, ein Kleid aus rotem Kattun mit kleinen aufgestickten Sträußen und einer schwarzen Schürze; sie bedeckte sich den Busen mit einem gelbkarierten Tuch, und setzte auf ihre Haube einen breiten Hut aus grobem Stroh. Der Sohn des Hauses, Victor, ein Junge von etwa fünfzehn Jahren, begleitete sie, um sie querfeldein zur Straße nach Aix zu führen.
Der Abend war mild und erfrischend, warme Luft stieg von der Erde und schwächte die frische Brise etwas ab, die ab und zu vom Mittelmeer herwehte. Der Horizont im Westen bot noch das schwache Licht eines glühenden Rots; der übrige Himmel war in ein violettes Blau getaucht und verblasste allmählich; die Sterne – gleich den flackernden Lichtern einer entfernten Stadt – leuchteten einer nach dem anderen in der Nacht auf. Die Flüchtenden marschierten schnell, mit gesenktem Kopf und ohne ein Wort zu wechseln. Sie hatten es eilig, in die Einöde der Hügel zu gelangen. Solange sie die Vororte Marseilles durchquerten, trafen sie nur auf wenige Passanten, die sie misstrauisch beäugten. Nun breitete sich das weite Land vor ihnen aus, und sie sahen nicht mehr als hin und wieder ernste und regungslose Hirten am Rand der Wege inmitten ihrer Herden.
In der Dunkelheit, in der milde gestimmten Ruhe der heiteren Nacht flohen sie weiter. Vage Seufzer stiegen um sie herum auf; mit beunruhigendem Krach rollten die Steine unter ihren Füßen. Das schlafende Land weitete sich ganz schwarz in der Eintönigkeit der Dunkelheit. Blanche schmiegte sich ganz verschreckt eng an Philippe und beschleunigte die kleinen Schritte ihrer Füße, um nicht zurückzubleiben; sie stieß schwere Seufzer aus und entsann sich der ruhigen Nächte aus der Zeit, da sie noch ein junges Mädchen gewesen war.
Dann kamen die Hügel und die tiefen Schluchten, die überwunden werden mussten. In der Umgebung Marseilles sind die Straßen sanft und einfach, aber wenn man sich ins Land hinaus begibt, stößt man auf diese Felsrücken, die das ganze Zentrum der Provence in enge und unfruchtbare Täler zerschneiden. Brachliegende Steppen und steinige, mit dürren Thymian- und Lavendelsträußen übersäte Hänge breiteten sich jetzt aus vor den voll von trübseliger Verzweiflung erfassten Flüchtenden. Die Pfade stiegen entlang der Hügel an, führten hinab, Steinschläge versperrten die Wege; unter dem heiteren, blauen Himmel konnte man meinen, man stünde vor einem Meer aus Kieselsteinen, einem von ewiger Starrheit gekennzeichneten steinernen Ozean inmitten eines Orkans.
Victor, der voranging, sprang mit der Gelenkigkeit einer Gämse über die Felsen und pfiff dabei leise eine provenzalische Melodie; er war in dieser Einöde aufgewachsen, kannte darin die kleinsten abgelegenen Winkel. Blanche und Philippe hatten große Mühe ihm zu folgen; Philippe trug fast seine Geliebte, deren Füße von den scharfen Steinen des Weges geschunden wurden. Sie beklagte sich nicht, und wenn ihr ihr Liebhaber in der klaren Dunkelheit prüfend ins Gesicht sah, lächelte sie ihn an mit einer trübseligen Milde.
Sie hatten gerade Septème passiert, als sich Blanche, bereits völlig erschöpft, auf den Boden gleiten ließ. Im Licht des langsam am Himmel emporsteigenden Mondes gewahrte Philippe ihr blasses, in Tränen gebadetes Gesicht und bückte sich ängstlich zu ihr hinab. »Du weinst?«, schrie er auf. »Du leidest, mein geliebtes armes Kind! Oh, es ist feige von mir gewesen, dich bei mir zu behalten, nicht wahr?«
»Sagen Sie nicht so etwas, Philippe«, antwortete Blanche. »Ich weine, weil ich ein ungeschicktes Mädchen bin ... Schauen Sie, ich kann noch nicht einmal gehen. Wir hätten uns lieber vor meinem Onkel niederknien und ihn mit gefalteten Händen anflehen sollen.« Sie erhob sich mühevoll, und sie setzten ihren Marsch inmitten des wilden Landes fort. Es war keineswegs das verrückte und ausgelassene Ausreißen eines verliebten Paares: Das war eine trübsinnige Flucht voller Angst, die Flucht zweier schweigsamer und zitternder Schuldiger.