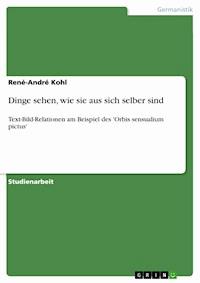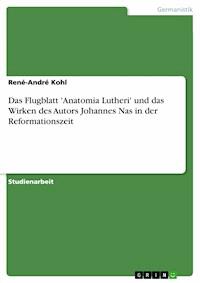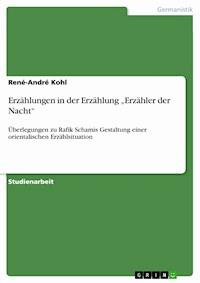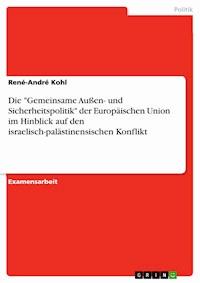
Die "Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik" der Europäischen Union im Hinblick auf den israelisch-palästinensischen Konflikt E-Book
René-André Kohl
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Examensarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Politik - Thema: Europäische Union, Note: 2,0, Universität Kassel, Sprache: Deutsch, Abstract: Mit dieser Arbeit soll die Entwicklung der europäischen Vergemeinschaftung von der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl bis hin zur Europäischen Union der 27 aufgezeigt werden. Die Europäische Union stellt in ihrer politischen wie wirtschaftlichen Bedeutung als Folge ihrer Zusammensetzung aus Nationalstaaten ein besonderes Einflussmedium dar, dass sich in den vergangenen Jahren zunehmend im internationalen Auftreten einheitlich gestaltet. Die Einflussnahme und die Sonderstellung einzelner Mitgliedsstaaten bieten für die ‚Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik’ der Europäischen Union Chancen aber auch Konfliktpotential. Um die politische Beteiligung der EU an einem direkten Beispiel sichtbar zu machen, bietet sich der israelisch-palästinensische Konflikt an. Dieser Konflikt beherrscht den Nahen Osten ebenso lange, wie die europäische Integration in Europa fortschreitet. In diesem Konflikt treten Einflüsse von internationaler Seite, durch die Vereinten Nationen, durch führende Wirtschaftsnationen und durch benachbarte arabische Länder und Organisationen deutlich zutage. Diese internationalen Vermittlungsversuche prägen das schwankende Verhältnis zwischen Israelis und Palästinensern von Annäherung und Distanzierung, von Anerkennung und Vertreibung seit der Entstehung des Staates Israel nachhaltig. Die Europäische Union hat sich im Laufe ihrer Entwicklung auf den verschiedensten Politikfeldern mit diesem Konflikt befasst und betätigt sich vornehmlich ökonomisch und finanziell an den Verhandlungen. Ob die EU als selbsternannter globaler Akteur aktiver in die Friedensverhandlungen intervenieren sollte oder ob das Maß der Interaktion zwischen den Konfliktparteien und der EU angemessen ist, soll diese Wissenschaftliche Hausarbeit differenziert erarbeiten. Durch die Präsentation der für den israelisch-palästinensischen Konflikt bedeutsamen Politikbereiche der Europäischen Union soll eine Grundlage vermittelt werden, die es ermöglicht, sich dem in der Arbeit folgenden historischen Einblick über den Nahost-Konflikt kritisch zu widmen und aus den Erfahrungen der Vergangenheit Schlüsse und Prognosen für die Zukunft zu entwickeln.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2008
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
1. Vorwort
2. Die ‚Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik’ der Europäischen Union
2.1 Grundlegende Vertragstexte
2.1.1 Der Vertrag von Maastricht
2.1.2 Der Vertrag von Amsterdam
2.1.3 Der Vertrag von Nizza
2.1.4 Bewertung der Entwicklung in der GASP
2.2 Die ‚Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik’
2.2.1 Die militärische Komponente der ESVP
2.2.2 Die zivile Komponente der ESVP
2.2.3 Die ESVP in der Bewertung
2.2.4 Die Europäische Sicherheitsstrategie
2.3 Die Europa-Mittelmeer-Partnerschaft
2.3.1 Die drei Dimensionen der Zusammenarbeit
2.3.2 Die Entwicklung des Barcelona-Prozesses
2.3.3 Kommentierung der Euromed-Partnerschaft
2.4 Die Europäische Nachbarschaftspolitik
2.5 Das Nahost-Quartett
3. Die Europäische Union und der israelisch- palästinensische Konflikt
3.1 Der israelisch-palästinensische Konflikt
3.1.1 Das Vorfeld der Staatsgründung Israels
3.1.2 Die Folge der Staatsgründung
3.1.3 Der Sechs-Tage-Krieg und die Folgen
3.1.4 Der Beginn des Nahost-Friedensprozesses
3.1.5 Die erste Intifada
3.1.6 Ein erster Durchbruch im Nahost-Friedensprozess
3.1.7 Ursachen und Ausbruch der zweiten Intifada
3.1.8 Internationale Vermittlung durch das Nahost-Quartett
3.1.9 Der innerpalästinensische Konflikt
3.1.10 Israelisch-palästinensische Friedensbemühungen
3.2 Die Rolle der Europäischen Union
3.2.1 Hilfe im Rahmen der Road Map
3.2.2 Ablehnungspolitik der EU gegenüber der Hamas
3.2.3 Gemeinsame Aktionen der EU
3.2.4 Allgemeine Zielsetzung europäischer Bemühungen
3.2.5 Tendenzen zum Jahresende 2006
3.2.6 Belebung des Friedensprozesses 2007
4. Schlussbemerkung mit Ausblick
5. Literaturverzeichnis
1. Vorwort
Mit dieser Wissenschaftlichen Hausarbeit im Fach Sozialkunde / Politik und Wirt-schaft soll die Entwicklung der europäischen Vergemeinschaftung von der Euro-päischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl bis hin zur Europäischen Union der 27 aufgezeigt werden. Die Europäische Union stellt in ihrer politischen wie wirtschaft-lichen Bedeutung als Folge ihrer Zusammensetzung aus Nationalstaaten ein beson-deres Einflussmedium dar, dass sich in den vergangenen Jahren zunehmend im internationalen Auftreten einheitlich gestaltet. Die Einflussnahme und die Sonder-stellung einzelner Mitgliedsstaaten bieten für die ‚Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik’ der Europäischen Union Chancen aber auch Konfliktpotential. Die intergouvernementalen Politik der im Vertrag von Maastricht niederge-schriebenen zweiten Säule der Europäischen Union in ein konzertiertes und konvergentes Auftreten zu wandeln, ergibt eine Herausforderung für die Vertreter der Mitgliedstaaten und die Repräsentanten der Europäischen Union.
Auch die Personalentwicklung und Institutionalisierung vor allem in der Person des Hohen Vertreters für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, derzeit Javier Solana, hat zu einer Intensivierung der gemeinschaftlichen Politik geführt. Hieraus erwächst der EU Einfluss im globalem Maßstab, dem sich die Union in den Veränderungen ihrer Politiken stellen möchte. Die Europäische Union befindet sich aber noch immer in einem Prozess der Vergemeinschaftung, der Herausbildung gemeinsamer, transnationaler Politiken und der Integration neuer Mitgliedsländer. Dieser Prozess bedarf kontinuierlicher Reformen und Weiterentwicklungen, wie sie durch die Verträge von Amsterdam, Nizza und den wohl im Dezember von den Regierungschefs zu verabschiedenden Vertrag von Lissabon erarbeitet wurden und werden. Auch aus gescheiterten Vorhaben, wie dem Entwurf einer Verfassung für Europa, werden Schlüsse gezogen, die für zukünftige Vorhaben positive Akzente setzen und begangene Fehler vermeiden. Der Reformvertrag von Lissabon lässt sich als Lehre aus dem Scheitern des Vertrags über eine Verfassung für Europa sehen.
Im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik strebt die Europäische Union das ‚globale Gut Sicherheit’[1] nicht nur über die Ebene der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik an, sondern bedient sich dreierlei Wegen:
Der erste Weg fand unter der „amerikanischen Sicherheitsglocke“[2] zu Zeiten des Kalten Kriegs statt und verschaffte sich nach dem Scheitern der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft 1954 ein nach innen gerichtetes Sicherheitsverständnis.[3] Diese Entwicklung umfasst innenpolitische Themen ebenso wie die wirtschaftliche Zusammenarbeit, die als Motor der europäischen Vergemeinschaftung gilt.
Der zweite historische Weg der Friedensausweitung beginnt nach dem Ende des Ost-West-Konflikts 1989/90. Durch den Zusammenfall des Sowjetblocks dehnte sich der nach innen gerichtete Sicherheitsbegriff durch eine von der Europäischen Gemeinschaft betriebene Projektion auf die Nachbarländer aus, sodass „ehemalige Nachbarn zu integrierten Partnern“[4] der Europäischen Gemeinschaft wurden. Die Transformation dieser Europäischen Gemeinschaft in die Europäische Union fand 1992 mit dem Vertrag von Maastricht statt. Durch die Aufnahme neuer Mitgliedsländer stieß die EG (während des Kalten Krieges) und die EU (nach 1992) an immer neue Nachbarländer, auf die die Sicherheitsprojektion ausstrahlte.
Nachdem die europäische Integration von neuen Mitgliedstaaten an die Kapazitätsgrenzen des politisch und finanziell Bewältigbaren gelangt, versucht sich die EU der 27 Mitgliedstaaten auf dem neuen, dritten Weg: der Autonomie im Sicherheitssektor. Dieses Bestreben umfasst eine Ausweitung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und die Ausbildung einer eigenen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, um sich von den Abhängigkeiten gegenüber der USA zu emanzipieren. Dieses junge Politikfeld stellt die EU vor die „größte Herausforderung“[5] der Gegenwart.
Um die politische Beteiligung der EU an einem direkten Beispiel sichtbar zu machen, bietet sich der israelisch-palästinensische Konflikt an. Dieser Konflikt beherrscht den Nahen Osten ebenso lange, wie die europäische Integration in Europa fortschreitet. In diesem Konflikt treten Einflüsse von internationaler Seite, durch die Vereinten Nationen, durch führende Wirtschaftsnationen und durch benachbarte arabische Länder und Organisationen deutlich zutage.
Diese internationalen Vermittlungsversuche prägen das schwankende Verhältnis zwischen Israelis und Palästinensern von Annäherung und Distanzierung, von Anerkennung und Vertreibung seit der Entstehung des Staates Israel nachhaltig.
Die Europäische Union hat sich im Laufe ihrer Entwicklung auf den verschiedensten Politikfeldern mit diesem Konflikt befasst und betätigt sich vornehmlich ökonomisch und finanziell an den Verhandlungen. Ob die EU als selbsternannter globaler Akteur aktiver in die Friedensverhandlungen intervenieren sollte oder ob das Maß der Interaktion zwischen den Konfliktparteien und der EU angemessen ist, soll diese Wissenschaftliche Hausarbeit differenziert erarbeiten.
Durch die Präsentation der für den israelisch-palästinensischen Konflikt bedeut-samen Politikbereiche der Europäischen Union soll eine Grundlage vermittelt werden, die es ermöglicht, sich dem in der Arbeit folgenden historischen Einblick über den Nahost-Konflikt kritisch zu widmen und aus den Erfahrungen der Vergangenheit Schlüsse und Prognosen für die Zukunft zu entwickeln.
Ohne einen Überblick über das gesamte Spektrum der Möglichkeiten der EU zu haben, lässt sich eine effektive Bewertung der Vorgehensweise der EU im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik im Hinblick auf den israelisch-palästinensischen Konflikt nicht durchführen.
Den Abschluss dieser Wissenschaftlichen Hausarbeit bildet somit eine Bewertung des israelisch-palästinensischen Konfliktes und der Einflussnahme der Europäischen Union mit einer Bezugnahme zu den aktuellen Tendenzen, die sich während der Niederschrift dieser Arbeit ergaben.
Mit der Widmung dieser Arbeit für Sarah Bech möchte ich mich bei ihr für die Hilfe und Unterstützung während des Entstehungsprozesses bedanken.
2. Die ‚Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik’ der Europäischen Union
Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik hat im Integrationsprozess der Europäischen Union eine Schlüsselstellung übernommen. Durch Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS, auch Montanunion genannt) wurde nach dem Zweiten Weltkrieg „eine Sicherung des innereuropäischen Friedens durch die Vergemeinschaftung, also die gegenseitige Kontrolle, der kriegswichtigen Güter Kohle und Stahl,“[6] erzielt. Die auf Initiative des französischen Ministerpräsidenten René Pleven 1952 gegründete Europäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG) scheiterte 1954 am einstigen Initiatorland.[7] Diese Vergemeinschaftung wurde durch die Römischen Verträge von 1957 fortgesetzt, in denen die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und die Europäische Atomgemeinschaft (EAG) gegründet und 1967 mit der EGKS zur Europäischen Gemeinschaft (EG) zusammen geschlossen wurden. Neben den Gründernationen Frankreich, Italien, der Bundesrepublik Deutschland, Belgien, den Niederlanden und Luxemburg traten 1973 Dänemark, Irland und das vormals durch Frankreich in seinen Beitrittgesuchen abgelehnte Großbritannien der EG bei. Die Süderweiterung der EG erfolgte in den 1980er Jahren mit Griechenland (1981), Portugal und Spanien (1986). Inhaltlich stimmten sich die Mitgliedstaaten der EG seit 1970 in der Europäischen Politischen Zusammenarbeit (EPZ) ab und schufen ein einheitliches Europäisches Währungssystem (EWS, 1979). Die Beteiligung der europäischen Bevölkerung erfolgte ab dem selben Jahr durch Direktwahlen zum Europäischen Parlament. Um diesen Fortentwicklungen der Römischen Verträge auch eine vertragliche Grundlage zu schaffen und das demokratische Defizit im Abstimmungsprozess durch gesteigerte Kompetenzen des Europäischen Parlaments abzuschwächen[8], wurde 1986 die Einheitliche Europäische Akte (EEA) verabschiedet, die bis 1992 einen europäischen Binnenmarkt vorsah und die vorherigen vertraglichen Texte zusammenfasste. Als eine Fortentwicklung dieser Verträge kann der Vertrag von Maastricht 1991 beschrieben werden.
2.1 Grundlegende Vertragstexte
In der Entwicklung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union gibt es drei zentrale Vertragswerke, die die GASP der Europäischen Union regeln und beginnend mit dem Vertrag von Maastricht (EUV), über den Vertrag von Amsterdam (VA) bis hin zum Vertrag von Nizza (NV) ausweiten und institutionalisieren. Um einen Einblick in die Entwicklung der GASP zu haben, bietet sich eine Durchsicht der Vertragstexte an, inwieweit sich die Europäische Union im Bereich der GASP verändert hat.
2.1.1 Der Vertrag von Maastricht
Der Vertrag von Maastricht[9] stellt die „Geburtsstunde“[10] der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik dar. Mit diesem Vertragswerk, das am 07. Februar 1992 vom Europäischen Rat unterzeichnet wurde, werden die bisherigen europäischen Bündnisse der EG (EGKS, EAG & EWG) mit der EPZ unter ein neues, den Vergemeinschaftungsprozess fortsetzendes Dach gestellt. Die Europäische Union (EU) löst dabei nicht die EG oder die EPZ ab, sondern setzt diese mit einem weiteren Politikfeld, der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in ein Drei-Säulen-Modell um. Die erste Säule bildet hierbei die Europäische Gemeinschaft, die zweite Säule entsteht durch die aus der EPZ entwickelte Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) und die dritte aus der strafverfolgenden Zusammenarbeit in den Bereichen Polizei und Justiz (PJZS).
Bei der ersten Säule handelt es sich um eine supranationale Einheit, deren Entschei-dungskompetenzen außerhalb der Nationalstaaten auf europäischer Ebene getroffen werden und für die Mitglieder bindenden Charakter besitzen – die Nationalstaaten geben in diesen Politikfeldern von ihrer Souveränität an die übergeordneten Institutionen der EU ab. Die supranationalen Institutionen sind die Europäische Kommission (KOM) als Exekutivorgan. Der Rat der Europäischen Union (Ministerrat, oder Rat) bildet auf europäischer Ebene in Verbindung mit dem Europäischen Parlament das Legislativorgan und der Europäische Gerichtshof (EuGH) die Judikative. Über die höchste Kompetenz verfügt der Europäische Rat, die Konferenz des Kommissionspräsidenten mit den Staats- und Regierungschefs. Der Europäische Rat besitzt auf EU-Ebene jedoch über keine Organfunktion.
Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik bildet in Säule II ein intergouvernementales Politikfeld, das sich durch Kooperation zwischen den Mitgliedstaaten auf Regierungsebene auszeichnet. Unter Artikel B (EUV) wird hervorgehoben, dass die Europäische Union zur „Behauptung ihrer Identität (...) durch eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, wozu (...) die Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik gehört,“ einen weiteren Integrationsprozess auf den Weg bringen möchte. Die Beschlussfassung über die Einführung der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik befindet sich in Art. J (EUV), in dem es heißt: „Die Union erarbeitet und verwirklicht eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik“ (Art. J.1 Abs. 1 (EUV)). Der Schutz und die Stärkung der Sicherheit innerhalb der EU, die Sicherung der Charta der Vereinten Nationen und die Wahrung des Friedens im Zusammenspiel mit der Förderung der internationalen Zusammenarbeit bei der Verbreitung von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie werden als Ziele der GASP definiert (Art. J.1 Abs. 2 (EUV)). Die vorbehaltlose und loyale Unterstützung der GASP durch die Mitgliedstaaten fordert Art. J.1 Abs. 4 (EUV) ein und bringt somit eine Wertlegung auf Kooperation und Fortentwicklung des europäischen Einigungsprozesses zum Ausdruck. Die einzelnen Meinungen und Standpunkte der Regierungen der Mitgliedstaaten in Bereichen der GASP sollen durch eine Bündelung und zwischenstaatliche Einigung auf eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik erreicht werden, die international durch den Vorsitz im Rat unter Beteiligung der Kommission repräsentiert werde.[11] Der Europäische Rat bestimmt hierzu die „Grundsätze und die allgemeinen Leitlinien“ zu einem „einheitlichen, kohärenten und wirksamen Vorgehen“ (Art. J.8 Abs. 1 (EUV)). Die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik umfasst laut Art. J.4 (1) eine „Fest-legung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik,“ über die der Rat in Verbindung mit der Westeuropäischen Union (WEU)[12] entscheidet. In der Entwicklung der EU gilt die WEU als integraler Bestandteil, der verteidigungspolitische Entscheidungen und anzunehmende Aktionen beschließt (Art. J.4 Abs. 2 (EUV)).
Der Vertrag über die Europäische Union hat somit eine Regierungszusammenarbeit in den Bereichen der Außen- und Sicherheitspolitik erstmalig vertraglich festgelegt und die EPZ tiefer ausgearbeitet. Durch die Auslegung dieser GASP wird die Zielvorstellung einer europäischen Verteidigungspolitik signifikant und gewinnt in der Folge an Gesicht, was durch den Vertrag von Amsterdam festgeschrieben wird.
2.1.2 Der Vertrag von Amsterdam
Der Vertrag von Amsterdam[13] ist als die schon im EUV angelegte Revision und Überarbeitung des Vertragstextes zu verstehen, die die Europäische Union inhaltlich ausweitete und auf neue Bereiche der Justiz- und Innenpolitik ausdehnte. Neben einer Neunummerierung der Vertragsartikel wurde mit der Aufnahme des Schengener Abkommens[14] und weiteren Veränderungen die Europäische Union von Maastricht vertieft.
Mit der Unterzeichnung des Abkommens von Schengen durch lediglich fünf der elf Mitgliedsländer wurde der EU ein Beispiel vorgelegt, das in den VA unter dem neuen Modus der verstärkten Zusammenarbeit eingeführt wurde. Diese verstärkte Zusammenarbeit wird in Artikel K.12 des Vertrags von Amsterdam mit einer detaillierten Ausführungsbestimmung in den Artikeln K.15 und K.16 ein- und näher ausgeführt wird. Die verstärkte Zusammenarbeit muss – entgegen dem Vorhaben von Schengen – von einer Mehrheit der Mitgliedstaaten ausgehen und umfasst Ziele, die dem Wohle der gesamten EU dienen. Dies lässt den Schluss zu, dass eine „Vertiefung der Integration gegebenenfalls in einem kleineren Kreis“[15] schneller die Ziele der EU als Ganzem erreichen kann, weil eine Gruppe testwilliger Staaten als Motor fungiert und bei positiven Tendenzen – wie am Beispiel Schengen – die gesamte Union (hier mit Ausnahme Großbritanniens und Irlands) die Neuerung übernimmt. Dieses Vertragselement eröffnet der EU die Möglichkeit, mit Hilfe der verstärkten Zusammenarbeit flexibler zu agieren und zögernde Staaten von Erfolgen zu überzeugen. Neben dieser „Flexibilitätsklausel“[16] gilt aber „konzertiertes und konvergierendes Handeln“ (Art. 16 des Vertrags von Amsterdam) als oberstes Prinzip der Europäischen Union, damit der Einfluss der EU international „möglichst wirksam zum Tragen kommt.“ Eine internationale Bedeutung wird der EU schon zu diesem Zeitpunkt beigemessen und soll weiter ausgebaut werden, um die Interessen der europäischen Mitgliedsstaaten im globalen Maßstab zu vertreten. Um diesem internationalen Einfluss ein Gesicht zu geben, wird „der Rat (...) von einem Generalsekretariat unterstützt, das einem Generalsekretär und Hohen Vertreter für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik untersteht.“[17] Die personelle Bindung der intergouvernementalen Politikfelder an einen Generalsekretär und Hohen Vertreter für die GASP verleiht der Vergemeinschaftung einen neuen Tiefgang. Mit dem Hohen Vertreter für die GASP wird eine Funktion in die zweite Säule auf europäischer Ebene integriert, die neben dem rotierenden Vorsitz im Rat und dem für außenpolitische Beziehungen zuständigen Kommissar der Kommission den europäischen, außenpolitischen Einfluss international geltend machen soll. „Der Generalsekretär und Hohe Vertreter für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik unterstützt den Rat [durch] Formulierung, Vorbereitung und Durchführung politischer Entscheidungen [und führt] auf Ersuchen des Vorsitzes im Namen des Rates den politischen Dialog mit Dritten“ (Art. J.16 des VA). Diese Handlungsbefugnis wird durch eine einstimmige Benennung des Hohen Vertreters durch den Rat untermauert (Art. 207 Abs. 2 EGV 1997). Zudem wird dem Generalsekretariat eine Einheit unterstellt, die in den Bereichen Außen- und Sicherheitspolitik Analysen, Bewertungen, Empfehlungen und Strategien entwickelt, die dem Vorsitz und dem Rat zugänglich gemacht werden.[18] Aus der außenpolitischen Vertretung der EU durch den Vorsitz des Rats ist nun durch den zuständigen Kommissar und den Hohen Vertreter für die GASP eine außenpolitische Troika geworden (Art. J.8 Abs. 1, 3 und 5 VA).
Die Verträge von Maastricht und Amsterdam repräsentieren „wichtige konkrete Schritte, um die Europäische Union (...) und ihre politische Identität nach innen und außen sichtbarer und wirksamer zu machen.“[19] Im Rahmen der fortschreitenden Erweiterung von 15 in Amsterdam beteiligten auf derzeit 27 Mitgliedstaaten wurden zu Beginn des 21. Jahrhunderts weitere Vertragsveränderungen notwendig, die vor allem Regelungen der Stimmengewichtung und die Postenvergaben beinhalten. Diese wurden auf der Regierungskonferenz vom 07. bis 09. Dezember 2000 in Nizza in dem nach dem Tagungsort benannten Vertrag festgehalten.
2.1.3 Der Vertrag von Nizza
Der Vertrag von Nizza[20] ist unter den Hintergrund der anstehenden Osterweiterung der Europäischen Union und den in Amsterdam nicht gefundenen Einigungen in Anbetracht der Umverteilung der Stimmen entstanden. Wie bei den vorangegangenen Verträgen handelt es sich bei dem Vertrag von Nizza um einen „Mantelvertrag“[21], der die Vorgänger nicht ablöst, sondern diese integriert und teilweise revidiert.
Zentrale Änderungen des Vertrags von Nizza betreffen die Größe und die Zusammensetzung der Europäischen Kommission, in der jedes Mitgliedsland ungeachtet seiner Größe nur noch einen Kommissar stellt (EU der 25 Mitglieds-länder 2004 bis 2007) und mit dem Beitritt Bulgariens und Rumäniens in 2007 wird die Vergabe der Kommissionsmitglieder einer gleichberechtigten Rotation folgen.[22] Die Anzahl der Parlamentarier für das Europäische Parlament wird durch den NV auf 732 limitiert (Art. 189 Abs. 2 (EGV 2001)) und entsprechend der Zunahme der Bevölkerung durch die Erweiterung auf die Mitgliedsländer verteilt (Art. 190 Abs. 2 (1) (EGV 2001)). Zentraler Diskussionspunkt war schon in Amsterdam die Stimmengewichtung der einzelnen Mitgliedsländer im Rat, die durch den Artikel 205 Absatz 2 (EGV 2001 mit Wirkung vom 01. Januar 2005) die Gewichtung und Verteilung neu regelt.
Um im Entscheidungsfindungsprozess in einem Europa von 27 gleichberechtigten Mitgliedsländern noch entscheidungsfähig zu bleiben, wurden die Zuständigkeiten der Europäischen Union ausgeweitet und die Anzahl der Entscheidungen mit qualifizierter Mehrheit[23] um 35 der vorgeschlagenen 50 Bestimmungen erhöht.[24] Die qualifizierte Mehrheit findet nach der neuen Regelung Anwendung auf die Ernennung von Mitgliedern europäischer Institutionen und die Ernennung des Hohen Vertreters für die GASP (Art. 207 EGV 2001) und für Sonderbeauftragte im Rahmen der GASP (Art. 23 EUV 2001).
Auch die Flexibilitätsklausel der verstärkten Zusammenarbeit wird auf den Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik ausgeweitet und unter die Verwaltung des Hohen Vertreters für die GASP gestellt (Art. 27d (EUV 2001)), wobei militärische und verteidigungspolitische Entscheidungen von der verstärkten Zusammenarbeit ausgeschlossen bleiben (Art. 27b (EUV 2001)). Die verstärkte Zusammenarbeit muss nicht mehr durch eine Mehrheit der Mitgliedstaaten getragen werden, sondern von mindestens acht Nationen (Art. 40a (EUV 2001)). Eine Entwicklung einer partnerschaftlichen, engeren Zusammenarbeit zweier Mitgliedstaaten auf Ebene der WEU oder der NATO ist hingegen ausgenommen (Art. 17 Abs. 4 (EUV 2001)). Auch regelt der Vertrag von Nizza eine rüstungspolitische Zusammenarbeit mit dem Ziel einer gemeinsamen Verteidigungspolitik, die die Übernahme der Krisenmanagementaufgaben von der WEU zum Ziel hat (Art. 17 Abs. 2 (EUV 2001)). Ein entscheidender Schritt von einer Zivilmacht in Richtung eines militärischen Akteurs ist auch die Umwandlung des Politischen Komitees in ein Politisches und Sicherheitspolitisches Komitee (PSK), das „unter der Verantwortung des Rates die politische Kontrolle und strategische Leitung von Operationen zur Krisenbewältigung“ (Art. 25 (EUV 2001)) wahrnehmen kann.
2.1.4 Bewertung der Entwicklung in der GASP
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: