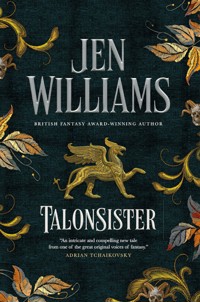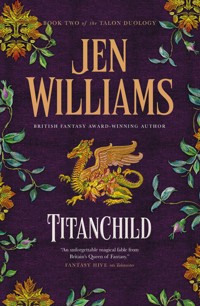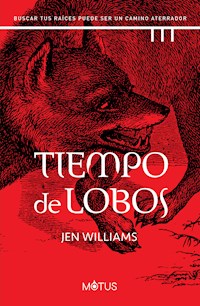1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beBEYOND
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Kupfer Fantasy Reihe
- Sprache: Deutsch
Schreckliches geht im Dunkelforst vor sich. Fane und seine skrupellosen Männer terrorisieren die Menschen von Kieferngrund. Sie greifen zu den grausamsten Mitteln, um aus den Bewohnern Hinweise auf einen geheimen Schatz der Friths zu pressen. Wydrin, Sebastian und Lord Frith sind die letzte Hoffnung für die geschundene Bevölkerung. Doch sie brauchen einen guten Plan. Und zwischen Frith und der wohlverdienten Rache an dem Mörder seiner Familie steht ein schier unüberwindlicher Feind: die gespenstischen Geschwister des Nebels ...
Die Fantasy-Reihe "Von Göttern und Drachen" von Jen Williams umfasst die folgenden vier Bände:
Der Geist der Zitadelle - Band 1
Die Geschwister des Nebels - Band 2
Der Prinz der Schmerzen - Band 3
Die Klinge aus Asche - Band 4
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 214
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über diese Folge
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
In der nächsten Folge …
Über diese Folge
Schreckliches geht im Dunkelforst vor sich. Fane und seine skrupellosen Männer terrorisieren die Menschen von Kieferngrund. Sie greifen zu den grausamsten Mitteln, um aus den Bewohnern Hinweise auf einen geheimen Schatz der Friths zu pressen. Wydrin, Sebastian und Lord Frith sind die letzte Hoffnung für die geschundene Bevölkerung. Doch sie brauchen einen guten Plan. Und zwischen Frith und der wohlverdienten Rache an dem Mörder seiner Familie steht ein schier unüberwindlicher Feind: die gespenstischen Geschwister des Nebels …
Über die Autorin
Jen Williams lebt mit ihrem Partner und ihrer Katze in London. Sie war schon immer von Piraten und Drachen fasziniert und schreibt über sie, seit sie denken kann. Mittlerweile lebt sie ihre Leidenschaft in rasanten Fantasy- und Sword-and-Sorcery-Romanen aus, in denen es nicht nur die bereits erwähnten Piraten und Drachen gibt, sondern auch jede Menge Magie und stets ein kleines Augenzwinkern. Bei den British Fantasy Awards war sie 2015 als Best Newcomer nominiert. »Von Göttern und Drachen« ist ihr Debüt.
JEN WILLIAMS
DIEGESCHWISTERDES NEBELS
VON GÖTTERN UND DRACHENBAND 2
Aus dem Englischen vonFalko Löffler
beBEYOND
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Titel der englischen Originalausgabe: Children of the Fog
Copyright © 2014 by Jennifer Williams
Für die deutschsprachige, digitale Originalausgabe
Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Übersetzer: Falko Löffler
Textredaktion: Catherine Beck
Covergestaltung: Manuela Städele-Monverde unter Verwendung von Motiven © Headline Publishing Group unter Verwendung von shutterstock: Algol und Getty Images: Dagli Orti
eBook-Erstellung: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-4388-5
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Mit Liebe für
1
Die Dreiunddreißigste lief die gepflasterte Straße entlang, und ihre nackten Füße erzeugten kein Geräusch auf den Steinen. Weiter vorne konnte sie die schlanke Gestalt ihrer Brutschwester ausmachen, der Siebenundneunzigsten, die vor etwas Zuckendem hingehockt war. Es gab Geräusche von sich, und sie konnte das Vergnügen ihrer Schwester wie eine warme Stelle in ihrem Geist fühlen. Die Dreiunddreißigste lächelte, schmeckte den Rauch auf ihrer Zunge.
Sie hatten keine Namen, wie niemand aus der Brutarmee, aber die Dreiunddreißigste wusste, wo und wann sie entstanden war. In Kälte und Dunkelheit war sie viele Jahre lang gewachsen, ganz nah an ihren Schwestern, im Geiste miteinander verbunden, bis sie sich kannten, ohne ihre Gesichter sehen zu müssen. Es gab welche, die schon vor ihr da waren, und andere kamen nach ihr, das war alles. Und es gab natürlich Mutter.
Eine kleine Gestalt kam aus einem offenen Durchgang geeilt und vor ihr zum Stehen. Das Wesen hatte die Augen panisch aufgerissen, und sofort war die Dreiunddreißigste auf der Jagd. Darüber musste sie gar nicht nachdenken, denn das Wesen war klein und warm und erschrocken, es war Beute. Es machte den Fehler, sich umzudrehen und wieder in das dunkle Gebäude zu laufen, und die Dreiunddreißigste folgte ihm.
Die Familie hatte sich im Wohnzimmer versammelt und drängte sich bei den Überresten eines Esstisches aneinander. Die Dreiunddreißigste konnte die Erleichterung im Gesicht der Mutter sehen, als ihr Sohn zurückkam, der so leichtsinnig weggelaufen war. Der Ausdruck dieses Gefühls wich blankem Schrecken, und die Dreiunddreißigste verfolgte diese Veränderung genau. Die Mutter nahm den Sohn in ihre Arme und drückte ihn an sich.
»Hallo«, sagte die Dreiunddreißigste. Sprechen war interessant. Jedes Wort hatte einen neuen Geschmack.
»Hinaus.« Der Vater war ein dünner Mann mit braunen Haaren, in denen eine kahle Stelle glänzte. Sein ganzes Leben lang hatte er Karren gezogen und ging deswegen krumm, und sie erkannte im glasigen Blick seiner Augen, dass er bislang nie hatte tapfer sein müssen, aber nun stand er vor ihr und war es trotzdem. Sie grinste. »Hinaus, lass uns in Ruhe«, sagte er.
Die Dreiunddreißigste zog ihr Schwert. Es bestand aus blauem Kristall, und es summte, als es aus der goldenen Scheide glitt. Bei diesem Geräusch erschauderte die ganze Familie, denn sie alle hatten es in den letzten Stunden öfter gehört und wussten, was es bedeutete. Die Dreiunddreißigste kniete sich hin und legte es vor ihren Füßen auf den Boden. »Ich bin nur hier, um zu reden«, sagte sie in einem Ton, von dem sie hoffte, dass er freundlich klang. Der Junge wimmerte und klammerte seine Fäuste in die Schürze seiner Mutter »Für mich ist das neu, dieses … reden. Ich möchte Fragen stellen, eure Antworten hören, und dann könnt ihr gehen, ja?«
Der Mann und die Frau warfen sich einen Blick zu. Hoffnung lag in diesem Blick, eine winzige Kerzenflamme, die nie gelöscht werden konnte. Das war eines der Dinge, die sie über sie erfuhr.
»Wir können gehen?«, fragte die Frau.
»Ja. Sagt mir, wie heißt der Junge?« Sie deutete mit einem Klauenfinger auf das Kind.
»Ben, sein Name ist Ben.« Nun, da sie Hoffnung hatten, gaben sie sich ihr hin. Der Mann nickte und lächelte sogar, als wären seine Nachbarn gar nicht tot und die Stadt stünde nicht in Flammen. »Unser Kleiner hatte gerade seinen neunten Geburtstag.«
»Wirklich?« Darüber war die Dreiunddreißigste tatsächlich erfreut. Es war ähnlich wie das befriedigende Gefühl, wenn sie mit dem Fuß auf ein zerbrechliches Objekt trat. »Ich hatte auch gerade Geburtstag. Den ersten. Mein erster Geburtstag.«
»Wie schön«, sagte die Frau. Ihre Stimme war angespannt.
»Und du lebst hier, in dieser Stadt.« Die Dreiunddreißigste machte eine ausschweifende Armbewegung. »Wie ist das, in einer Stadt zu leben?«
Das angedeutete Lächeln im Gesicht des Mannes wurde starr, gefror zu einer Maske. Er verstand die Frage nicht, das sah sie, und er wusste, dass es gefährlich wäre, nicht zu antworten.
»Ich weiß nicht … wie meinst du das?«
Sie machte einen Schritt in ihre Richtung, und sie rückten gemeinsam nach hinten. Ihr Lächeln wurde breiter. »Ihr baut Dinge, macht Dinge, dann bringt ihr alles an einen Ort, und dann esst und schlaft ihr und verrottet und sterbt nebeneinander. Warum tut ihr das?«
»Es … das hier ist Krete. Seit Tausenden von Jahren leben hier Menschen, es ist eine große Zivilisation. Es gab die Zitadelle …« Sein Blick raste umher, aber es fiel ihm nichts mehr ein.
»Ja, es gab sie«, stimmte die Dreiunddreißigste ihm zu. »Ich bin fertig. Ihr könnt gehen.« Sie wies zur Tür hinter sich.
»Das können wir?«, fragte die Frau. Sie hatte während des Austauschs kein einziges Mal den Blick von der grünhäutigen Soldatin abwenden können. »Du lässt uns einfach gehen?«
»Aber natürlich«, sagte die Dreiunddreißigste und war mit sich selbst zufrieden. Sie hatte von ihnen schon einige gute Wörter gelernt. Oder stammten sie aus ihr selbst? »Zuerst bitte der Junge. Schickt ihn nach draußen und geht ihm hinterher. Wenn ihr euch beeilt und nicht die Aufmerksamkeit meiner Schwestern auf euch zieht, entkommt ihr ihnen.«
»Und du verletzt uns nicht?«, fragte die Frau, aber sie schob schon den Jungen um den Tisch herum, hatte die Hände auf seine Schultern gelegt. »Keine Tricks?«
»Keine Tricks«, erwiderte die Dreiunddreißigste freundlich. »Mein Schwert liegt auf dem Boden.«
Das Kind, Ben, schlurfte ein paar Schritte vorwärts. Er sah zur offenen Tür, zur großen Soldatin mit den spitzen Zähnen, dann wieder zur Tür.
»Geh, Ben«, sagte sein Vater mit aufgesetzter Fröhlichkeit. »Wir treffen uns draußen.«
»Tu, was dein Vater sagt, Ben«, sprach die Dreiunddreißigste beruhigend, aber als er an ihr vorbeiging, griff sie mit ihrer Klauenhand nach ihm, als wollte sie ihm über die Wange streichen, doch riss seine Kehle auf. Das heiße Blut benetzte ihren Arm bis zum Ellenbogen, und wieder überkam sie das warme Gefühl. Als die Mutter zu schreien begann, wandte sie sich an die Eltern.
Das Schwert beschleunigte das, was dann folgte.
Draußen standen die Straßen in Flammen. Die Dreiunddreißigste, die nun voll und träge wie eine Schlange war, begutachtete den wogenden Rauch. Sie dachte an die Fragen, die sie gestellt hatte, und an das, was sie nicht ausgesprochen hatte.
»Aber natürlich«, murmelte sie. Die Worte waren seltsam und doch nicht. Es war noch jemand in ihrem Blut, und es war nicht ihre Mutter. Sie wusste es, so wie sie die Gesichter ihrer Brutschwestern kannte.
»Wir tragen dich in uns, Vater«, sagte sie zu den blutverschmierten Pflastersteinen. »Kannst du es fühlen?«
Sebastian, der in einem Albtraum aus Blut, Feuer und Schmerzen verloren war, hörte die Stimme, die ihn Vater nannte – und fühlte, wie sein Herz aussetzte.
2
Wydrin zwang sich, die Augen zu öffnen, und starrte in einen lila Himmel, der von schwarzen Zweigen eingerahmt wurde.
Riesige Bäume standen beiderseits mit knorrigen Stämmen und Ästen voll dunkelgrüner Blätter. An ihren Wurzeln hatten sich riesige Pilze gebildet, die wie blasse, aufmerksame Kinder wirkten, und der Wind wehte klagend durch die Baumwipfel. Normalerweise hasste es Wydrin, offensichtliche Sachen zu erfragen, aber diesmal konnte sie es kaum vermeiden.
»Wo bin ich?«
Es kam keine Antwort.
Krete roch stets nach einem Abfalleimer, der zu lange in der Sonne gestanden hatte, doch hier war die Luft sauber und frisch. Wydrin lag auf Erde, die dunkel und feucht war. Ihre Finger fuhren darüber, und sie atmete die Düfte von Matsch und Bäumen ein, den intensiven, erdigen Geruch eines alten Orts, der reine Natur war. Die staubigen Ruinen von Krete waren durch einen stillen Wald ersetzt worden, und die dunklen Himmel über ihr waren gnädigerweise frei von Drachen.
Sie setzte sich auf, und all der Schmerz kam wieder zurück. In ihrem Arm war ein scharfes Pochen, das vermutlich von einer Knochenverletzung rührte, und ihr Schädel war in Mitleidenschaft gezogen, wo eine der grünen Schlampen sie überraschend erwischt hatte. Sie sah an sich runter und sah, dass sie mit Blut bedeckt war. Ein paar andere Erinnerungen kehrten zurück.
»Sebastian!«
Sie rappelte sich auf. In der Nähe war ein schmaler Graben, an dem Farne und kleine Büsche wuchsen. Schwindel überkam sie und ließ sie stolpern, aber sie entdeckte Frith, der auf der Seite lag, mit zerwühlten weißen Haaren und Kleidern, die noch feucht vom See waren. Mit zitternden Händen rieb er sich übers Gesicht. Sebastian lag vor ihm, ein gutes Stück von den beiden entfernt. Er rührte sich nicht.
Sie rannte zu ihm und drehte ihn auf den Rücken. Während ihrer heftigen Reise war der Dolch rausgerissen worden, aber sein Körper fühlte sich schwer an und als wären keine Knochen mehr darin.
»Wach auf!« Sie schüttelte ihn heftig an den Schultern. »Wir sind jetzt draußen. Wir sind nicht mehr in der Zitadelle!«
»Das wird ihm nicht helfen.«
Frith tauchte an ihrer Seite auf. Ein Streifen Dreck klebte an seiner Backe. Wydrin verengte die Augen zu Schlitzen und hieb ihm fest ins Gesicht. Frith stolperte rückwärts in den Matsch.
»Du!« Sie wandte sich von Sebastian ab und wollte mit juckenden Fäusten wieder auf Frith losgehen. »Du hast ihn sterben lassen!«
»Warte.« Blut floss von seiner Lippe. Er hob eine Hand, um sie abzuwehren. »Ich weiß, wie man ihm helfen kann.«
Wydrin zog Frostling. »Deine Lügen werden deinen hübschen Hals nicht beschützen, Prinzlein.«
»Die Magier, es muss einen Heilzauber geben, verstehst du nicht?« Frith kam mühsam auf die Füße und behielt misstrauisch die Klinge im Auge. »Lass es mich wenigstens versuchen. Wenn ich es nicht schaffe, kannst du mir immer noch den Hals aufschlitzen.«
Wydrin hielt inne, und aus Zorn wurde Hoffnung. Sebastian hätte sie zur Vorsicht gemahnt, hätte ihr gesagt, dass sie sich beruhigen und dem Prinzlein eine Chance geben sollte. Blöder Sebastian. Widerspenstig steckte sie den Dolch wieder weg.
»Na los dann«, sagte sie und versuchte, keine Angst in ihrer Stimme mitschwingen zu lassen. »Aber ich hoffe, deine Magiertricks wirken, um deinetwillen.«
Frith trat zu Sebastian, ohne sie anzuschauen, und nahm den Kopf des großen Ritters in seine Hände.
»Versuche seine Augen zu öffnen«, flüsterte er.
Wydrin tat, wie ihr gesagt wurde, auch wenn sich ihr wieder der Magen umdrehte, als sie seine Augenlider nach oben zog und den leblosen Blick darin sah. Seine blauen Augen sahen im schwachen Licht schwarz aus.
»Gut«, sagte Frith. Er löste die Bänder, die Sebastians Kettenhemd fixierten, und zog den Stoff darunter zur Seite, um die Wunde zu entblößen. Der Schnitt war klein, aber tief, die Haut blutig. Frith legte seinen Finger auf die Wunde und senkte den Kopf, als versinke er in ein Gebet.
»Was sagst du da?«, fragte Wydrin.
Er warf ihr nur einen bösen Blick zu. »Ich sage gar nichts, du Närrin. Sei still und lass mich nachdenken.«
Wydrin zog kurz in Erwägung, ihn noch einmal zu schlagen, entschied sich aber dagegen. Einige Augenblicke später, in denen es auf Wydrin wirkte, als wäre der Wald unnatürlich schwach geworden, schimmerte ein schwaches rosa Licht zwischen Friths Fingern. Es kroch wie Honig über Sebastians nackte Brust, und Wydrin beobachtete, wie die Ränder der Wunde sich schlossen.
»Es funktioniert«, sagte sie, aber Frith ignorierte sie. Er schwitzte nun, wie sie bemerkte, und lange Strähnen seines dünnen, weißen Haares klebten an seiner Stirn, außerdem zitterte er am ganzen Körper. Das rosa Licht unter seinen Händen wurde intensiv, bis es so hell war, dass Wydrin fast nicht mehr hinsehen konnte.
»Ich kann es kaum kontrollieren …«, stieß er aus, aber Wydrin hatte nicht den Eindruck, dass er zu ihr sprach. »Ich erinnere mich nicht. Es ist anders.«
Nach ein paar Minuten begann das Licht zu pulsieren, und seine Augen wurden größer. »So!«, keuchte er, hob seine Hände von der Wunde, und dort war die Haut wieder glatt.
Sebastian schüttelte sich abrupt und begann zu husten.
Frith blickte verwundert auf seine Hände. Er sah Wydrin in die Augen, und ein winziges Lächeln erschien auf seinen Lippen. »Ich konnte fühlen, wie es in mir aufsteigt, wie eine gewaltige Welle. Wie der See.« Seine Stimme klang, als würde er sich in einem langen Tunnel von ihr entfernen. »Ich glaube …« Damit verdrehte er die Augen und fiel zum zweiten Mal nach hinten in den Schlamm.
Nach einigen Augenblicken setzte sich Sebastian auf und strich sich über den Kopf. Er schaute zu seinen blutgetränkten Kleidern, dann zu der Gestalt, die neben ihm lag. »Was ist mit Lord Frith passiert?«, fragte er mit einer Stimme, die nur ein Krächzen war.
Wydrin seufzte. »Das Prinzlein ist überglücklich, dass du wieder gesund bist, und ist deswegen direkt ohnmächtig geworden.« Sie hielt kurz inne und verpasste Sebastian einen Knuff gegen den Arm. »Schön, dass es dir wieder gut geht. Willst du mir helfen herauszufinden, wo wir sind?«
3
»Du hast was getan?«
Sie saßen zusammen um ein kleines Feuer, so nah wie möglich an den Flammen. Es hatte einige Zeit gedauert, bis sie es entzündet hatten. Wydrin hatte den feuchten Wald mit vielen bunten Flüchen bedacht, bis schließlich ein paar schwache Flammenzungen die grünen Zweige berührten, die sie gesammelt hatten. Dabei hatte Sebastian geholfen, so gut er konnte, obwohl Wydrin darauf bestand, dass er sich ausruhen und Kraft sammeln sollte. Doch er fühlte sich so gut, wie es überhaupt nur möglich war. Der grässliche brennende Schmerz, den er seit Gallos Stich gefühlt hatte, war vollständig verschwunden, und all die Zipperlein, die ihn nach dem Kampf gegen die Culoss plagen müssten, stellten sich gar nicht erst ein.
»Wohin hättet ihr sonst gehen wollen?«, fragte Frith. Nun, da er wach war, schien ihn düstere Stimmung gepackt zu haben. Sebastian vermutete, dass ihm seine Ohnmachtsanfälle peinlich waren. »Nach Litvania zurückzukehren, war sowieso mein Ziel.«
»Und warum schleuderst du uns dann mitten in diesen gottverlassenen Wald? Wäre es nicht etwas hilfreicher gewesen, wenn wir in deiner großen, gemütlichen Burg landen?« Wydrin schnaubte und stocherte mit einem Ast im Feuer herum.
Frith sah sie düster an. »Das lässt sich nicht genau bestimmen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, aber wir liefen ein klein wenig Gefahr, von einem riesigen Drachen gefressen zu werden.«
»Ja, was das angeht …«, sagte Sebastian, »was schlägst du vor, was wir deswegen unternehmen?«
Er sah, wie sich Frith und Wydrin einen Blick zuwarfen. Ihr Gezänk war für den Augenblick vergessen.
»Unternehmen?«, fragte Frith zurück. »Was meinst du damit?«
Sebastian sah zum Himmel hoch. Nun war er vollständig schwarz, und die Sterne wurden zum größten Teil von Wolken verdeckt, doch hier und da sah er einige Lichtpunkte. Sie waren wie Augen, die ihn beobachteten.
»Wir haben ein Monster entfesselt.« Er sah Frith direkt in die Augen, dann zu Wydrin. »Schlimmer noch, eine ganze Armee von Monstern. Es ist unsere Schuld. Wir müssen zurückkehren und sie aufhalten. Was meinst du, was mit Krete geschehen ist, nachdem wir verschwunden sind? Mit den Leuten, die dort leben?«
»Ich weiß es sicher nicht«, sagte Frith. In seiner Stimme lag eine neue Kälte, und Sebastian erkannte, dass aus dieser Richtung wenig Hilfe zu erwarten war. »Die Stadtwache wird sich darum kümmern, schätze ich. So oder so, meine Belange liegen hier in diesem Wald. Meine Burg ist immer noch in den Händen der Volksrepublik von Istria, und wo ich nun die Mittel habe« – er hob seine Hände, als wären sie explosiv – »möchte ich sie mir zurückholen. Was ihr beide macht, interessiert mich nicht. Geht zurück nach Creos, wenn ihr das wollt, und schlachtet gern euren Drachen.«
»Er hat schon recht, Seb«, sagte Wydrin. »Wir sind … wie viel, tausend Meilen weit weg von Creos? Wahrscheinlich sogar mehr als das. Was sollen wir tun? Außerdem …«, sie wandte sich an Frith und trat ihm gegen den Stiefel, »… schuldet dieses Prinzlein hier uns noch Geld. Soweit es mich betrifft, ist dieser Auftrag erfüllt.«
Frith sah sie düster an. »Sobald ich meine Burg zurückhabe, wirst du deinen Anteil bekommen, Weib.«
Sebastian schluckte einen Protest hinunter, drehte eine heiße Kastanie zwischen den Fingern. Sie hatten ihm berichtet, was während seiner Bewusstlosigkeit geschehen war, ihm alle Details erzählt, was es mit dem See unter der Zitadelle auf sich hatte, und wie der letzte verzweifelte Kampf von Wydrin und den Culoss gegen die geschuppten Kriegerinnen verlaufen war (an dieser Stelle teilte Wydrin unmissverständlich und blumig ihre Ansicht über Friths Taten mit), und dann erzählten sie vom Drachen, der unter den Ruinen der Zitadelle hervorgekrochen war. Sogar Frith zeigte dabei Anzeichen von Ehrfurcht, schüttelte langsam den Kopf, als er die mit gelbem Feuer erfüllten Augen der Kreatur beschrieb. Was Sebastian ihnen nicht sagen konnte, war, dass er das alles schon wusste. Er hatte die Bewegungen der geschuppten Soldatinnen in seinem eigenen Blut gefühlt, genauso wie sich die Kreatur namens Y’Ruen zum ersten Mal seit Jahrtausenden ins Sonnenlicht erhoben hatte. Wenn er die Augen länger als ein paar Sekunden schloss, konnte er sie alle fast sehen: den strahlenden Kristall ihrer blutverschmierten Schwerter, den elend orangen Himmel über Creos, während alles brannte. Y’Ruen musste aufgehalten werden, da hatte Wydrin recht. Aber wie?
Sie und Frith stritten schon wieder. Unter Mühen richtete er seine Aufmerksamkeit wieder auf das Feuer.
»… und was glaubst du, wie das gelingen soll?«
»Du hast gesehen, wozu ich in der Lage bin«, sagte Frith. »Ich habe die Zitadelle vernichtet.«
»Allerdings schätze ich, dass du das nicht mit deiner Burg tun willst?«, gab Wydrin mit einem höhnischen Grinsen zurück. »Wäre doch ein ziemlich sinnloses Bemühen.«
»Ich muss meine Pläne nicht mit jemandem wie dir diskutieren.«
»Bist du dir überhaupt sicher, dass es das wert ist?« Wydrin deutete zu den schwarzen Bäumen, die wie Wächter herumstanden. Eine strenge Kälte war mit der Nacht gekommen, und nun schlängelten sich Nebelfetzen um die Stämme, wie verschüchterte Geister, die die Neuankömmlinge in Augenschein nehmen wollten.
»Und was meinst du damit?«
»Also, du weißt schon …« Wydrin zuckte mit den Schultern und kratzte etwas getrocknetes Blut aus dem Haar. »Es ist hier etwas … also … viele Bäume, was nett ist, wenn man Bäume mag. Große, stabil aussehende Bäume. Aber das ist alles. An deiner Stelle würde ich alles als Verlust abhaken und mich interessanteren Dingen widmen. Kreuzhafen empfängt gern geschäftstüchtige Männer mit Geld in der Tasche und einem Talent für Vernichtung.«
Frith sah sie einfach nur an. Unvermittelt stand er auf. Sein weißes Haar fiel ihm ins Gesicht und verdeckte die Wut in seinen Augen. »Ich gehe spazieren.« Und damit wanderte er zwischen die Bäume, mit Schultern so schmal wie eine Messerklinge.
Wydrin und Sebastian schauten sich an. In ihrem Gesicht stand höfliches Erstaunen, dass sich schnell in Gelächter auflöste. Sebastian lachte mit. »Jetzt hast du es geschafft.«
»Ach, der verdient viel mehr.« Die Heiterkeit verblasste, und sie blickte wieder ernst drein. »Er hätte dich wirklich sterben lassen, Seb. Mich auch, auch wenn ich nicht sagen will, dass ich mich nicht durch diese spitzzahnigen Teufel hätte kämpfen können.«
»Vielleicht hatte er die ganze Zeit einen Plan«, sagte Sebastian, obwohl er es selbst nicht recht glaubte. »Und ich vermute, seine blutige Lippe stammt von dir?«
Wydrin legte den Kopf schief. »Wie gesagt, der verdient viel mehr.«
»Jedenfalls sollte er nicht allein unterwegs sein.« Sebastian nickte zu den Bäumen, zwischen denen er verschwunden war. Die Schwärze hatte sich wie ein Mantel über den jungen Lord gelegt. »Der Dunkelforst ist nicht unbedingt ein freundlicher Wald. Wölfe, Bären. Alle möglichen Raubtiere sind darin.«
»Schon gut, ich suche ihn.« Wydrin stand auf, und als sie den überraschten Gesichtsausdruck bei Sebastian bemerkte, zuckte sie mit den Schultern. »Er schuldet uns Geld, schon vergessen? Ich werde erst zulassen, dass er von einem Wolf gefressen wird, nachdem er seine Burg gefunden hat.«
»Wydrin …« Sebastian lächelte. An ihm sah es seltsam aus, aber durchaus willkommen. »Dein Geschmack, was Männer angeht, ist immer noch katastrophal.«
»Nicht schlimmer als deiner.« Sie zog eine Grimasse und schlenderte in den Wald.
Frith hatte sich ein Stück von dem Feuer entfernt, aber es war noch als schwacher Schimmer zu erkennen. Sein weißes Haar strahlte im Mondlicht wie ein Leuchtturm. Wie er mit steifen Beinen und hochgezogenen Schultern rumlief, wusste Wydrin, dass er schmollte. Diese Pose hatte sie oft genug bei ihrem Bruder gesehen.
»Pass auf, wohin du gehst, Prinzlein!«, rief sie ihm zu. »Sebastian sagte, dass die Tiere in diesem Wald sogar deine dünne Gestalt als Mahlzeit sehen würden.«
Frith sah sie düster an, als sie zu ihm trat. »Was willst du?«
»Nur sichergehen, dass du keine Dummheiten anstellst. Schließlich schuldest du uns noch einiges an Geld.«
»Du bekommst dein Geld, Söldnerin.« Er spuckte das Wort regelrecht aus.
Nachdem sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, konnte sie die scharfen Konturen seines Gesichts im Schein des fernen Lichts ausmachen. Er ist tatsächlich recht hübsch, dachte sie, trotz der Haare.
»Sie haben mir alles genommen«, sagte Frith unvermittelt. Er sah sie nicht an, sondern in die Dunkelheit, als würden sich seine Feinde zwischen den Bäumen verstecken. »Meine Familie, mein Heim. Alles, was wir je besessen haben, ist weg. Einmal haben sie mich aus dem Kerker gezerrt und in den Hof gebracht. Lady Bethan bestand darauf, dass sie mich wuschen, denn schließlich verseuchte mein Gestank ihre Burg.« Er schnaubte. »Sie schütteten Wassereimer über mir aus. Der Boden war noch gefroren, und ich lag zitternd im Dreck. Da habe ich gesehen, dass sie unsere Diener an den Wänden aufgeknüpft hatten. Jeden Einzelnen. Ihre Gesichter waren lila. Männer und Frauen, die ich gekannt hatte, seit ich geboren war …« Seine Stimme verklang.
Frith hatte nicht viel davon erzählt, was ihn aus seiner Heimat vertrieben hatte, aber es war leicht zu durchschauen, dass es nicht angenehm gewesen war. Wie Sebastian zwischen zwei Pints voll Ale gesagt hatte: Solange sie bezahlt wurden, war es egal, wenn Lord Frith die Details für sich behalten wollte. Aber Wydrin war von Natur aus neugierig und immer gern taktlos.
»Warum haben sie es getan?«
Frith sah sie einige Sekunden lang an, bevor er antwortete. »Warum tun Diebe überhaupt etwas? Sie wollen etwas an sich reißen, das ihnen nicht gehört, und sie wollen die Leben anderer Leute ruinieren.« Er machte eine ausholende Armbewegung in der Dunkelheit. »Die Frith waren immer ein Teil des Dunkelforsts. Er ist unsere Heimat, solange irgendjemand zurückdenken kann. Man sagte, wenn man einen Frith schneidet, kommt nicht nur Blut raus, sondern auch Rindensaft. Wir sind immer hier gewesen.«
»War es ein alter Feind?«
Frith schüttelte den Kopf. »Es gab Gerüchte, dass eine Söldnergruppe die Grenze von Istria überquert hatte, und vielleicht hätte mein Vater deswegen …« Frith schüttelte den Kopf, als wäre es sinnlos, den Satz zu vollenden. »Mein Bruder Tristan war neun Jahre alt. Ich weiß nicht mal, was sie mit seinem Körper gemacht haben.«
Wydrin wusste nicht, was sie sagen sollte. Außerdem bemerkte sie, dass sie sich etwas schuldig fühlte, weil sie Frith auf den Mund geschlagen hatte, und das gefiel ihr überhaupt nicht. »Hör zu«, sagte sie und kratzt sich am Hinterkopf. Dreck klebte in ihrem Haar. »Du hast Sebastian gerettet. Es war deine Schuld, dass er überhaupt in diese Lage geraten war, und du hättest uns beide zum Sterben zurückgelassen, außerdem war es reines Glück, dass der See überhaupt funktioniert hat …«, sie atmete durch, »… jedenfalls will ich Danke sagen. Dass du Sebastian gerettet hast. Du hast ihn zurückgebracht, und dafür bin ich dankbar.«
Frith räusperte sich. »Ich will niemanden von euch zu Schaden kommen lassen.«
»Wie hast du das getan? Wenn man so etwas beherrscht, kann es sehr nützlich sein.«
Frith schüttelte den Kopf und blickte in die Schwärze. »Ich bin mir nicht sicher, ob ich es dir erklären könnte, selbst wenn du in der Lage wärst, es zu erfassen. Das Wissen ist tief in meinem Kopf, und es ist, als wäre es in einer Sprache, die ich nicht entziffern kann. Manchmal wächst diese in mir schlummernde Macht und beherrscht mich, beispielsweise, als ich die Decke in der Zitadelle habe einstürzen lassen, oder als ich den Ritter geheilt habe.«
»Und du hast uns von Krete hierhergebracht.«