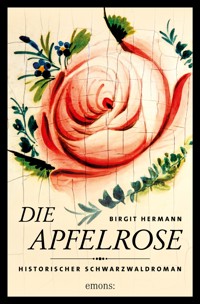Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Historischer Schwarzwaldkrimi
- Sprache: Deutsch
Marie, Tochter des Glasvogts und Mutter eines unehlichen Kindes, erlernt von ihrem Onkel die Kunst wertvolles Glas herzustellen. Sie träumt davon, die erste weibliche Aschenbrennerin zu werden. Auch Wiltrudis, Priorin des Klosters Berau, steht vor einer großen Herausforderung. Sie will sich auf die Suche nach ihrem tot geglaubten Sohn begeben. Doch die Plände der beiden Frauen drohen zu scheitern - denn ein Mörder auf Rachefeldzug kreuzt ihren Weg....
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 646
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Birgit Hermann ist gebürtige Schwarzwälderin, lebt in Titisee-Neustadt und liebt die blauen Höhen und dunklen Wälder ihrer Heimat. Die Mutter dreier erwachsener Kinder arbeitet als Laborantin in einer Klinik und hat bereits mehrere erfolgreiche Romane veröffentlicht.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
©2016 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: photocase.com/daniel.schoenen, shutterstock.com/Giraphics, shutterstock.com/ilolab Umschlaggestaltung: Nina Schäfer Lektorat: Susann Säuberlich, Neubiberg eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-96041-104-8 Historischer Schwarzwaldkrimi Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
Ein eigenwilliges Bergvolk waren sie, die Glasmacher. Ihre Schädel waren undurchsichtig wie die grünlich schimmernden Glasklumpen, die sie zuweilen aus ihrem Ofen zogen. Kaum an der frischen Bergluft, erstarrten diese und erinnerten in ihrer Festigkeit an einen Felsbrocken. Besser, man hatte nicht zu oft mit diesem starrsinnigen Volk zu tun.
PROLOG
Er hätte nicht die Hand vor Augen gesehen, selbst wenn es ihm möglich gewesen wäre, diese zu öffnen. Das Schneetreiben hatte sich seit Einbruch der Dunkelheit weiter gesteigert. Die Eiskristalle trafen ihn waagrecht im Gesicht wie kleine Glassplitter, seine Augenlider schmerzten.
Nur nicht stehen bleiben, oder noch schlimmer, sich einfach in den weichen Schnee fallen lassen, liegen bleiben. Es wäre ein gnädiger Tod gewesen. Doch er hatte sich nicht durch die Wildnis gekämpft, um jetzt aufzugeben. Er war seinem Häscher mehr als einmal entkommen. Knapp entkommen. Sollten ihn jetzt die Naturgewalten in die Knie zwingen?
Er hatte das Tal der Alb verlassen, als das Licht diffuser und der Sturm immer heftiger wurde. Gehofft, auf dem Höhenrücken im Schutz der Bäume besser voranzukommen. Nach seinen Berechnungen hätte er das nächste Kloster, St.Blasien, in einem Tagesmarsch erreichen sollen, Berau in zwei und Klingnau in drei.
Doch auch hier oben versank er mit jedem Schritt bis fast zu den Hüften im Neuschnee. Um die Füße gegen die Kälte zu schützen –er trug nur Sandalen–, hatte er schon vor Tagen seinen wollenen Habit bis zu den Oberschenkeln in Streifen gerissen und die Beine bis zu den Knien bandagiert. Unter seiner zerrissenen Kutte trug er glücklicherweise noch ganz normale bürgerliche Kleidung. Die Kapuze hatte er tief ins Gesicht gezogen. In der Wildnis war es einerlei, ob er als Bürger oder Mönch auftrat. Hauptsache, er entkam lebend dieser weißen Hölle.
Plötzlich rutschte er einen Abhang hinunter und fand sich auf festem Untergrund wieder. Er beschirmte seine Augen. Schemenhaft konnte er einen Weg ausmachen. Einen Trampelpfad. Er glaubte, eine Siedlung vor sich zu erkennen, Hütten. Das konnte unmöglich sein. Seine Landkarte hatte für diese Gegend nur unbewohnte Waldgebiete eingezeichnet. Hatten ihn seine Sinne getäuscht? Gaukelte ihm sein Unterbewusstsein eine Scheinwelt vor, hatte er die reale Welt schon verlassen?
Mehr wankend denn gehend erreichte er den unwirklichen Ort. Hatte er gerufen, oder erwartete man ihn bereits?
Ein Tor öffnete sich, ein riesiges Feuer prasselte, er konnte die Hitze auf der Haut schmerzhaft spüren.
Kleine Männlein mit spitzen Filzhüten zerrten an ihm, schleiften ihn zum Feuer. Waren es Teufel, die ihn ins Höllenfeuer werfen wollten?
KAPITEL 1
Noch herrschte Stille über dem Wald– ein kurzes Innehalten der Natur im Übergang von Nacht zum Tag. Die Jäger der Dunkelheit waren verstummt, die Tiere des Morgens harrten im Unterholz, als warteten sie auf ein heimliches Zeichen, das den Beginn der Dämmerung einläutete.
Ein schwacher Silberstreif am östlichen Horizont zeichnete die Spitzen der Tannen immer deutlicher gegen den funkelnden Sternenhimmel ab. Schemenhaft ließen sich die Umrisse des Glasmacherdorfes im Windbergtal hoch über St.Blasien ausmachen. Die tief gezogenen Dächer der Schwarzwaldhäuser duckten sich an die steilen Halden, als müssten sie sich vor einem unsichtbaren Feind verstecken.
In der Mitte des Ortes lag das pulsierende Herz der Siedlung, die Glashütte. Die Wohnhütten hielten respektvollen Abstand vor dem Hitze und Funken speienden Ungetüm des Waldes. Es schlief nie.
Von diesem Schmelzofen hing die Existenz des ganzen Dorfes ab. Ging die Keimzelle des Lebens aus, verschwand die Siedlung. Das geschah alle paar Jahrzehnte, dann, wenn der Feuerschlund alles um sich herum kahl gefressen hatte.
Noch brannte im Inneren der Glashütte das ewige Feuer, blubberte und brodelte die schmelzende Masse in den irdenen Häfen. Die rote Glut der Ofenlöcher tauchte den ganzen Raum in ein diffuses oranges Licht, das durch die Fenster und Türritzen in die Nacht hinaus schimmerte. Es wirkte von Weitem, als stünde die ganze Hütte in Flammen. Ging die Tür, weil einen der Wachhabenden die Notdurft plagte, hörte man das Prasseln der auflodernden Flammen, die durch den Luftzug neue Nahrung bekamen.
Die Schürbuben hatten die ganze Nacht gewacht und Holzkohlen nachgelegt. Das Gemenge in den Tonhäfen über den Feuerlöchern war nun geschmolzen. Die Jungs behielten die zähe, nahezu glühende Masse genau im Auge. Nicht mehr lange, und sie war aus dem Sande, was bedeutete, dass sich die letzten Sandkörner unter der Einwirkung der Hitze auflösten. Dann war es Zeit für das Klopfen. Die Glasbläser wurden geweckt. Die ideale Zeitspanne für die Ausarbeitung war sehr kurz, sie durften sie nicht verschlafen.
***
Marie, die Tochter des Glasmachermeisters Michael Sigwarth, schreckte im Bett hoch. Irgendetwas hatte sie geweckt. Noch ehe sie überlegen konnte, ob sie nur geträumt hatte, hörte sie es wieder. Ein feines »Pling«. Es war nicht das dumpfe Klopfen der Schürer gegen die Brettertür, jenes Geräusch kannte sie seit ihrer Kindheit und registrierte es höchstens noch im Unterbewusstsein. Es klang, als werfe jemand Steinchen gegen die Glasscheiben.
Marie vernahm im Raum nebenan, der elterlichen Schlafkammer, schlurfende Schritte Richtung Fenster, das sogleich aufgeschoben wurde. Sie huschte, neugierig geworden, ebenfalls aus dem Bett, ihre Schwestern schliefen noch.
Das Fenster der Mädchenkammer klemmte, so konnte Marie zwar die Stimme des Vaters vernehmen, der sich im Augenblick wohl aus dem Fenster lehnen musste, aber sie verstand seine Worte nicht. Abgehackte Gesprächsfetzen drangen von unten nach oben.
Auch wenn sie sich auf die Zehenspitzen stellte, konnte Marie die Person unterhalb des Fensters nicht ausmachen. Das Fenster mit Gewalt zu öffnen hieße, das halbe Haus zu wecken und den nächtlichen Besucher zu warnen. Sie verharrte lauschend.
Leise ging die elterliche Schlafkammertür auf und wieder zu, kurz darauf knarzten die Stufen am Ende des Flurs. Michael Sigwarth schlich die Treppe hinunter. Normalerweise polterte er unüberhörbar.
Als sie eine Weile nichts mehr gehört hatte, öffnete Marie vorsichtig die Tür. Sie hielt die Klinke mit beiden Händen umschlossen, um das zu erwartende Geräusch zu dämmen, denn auch dieses Schloss quietschte. Sie wollte die Schwestern nicht wecken.
Auf Zehenspitzen eilte sie durch den Hausflur des Obergeschosses und blickte auf der Stirnseite des Hauses auf den Dorfplatz. Im flackernden Schein der Glashütte erkannte sie die breite Gestalt ihres Vaters. Er stand unweit des Brunnens mit dem Rücken zu ihr. Die Person, mit der er sprach, war leicht nach vorn übergebeugt, sie stand im Schatten des Vaters. Die Unterhaltung war sehr knapp.
Kurz darauf riss Michael in gewohnter Manier lautstark die Haustür auf und brüllte nach seinem Weib: »Ludwina!«
Marie schlich wieder zurück in die Kammer und spähte aus dem talwärts liegenden Fenster. Die fremde Person entfernte sich humpelnd und lief am Bächlein entlang Richtung Talausgang. Sie nahm nicht den offiziellen, breiten Weg über den Berg, sondern den kürzeren, aber gefährlicheren Schluchtensteig Richtung St.Blasien.
Marie hielt den Atem an. Sie erkannte den Mann an seinem Gang. Man nannte ihn »Dubel«. Er lebte unten im Kloster und war nicht ganz gescheit im Kopf, so zumindest sagten die Leute.
***
Die Umrisse der Umgebung waren bereits deutlich zu erkennen, als der nächtliche Wanderer die Schlucht auf halber Höhe wieder verließ und entlang der Felsen eilte. Das Kloster, sein Ziel, lag an der Alb.
Noch vor dem Erwachen der Waldvögel war von dort fein wie Spinnfäden ein dünner Gesang zu vernehmen. Er durchwob sacht die allmählich weichende Dunkelheit. Der Lobgesang »Benedictus« wehte durch die Flure und klopfte an allen Zellentüren des Klosters an. Nach und nach wurde er fester und kräftiger, bald mehrstimmiger. Die Mönche waren erwacht.
Der Ankömmling glitt ungesehen in den Chorraum.
Psalm50 folgte bereits im Wechselgesang. Die morgendliche Andacht begrüßte diesen neuen Tag im Herbst des Jahres 1711 wie jeden Morgen.
Wäre da nicht ein plötzliches lautes Poltern zu vernehmen gewesen, das die Ruhe zerriss, die bis eben noch im Skriptorium geherrscht hatte.
Bruder Stephanus lag am Boden, ein umgekippter Hocker neben ihm. Ein ganzer Stapel Schriftrollen regnete sogleich aus dem Regal über seinem Kopf auf ihn nieder. Die Flamme der Kerze, die auf dem schweren Eichenpult stand, duckte sich, als müsse auch sie sich vor den fallenden Dokumenten schützen. Nur um sich gleich wieder in Richtung Tür zu neigen, dem Sog nachgebend. Denn dort stand mit strengem Blick Pater Cajetano. Der klösterliche Oberrechner.
»Stephanus, was tut Ihr hier? Solltet Ihr Euch um diese Zeit nicht zur Laudes im Chorraum befinden? Stattdessen lärmt Ihr wie ein Poltergeist und liegt unter meinen Dokumenten begraben. Was habt Ihr hier überhaupt zu suchen?«
Bruder Stephanus hätte ihm die gleiche Frage stellen können. Es war klar, dass auch Cajetano nicht im Chorraum gewesen war, denn der lag außerhalb der Hörweite des Skriptoriums. Dennoch zog er es vor, Demut zu demonstrieren und wie ein ertappter Dieb mit hängenden Schultern zu schweigen. Stephanus war zwar vom Stuhl, aber nicht auf den Kopf gefallen. Großmut wäre hier fehl am Platze gewesen.
Pater Cajetano nahm dies mit Genugtuung zur Kenntnis, doch nicht nur des ergebenen Schweigens wegen. Er schielte auf die angeknackste Strebe des dreibeinigen Hockers. Seine Manipulation hatte die Wirkung nicht verfehlt, er war mit sich zufrieden.
Cajetano hatte Bruder Stephanus schon länger im Verdacht, der nächtliche Unhold zu sein, der sein Refugium heimlich aufsuchte. Das Betreten dieses abgegrenzten Teils des Skriptoriums war für Stephanus ohne die ausdrückliche Genehmigung des Paters nämlich untersagt. Ihm, Cajetano, war aufgefallen, dass manche Dinge am Morgen anders standen, als er sie am Abend hingelegt hatte.
Bruder Stephanus nahm sich seit seiner Ernennung zum Sekretarius viele Freiheiten heraus, was das Herumschnüffeln im Skriptorium und in der Bibliothek betraf. Zu viele, für Cajetanos Geschmack. Vermutlich studierte er nachts heimlich die Akten, nur mit dem Ziel, vor dem Abt zu glänzen und ihm, dem klösterlichen Oberrechner, das Wasser abzugraben. Doch so leicht ließ er sich nicht aus dem Amt vertreiben. Da konnte Abt Augustinus den scheinheiligen Bruder zehnmal belobigen. Der Oberrechner war noch immer er, Cajetano. Und diese frühmorgendliche Runde des Schlagabtausches ging an ihn, hatte er den Bruder doch überführt.
Cajetano wippte siegessicher auf den Zehenspitzen, eine Angewohnheit, die ihn in brenzligen Situationen um ein paar Nuancen größer wirken ließ, denn er war von der Natur um eine halbe Haupteslänge betrogen worden.
»Oh, oh, Pater Cajetano, ich weiß, dass es sich nicht schickt zu so früher Stunde, aber ich wollte Euch eine Freude machen und unsere Reise vorbereiten. Die Landkarte über die Waldgebiete am Schluchsee. Ich kann sie nicht finden.« Stephanus hatte noch nie gut gelogen. Ein Anflug von Verlegenheit hauchte ihm einen roten Schimmer auf die runden Wangen.
»Hier werdet Ihr sie auch nicht finden. Die Landkarten sind dort drüben.« Cajetano deutete mit seinem ausgestreckten Finger an die gegenüberliegende Wand. »Und jetzt raus hier.«
Bruder Stephanus hatte sich aufgerappelt und versuchte recht ungeschickt, die Schriftrollen vom Boden aufzusammeln.
»Lasst das liegen, Ihr seid noch imstande und zertrampelt meine wertvollen Dokumente.« Der Finger des Paters deutete unmissverständlich in Richtung Tür, woraufhin Bruder Stephanus die Rollen erneut auf den Boden fallen ließ und wie ein gescholtenes Kleinkind davontrottete.
Cajetano atmete erleichtert durch. Stephanus war zwar ein Zahlengenie, aber auch ein Chaot. Wo er war, hinterließ er eine Spur der Verwüstung. Zumindest empfand Pater Cajetano das so. Nichts war mehr so, wie es war, seit diese Dampfwalze Zutritt zur Bibliothek hatte. Stephanus war keine Schriftrolle heilig, nicht einmal die alte Stammurkunde aus dem Jahre 983, die man wie eine Reliquie in einer geschnitzten Schatulle aufbewahrte. Dass er sie in den Händen gehabt hatte, war eindeutig. Seine klebrigen Fingerabdrücke waren auf der Außenseite des Behältnisses zu sehen gewesen. Klebrig vom Beerenmus, von dem er zuvor in der Küche genascht haben musste.
Das war auch schon seine zweite Unart, das Essen. Oder sollte man eher Fressen sagen? Denn nichts anderes war es, wenn Stephanus schmatzend und schlürfend am Tisch saß, nicht ahnend, dass er damit seine primitive Abstammung bekundete.
Cajetano schauderte, wenn er daran dachte. Und doch musste er ihn erdulden, Abt Augustinus hielt große Stücke auf den Trampel. Bisher war er der alleinige Herrscher in diesen Archiven gewesen. Er, Pater Cajetano, der klösterliche Oberrechner und die rechte Hand des Abts Augustinus. Bisher, doch dieser bäuerliche Emporkömmling mischte sich immer wieder in seine Abrechnungen und Verträge, um dem Abt stehenden Fußes Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten. Sein Feingefühl dem älteren Oberrechner gegenüber glich dabei dem eines verirrten Wildschweins in einem Rosengarten. Einem gepflegten und gehegten Rosengarten.
Jede alte Niederschrift war eine empfindliche Blüte, jede Zeichnung eine Knospe. Doch davon verstand diese gezähmte Kreatur nichts, unter der Mönchskutte steckte noch immer das Wildschwein.
Deshalb hatte Cajetano begonnen, die kirchlichen und weltlichen Schätze zu schützen– auf seine Art. Niemand wusste davon, nicht einmal der Abt, die Lichtgestalt von St.Blasien. Der am allerwenigsten, denn sein Licht war ein Blendwerk.
Eigentlich hätte Stephanus wissen müssen, wo die Landkarten lagerten. Er hatte sie vor einigen Monaten selbst vom Arbeitspult ins Skriptorium geräumt. Was hatte er wirklich gesucht?
Cajetano rollte das Dokument, das Stephanus aus den Händen geglitten war, auf. Er warf einen flüchtigen Blick darauf. Der letzte Pachtvertrag mit den Glasmachern. Unterzeichnet vom Vorgänger Augustinus’, Abt Romanus. Der Vertrag trug das Datum vom 9.August 1684. Als Glasermeister hatten damals unterschrieben: Vogt Michael Sigwarth, dessen Bruder Josef, Michael Schmidt, der zugleich als Wirt fungierte, dessen Bruder Conrad, Barde Rogg, Samuel Hug und Georg Greiner. Das Nutzungsrecht des Waldes beim Wittemle im Windbergtal war laut diesem Abkommen auf dreißig Jahre vergeben worden. In drei Jahren würde es auslaufen.
Leben kam in den klösterlichen Oberrechner. Bruder Stephanus konnte ihm viel erzählen, aber es war kein Zufall, dass ihm ausgerechnet heute der Vertrag der Glasmacher auf den Kopf gefallen war. Heute, da das Treffen mit den Glasmachern stattfinden sollte.
Cajetano drehte die Rolle ganz auf. Das Schriftstück von Abt Augustinus, das die Bitte der klösterlichen Glasmacher um Verlängerung der Nutzungsrechte ablehnte, fehlte. Die Glasmacher waren nur die Pächter. Diese Absage war der Gegenstand des heutigen Treffens. Die Wälder am Wittemle waren durch den Hüttenbetrieb nahezu abgeholzt, der Boden gerodet und somit bereit für Ackerbau und Viehzucht. Das Kloster plante, zehntpflichtige Bauern anzusiedeln. Um diese in die entlegenen Ecken zu locken, war es den Zuzüglern möglich, die Lehensgüter käuflich zu erwerben. Ein Novum in der Geschichte des Klosters. Hörige, die Besitz erwerben konnten!
Cajetano wusste, ginge es nach Augustinus, würde er das Gesetz wieder rückgängig machen. Doch der Abt konnte sich nicht noch mehr Ärger mit seinen Untertanen leisten.
Die Möglichkeit, sesshaft zu werden, war auch einigen Familienmitgliedern der Glassippe willkommen, denn nicht alle konnten oder wollten Glasmacher werden. So hatten sich schon manche im Vorgängerdorf Althütte eingekauft. Die restlichen Baumbestände mussten vor den Holz fressenden Öfen der Glasmacher bewahrt werden. Ohne Brennholz wäre auch das Überleben der Bauern nicht möglich. Es ging dem Kloster um Wirtschaftlichkeit und effektivste Nutzung.
Nordwestlich des Schluchsees gab es noch nahezu unberührte Urwälder, die ideale Bedingungen für die Glasmacher boten. Man musste den Glasvogt nur überzeugen. Ein schwieriges Unterfangen, was eher an der Person als an der Lage des neuen Platzes lag.
Cajetano wusste zwar nicht, was Stephanus mit dem verschwundenen Vertrag im Sinn hatte, dennoch fühlte er sich hintergangen.
»Von wegen Landkarte. Warte nur, du scheinheiliges Bauernbürschchen, dich führe ich vor!« Er ballte seine Rechte zur Faust und drohte lautstark gegen die halb offene Tür, wissend, dass der Sekretarius schon längst das Weite gesucht hatte.
***
Michael, der jüngere Neffe des damaligen Glasvogts Michael Sigwarth, hatte das Amt des Ortsvorstandes heute inne. Er hatte soeben eine wichtige Nachricht erhalten und polterte die Stiege hoch.
»Weib«, rief er und stieß seine noch schlafende Frau unsanft an, »wo ist mein Wams!«
Ludwina reckte den Kopf. »Wo soll es sein? Dort, wo es immer ist. Über dem Stuhl.« Sie drehte sich um und zog die Decke weit über die Ohren, es war noch nicht ihre Zeit. Doch die Ruhe währte nicht lange.
»Ich meine mein ledernes. Es ist kühl heute Morgen«, sagte Michael unwirsch.
»Herrgott, es ist noch Nacht. Was weiß ich. Fragt Marie, sie sollte das Lederzeug fetten.« Ludwina hoffte, den frühmorgendlichen Plagegeist erst einmal loszuhaben, sollte seine Tochter sich kümmern.
Schnaubend zog der Glasmachermeister aus der Ehekammer, stieß die Tür zur Mädchenkammer auf und brüllte: »Marie! Meine Weste!«
Die Angesprochene hob scheinbar verschlafen den Kopf, so als sei sie eben erst aufgewacht. Mit ihr reckten sich drei weitere Blondschöpfe aus den Kissen. Zerwühlt und orientierungslos, da aus tiefstem Schlaf gerissen.
»Euer Lederwams, Vater? Das müsste noch in der Truhe sein. Ihr hattet es diesen Herbst noch nicht an. Wozu, wenn ich fragen darf, braucht Ihr es heute in aller Frühe?«
Marie versuchte, so nebensächlich wie möglich zu klingen, aber sie brannte darauf, zu erfahren, was der Dubel zu solch früher Stunde im Dorf zu vermelden gehabt hatte.
»Dass ich es noch nicht anhatte, weiß ich selbst«, fuhr ihr Vater sie an. »Die Herren vom Kloster kommen. Schnell, es war wohl deine Aufgabe, mein Wams herzurichten!«
Marie wusste auch ohne in der Dunkelheit Einzelheiten ausmachen zu können, dass seine Halsvene bereits dick angeschwollen war. An Schlaf war nicht mehr zu denken, ehe der Vater sein Begehren nicht erfüllt bekam. So kroch sie aus dem Bett.
Den Auftrag, das Wams des Glasmachermeisters herzurichten, hatte sie zwar nie erhalten, wie auch, bis eben wusste noch niemand vom heutigen Aufkreuzen der Klosterherren. Es nützte jedoch nichts, sich zu rechtfertigen, ihre Stiefmutter würde es sowieso abstreiten.
Ein Blick durch die hellen, kostbaren Butzenscheiben, ein Privileg ihres Familienstandes, zeigte ihr im ersten anbrechenden Tageslicht, dass die Scheiben gefroren waren. Sie ging dem Vater voraus und öffnete die Truhe, die im Flur zwischen den Schlafkammern stand. Er leuchtete ihr mit einer Kerze.
»Hier ist Euer Wams.«
Michael Sigwarth packte die ärmellose Lederjacke mit seinen großen Pranken. Dann schmiss er sie Marie wütend vor die Füße.
»Hart wie Schuhsohle! Ist das gefettet? Soll ich etwa so vor die Klosterherren treten? Wie ein Bettler mit abgewetztem Rock? Mich der Lächerlichkeit preisgeben? Zu was habe ich eine Handvoll Weiber im Hause? Damit die sich dem Schlaf der Schönheit hingeben, während ich um die Zukunft der Glasmachersippschaft verhandle? Ist das der Dank? Schickt man mich wie einen Lumpen vor die Hütte?«
Marie atmete kurz durch und schnappte das am Boden liegende Wams, ehe der Vater sich weiter in seine Tragödie hineinsteigern konnte. Sie hätte es sich denken können: Einen Michael Sigwarth speiste man nicht mit halb fertigen Dingen ab.
Es blieb ihr keine andere Wahl, als die Weste zu fetten. Und zwar jetzt, selbst wenn vor Sonnenaufgang nicht mit dem Besuch der Gesandtschaft zu rechnen war.
Im Vorbeilaufen stieß sie die neugierigen Köpfe ihrer Schwestern in die Kammer zurück und zog die Tür zu. Mit nackten Füßen eilte sie über die kalten steinernen Bodenplatten in die Küche.
Marie öffnete das Türchen des Chuchichäschtlis, wie der Küchenschrank mit eidgenössischem Spracheinschlag auf dem Wald genannt wurde. Der Geruch von geräucherten Speckschwarten stieg ihr in die Nase. Sie griff, trotz Dämmerlicht, zielsicher danach. Die scheinbar wertlosen Reste der letzten Mahlzeit wurden sicher vor den Katzen in einem Tongefäß aufbewahrt. Nicht nur Leder wurde damit gefettet, auch die Messer und Klingen der Äxte wurden so vor Rost geschützt.
Marie setzte sich und begann, das Wams unter dem schwachen Schein der Kerze, die ihr Michael hingestellt hatte, einzufetten. Unterdessen öffnete ihr Vater das Fenster und brüllte über den Hof: »Schürer, Feuer!«
Ein etwa zehnjähriger Junge kam kurz darauf gerannt. Seine Füße waren in Felle gewickelt, seine Wangen glühten von der nächtlichen Arbeit am Ofen. In der einen Hand balancierte er auf einer Schaufel die glühenden Holzkohlestücke, unter dem anderen Arm trug er Holzscheite.
Michael hielt ihm die Tür auf. »Guter Junge«, lobte er ihn, als spräche er mit einem Hund.
Während der Bub das Feuer im Ofen seines Meisters schürte, machte er selbst sich daran, den Kienspan zu entzünden. Ein warmer Schein erhellte die Umgebung.
»Soll ich Euch noch mehr Holz bringen, Meister?«
Das Feuer knisterte im Ofen, der Junge deutete eine ergebene Verbeugung an.
Michael war zufrieden. »Nein, die Mädchen müssen nachher auch noch was zu tun haben. Du kannst dir einen Apfel dort aus dem Korb nehmen«, sagte er und deutete mit dem Kopf in Richtung Obstkorb.
Als endlich Ludwina, Michaels zweite Frau, schwerfällig die Stiege herunterkam und begann, den Haferbrei zu kochen, war der Meister endgültig versöhnt. Er setzte sich an den Tisch und ließ sich das Frühstück heranschaffen. Neben Haferbrei gab es in Speck gebratene Eier, Roggenbrot, Tee und Waldbeerenmus.
Er müsse sich gut stärken, verdeutlichte Michael seiner Familie, vor ihm liege eine schwierige Aufgabe: die Suche nach einer geeigneten Bleibe für die nächsten Jahrzehnte. Dass Abt Augustinus seine Meinung ändern würde, war unwahrscheinlich.
Augustinus’ Wort war Gesetz. Und wenn er die Bitte auf Verlängerung ausschlug, gab es kein Zurück. Raubbau am Wald! So die Begründung des Klosters. Dabei hätte das Holz noch auf Jahre gereicht, wären sie nicht genötigt worden, die Produktion zu erhöhen. Genötigt vom Kloster selbst. Weißes Glas! Wo jeder wusste, dass dafür ein Vielfaches an Holz gebraucht wurde, um die reinigende Pottasche herzustellen. Die Produktion von grünem Waldglas, wie es seit Jahrhunderten im Schwarzwald Sitte war, hätte die Wälder nicht so sehr in Mitleidenschaft gezogen.
Es waren nicht nur die Reparaturen am Kloster selbst, die die Gelder verschlangen. Der Dreißigjährige Krieg hatte große Verwüstungen hinterlassen, gewiss. Kaum war jedoch der Friede im Land eingekehrt, zogen wenige Jahre darauf bedingt durch den Spanischen Erbfolgekrieg, der immer mal wieder in einer Ecke des Landes aufloderte, weitere Heereszüge durch den Schwarzwald.
Trotz der Raubzüge lag der größte Hunger nach Steuergeldern vielmehr in Augustinus’ ehrgeizigen Bauplänen begründet. Hatte der doch gleich zu Beginn seiner Amtszeit damit begonnen, den Kirchturm abtragen zu lassen. Zwei Türme schmückten nun das Münster, so wie es überall Mode war. Und weitere Umbauten waren im Gange. »Barock«, nannte man den neuen Baustil, der auch die Klöster erfasste.
Kaspar Moosbrugger, ein Laienbruder aus Einsiedeln, hatte die Pläne gezeichnet. Doch das Volk, die Bauern aus der Grafschaft Hauenstein, dessen Landgraf Augustinus ebenfalls war, begehrte auf. Sie wehrten sich gegen die immer höher werdenden Abgaben. Schon seit Jahren dauerten die Streitereien. Einmal musste Augustinus sich sogar vor diesem Mob in der St.Blasianischen Propstei in Klingnau auf eidgenössischem Gebiet in Sicherheit bringen. Zweimal weilte er aus demselben Grund im Kanton Aargau in der klösterlichen Propstei Wislikofen. St.Blasien hatte seine Güter weit gestreut. Eine Legende berichtete, dass im späten Mittelalter klösterliche Gesandte auf ihrem Weg nach Rom immer in eigenen Klöstern übernachten konnten.
Augustinus nahm es von den Lebenden, wie man so schön sagte. Darum lag es nun an ihm, Michael Sigwarth, dem Vogt der Glasmachersippe, möglichst gute Bedingungen mit den Abgeordneten des Klosters auszuhandeln, von deren Besuch er offiziell noch nichts wusste. Solche Treffen wurden meist einseitig beschlossen, doch es gab Verbündete.
Nicht nur Michaels Leben und das der Familien hingen vom Verlauf des heutigen Tages ab. Ein ganzer Tross von Arbeitern und Helfern erwartete von ihm, dass er ihre Zukunft sicherte. Und dazu gehörte, ebenso wie Verhandlungsgeschick, ein neuer guter Glashüttenplatz, der alle Voraussetzungen für wirtschaftliches Arbeiten erfüllte.
Im Geiste zählte Michael die vom Kloster aufgebürdeten Geschäftsbedingungen nochmals auf, um keine zu vergessen. Er würde die Glasmacher sicherheitshalber zur Beratung einbestellen. Zehn Köpfe dachten mehr als nur einer, auch wenn er das Oberhaupt und Sprachrohr der Gemeinschaft war. Für das nachfolgende wichtige Zusammentreffen mit den Lehensgebern brauchte Michael neben einem klaren Sachverstand auch ein tadelloses Erscheinungsbild. Dazu gehörte das lederne Wams. Kleider machten Leute.
***
Die Sonne kam bereits über den Wald, als drei klösterliche Gesandte den uralten Weg den Bötzberg hinaufritten. Allen voran der Stallmeister, in der sicheren Mitte Pater Cajetano und mit großem Abstand, so wie es einem reuigen Klosterbruder gebührte, Bruder Stephanus.
Gleich nach dem Frühgebet hatte Cajetano die Gelegenheit genutzt und sich vor den Gelehrten über die nächtlichen Einstiege in sein Heiligtum ausgelassen. Bruder Stephanus hatte die Beschimpfungen mit hängenden Schultern über sich ergehen lassen. Nur um Cajetano anschließend mit verständnislosem Blick anzustarren und ihn zu fragen, welches verschwundene Schriftstück er denn meine, er wisse von nichts. Was den Pater nicht gerade gnädiger gestimmt hatte.
Eine Raureifschicht überzog den grasbewachsenen und blätterübersäten Boden, sodass die gemächlichen Schritte der Pferde sich anhörten, als durchquerten sie ein Schneefeld: leicht klirrend und dennoch gedämpft, als zerbreche feines Glas. Der Rhythmus der Hufauftritte hatte etwas Meditatives, die Reiter schwiegen, hingen ihren Gedanken nach. Vielleicht war auch der gegenseitige Argwohn zwischen Cajetano und Stephanus ausschlaggebend für die verbale Stille.
Die Männer, allesamt Mönche, verkrochen sich in ihren wärmenden Wollfilzumhängen, stießen, wie die Pferde unter ihren Körpern, die weiße Atemluft in den stahlblauen Himmel. Es versprach, ein schöner Tag zu werden.
Ihr Ziel, die Glashütte im Windbergtal, lag in einem Talkessel nordöstlich über St.Blasien, eingeschlossen von steilen Berghängen. Der südliche Talausgang war nur über jenen schmalen Fußpfad durch die felsige Schlucht begehbar, den heute früh schon der heimliche Bote benutzt hatte.
Der Weg, der die Mönche über den Berg führte, war zwar länger als der Pfad durch die Schlucht, dafür aber bequem zu Pferd zu bereisen– ein alter Handelspfad, von mächtigen Ahornbäumen gesäumt. Deren Holz war zu kostbar, um die Öfen der Glasmacher zu schüren, es diente als Bau- und Möbelholz und stand somit unter dem Schutz des Klosters.
Dort, wo keine größeren Flussläufe den Abtransport von Holz ermöglichten, entstanden von alters her Glashütten, um dem Wald Gewinne abzuringen. Ganz anders sah es in den nördlichen Tälern, etwa im Kinzigtal, aus. Dort wurde das Holz für den Schiffsbau in den großen Werften Hollands geschlagen und von Schiltach, Gutach, Hausach und wie die Orte alle hießen, auf der Kinzig bis in den Rhein und von dort bis Rotterdam geflößt.
Die Bachläufe in den Hochlagen des südlichen Schwarzwalds waren im Vergleich zu diesen Flüssen nur Rinnsale. Dort, wo sie mächtiger anschwollen, wie etwa die Alb, waren sie wild und unwegsam. Die Flößerei war nur bedingt und in Abschnitten möglich.
Endlich erreichten die Reiter den Höhenkamm und blickten in das Windbergtal. Zäher Nebel stieg vom Bachlauf auf und begrub das Tal unter sich. Ein spätherbstliches Phänomen– sobald die Sonne die Bergspitzen und somit die oberen Luftschichten erwärmte, schlug die durch die Bachläufe feuchtigkeitsgeschwängerte Luft als Kondensat nieder und blieb in den Tälern hängen, bis die Sonnenstrahlen senkrechter standen, den Talboden erreichten und somit die Nebel binnen kürzester Zeit auflösten.
Wäre nicht der Rauch des ewigen Feuers des Glasofens knapp über dem Bodennebel aufgestiegen und hätte ihnen den Weg zur Hüttensiedlung gedeutet, sie hätten geglaubt, das Tal wäre unbewohnt. So oft waren die Klosterbrüder nämlich noch nicht hier oben bei den Glasmachern gewesen, als dass sie sich unter diesen Bedingungen ausgekannt hätten.
Ein eigenwilliges Bergvolk waren sie, die Glasmacher. Ihre Schädel waren undurchsichtig wie die grünlich schimmernden Glasklumpen, die sie zuweilen aus ihrem Ofen zogen. Kaum an der frischen Bergluft, erstarrten diese und erinnerten in ihrer Festigkeit an einen Felsbrocken. Besser, man hatte nicht zu oft mit diesem starrsinnigen Volk zu tun.
Das Drama um die Huldigung aus dem Jahre 1666 war im Kloster noch nicht vergessen. Hatten sich doch die Blasiwälder, wie sich die Waldbewohner des St.Blasianischen Waldgebietes nannten, bis dahin geweigert, dem seit zwei Jahren im Amte stehenden Abt Oddo zu huldigen und ihren Stand als Untertanen des Klosters zu erneuern, wie es Brauch war, wenn ein neuer Klostervorstand seinen Dienst antrat.
Als man sie vor den Landesherrn ins Kloster zitierte, wagte der damalige Vogt aus der Siedlung Eisenbreche, die Ausstellung der Kaufbriefe für die seit Langem gekauften Güter im Gegenzug zur Huldigung zu fordern. Was im Kloster Empörung ausgelöst hatte. Schließlich konnte man nicht anders, als die Untertanen auf die Ausstellung der Briefe wenigstens auf Kirchweih zu vertrösten, um nicht ganz das Gesicht zu verlieren, und die Blasiwälder legten endlich ihren Eid ab.
Stur, hart und kalt wie Waldglas, das war der Ruf der Glasmacher unten im Kloster. Pater Cajetano war gewappnet.
Sie gaben den Tieren die Sporen und überwanden den Bergkamm. Rösser und Reiter verschwanden einer nach dem anderen im Nebelmeer, als tauchten sie in einen See ab.
Die gedungene Gestalt, die die gespenstische Szenerie beobachtet hatte, löste sich aus ihrem Versteck im Gebüsch. Sie hatte es plötzlich eilig und humpelte in nordöstlicher Richtung durch das Unterholz dem Krummen am Ende des Schluchsee zu.
Die Augen und Ohren des Waldes hießen Justus. Doch alle nannten ihn Dubel, eine Bezeichnung, die der eines Deppen gleichkam. Diesem angehängten Status zum Trotz ließ Justus sich nicht übers Ohr hauen. Er war der leibliche Bruder von Stephanus und dieser sein Gönner und Beschützer. Er durfte im Schuppen des Klosterhofes schlafen, dort wo die Laienbrüder ihre Werkstätte eingerichtet hatten. Es war nicht sonderlich wohnlich dort, aber zumindest warm und geschützt vor Wind und Wetter sowie vor den wilden Tieren des Waldes. Ein Strohsack in der Ecke hinter der Werkbank war sein ganzer Besitz, abgesehen von den Lumpen, die er am Leibe trug. Dazu gehörte eine abgetragene Kutte eines Laienbruders. Mehr war der Dubel nicht wert. Man duldete ihn und fütterte den armen Kerl mit Küchenresten durch wie einen Hund.
Justus beklagte sich nicht, er kannte es nicht anders, auch daheim war es ihm nach dem Tod der Mutter nicht besser ergangen. Im Gegenteil, sein Vater glaubte, den Irrsinn, wie er sagte, aus ihm herausprügeln zu müssen. Schließlich hatte Stephanus den Dubel mit ins Kloster genommen. Dafür musste dieser alle unangenehmen Arbeiten und Botengänge übernehmen. Einzig Stephanus hielt ein Auge darauf, dass die Brüder es nicht zu toll mit ihm trieben. Denn auch hier war einer, der nicht in die Norm passte, minderwertig und Zielscheibe von üblen Späßen.
***
Während die drei jüngeren Sigwarth-Töchter unentwegt mit ihren einfachen Holzschuhen den ausgetretenen Pfad zwischen Holzschuppen und Küche gingen, um das Brennholz heranzuschaffen, und Marie im Stall die Ziegen molk, hatte sich Ludwina über die Reste des Frühstücks ihres Mannes hergemacht. Nun war sie die Herrin im Haus, denn ihr Gemahl hatte sich zur Besprechung mit den Meistern in die Schänke begeben, die ausnahmsweise zu solch früher Stunde geöffnet worden war. Es gab einiges zu besprechen, man musste Einigkeit demonstrieren.
»Hunger!« Martha sah ihre Mutter strafend an und ließ die Holzscheite auf den Boden fallen, als sie sah, dass sie sich den Bauch vollschlug. Martha war zwar erst drei, dennoch hatte sie schon oft genug erfahren müssen, dass man um sein tägliches Brot kämpfen musste. Und ihr kindliches Befinden sagte ihr, dass sie bereits genug getan hatte, um etwas abzubekommen.
Klara, vier Jahre älter, nahm ihre Schwester an der Hand. »Komm, noch einmal!«, sagte sie, denn der Blick der Mutter war alles andere als gnädig.
»Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Faules Weiberpack!«, rief Ludwina ihren Töchtern hinterher. Sie ließ die Klage mitschwingen, dass Gott sie nur mit unnützen Mädchen gesegnet hatte. Leider hatte es das Schicksal noch nicht vermocht, dass sie ihrem Mann einen Erben schenken konnte. Mit jeder Tochter, die das Licht des Waldes erblickte, sank Ludwinas Ansehen, so zumindest glaubte sie.
Manchmal gingen die Leute ihr aus dem Weg, um sich ihr ewiges Gejammer nicht anhören zu müssen, was sie aber als Geringschätzung ihrer Person missdeutete.
Auch die Achtung der Eheleute Sigwarth voreinander hatte im Laufe der Jahre gelitten. So kam zur Klage über die Töchter auch noch das Leid der unglücklichen Ehe hinzu. Ludwina verfiel zunehmend in Selbstmitleid, Antriebsarmut und Fresssucht. Der einzige Respekt, den sie sich verschaffte, lag darin, über die Töchter und noch mehr über die Stieftochter zu herrschen.
Franziska, die Mittlere der drei jüngeren Mädchen, ein sehr feinfühliges Kind, sah ihre Mutter mitleidig an. Sie wusste, dass sie den Kummer »hinunterschlucken« musste. Was auch immer die Mutter damit meinte, es musste etwas Schlimmes sein. Vielleicht etwas, das im Hals steckte und nie mit hinunterrutschte. Franziska stellte sich ein quer liegendes Holzscheit vor. Das wäre schlimm genug. Der Leib ihrer Mutter war vom vielen Hinunterschlucken inzwischen schon ganz füllig geworden.
Franziska litt mit der am Tisch sitzenden und würgenden Ludwina.
»Weib!«, brüllte es abermals durch den Nebel von der Schänke herüber.
Ludwina, die sich bei ihrer Fressattacke ertappt fühlte, fuhr in die Höhe und stieß dabei die Schüssel mit frischer Ziegenmilch um, die Marie soeben abgestellt hatte. Martha brüllte ob ihres vergossenen Morgenmahls.
Michael stürzte herein, überblickte die Szenerie und schrie seine aufgeschreckte Frau an: »Du würdest dem Teufel noch den Schwanz wegfressen, hast du auch noch was anderes im Sinn? Die Mönche sind schon über den Bötzberg gekommen, los, richte mir ein Vesper, wir werden wohl mit ihnen aufbrechen müssen.« Er blickte sich zu den verängstigt dreinschauenden Mädchen um. »Und ihr? Habt ihr auch nichts weiter zu tun, als um das Essen zu brüllen? Ihr seid schon wie eure Mutter!«
Er schlug mit der Faust auf den Tisch, um sich Respekt zu verschaffen. Dabei fiel der Teller mit den letzten Speckeierresten zu Boden.
Ludwina ließ sich zwar viel gefallen, aber wenn es um das Essen ging, erwachte in ihr die Furie. Sie warf ihre mächtigen Arme angriffslustig in die Luft.
Was das zu bedeuten hatte, wollte Marie lieber nicht wissen. Sie zog ihre Stiefschwestern mit nach draußen.
Ihr Blick fiel auf das Aschenhaus, dort glaubte sie sich in Sicherheit, bis der Sturm im Haus wieder abgeebbt war. Mit großen Schritten eilte sie, Martha auf den Hüften tragend, auf das Gebäude zu, während ihre Stiefmutter keifte und ihr Vater brüllte. Klara und Franziska folgten ihr schweigend. Es war nicht das erste Mal, dass sie zum alten Pottaschesieder flohen.
Die Tür zum Aschenhaus war nur angelehnt. Es war der Brandgefahr wegen neben der Glashütte das einzige Gebäude aus Stein und stand ebenfalls in gebührendem Abstand zu den anderen Hütten und Häusern.
Ehe Marie anzuklopfen wagte, hielt sie inne, denn sie vernahm eine fremde Stimme aus dem Inneren. Bereits das zweite Mal an diesem Morgen wurde sie Zeugin eines heimlichen Besuches. Dieses Mal konnte es nicht der Dubel sein, der sich mit abgehackten Sätzen und gurrenden Lauten kundtat. Eine angenehme Stimme drang an ihr Ohr. Die eines jungen Mannes.
***
Lautes Rufen ließ den Vogt Michael Sigwarth unter die Tür der Glashütte treten, sein frisch gefettetes ledernes Wams glänzte im flackernden Licht des Schmelzofens. Eine imposante Erscheinung. Niemand, der sich bei der Arbeit am Glasofen auskannte, hätte geglaubt, dass Michael in seinem stattlichen Aufzug geradewegs von der Arbeit an seinem Stand des Ofens kam. Er wäre in seinem Lederwams schlichtweg vor Hitze eingegangen, zumindest hätte er schweißnass sein müssen. Doch das wussten die Besucher nicht. Für sie war er das Oberhaupt der Glashütte, das geradewegs von der Arbeit weggerufen worden war. So sollte es auch wirken– überrascht.
Michael blickte verwundert von einem zum anderen, so, als habe der Glasmachermeister Besseres zu tun, als die Brüder aus St.Blasien zu empfangen. Sein Blick streifte kurz Bruder Stephanus, einen nahen Verwandten seiner ersten Frau, und als dieser ergeben sein Haupt senkte, musste Michael innerlich grinsen. Beide wussten nun, die Botschaft war angekommen. Michael war dank Stephanus’ Boten nicht unvorbereitet vom klösterlichen Oberrechner überfallen worden, hatte Zeit gehabt, seine Forderungen zu überdenken.
»Seid Ihr Michael, der Glasmachermeister?« Cajetano räusperte sich, seine Stimme war von der morgendlichen Kälte belegt und klang, wie er selbst glaubte, nicht eindringlich genug.
»Was ist Euer Begehr, Pater?«, fragte Michael unwirsch. Seine massige Erscheinung hätte genügt, dass Cajetano diesem Kerl lieber nicht allein im Wald begegnet wäre. Um nicht zu dem Untertan aufschauen zu müssen, blieb er im Sattel sitzen.
Zu Michaels Statur kam sein wildes Aussehen hinzu. Die Haut seines Gesichts war von der Arbeit am heißen Ofen in Mitleidenschaft gezogen. Mehrere Vernarbungen, entstanden durch Verbrennungen, sei es durch herausschießende Kohlestücke am Ofenloch oder Hitzeblasenbildung durch zu langes Stehen am Ofen, hatten sein Gesicht entstellt. Wie das der meisten Glaser war es rot. Hinzu kam, dass die Glaser dem Alkohol nicht abgeneigt waren. War ihnen doch als einziger Zunft das Bierbrauen erlaubt, um der schweißtreibenden Arbeit am Ofen gerecht zu werden.
»Ich habe Order, Euch und Eurer Sippe ein neues Gebiet zuzuweisen. Ihr wisst, dass Abt Augustinus Euer Begehren, den Pachtvertrag zu verlängern, abgelehnt hat. Sattelt Euer Pferd und folgt uns. Der Obervogt aus Bettmaringen erwartet uns bereits.«
»Ist es im Kloster üblich, rechtschaffenes Volk wie Hunde von ihrer Arbeit abzukommandieren?« Michael war noch nicht gewillt, der Forderung Folge zu leisten.
Cajetano hoffte, dass er nicht darauf bestand, die schriftliche Ablehnung vorgelegt zu bekommen. Es hätte ihn in Bedrängnis gebracht. Er war sich nicht einmal sicher, ob der Vogt des Lesens überhaupt mächtig war. »Im Kloster ist Gehorsam und Demut oberstes Gebot, Meister Michael. Etwas von beidem würde Euch gut stehen. Oder wagt Ihr, gegen Euren Landesherrn aufzubegehren? Eure Sippe…«, er machte eine ausladende Handbewegung, denn das ganze Hüttendorf stand inzwischen im Halbkreis vor der klösterlichen Abordnung, »wird Euch Eure Großspurigkeit nicht danken, wenn sie Arbeit und Brot verliert. Ihr und Euer armseliges Dorf seid auf die Gunst des Abts angewiesen.« Es konnte nicht schaden, dem mächtigen Glasermeister etwas Respekt vor dem Klerus einzubläuen.
»Mich dünkt, als sei der Abt auf unsere kostbaren Gläser und unsere Abgaben angewiesen«, konterte Michael, noch immer nicht kleinlaut geworden, denn er wusste seine Meister und Arbeiter hinter sich.
»Ihr werdet für Eure Arbeit entlohnt und habt weitere Vergünstigungen.« Cajetano ließ sich nicht aus dem Konzept bringen.
»Wir bezahlen für die Glashütte und den Wald unseren jährlichen Zins von zweihundert Gulden«, sagte Michael. »Dazu noch den Zins für die Nutzung der Wiesen und Kräutergärten. Und das für jeden Meister. Weiterhin verlangt Ihr für die angebauten Früchte wie Flachs, Hanf, Rüben, Roggen, Hafer und dergleichen den großen, den kleinen und den Martinszehnten. Sogar die Anzahl unserer Tiere, die wir halten, schreibt uns das Kloster vor. Dreimal im Jahr muss sich jeder Meister für einen halben Tag zur herrschaftlichen Jagd zur Verfügung halten. Nicht einberechnet das Ehrtauen, der Frondienst im Heuet, das sind nochmals zwei Tage zur Erntehilfe. Weiterhin muss jeder unserer zehn Stände jährlich dreihundert Glasscheiben mittlerer Qualität und ein Dutzend reine Glaskelche liefern. Außerdem muss jeder unserer Glasmeister weitere drei Tage als Glasfensterbauer im Kloster arbeiten. Monatlich zahlen wir seit den Kriegstreibereien im Dreißigjährigen Krieg zehn Gulden Kontribution. Nicht einmal unser hochwertiges Glas dürfen wir selbst verkaufen, wir müssen es jeden Samstag im Kloster abgeben.«
»Was Ihr bezahlt bekommt, denn das Kloster hat das Vorkaufsrecht«, erwiderte Cajetano. »Die einfachen Gutteren und Euer Tonbrennzeug dürft Ihr ja eigenständig vermarkten. Dazu seid Ihr von der Landwehr befreit und dürft eine Schänke betreiben, ohne für Euch und Eure Leute oder Durchreisende Umgeld bezahlen zu müssen.«
»Wofür wir aber Taferngeld bezahlen. Die Umgeldbefreiung habt Ihr uns nur im Gegenzug zum fünfzigprozentigen Hüttenzinsaufschlag im Jahre 1671 gewährt. Ihr schenkt uns nichts, Pater. Also, was ist Euer Angebot.« Michael schnaubte, er hatte dem Pater verdeutlicht, dass man nicht willens war, jedes beliebige Gebiet anzunehmen, es musste also schon Vorteile bieten. »Wo sollen wir Eurer Meinung nach hinziehen?«, setzte er einen Ton ergebener hinzu, um die Verhandlungen in seinem Sinne in Gang zu bringen. Er wollte das Tempo bestimmen, darum gab er dem Stallburschen ein Zeichen, der kurz darauf mit einem gesattelten Pferd erschien.
»Wie ich schon sagte«, führte Cajetano aus, dem dämmerte, dass der Vogt vorbereitet war, »wir treffen uns mit dem Obervogt, beim Krummenhof am See. Also folgt mir und dem Gebot des Klosters, so wie es Eure Altvorderen schon immer getan haben, wenn das Umland kein Holz mehr hergab. Ihr werdet Eure Hütten und Ställe stehen lassen für die Siedler. Wer hier bleiben will, kann selbst eine der Hütten erwerben und sich niederlassen. Der Abt hat Anfragen von Glasermeistern aus Böhmen. Er wird sich also nicht die Bedingungen aufpressen lassen.« Pater Cajetano schwieg und lenkte sein Pferd wieder den Berg hoch. Nun hatte auch er seinen Trumpf aus dem Ärmel gezogen.
***
Noch während die klösterliche Abordnung auf dem Vorplatz mit dem Glasmachermeister feilschte, erkannte Marie im Innern des Aschenhauses die Stimme des alten Theis und verharrte einige Augenblicke. Er war ihr Onkel, der Bruder ihrer verstorbenen Mutter. Eine wichtige Person im Dorf, die nicht nur den Nichten Schutz bot, wenn der Haussegen der Sigwarths mal wieder schief hing. Er war auch der Aschenbrenner und Pottaschesieder. Ohne sein Wissen wären die Glasmacher unfähig gewesen, ihren Beruf auszuüben. Theis genoss hohes Ansehen. Marie war stolz, diesen wichtigen Mann als Onkel und Beschützer zu haben.
Nur ein Pottaschesieder kannte das Geheimnis, wie man aus grünem Waldglas reines weißes Glas herstellen konnte. Sein Aschenhaus war ein Laboratorium, in welchem er die unterschiedlichen Zusätze, die Glasseifen, herstellte. Niemand hatte zu seiner Giftkammer Zutritt. Sie war mit einem Schloss versehen, dem einzigen im Dorf.
In seinem Beisein hatte Marie hin und wieder zuschauen und auch schon selbst die Glasseifen mischen dürfen. Es kam ihr wie Zauberei vor, wenn Theis die Pulver mischte und dem flüssigen Glas die Farbe nahm. Doch diese Weisheit sah man dem alten, gebückten Mann nicht an. Dass die Zusätze, mit denen er hantierte, nicht unproblematisch waren, hingegen schon. Sein Körper war ausgemergelt, er selbst wirkte blass und blutleer. Seine Fingernägel wiesen weiße Streifen auf, und er litt an der Hüttenkrätze, einem chronischen Hautausschlag. Das lag am Arsenik, das er inzwischen dank der neuen Methode nur noch ganz selten verwendete.
Die Asche der Buchen diente den Glasmachern als Flussmittel, das den Quarzsand, der normalerweise erst bei tausendsiebenhundert Grad schmilzt, bereits zwischen siebenhundertfünfzig und tausend Grad verflüssigte.
Aber es war nicht nur Theis’ Aufgabe, diese Asche herzustellen. Durch ein aufwendiges Verfahren konnte er aus der einfachen Holzasche reine Pottasche brennen. Man nannte den Vorgang auch Calcinieren. Diese Methode war erst seit der zweiten Hälfte des 17.Jahrhunderts gebräuchlich. Zuvor hatte man hauptsächlich Arsenik zur Bereinigung des Grünstichs verwendet, der auf das Vorkommen von Eisenverbindungen im Quarzsand zurückzuführen ist.
Marie schob die Tür des Aschenhauses einen Spalt weiter auf, um zu sehen, mit wem Theis gesprochen hatte.
Martha, auf ihrer Hüfte sitzend, begann ungeduldig zu plärren: »Onkel Theis!«
Sie waren entdeckt. Eine Tür schlug.
Theis begrüßte die Mädchen freudig, wenn auch etwas überrascht.
»Mit wem hast du gesprochen?«, fragte Marie. Sie war von Natur aus neugierig.
»Ich, gesprochen? Ich habe mit niemandem gesprochen, oder siehst du jemanden?« Theis drehte sich im Kreis, als suche er einen imaginären Besucher. »Ah«, meinte er dann und schlug gegen die Bretterwand, »der Geißbock! Ich habe mit ihm gesprochen.« Er schaute die amüsierten Blondschöpfe an und schlug nochmals gegen die Wand. »Du alter Bock, du, Ruhe jetzt mit dem Gemecker!«
Martha kicherte, Marie setzte sie ab und beließ es dabei. Wenn Theis ihr nicht sagen wollte, wer bei ihm gewesen war, hatte er seine Gründe. Sie würde es herausbekommen.
Die Dreijährige polterte mit ihren Holzschuhen unbeirrt zum Esstisch, auf dem zwei Gläser standen. Stangengläser, die mit ihren Noppen und der handbreiten Größe auch dann noch gut in der Hand lagen, wenn ihre Benutzer schon kräftig dem Inhalt zugesprochen hatten. Most oder auch selbst gebrautes Bier wurde daraus getrunken.
Marie verkniff sich die Frage, ob der Ziegenbock neuerdings auch aus Gläsern trank. Um ihren Onkel nicht in Verlegenheit zu bringen, vermied sie direkten Blickkontakt.
Martha setzte an, den Rest aus einem Glas zu trinken. Sie verzog kurz das Gesicht, dann verlangte sie mehr.
»Habt wohl noch nichts bekommen, wie?«, sagte Theis und zwinkerte den Kindern zu. An Marie gewandt, meinte er: »War ja nicht zu überhören, das Gebrüll drüben im Haus Sigwarth. Nun, Most ist wohl nichts für die Kinder. Aber der Onkel Theis hat auch noch Apfelsaft!« Er war froh, von seinem Besucher ablenken zu können, eilte um die Ecke und kam mit einem bauchigen Glasgefäß, einer Guttere, in der eine leicht bräunliche, schäumende Flüssigkeit schwappte, wieder. Das bedeutete, der Apfelsaft hatte schon gezogen. Dennoch vereinbarte Theis mit einem stummen Blickaustausch mit seiner Nichte, die Mädchen nicht zu enttäuschen.
Gierig tranken sie den Apfelsaft. Theis, dem die Folgen bewusst waren, bemühte sich, jedem der Mädchen noch einen Kanten Brot auf den nüchternen Magen zu reichen. Es dauerte trotzdem nicht lange, bis sie wankend einen Schlafplatz neben dem warmen Aschenofen suchten.
Marie spürte ebenfalls die Schwere in den Beinen, dennoch half sie Theis beim Auslaugen. Endlich hatte sie den alten Mann für sich.
Sie ließ sich die Arbeitsgänge erklären und passte gut auf. Sie wollte unbedingt wissen, wie man die grünliche Farbe aus dem Glas bekam und warum das so war. Jedes lobende Wort ihres Onkels fiel auf fruchtbaren Boden und spornte sie weiter an. Anerkennung für ihre Arbeit gab es im Hause Sigwarth nie. Auch das war ein Grund, warum sie lieber Theis half.
Mit Eifer füllte sie die Asche in mit Leinen ausgeschlagene Weidenkörbe, stellte diese über die Laugbütte und übergoss das Ganze mit kaltem Bachwasser. Nun musste das Wasser nur noch durchsickern.
Theis stemmte die in den kleinen Auffangbütten gewonnene kalte Lauge zum großen Eisenkessel über dem Feuer und kochte sie. Mutterlauge wurde die Flüssigkeit genannt, die nun stundenlang vor sich hin köchelte, bis das Wasser verdampft, das zurückgebliebene Pulver zur Glut erhitzt und schließlich reine weiße Pottasche übrig war. Das Gold der Glasmacher.
Theis erzählte ihr dabei Geschichten, wie er es schon immer gern getan hatte. Obwohl Marie inzwischen den Märchen entwachsen war, genoss sie die Zweisamkeit mit dem gutmütigen alten Mann.
Die Geschichte mit den Kobolden, die auf ihrer Suche nach Kobaltgestein vom fernen Venezien über die Berge des Schwarzwaldes gekommen waren, kannte sie bereits. Die Venezianer waren fremdartig gekleidete Männer und sprachen eine eigene Sprache. Man habe sich vor ihnen gefürchtet, so Theis. Er sprach von ihnen, als ob er sie selbst gesehen hatte. Dabei musste das schon lange her gewesen sein. Sie hätten seltsame Zeichen in Stein gemeißelt, um ihresgleichen geheime Hinweise zu den Bodenschätzen zu hinterlassen. Niemand könne die Zeichen mehr deuten.
Am Verlauf des Wassers und an den Pflanzen erkannten die Venezianer seinerzeit, ob der Boden das heiß ersehnte Kobalt enthielt oder nicht. Dieses Erz war nötig, um das Glas blau zu färben. Nur die Kobolde aus Venedig kannten die geheime Rezeptur, auf deren Verrat die Todesstrafe stand.
Nachdem sie die hiesigen Waldböden untersucht hatten, waren sie eines Morgens plötzlich verschwunden. Auf der Alb läge noch solch ein geheimnisvoller Stein, erzählte Theis Marie. Sie wusste nicht, ob die Geschichte der Wahrheit entsprach oder seine Erfindung war. Niemand hatte je von einem solchen Stein berichtet.
Der Bischof von Basel, der im Mittelalter noch Landesherr über das Gebiet gewesen war, hatte bald darauf Stollen in die Berge treiben lassen, um Silber im Schwarzwald abzubauen, welches er in seiner Münzprägewerkstätte verarbeiten ließ. Seit diesem Bergfrevel waren die Kobolde nie wieder gesehen worden. Man raunte sich zu, der Bischof habe sie in den Kerker werfen lassen, weil sie ihr Geheimnis nicht verrieten. Sie hätten sich jedoch ihr Leben damit erkauft, indem sie dem Bischof die Silbervorkommen anvertrauten. Doch der Bischof befürchtete, dass die Kobolde ihr Wissen anderen mächtigen Herrschern ebenfalls verkaufen würden, wenn er sie freiließ. So beschloss er, ihnen zwar das Leben zu schenken, jedoch mussten sie bis ans Ende ihrer Tage in den Silberminen für ihn schuften, ohne je das Tageslicht wiedergesehen zu haben.
Die Kobolde waren nach und nach gestorben, bis auf einen, dem schließlich die Flucht gelang: dem Glasmännlein, dem Schutzgeist der Glasmacher. Weil er sein Geheimnis weiterhin wie einen Schatz hütete, gab man ihm auch den Beinamen »Schatzhauser«.
Als Marie abermals zum Bach ging, um Wasser zu holen, fühlte sie sich beobachtet. Der Nebel hatte sich verzogen, die Sicht ringsum war frei. Sie verharrte kurz, um zu lauschen. Blickte sich um. Nichts.
In ihren Ohren klang noch die Geschichte des alten Theis nach. Die Kobolde gab es nicht mehr. Dafür gab es einen, der manchmal in den Büschen hockte und die Weiber beobachtete: den Dubel.
Marie wusste, dass er von allein wieder abzog, schenkte man ihm keine Beachtung. Wagte man jedoch einen Blick oder hatte gar ein freundliches Wort, griff er unter seine Kutte und zog etwas hervor, das die Weiber Reißaus nehmen ließ. Kreischend vor Freude, sie in die Flucht geschlagen zu haben, stand er dann da und äffte sie nach. Sein bestes Stück in den Händen haltend, hin und her wippend. Marie fürchtete sich vor Justus.
Dass dieser Kerl zum Krummen geschickt worden war, um die Kunde der ankommenden Mönche weiterzuleiten, konnte sie nicht wissen.
Die Neugier trieb Marie vorsichtig weiter. Hier war doch jemand! Als sie aber selbst hinter den Brombeerhecken niemanden entdecken konnte, besann sie sich wieder auf ihre Arbeit. Dennoch glaubte sie, einen Blick im Nacken zu spüren, der sich erst löste, als sie die Tür zum Aschenhaus wieder hinter sich zugezogen hatte.
***
Wie verlassen, fast geisterhaft, ragte das strohbedeckte Dach des Krummenhofs am Schluchsee aus dem Nebel. Die abgeernteten Rübenäcker am Hang lagen brach und dampften im ersten Sonnenlicht, das hier schon Oberhand gewonnen hatte. Es roch nach feuchter Erde. Keine Menschenseele war zu sehen. Eine seltsame Stille umgab den Hof.
Einzig drei fremde Pferde, angeleint vor dem Stall, zeugten vom Leben diesseits des Sees und davon, dass hier nicht alles seinen gewohnten Gang ging. Die Tiere standen noch nicht lange hier. Ihre Leiber waren feucht von der Anstrengung des Ritts.
Justus hatte den Schweiß der nahenden Tiere rechtzeitig gerochen, um sich in Sicherheit zu bringen. Die zugehörigen Reiter hatten sich gleich darauf mit Nachdruck Einlass in das abgelegene Bauernhaus verschafft, denn man war hier Fremden gegenüber sehr misstrauisch.
Herrschaftlich bestimmt hatten sie sich gegeben, die Eindringlinge. Das bedeutete meist nichts Gutes. Die einfachen Bauersleute hatten ihn, den mächtigen Herrn, und sein Gefolge nicht erkannt, wie sie entschuldigend beteuerten, woher auch.
Er sei der Obervogt aus Bettmaringen, der Schluchsee gehöre zu seinem Zuständigkeitsgebiet, hatte er sie aufgeklärt. Die beiden Begleiter seien ortskundige klösterliche Jäger. Man habe sich hier mit weiteren Herren aus St.Blasien zu einer Ortsbegehung verabredet.
Sie ließen sich ungefragt in der guten Stube nieder und vom Bauern mit Selbstgebranntem aushalten. Der Bauer bedauerte unterwürfig, dass er noch nicht geschlachtet habe und somit den Herren nicht mit einem ordentlichen Mahl aufwarten könne. Sie hätten sich ja auch nicht angemeldet.
Schließlich schickten die Herren das Weib des Wirts in die Küche, sie solle wenigstens eine kräftige Suppe herrichten, wenn sie schon keinen Schinken mehr habe, man erwarte die Gesandten des Klosters, den Glasvogt vom Windberg und außerdem noch die Glasermeister aus Grünwald auf der anderen Seite des Sees. Ebenfalls eine St.Blasianische Hütte.
Hinter dem Schuppen versteckt, aber mit Aussicht auf den See und den Weg, wippte Justus mit dem Oberkörper. Das tat er immer, wenn er aufgeregt war. Und aufgeregt, das war er heute. Sein Blick wanderte zwischen Waldrand und See hin und her.
Er hatte den Bauern schon am Vormittag über den hohen Besuch informiert, sodass er seine Vorräte an Speck, Schinken und geräucherten Würsten im Heustock verstecken konnte. Die hohen Herren waren dafür bekannt, sich zu bedienen und die armen Leute die Zeche bezahlen zu lassen.
Doch dieses Mal war Justus der Gewinner. Gierig biss er in die geräucherte Bratwurst, die ihm die Bäuerin als Lohn gereicht hatte. Er war zufrieden mit sich und der Welt. Er hatte seine Arbeit gut gemacht.
Noch ehe ein Auge das Boot ausmachen konnte, das sich schweigend im Nebel näherte, hörte er die Wellen, die die Ruder im Wasser zogen und die leicht an das grasbewachsene Ufer klatschten. Justus beobachtete das Geschehen.
Es war ein Fischerboot, das kurz darauf anlegte. Zwei Männer stiegen aus und stießen das Boot gleich wieder ab, das mit dem einsamen Fährmann im Nebel verschwand.
Aufgeregt rannte Justus an das Fenster zur Küche, das vom See her nicht einsehbar war, und klopfte gegen das trübe, grünstichige Glas. Billige Abfallware.
Die Bäuerin öffnete einen Spalt. »Was gibt’s?«
»Noch zwei! Kommen aus dem Wasser!«
Sie reichte ihm einen Kanten Brot. Man musste sich Justus warm halten, sonst verkaufte er einen an den Nächstbesten, der ihm Essbares bot.
Justus trollte sich freudig und hüpfte erneut wie ein junger Ziegenbock zu seinem Ausguck. Er wollte sich schon gemütlich an die Bretterwand lehnen und die durchgebrochene Sonne auf sein Antlitz scheinen lassen, als sich die Reiter vom Windbergtal näherten. Sie führten zwei unberittene Pferde mit, die offensichtlich für die Grünwälder, ihre Verwandten, bestimmt waren.
Heute war sein Glückstag! Wieder lief Justus zur Bäuerin, um Meldung zu geben. Diesmal wollte sie ihn jedoch unwirsch wegschicken, mit dem Hinweis, dass er schon genug habe.
»Durst, Bäuerin, Durst!« Justus mimte mit der Rechten, als trinke er aus einem Becher.
»Der See hat genug Wasser für einen wie dich!«
Er rieb die Handflächen gegeneinander, grinste: »Pater Cajetano mag Schinken vom Heustock«, und eilte der näher kommenden Reitergruppe entgegen.
»Halt! Du Lumpenhund! Bleib da!«
Justus blieb augenblicklich stehen, wandte sich langsam um, legte den Kopf schräg und forderte: »Most! Bäuerin, Most!«
»Du bringst mich noch an den Bettelstab, du Herumtreiber!«
»Justus Bettelmönch, St.Blasien!« Er zog den imaginären Hut und verbeugte sich, offensichtlich hatte man ihm schon öfter ähnlich klingende Namen gegeben. Siegessicher nahm er einen weiteren Botensold entgegen und zog sich zufrieden an sein Sonnenplätzchen zurück, wo er den Herrgott einen guten Mann sein ließ, wie man hierzulande den Müßiggang nannte.
***
»Wir werden noch im Hochmoor versinken«, keifte Cajetano, nachdem sie bereits vor einer halben Ewigkeit, wie er meinte, vom Pfad abgebogen waren. Der Krummenhof lag weit zurück, auch der Schluchsee selbst war nicht mehr zu sehen. Die Pferde steckten knöcheltief im Morast, doch die klösterlichen Jäger trieben die zweifelnden Herren immer weiter voran.
Sie waren vom See aus einem Bachlauf gefolgt, der sich hier im Moor stark verzweigte und kaum noch auszumachen war. Unberührter Urwald, so weit das Auge reichte, und weit und breit keine menschliche Siedlung.
»Dies ist nur der Jägerpfad. Den Platz selbst werdet Ihr künftig über den Höhenrücken trockenen Fußes erreichen können«, klärte Jos, einer der Jäger, den finster dreinschauenden Glasvogt auf. Er missachtete das ebenfalls griesgrämige Gesicht des Oberrechners. Der Vogt musste überzeugt werden, nicht der Mönch.
Erst sehr viel weiter nordwestlich würde sich die neue Glashütte unter der Schirmherrschaft der Fürstenberger befinden, versicherte er weiter. Sie gehöre zu einem anderen Herrschaftsgebiet.
Kurz darauf stieg der kaum sichtbare Pfad bergan. Der Wald war nun so dicht, dass kaum Tageslicht durchdrang.
»In der Tat, Holz genug, um über Jahrzehnte hinaus die Öfen zu schüren«, bemerkte der Glasmachermeister Rogg aus Grünwald anerkennend, und die anderen mussten ihm recht geben.
Die Sonne hatte ihren höchsten Stand überschritten, als sich der Wald endlich lichtete. Vor ihnen breitete sich eine sonnendurchflutete Wiese aus. Durchzogen von einem glasklaren Bach. In seinem Lauf feinster Quarzsand. Hüben und drüben saftiges Gras, dem der nächtliche Frost nichts angehabt hatte. Vögel zwitscherten, als seien sie zum Empfang der Gesandtschaft extra einbestellt worden.
Über die Gesichter ging ein Lächeln.
»Das ist der Platz. Diese kleine Aue, umgeben von Wäldern, ist wie geschaffen für Eure Zwecke.« Jos rutschte vom Pferd. Die anderen taten es ihm gleich.
Hatte man am Morgen noch gefeilscht und gejammert, mit einem Mal schienen alle zufrieden.
»Doch, Ihr habt recht. Dieser Platz ist für eine Glashütte extra wohl und kommod. Pater Cajetano, wir vom Windberg nehmen ihn an«, sagte Michael Sigwarth.
Die beiden Glasmachermeister Rogg und Raspiller aus Grünwald wechselten kurze Blicke, ehe sie ebenfalls einstimmig der Zusammenlegung und Neugründung einer gemeinsamen großen Glashütte zustimmten. Hier gab es Holz und Platz für mehrere Familien, Ressourcen für gut hundert Jahre, wie Stephanus bemerkte. Er war nicht unvorbereitet, gemeinsam mit den Jägern hatte er die Gegend bereits erkundet. Dennoch bereitete ihm eine andere Sache Unbehagen. Er schien der Einzige zu sein, der sich über die Zugehörigkeit dieser Gegend Gedanken gemacht hatte. Dieser Platz in der Einöde des Waldes gehörte nicht mehr zum klösterlichen Blasiwald.
Sein Wissen behielt Stephanus zunächst für sich. Gab es niemanden, der sich dagegen wehrte, was man in dieser Wildnis annehmen konnte, dann verfuhr man wie die Jahrhunderte zuvor: Was das Kloster kultivierte, gehörte letztendlich ihm. Die Landesregierung war weit weg in Wien, auch wenn sie ihre Vertretung in Freiburg sitzen hatte. Weit und breit gab es keinen Grenzstein der Fürstenberger, auch das hatte Stephanus im Vorfeld erkundet. Von dieser Seite konnte also kein Anspruch kommen.
Die Streitigkeiten mit den Fürstenbergern um das Schluchseegebiet hatte er die Nacht zuvor studiert. Seit 1659 gehörte die Reichsvogtei Schluchsee zu St.Blasien. Abgekauft von den Fürstenbergern für den Verzicht auf die Leibeigenen in Lenzkirch und eine Zahlung von neuntausend Gulden. Ähnlich wie schon Abt Martin im Jahre 1609 die Herrschaft Bonndorf gekauft hatte. Selbst die ursprüngliche Besitzurkunde aus dem Jahre 983, in der Kaiser Otto dem Eremiten Reginbert das Gebiet zugewiesen hatte, hatte Stephanus studiert. Sie galt als die Urkunde, wenn es um Besitzstreitigkeiten ging. Von der Albquelle am Feldberg bis zum Ausfluss der Schwarza am Schluchsee, so die Urkunde, verlief die Grenze. Von den Höhen zwischen Albquelle und See, wo sie sich jetzt befanden, war nie die Rede gewesen, sie galt einfach als zugehörig. Er würde sich darum kümmern müssen, das zu verdeutlichen.
Stephanus stieg vom Pferd und ließ seinen Blick suchend zum Waldrand schweifen. Irgendwo musste er doch stecken, dieser Kerl. Er war ihnen doch gefolgt! Oder war er eingeschlafen, nachdem er sich den Bauch vollgeschlagen hatte?
Während die anderen einen kräftigen Schluck aus der Beutelflasche des Glasvogts nahmen, entfernte sich Stephanus von ihnen, als drücke ihn ein menschliches Bedürfnis.
Cajetano und der Stallmeister zierten sich zunächst noch, dem Alkohol zuzusprechen, es schicke sich nicht für Gottesmänner, beteuerten sie. Dabei hatten sie nur Angst, mit den trinkfesten Glasmachern nicht mithalten zu können. Zu schnell war eine unüberlegte Zusage gemacht. Als jedoch Stephanus mit zufriedenem Ausdruck wieder zurückkam und die Flasche verlangte, hielten auch die beiden anderen Mönche nicht länger ein.
Die Flasche noch in der Rechten, machte Stephanus eine rundum ausladende Handbewegung. »Was für eine herrliche Aue. Klein, aber genau richtig. Eben ein Äule.«
KAPITEL 2
Trotz seines Rufes, mit eiserner Hand zu regieren, war Abt Augustinus keine besonders auffallende Erscheinung. Er trug, wie alle Mönche des Ordens, einen schwarzen Habit. Auf seiner Brust prangte ein Kreuz, das an einer Kette hing. Lediglich ein darin eingelassener Rubin zeugte von einer hohen Stellung innerhalb des Ordens. Niemand hätte also auf den ersten Blick jene ehrgeizige Seele vermutet, die unter der Kutte wohnte.
Augustinus verfolgte ein ruhmvolles Ziel: Er wollte in die Geschichte St.Blasiens eingehen. Dazu musste er am besten schon zu Lebzeiten, spätestens aber nach seinem Tod von sich reden machen. Etwas Bestehendes schaffen, das er der Nachwelt hinterlassen konnte. Etwas Eindrucksvolles.
Es gab zwei Möglichkeiten, sich zu verewigen: Entweder war man ein genialer Denker und Reformator, oder man hinterließ großartige Baudenkmäler. Besser war beides.
Augustinus hatte zwar vier Jahre lang am Collegium Germanicum in Rom studiert, was ihm die Familie ermöglicht hatte. Doch er war kein so herausragender Schüler gewesen, um die Kirchengeschichte zu revolutionieren. Er war eher Durchschnitt, das Studentenleben ihm wichtiger als die Lehrinhalte seines Studiums.
Seine kirchliche Karriere hatte er dem Status seines verstorbenen Vaters zu verdanken, des Oberamtmanns Elias Vratislaus Thomas Eusebius Finck aus Wolfach, dessen zweiter Vorname seiner Geburtsstadt Prag geschuldet war, wo Augustinus’ Großvater als Landschaffner und Amtmann abberufen gewirkt hatte. Die Stammheimat der Familie war jedoch Wolfach.
Augustinus, der mit bürgerlichem Namen Simon Eusebius hieß, war das siebte Kind des bereits einundsechzigjährigen Vaters. Seine Mutter Jakobea Wohlin dessen zweite Frau.
Seine Brüder, zwei waren den Kapuzinern beigetreten, hatten sich schon Rang und Namen erarbeitet, die Schwestern waren gut verheiratet.
Simon Eusebius alias Augustinus entstammte also einer angesehenen und mächtigen Familie. Erfolg wurde vorausgesetzt. Schon als junger Mann hatte Augustinus Mittel und Wege gefunden, erwünschte Ziele zu erreichen. Seine Mitschüler nannten diese zweifelhafte Gabe noch Erpressung– als Abt adelte man die Gabe als Strategie.
Da es nun mit der Umsetzung einer Ideologie haperte –er hatte schlichtweg noch keine–, musste die zweite Möglichkeit, sich ein Denkmal zu setzen, herhalten. Die sichtbaren Werke! Was eignete sich dazu besser als der ein oder andere Prunkbau?