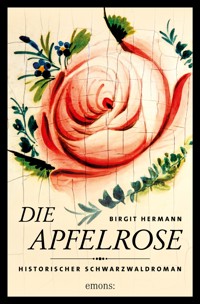
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Historischer Schwarzwaldkrimi
- Sprache: Deutsch
Ein opulentes Schwarzwald-Epos zur Zeit der Napoleonischen Kriege. Schwarzwald, um 1800: Die Menschen haben mit Hunger, Viehseuchen und Plünderungen durch französische Soldaten zu kämpfen. Als Bauerstochter Helena durch einen gewaltsamen Übergriff schwanger wird, will ihr Vater sie zwangsverheiraten. Helenas Liebe aber gilt dem jungen Uhrenhändler Antonius. Doch nicht nur ihr Vater, auch das Schicksal treibt das junge Paar auseinander, und während Helena eine Lehre als Hebamme beginnt, zieht es Antonius über die Alpen bis nach Italien. Eine Reise, die nicht nur Gefahren birgt, sondern auch dunkle Schatten aus der Vergangenheit weckt. Glänzend recherchiert, atmosphärisch dicht und voller überraschender Wendungen. Ein opulentes Schwarzwald-Epos aus der Zeit der Napoleonischen Kriege.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 881
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Birgit Hermann lebt mit ihrem Mann in Titisee-Neustadt, ist gebürtige Schwarzwälderin und liebt die blauen Höhen und dunklen Wälder ihrer Heimat. Die Mutter dreier erwachsener Kinder arbeitet als Naturparkführerin und als Medizinische Fachangestellte und hat bereits mehrere erfolgreiche Romane veröffentlicht.
Dieses Buch ist ein Roman mit historischem Hintergrund. Einige der aufgeführten Personen haben tatsächlich gelebt, andere kamen hinzu. Die Namen einiger Höfe wurden geändert, da deren Protagonisten frei erfunden sind.
© 2024 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, unter Verwendung eines Motivs von mauritius images/Jürgen Wiesler/imageBROKER
Lektorat: Jana Budde
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-98707-190-4
Historischer Schwarzwaldroman
Überarbeitete Neuausgabe
Die Originalausgabe erschien 2005 unter dem Titel »Die Apfelrose« im Schillinger Verlag Freiburg.
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Dieser Roman wurde vermittelt durch die Literaturagentur Beate Riess, Freiburg.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß §44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Fast hatte sie es geschafft, nur noch wenige Schritte, und sie würde den Wald hinter sich lassen und die ersten Häuser Rudenbergs sehen. Fast. Denn irgendetwas ließ sie stocken …
KAPITEL 1
28.Juli 1796, Klosterwald Friedenweiler
Eine schlanke Gestalt huschte durch die offen stehende Gartentür der kleinen, windschiefen Hütte. Sie blickte sich noch einmal hastig um, so als wollte sie sicher sein, dass sie niemand beobachtet hatte. Denn hierher kam man nur dann, wenn man an die Kraft der Gebete allein nicht mehr glaubte. Dann verschwand sie um die Ecke.
Der Weg zu diesem Haus führte über einen bewaldeten Höhenrücken und verband die Dörfer Friedenweiler und Eisenbach. Inmitten dieser struppigen Wildnis, zwischen den einzelnen Baumstümpfen und dornigen Gebüschen – man hatte halbherzig den Versuch gewagt, den einst dichten Wald wieder aufzuforsten, der durch die Glasbläserei sehr in Mitleidenschaft gezogen worden war –, lag in einer Talmulde eine lang gezogene Lichtung. Kleineisenbach nannte man sie schlicht, vielleicht, weil niemand ein geeigneterer Name eingefallen war.
Das mit Stroh bedeckte Dach des Gebäudes zog sich zum Weg hin fensterlos bis auf den Boden und machte einen wenig einladenden Eindruck. Der First lag fast auf derselben Höhe wie der schmale Fußweg, und so bildete sich eine Mulde zwischen Dach und Berghang, in der sich winters der Schnee durch Verwehungen sammelte und somit eine optimale Isolierung gegen den bissigen Ostwind bot, der manchmal tagelang tobte. Zum Norden hin stand das Vieh im Stall.
Doch obwohl es ein ganz normales, typisches Haus für diese Gegend war, eben ein Abbild der großen Erbpachthöfe des Klosters, haftete etwas Mystisches, ja gar Unheimliches an ihm. Man konnte es nicht sehen, aber man spürte es, sobald man in die Nähe kam.
Vielleicht war es auch nur die Angst vor der Frau mit den stechend grünen Augen, die hier wohnte. Man bekam sie tagsüber selten zu Gesicht. Meist holten die Menschen sie erst in der Dämmerung zu ihren Kranken oder zu den Gebärenden. Nicht einmal am Sonntag in der Kirche ließ sie sich blicken.
Umso überraschter war Helena, die Besucherin, die sich soeben durch die Gartentür geschoben hatte, als sie plötzlich inmitten eines blühenden Paradieses stand, das man vom Weg her nicht einsehen konnte. Eine bunte Auswahl an Gemüse und Blumen wechselte sich mit unzähligen, ihr zum Teil unbekannten Heilkräutern ab. Die Besitzerin musste mehrere Stunden am Tage hier verbringen, um diese Pracht zu pflegen. Bienen und Schmetterlinge flogen von Blüte zu Blüte, und ein ausgehöhlter Baumstamm diente als Brunnen, in dem sich das gleißende Sonnenlicht spiegelte. Helena, die zuvor noch nie hier gewesen war, war gekommen, weil ihre Mutter auf die Heilkünste Josephas schwor und sie dringend benötigte.
Sie wandte sich der Hütte zu, deren Südseite mit einer ganzen Galerie von winzigen Fenstern durchzogen war. Doch die schwere Holztür war zugezogen. Die alte Bewohnerin schien nicht da zu sein, sonst stünde die Tür offen, so wie es hier in der Gegend üblich war, um Licht und Luft in die niedrigen Gebäude zu lassen, die im Innern stets dunkel und durch die angrenzenden Ställe feucht und muffig waren. Nur nachts oder an besonders kalten und stürmischen Tagen schloss man die Tür. Oder eben, wenn man nicht daheim war.
Eine schwarze Katze verschwand um die Ecke, als sie Helena erblickte. Mit klopfendem Herzen näherte sich das Mädchen schließlich doch dem Eingang; sie wollte sich vergewissern, ob wirklich niemand hier war und sie den Weg umsonst gemacht hatte.
Als sie näher kam, öffnete sich die Tür knarrend wie von Geisterhand einen Spaltbreit. Helena erschrak, doch dann bemerkte sie, dass die Tür wohl doch nur angelehnt gewesen war.
Ein stechender, undefinierbarer Geruch schlug ihr entgegen. Zögernd blieb sie stehen und spähte vorsichtig durch den Spalt. Von der Decke baumelten unzählige Kräuterbüschel zum Trocknen, doch diese konnten nicht die Quelle des Geruchs sein. Neben der Tür standen aufrecht zwei überkreuzte Reisigbesen, mit dem Kopf nach oben. Helena kannte die Bedeutung dieses Zeichens, es war ein Abwehrzauber gegen böse Mächte. Für gewöhnlich stellte man es vor die Kammer einer Wöchnerin. Über dem Eingangsbalken hing ein Tierschädel. Auch dieser Brauch irritierte Helena nicht, obwohl der Ochs, der das Bauholz hergekarrt hatte, eigentlich nur bei großen Gehöften zum Richtfest geschlachtet und der Schädel als Geisterschutz angebracht wurde. Aber Josepha schien sich gut abzusichern, auch wenn es nur der Schädel eines Ziegenbocks war.
Das Mädchen setzte vorsichtig einen Fuß über die Schwelle.
»Helena?«
Helena zuckte vor Schreck zusammen, als eine strenge Stimme ihren Namen rief. Offensichtlich hatte die Alte ihr Kommen bemerkt, obwohl sie sie unmöglich gesehen haben konnte, denn die Küche lag nach hinten heraus.
Lautlos tasteten sich Helenas nackte Füße durch den dunklen Flur, ihr Herz klopfte bis zum Hals. An der Schwelle zur Küche blieb sie erneut stehen.
Eine Spur der Erleichterung huschte über das Gesicht der alten Frau, als sie sich zum Eingang wandte und das Mädchen aus dem Nachbardorf im Türrahmen erkannte. Sie lag mit ihrer Vermutung richtig. Es war Helena. Helena Kirner, die älteste Tochter von Leopoldine Kirner, die sie erst vor ein paar Tagen entbunden hatte.
»Josepha? Ihr seid zu Hause, Gott sei Dank!«, stammelte Helena schließlich. Als ihre Augen sich an die Dunkelheit des Raumes gewöhnt hatten, denn nur ein winziges Fenster war vorhanden, glaubte sie für einen Moment, in den grünen Augen der alten Frau so etwas wie Furcht gesehen zu haben. Das verwunderte sie doch sehr, denn normalerweise hatten die Leute vor Josepha Angst und nicht umgekehrt. Ob sie jemand anderen erwartet hatte?
Als Josepha aber weiter nichts sagte und sich wieder der zähen Masse auf dem qualmenden offenen Küchenherd zuwandte, war Helena überzeugt, sich geirrt zu haben. Der beißende Rauch zog an der Steinwand, die schon ganz rußgeschwärzt war, hoch und sammelte sich über dem Herd in einem Gewölbe, ehe er abgekühlt wieder leicht nach unten sank und sich an den im Rauch trocknenden Würsten und Schinken vorbei einen Weg ins Freie suchte.
Unentschlossen stand Helena eine Weile da und wusste nicht, ob sie die Alte ansprechen sollte oder nicht. Vielleicht wollte sie nicht, dass man sie bei der Arbeit störte.
Josepha stemmte schließlich den linken Arm in die Hüfte und wandte ihren Kopf abermals zu Helena, während sie mit der Rechten unentwegt weiter den Kochlöffel langsam und gleichmäßig im Topf kreisen ließ. Sie legte ihre Stirn in Falten, was ihrem mit unzähligen Runzeln überzogenem Gesicht einen fast furchteinflößenden Ausdruck verlieh. Dazu hatte sie das im Nacken gebundene Kopftuch tief ins Gesicht gezogen. Sie war nicht sehr groß und musste deshalb zu Helena aufblicken.
»Helena, es bedeutet nichts Gutes, dass du kommst. Deine Mutter?«
Helena senkte ihr Haupt und nickte. Ihr langes, gewelltes dunkelblondes Haar war zu zwei Zöpfen gebunden und hing über die schmalen Schultern der Siebzehnjährigen. Ihr schlanker, hochgewachsener Körper steckte in einem groben braunen Leinenkleid, das nur knapp die nackten Knie bedeckte. Der Saum war schon zweimal ausgelassen worden, was an einer Falte zu erkennen war. Trotzdem war Helena schon wieder dem Kleid entwachsen. Eine fadenscheinige halbe Schürze bedeckte einen Teil des Kleides, das mit Bändern vorn geschlossen war.
In der rechten Hand hielt Helena ein Päckchen, das sie nun langsam der Dorfhebamme hinstreckte und sie dabei bittend anschaute.
Doch ehe sie etwas sagen konnte, entgegnete ihr Josepha rau: »Dein Vater weiß nicht, dass du zu mir gekommen bist, stimmt’s?«
Helena öffnete erstaunt den Mund. Diese Alte schien alles zu wissen.
Doch Josepha fuhr fort. »Er ist nicht der Mann, der die Hebamme zweimal kommen lässt. Das Kind war gesund, wenn auch nur ein Mädchen, und die Geburt war ohne Probleme. Also, was ist passiert?«
»Mutter hat hohes Fieber.«
»Krämpfe im Unterleib oder sind es die Brüste?« Josepha wandte sich wieder seufzend ihrem Kochtopf zu, den sie ruckartig vom Herd nahm und dessen Inhalt sie über einer auf dem Tisch stehenden und mit einem Tuch abgedeckten Schüssel ausgoss.
»Sie kann Sophie nicht mehr an der rechten Seite anlegen, die Brust ist rot, heiß und ganz dick geschwollen. Sie hat starke Schmerzen. Und manchmal phantasiert sie im Fieber.«
»Gut! Dann ist es nicht so schlimm.«
Helena wusste nicht, was sie antworten sollte – was sollte gut daran sein? Wozu hatte sie den Weg hierher gemacht? Dazu noch ohne das Wissen des Vaters, der ihr bestimmt eine Tracht Prügel verpassen würde, wenn er erfahren sollte, was sie hinter seinem Rücken trieb.
Verloren stand sie da, das Päckchen noch immer in der Hand, und schaute zu, wie Josepha den leeren Topf auf den Steinboden neben dem Herd stellte und dann den Rest der im Tuch befindlichen Pflanzenteile ausdrückte, ehe sie die Rückstände in einen Abfallkübel schüttelte. Danach rieb sie ihre Hände an der Schürze trocken, legte einen Teller auf die eben gefüllte Schüssel und stellte das Ganze vor ein winziges Fenster.
Dann endlich wandte sie sich Helena ganz zu. »Ja, schau nicht so. Deine Mutter hat eine Brustentzündung. Hätte sie Bauchkrämpfe und Fieber, wäre es viel schlimmer. Gegen Kindbettfieber kann auch ich nicht viel ausrichten. Entweder die Frauen sind stark und schaffen es, oder sie schaffen es nicht.«
Sie nahm Helena das Päckchen ab und wickelte dessen Inhalt aus. Eine Scheibe Speck kam zum Vorschein. Sie hielt sie Helena unter die Nase. »Dein Vater weiß auch davon nichts, stimmt’s?«
Wieder nickte Helena verlegen.
Josepha verstaute die Speckscheibe im Küchenschrank und zuckte die Schultern. »Ich habe mir abgewöhnt, bescheiden zu sein. Wenn ich’s nicht nehme, versäuft er doch alles. Ihr Kinder habt sowieso nichts davon. Komm, ich gebe dir eine Medizin. Aber du musst aufpassen, dass die Kleinen nichts davon trinken. Die Flüssigkeit kann Kinder umbringen.« Sie kramte im Küchenschrank, bis ein Fläschchen mit trübem Inhalt zum Vorschein kam. Sie füllte etwas davon in ein weiteres Glasfläschchen und hielt es Helena hin. »Aber pass auf. Es ist das Konzentrat von Tollkirschen. Giftig, wie ich schon sagte. Du darfst deiner Mutter nur zwei bis drei Tropfen in ein Glas Wasser geben. Morgens und abends. Dann mach ihr kühlende Umschläge, am besten mit Quark, auf die kranke Brust. Und sag ihr, sie muss Sophie an der entzündeten Seite anlegen und dabei mit dem Finger schön die Milch ausstreichen, damit das Kind trinken kann. Es gibt sonst einen Stau, der sich eitrig entzündet. Es wird sehr schmerzhaft sein, aber das macht nichts. Hörst du? Das kannst du dir doch merken, oder?«
»Ja, sicher.« Helena nahm das Fläschchen und ließ es in ihre Schürze gleiten, wo sie die kostbare Medizin mit der Hand umklammert hielt. »Danke, Josepha. Vergelt’s Euch Gott.« Erleichtert wandte sie sich zum Ausgang. Sie war froh, dass sie endlich gehen konnte. Diese Frau war ihr unheimlich. Sie konnte sie einfach nicht einschätzen.
»Sag deiner Mutter die besten Wünsche von mir.« Josepha hielt ihr die Tür auf. Wieder legte sich dieser besorgte Blick auf ihr Gesicht, den Helena schon vorhin beim Eintreten zu sehen geglaubt hatte. Ihre starren Augen schienen durch sie hindurchzuschauen, gerade so, als hielte sie Ausschau nach jemandem. Sie wandte den Kopf dabei leicht nach rechts und dann leicht nach links.
Plötzlich packte die Frau Helena mit ihren Gichtfingern am Oberarm und zog sie zu sich herunter. »Du hast niemanden gesehen auf dem Weg hierher?« Sie legte die Stirn so sehr in Falten, dass die dichten Brauen beinahe zusammenstießen und eine Linie bildeten.
»Nein.« Helena, der das Herz fast wieder bis zum Hals klopfte, fasste Mut und fragte nach: »Wen soll ich gesehen haben? Erwartet Ihr jemanden?«
»Du hast es noch nicht gehört? Ich habe mich schon gewundert, dass man dich hat rennen lassen. Aber offensichtlich weiß niemand, nicht einmal deine Mutter, dass du bei mir bist. Und dass sie da sind.« Josephas Augen funkelten bedrohlich. Mit ihren knorrigen Händen zog sie Helena noch näher zu sich, als könnte jemand mithören. Ihre Stimme senkte sich zu einem Flüsterton. »Pass auf, die Soldaten sind wieder hier.« Sie machte eine plötzliche ausschweifende Handbewegung und wirbelte im Kreis, dass Helena erschrocken zurückfuhr. Eine so schnelle Bewegung hätte sie der Alten nicht zugetraut.
»Draußen, überall in den Wäldern treiben sie sich rum: die Franzosen! Sie bringen Elend und Not. Glaub mir. Sie werden kommen und uns ausrauben. Sie werden die Häuser und Höfe niederbrennen und deinesgleichen …«, sie tippte mit ihrem Zeigefinger auf Helenas Brustbein, dass es sie schmerzte, »… deinesgleichen werden sie zur Belustigung auf den Dorfplätzen schänden.«
Ein kalter Schauer lief Helena über den Rücken. Sie wusste nicht, vor wem sie mehr Angst haben sollte: vor den angeblich in den Wäldern lauernden Soldaten oder vor dieser Alten, die offensichtlich nicht mehr ganz richtig im Kopf war. Weit und breit waren schon lange keine Feinde mehr gesehen worden. Das hätte Helena gewusst, denn solche Nachrichten verbreiteten sich wie ein Lauffeuer. Woher also wollte die Alte wissen, was bevorstand?
Die Blicke der Frau durchbohrten sie regelrecht, und Helena hatte nur noch den Wunsch, so schnell wie möglich von hier wegzukommen. Sie stolperte einige Schritte rückwärts, dann drehte sie sich um und ergriff die Flucht.
»Nicht über den Waldweg, Kind! Meide die Wege, lauf durchs Unterholz! Dort bist du sicherer, und beeil dich! Sie sind in der Nähe! Ich habe es heute Nacht geträumt!«, rief Josepha ihr nach.
Helena stockte und schaute sich um. Hatte sie richtig gehört? Die Alte hatte das nur geträumt? Ihr lief es abermals kalt den Rücken runter. Hatte diese Hexe wirklich seherische Fähigkeiten, oder war sie verrückt? Doch die Haustür war bereits zu. Das alte, windschiefe Häuschen lag friedlich, als wäre nichts gewesen, auf der kleinen Waldlichtung.
Die Hitze des Sommertages schien sich aufzustauen, kein Lüftchen wehte, nicht einmal die Vögel in den Bäumen zwitscherten. Es schien, als läge mit einem Mal eine unheimliche Stille über dem Hochtal. Langsam drehte sich Helena im Kreis und fühlte sich, als beobachteten sie tausend fremde Augenpaare.
Vielleicht hatte Josepha recht? Vielleicht lagen sie wieder in den Wäldern, die Franzosen. Es wäre nicht das erste Mal, dass Truppen durch die abgelegenen Siedlungen streiften, auf ihrem Kriegszug gen Osten auf der Suche nach Lebensmitteln. Nur wenige Täler von hier entfernt verlief die Grenze Vorderösterreichs, der sogenannten Schwanzfeder des Kaiserreichs. Das war auch der Grund, weshalb der abgelegene Schwarzwald in der Vergangenheit immer wieder Kriegsschauplatz geworden war.
Seit der Kriegserklärung Frankreichs gegen die Österreicher und Preußen am 20. April 1792 herrschte Aufruhr im ganzen Breisgau. Vor einem Jahr erst waren die Klosterfrauen aus Friedenweiler unter den fürstenbergischen Schutz gestellt und in einem Schlösschen zu Hausen vor Wald in Sicherheit gebracht worden. Das Kloster diente als kaiserliches Lazarett. Im Moment stand es jedoch wieder leer, denn die kaiserlichen Soldaten waren abgezogen, und seit mehreren Monaten herrschte Ruhe auf dem Wald. Doch wie lange noch?
Vielleicht hatte die alte Hebamme wirklich das Zweite Gesicht, wie manche im Dorf behaupteten. Vielleicht konnte sie tatsächlich sehen, was bevorstand? Erneut stellten sich Helenas Nackenhaare auf bei dem Gedanken an die Prophezeiung, die sie eben gehört hatte.
Ein ungutes Gefühl in ihr warnte sie. Angst ergriff sie, und sie rannte los. Im Nu hatte sie den Waldsaum erreicht und sprang mit ihren bloßen Füßen über knackendes Unterholz und zwischen Büschen und kleinen Tannenbäumen hindurch. Der ganze Wald schien unheimlich und bedrohlich, und als Helena zum Himmel blickte, sah sie geballte schwarze Gewitterwolken über den Baumwipfeln. Sie hielt kurz inne, um zu lauschen, aber außer ihrem pochenden Herzen konnte sie nichts hören, gar nichts. Kein Summen von Insekten, keinen Gesang der Vögel, nur Stille. Sie griff in die Schürzentasche und ertastete das Fläschchen. Sie durfte es auf keinen Fall verlieren, darum nahm sie es heraus und umklammerte es, bevor sie weiterrannte.
Ein Blitz zuckte plötzlich über ihren Kopf hinweg, und fast im selben Moment grollte der Donner. Wie auf ein himmlisches Kommando setzte nun auch der Regen ein; erst wenige dicke Tropfen, dann prasselte innerhalb kürzester Zeit eine breite Regenfront von Westen hernieder. Der Waldpfad verwandelte sich in eine einzige Schlammpfütze. Helenas Haare klebten ihr am Kopf und im Gesicht. Das Kleid war durchweicht und haftete, jetzt schwer wie ein Sack, an ihrem zierlichen Körper.
Fast hatte sie es geschafft, nur noch wenige Schritte, und sie würde den Wald hinter sich lassen und die ersten Häuser Rudenbergs sehen. Fast. Denn irgendetwas ließ sie stocken.
Ein Rascheln in den Blättern um sie herum. Helena wagte nicht zu atmen. Sie lauschte abermals angestrengt.
Nichts, es war wieder ruhig. Sie setzte, darauf bedacht, keine Geräusche zu machen, vorsichtig einen Fuß vor den anderen, denn sie beschlich das Gefühl, nicht mehr allein in diesen Büschen zu sein. Ihre Augen suchten gehetzt nach irgendwelchen Anzeichen von Soldaten.
Da sprang plötzlich ein großes Tier, größer als eine Hirschkuh, wenige Meter vor ihr durch das Dickicht und verschwand zwischen den Tannen. Helena hatte nur einen Teil des hinteren Rückens gesehen, braunes Fell. Ein Pferd, dachte sie, während ihr Herz raste und ihr Atem schneller ging, ein Pferd der Franzosen! Sie waren hier, sie waren wirklich hier! Die Alte hatte doch recht gehabt. Panik erfasste sie. Da fiel ihr Blick auf einen Holzstapel am Rande des Weges. Ohne weiter nachzudenken, hielt sie darauf zu und verschanzte sich dahinter.
Ein folgenschwerer Fehler, wie sie nun feststellte. Denn sie wurde schon erwartet. Ehe sie sich dessen vollkommen bewusst war, ergriffen zwei Männerhände ihre Gurgel und zerrten sie ins Gebüsch. Helena spürte den heißen Atem in ihrem Nacken, der keuchend und stoßweise ging, sie versuchte, sich loszureißen, um ihren Gegner zu erblicken. Aber sie konnte sich seinem eisernen Griff nicht widersetzen. Mit der einen Hand hielt er ihr Kinn nach hinten gedrückt, mit der anderen schob er ihren Rock nach oben. Er zerrte sie immer weiter rückwärts, bis sie stolperte und zu Boden fiel. Sie schlug mit dem Kopf hart auf. Wie ein schwarzes Tuch breitete sich die Dunkelheit über sie. Sie spürte noch den brennenden Schmerz, als er in sie eindrang. Dann verlor sie das Bewusstsein, ohne ihren Peiniger zu Gesicht bekommen zu haben.
***
Gleich dem Knurren eines beleidigten Hundes verzog sich das Gewitter ostwärts über die weiten Wald- und Sumpfgebiete des Klosters. Der Regen hatte so plötzlich aufgehört, wie er gekommen war, und schon tanzten die ersten Sonnenstrahlen wieder auf den Wasserperlen der nassen Gräser und Sträucher.
Antonius erhob sich hinter der Nische der Schillingskapelle, die hier auf dem höchsten Punkt zwischen den Orten Friedenweiler und Rudenberg stand, wo er Schutz gesucht hatte, und schüttelte seine Joppe aus. Er war trotzdem triefend nass geworden, denn er hatte seinen Schirm, eigentlich der ständige Begleiter eines Uhrenträgers, im Schafhof vergessen. Doch schnell war der Ärger über seine Gedankenlosigkeit vergessen, als er in seine Tasche griff und das Ledersäckchen spürte. Es war noch da, und es fühlte sich gut an, wenn er die Münzen darin durch seine Finger gleiten ließ. Fünfzig Gulden, der Lohn der letzten Monate, sein erstes richtig verdientes Geld. Seine Eltern und Geschwister würden Augen machen, wenn er es nachher zu Hause auf dem Tisch zählen würde. Sicherlich hatten sie noch nie so viel Geld auf einmal gesehen.
Genauso musste sich Mathias Faller vor vielen Jahren gefühlt haben, als er, ein reicher Mann geworden, in seidener türkischer Tracht in seiner Heimat erschienen war. Die eigenen Leute hatten ihn nach all den Jahren nicht wiedererkannt und waren, schreiend vor Angst, davongerannt. Antonius selbst war damals noch ein kleiner Junge gewesen, aber er kannte die Geschichten von Kindesbeinen an. Wieder und wieder hatte sein Großvater die Geschichte von dem Muselmanen erzählen müssen, der einst mit Uhren aus dem Schwarzwald in die Welt hinausgezogen war, um sein Glück zu suchen.
Von klein auf hatte Antonius ein klares Ziel gehabt: Er wollte in die Fußstapfen jenes mutigen Mannes treten, der sich nicht gescheut hatte, beim Großsultan zu Konstantinopel persönlich am Palast anzuklopfen und seine Uhren vorzustellen. Ja, Antonius hatte schon immer seinem Idol nacheifern und in die Welt ziehen wollen. Er hatte es geschafft, Fidelis, einen der Brüder des berühmten Mathias Faller, davon zu überzeugen, dass er der richtige Mann war, das Händlerhandwerk zu erlernen. Und nun war er von seiner ersten Wanderung zurück mit einem beträchtlichen Lohn für sein erstes Jahr als Uhrenträger. Denn drei Jahre musste man sich bewähren, ehe man als vollwertiges Mitglied in die Kompanie der Händler aufgenommen wurde. Aber nicht der Gewinn allein zählte, nein, Antonius freute sich schon darauf, den anderen von seinen Erlebnissen und Eindrücken zu berichten. Man würde ihn bestaunen und auch beneiden, denn was erlebte man schon hier in der Einsamkeit des Waldes? Da war bereits die Geburt eines Kalbes eine Sensation.
Frohen Mutes schlenderte er durch das letzte Waldstück. Gleich würde er den auf einer Anhöhe liegenden Schlegelhof, einen der großen Erbpachthöfe des Klosters, erblicken. Und daneben, etwas kleiner und bescheidener, den Hof seines Vaters Josef Burger, den Andresenhof, ebenfalls ein Erbpachthof des Klosters.
Man würde Antonius hoffentlich gleich von Weitem erkennen, denn er trug nun auch die traditionelle Uhrenhändlertracht: die leuchtend rote Weste über dem Tuchkittel, die Lederkniebundhose, darunter die gestrickten Schafwollstrümpfe, die ihm seine Mutter noch vor der Abreise geschenkt hatte, seine genagelten Wanderstiefel aus schwarz gefärbtem Leder und auf dem Kopf den runden schwarzen Hut und natürlich ein Halstuch. Nur eben der Schirm fehlte, aber deswegen wollte er nicht umkehren; Fidelis würde ihn sicherlich gut verwahren.
Er kam gerade an einem Holzstapel vorbei, als er glaubte, etwas zu hören. Unwillkürlich griff er an seinen Lederbeutel in der Westentasche und blieb stehen, um zu lauschen. Auf seiner Reise hatte er gelernt, sich vor Landstreichern und Taschendieben in Acht zu nehmen.
Da war es wieder. Es hörte sich an wie ein leises Wimmern. Sein Blick fiel neben den Holzstapel, als er erschrocken zusammenzuckte. Eine Hand schaute hinter dem Gebüsch hervor. Lag hier ein Toter? Nein, Tote stöhnten nicht.
Verstohlen schaute Antonius sich um, niemand war zu sehen. Das Gewimmer musste von dieser Person kommen. Also wagte er sich vorsichtig um die Ecke, denn es konnte auch eine Falle sein.
Bei dem Anblick des halb nackten Mädchens, das offenbar nicht ganz bei Bewusstsein war, bekreuzigte er sich. Dann kniete er sich neben sie und deckte vor Scham ihren Rock über die bloßen Schenkel, bevor er ihren Kopf anhob. Dabei verzog sie schmerzhaft das Gesicht.
Antonius’ Finger fühlten sich warm und feucht an, er hatte in eine blutende Platzwunde am Hinterkopf des Mädchens gefasst. Direkt neben ihr lag ein größerer Feldstein. Sie musste unglücklich gestürzt sein. Aber so, wie sie hier lag, deutete es eher auf einen Überfall, eine Schändung hin. Oder war sie gar mit dem Stein niedergeschlagen worden?
Er blickte sich um. Neben ihr lag ein kleines, verschlossenes Fläschchen mit einer Flüssigkeit. Antonius drehte es in seiner Hand, konnte sich aber keinen Reim darauf machen. Er zog den Stöpsel und roch daran. Ein stechender Geruch nach Hochprozentigem ließ ihn schnell wieder den Verschluss daraufstecken. Es musste eine Art Medizin sein. Er legte das Fläschchen zurück, denn jetzt entdeckte er, dass das Mädchen krampfhaft etwas festhielt. Er öffnete ihre Finger, ein Holzknopf kam zum Vorschein. Ein ganz gewöhnlicher Holzknopf, wie ihn jeder hier trug. Was wollte sie damit? Er konnte nicht von ihr stammen, denn ihr Kleid war mit Bändern verschlossen.
Im selben Moment kam Leben in sie, sie stöhnte und murmelte unverständliche Worte. Antonius steckte den Knopf in seine Westentasche. Kurz überlegte er, ob er weglaufen sollte. Der Verdacht würde sicher auf ihn fallen. Einem Uhrenhändler oder gar Uhrenträger gegenüber war man schnell misstrauisch. Andererseits würde man von der Sache sowieso erfahren und sich erinnern, dass auch er diesen Weg genommen hatte. Also beschloss er, dem Mädchen zu helfen. Es würde gewiss sagen, was vorgefallen war.
Vorsichtig strich er ihr verklebtes Haar aus dem Gesicht, da erkannte er sie – es war Helena, Helena Kirner aus seiner Nachbarschaft. Ihre Eltern betrieben eine kleine Selbstversorgerlandwirtschaft. Der alte Kirner, Julius, ihr Vater, ein Säufer, hatte eine Schreinerwerkstatt, die eher schlecht als recht lief. Arme Leute mit vielen Kindern, bestimmt sieben oder gar acht. Es kam fast jährlich eins dazu, dabei verlor man leicht den Überblick als Außenstehender.
»Hallo! Helena? Komm schon, mach die Augen auf!« Er klatschte ihr vorsichtig auf die Wangen. Sie stöhnte wieder auf. »Hörst du mich? Komm, hol mal tief Luft und versuch die Augen zu öffnen.«
Langsam hoben sich Helenas Augenlider, und sie blickte in ein braun gebranntes Gesicht, umrahmt von regennassen dunklen Locken. Auch seine Augen waren unergründlich dunkel. Sein ganzes Gesicht war für sie eher schemenhaft, aber seine Lippen bewegten sich, wenn sie auch nicht verstand, was er sagte.
Helena fühlte sich seltsam leicht und getragen – und dieses schöne Gesicht! So kam es ihr in den Sinn: Sie konnte nur im Himmel sein. Jetzt fiel es ihr auch ein. Es war das Gesicht des Erzengels Gabriel, der in der Klosterkirche die Wand zur Kapelle zierte! »Du bist es, der Erzengel Gabriel! Ich bin im Himmel, oder?«
Antonius musste lachen. »Das hat bisher noch keine von mir behauptet. Und den Himmel kann ich dir leider auch nicht bieten.«
»Aber wenn nicht Gabriel, wer dann?«
»Erkennst du mich nicht? Du bist ganz schön weit weggetreten gewesen. Komm, versuch dich aufzusetzen. Wir sind im Wald, oben auf dem Schilling. Versuche dich zu erinnern, was passiert ist.«
Helena rappelte sich mit Antonius’ Hilfe in eine Sitzposition hoch und lehnte mit dem Oberkörper an den Holzstapel. Mit einem Mal kam die Erinnerung, gewaltig, als hätte man Helena von einer Wolke gestoßen und auf die harte Erde fallen lassen. In ihrem Kopf pochte es, als würde jeden Moment ihre Schädeldecke zerbersten, ihre Glieder schmerzten bei jeder Bewegung, als würden sie zerreißen, ihr Unterleib, alles tat weh.
Langsam wurde ihr wieder bewusst, was ihr zugestoßen war. Josepha, die Soldaten, das Pferd! Was hatte dieser Uhrenhändler damit zu tun? Er kam ihr bekannt vor. Natürlich, es war Antonius Burger. Er hatte sich verändert in der Fremde. Aus dem schlaksigen Jungen war ein stattlicher, gut aussehender Mann geworden.
»Was tust du hier? Was hast du gesehen? Das Pferd, die Soldaten? Wo sind sie?« Helena zog schamhaft ihren zu kurzen Rock über die Knie. Ihre Gedanken rasten. Was hatte er mitbekommen? Wusste er von der Schande, die ihr angetan worden war? Seit wann lag sie hier? Vorsichtig, mit einer Hand den dröhnenden Kopf stützend, tastete sie sich am Holzstapel hoch.
Antonius griff ihr unter die Arme, aber sie schlug seine Hand weg. »Fass mich nicht an, hörst du?« Etwas ruhiger setzte sie hinzu: »Entschuldige, ich … ich bin noch so durcheinander.«
»Schon gut. Ich wollte dir nicht zu nahe treten. Was meinst du mit dem Pferd und den Soldaten? Haben die Soldaten dich …? Wie viele …?« Er stockte, weil er sah, dass sie ihre Augen vor Entsetzen weit aufriss. Er hätte sich ohrfeigen können.
Helena blickte beschämt zu Boden, dann nickte sie fast unmerklich, während ihr die Tränen über die Wangen kullerten.
»Ich habe niemanden gesehen«, begann er bedachter und wagte nicht, ihr in die Augen zu sehen. »Ich komme vom Schafhof. Wir haben abgerechnet, und nun war ich auf dem Heimweg, als das Gewitter mich überraschte. Ich habe mich oben hinter der Kapelle untergestellt.« Antonius deutete zur Kapelle, die man von hier aus sehen konnte.
Helenas Schultern bebten, sie schien am ganzen Leib zu zittern. Elend, wie ein geschlagener Hund, stand sie da, sich noch immer am Holzstapel haltend, klatschnass und voll brauner Erde. Endlich blickte sie auf. »Antonius, dann warst du ja ganz in der Nähe. Dann musst du doch Soldaten gesehen haben.«
Antonius schüttelte den Kopf: »Nein, tut mir leid. Ich habe überhaupt niemanden gesehen. Konntest du denn Soldaten erkennen?«
»Ich habe auch niemanden gesehen. Er … Er hat mich von hinten zu Boden geworfen. Dann habe ich das Bewusstsein verloren. Ich weiß nichts. Nur das Pferd, ich habe es von hinten gesehen, durch die Büsche ist es verschwunden.« Sie deutete in die Richtung, wo sie das Tier gesehen hatte, dann blickte sie wieder beschämt nach unten, ehe sie geräuschvoll die Nase hochzog und sich mit dem Ärmel über das Gesicht wischte.
»Wie kommst du dann darauf, dass Soldaten hier sind? Ich habe noch nichts davon gehört, es kann genauso gut jemand anders hier gewesen sein.« Als von Helena keine Reaktion kam, fügte er hinzu: »Aber ich bin auch erst heute angekommen.«
Sie blickte ihm nun fest und gefasst in die Augen, dann erzählte sie ihm stockend von ihrem seltsamen Erlebnis bei der Hebamme. Antonius hörte sich die mysteriöse Geschichte an. Er hatte bereits von den unheimlichen Fähigkeiten der Hebamme gehört.
»Eine Art Prophezeiung also.« Er biss sich auf die Unterlippe. »Bist du sicher, dass die Alte nicht manchmal, na ja, etwas zusammenspinnt?«
Helena hob matt eine Schulter.
»Komm, wie dem auch sei, wir sollten schauen, dass wir schleunigst hier verschwinden. Dieser Wald hat heute etwas Unheimliches an sich. Außerdem holst du dir den Tod, wenn du nicht aus deinen nassen Sachen kommst. Du zitterst wie Espenlaub.«
Antonius reichte ihr die Hand. Nur zögernd ging sie auf ihn zu.
Er deutete auf den Boden. »Vergiss deine Medizin nicht. Es ist doch Medizin, oder?«
Helena nickte. Mit einem Stöhnen, denn ihr Schädel dröhnte heftig, als sie sich bückte, nahm sie das Fläschchen auf.
»Komm, ich stütz dich«, bot sich Antonius an, doch sie lehnte dankend ab.
»Man kann uns sehen, wenn wir aus dem Wald kommen. Niemand darf etwas erfahren.« Helena blieb dicht vor Antonius stehen und blickte ängstlich zu ihm auf. »Du darfst es keinem sagen, hörst du? Versprich mir das. Vater schlägt mich tot, wenn er weiß, was passiert ist.«
Antonius war erleichtert. So kam er wenigstens nicht in Verdacht. »Helena, so wie du aussiehst, wird er dich aber wohl fragen, was passiert ist.«
»Vielleicht ist er noch gar nicht zu Hause. Er war draußen im ›Buchen‹, als ich weg bin.« Sie deutete Richtung Neustadt, dorthin, wo eine Gaststätte zwischen Rudenberg und dem Städtchen zur Stärkung einlud.
»Du blutest, lass uns runter an den Bach gehen. Du musst deine Wunde auswaschen.«
Helena tastete vorsichtig an ihren Hinterkopf, vor lauter Aufregung hatte sie die Platzwunde noch nicht wahrgenommen.
Schweigend setzten sie sich schließlich in Bewegung. Sie ließen den Wald hinter sich und gingen rechts vom Weg ab, um in der Talsohle an das Bächlein zu gelangen. Helena kullerten nach wie vor Tränen über das Gesicht, die sie immer wieder tapfer und schweigend mit dem Ärmel abwischte. Langsam hörte sie auf zu zittern und zu schluchzen.
Antonius überlegte noch immer krampfhaft, ob ihm nichts aufgefallen war. Aber er konnte sich an nichts erinnern, nicht einmal Hufspuren hatte er gesehen, die sich sonst im weichen Untergrund abdrückten.
Endlich kamen sie an das plätschernde Bächlein, das sich gurgelnd um die Steine wand und sich einen Weg ins Tal suchte. Helena stellte sich mit beiden Füßen in das kühle Nass und begann, ihr Gesicht und ihre Arme abzuwaschen. Als sie spürte, wie etwas Warmes zwischen ihren Beinen hinunterlief, zog sich in ihrer Magengegend vor Ekel und Scham alles zusammen. Dann musste sie sich übergeben.
Antonius, der sich ins Gras gesetzt hatte, sprang erschrocken auf. »Kann ich dir helfen?«
Helena schüttelte nur den Kopf und setzte sich weinend an die Böschung.
Hilflos stand Antonius einen Augenblick daneben, dann fasste er Mut. »So wird das nie etwas. Ich wasche dir die Wunde aus. Beug dich nach vorne.« Ohne auf ihren schwachen Protest zu achten, formte er seine Hände zu einer Schale und goss kaltes, klares Wasser über ihre Wunde am Hinterkopf. Dann reinigte er ihr das Kleid, das an ihrem Rücken Blutspuren aufwies. Die Wunde hörte aufgrund des kalten Wassers sogleich auf zu bluten, und Antonius drückte ein Taschentuch darauf. Dann deckte er Helenas Haare darüber. »Halt noch kurz.« Aufmunternd blickte er sie an. »So, komm, jetzt bist du nur noch nass, aber das bin ich auch. Das war vom Regen.«
Helena lächelte das erste Mal. »Ich danke dir, Antonius. Ich bin froh, dass du mir geholfen hast. Es bleibt unter uns, ja?«
»Versprochen.« Er reichte ihr die Hand, und zögernd gab sie ihm ihre. Für einen kurzen Moment blieben sie so stehen. Antonius blickte fasziniert in ihre wasserblauen Augen. Die Furcht, die er vorhin noch darin gesehen hatte, schien langsam zu weichen. Sie vertraute ihm.
***
Unruhig wälzte sich Helena in dieser Nacht im Bett umher. Ihr Kopf schmerzte und hämmerte noch immer. Und als sie endlich eindöste, erschienen schreckliche Gestalten auf übergroßen Pferden, verfolgten sie und schlugen sie, ehe sie sie in ihre schwarzen Gewänder packten und mitschleppten. Im letzten Moment konnte sich Helena befreien und schreckte hoch. Ihr Nachthemd war nass geschwitzt, sie zitterte am ganzen Leib.
Die kühle Nachtluft wehte durch das Fenster herein, der Mond warf seinen Schein auf den Bretterboden der Mädchenkammer. »Alles ist gut. Es war nur ein Traum«, redete sie sich ein. Die vertraute Umgebung ließ ihren Pulsschlag etwas verlangsamen.
»Gib endlich Ruhe! Ich kann nicht schlafen, wenn du so ein Geschrei veranstaltest!« Hannah, ihre jüngere Schwester, mit der sie das Bett teilte, keifte sie entnervt an.
Helena war sich gar nicht bewusst gewesen, dass sie geschrien hatte. »Entschuldige, ich habe schlecht geträumt.« Sie schwang ihre Beine aus dem Bett und schlug das Deckbett zurück. »Ich brauche etwas frische Luft.«
»Müssen ja heiße Träume sein. Was war es denn? Die Tracht Prügel vom Vater, weil du den Speck aus dem Vorratskästchen gestohlen hast? Oder gar der Uhrenträger?«
»Ach, lass mich doch in Ruhe.« Helena verspürte absolut keine Lust, mit ihrer Schwester über das Ereignis vom vergangenen Tag zu streiten. Sie wollte alles nur so schnell wie möglich vergessen. Diese Schmach und Schande, die ihr im Wald widerfahren waren. Die Prophezeiung dieser unheimlichen Hexe. Und dann auch noch die Schläge ihres Vaters wegen der gestohlenen Scheibe Speck. Und das alles nur, weil sie es gut gemeint hatte, sich um ihre Mutter sorgte, wenn es sonst keiner tat. Nicht einmal die alte Anna, die, weil sie sonst niemanden hatte, ihnen für Kost und Logis im Haushalt half, hätte gewagt, gegen den Willen des Hausherrn Hilfe zu holen. Lieber wäre sie betend neben dem Bett sitzen geblieben und hätte gewartet, bis Leopoldine gestorben wäre.
Helena hatte getan, wie ihr die Hebamme geheißen hatte, und hoffte, dass das Fieber bald nachlassen würde. Jedenfalls war ihre Mutter ruhiger eingeschlafen und deren Brust war nicht mehr so hart. Umso mehr pochte nun Helenas Kopf. Sie stand auf und ging zum Fenster, wo sie tief einatmete.
Sie musste an ihre Rückkehr und den Empfang durch ihren Vater denken. Sofort deutete ein vermehrter Speichelfluss eine neue Welle der Übelkeit an.
Als ob ihr Vater auf sie gewartet hätte, hatte er breitbeinig in der Stalltür gestanden, als sie mit Antonius aus dem Wald gekommen war. Er empfing die beiden wie Schwerverbrecher. Die Arme in die Hüften gestemmt, sein struppiges graues Haar vom Kopf abstehend und wie ein angriffslustiger Jungbär – denn er war von starkem Körperbau, wenn auch nicht sehr groß – füllte er den Türrahmen aus und wartete. Das Glänzen in seinen graugrünen Augen und die roten Ringe darum ließen Helena auf das Schlimmste gefasst sein. Er hatte wieder getrunken. Über sein pockennarbiges Gesicht mit der breiten Nase, deren Flügel verräterisch bebten, zog sich ein künstliches Lächeln.
»Da, sieh an, sieh an, das Fräulein Tochter kommt auch schon heim. Und wen haben wir denn da dabei? Einen Uhrenhändler, wie er im Buche steht. Kaum aus der Fremde zurück, rennen ihnen die Weiber wie läufige Hündinnen nach.« Er holte unversehens aus und schlug Helena mit dem Handrücken ins Gesicht, sodass sie taumelte.
Antonius sprang vor und hielt ihm die Hand fest. »Das macht Ihr nicht noch mal, Kirner.«
»So? Das werden wir ja sehen! Ich mache mit meiner Tochter, was ich will. Und wenn sie Schläge verdient, bekommt sie sie auch, verstanden?«
Für ein paar Wimpernschläge standen sie sich gegenüber wie zwei Kampfhähne.
Da schob sich Helena vor Antonius und hielt die Hände zur Abwehr hoch. »Nicht. Nicht schlagen, Vater. Es ist meine Schuld«, begann sie zu stottern.
Antonius zog sie beiseite. »Nein, ich war es, der sie aufgelesen hat oben im Wald, ich habe sie zufällig getroffen. Wir haben Schutz gesucht vor dem Gewitter. Bei der Kapelle.«
»Bei der Kapelle«, wiederholte Julius gedehnt und nickte, ohne Antonius aus den Augen zu lassen. »Bei der Kapelle, da hast du dir aber einen heiligen Ort ausgesucht.« Jetzt wandte er sich wieder an seine Tochter. »Du kleine Hure. Du Diebin! Glaubst, ich habe nicht bemerkt, dass du gestohlen hast? Treibst dich ohne Erlaubnis im Nachbarort herum? Lässt den Jungen allein auf der Viehweide, wenn ein Gewitter aufkommt? Die Viecher sind ihm ausgebrochen!« Er nickte zu Simon, der sich in der Stallecke herumdrückte. Offensichtlich hatte auch er schon Prügel bezogen.
»Aber Mutter …«, wagte Helena zu widersprechen.
»Mutter, Mutter!«, äffte er sie nach. »Weiberkram. Die wird schon wieder werden, sie hat schon genug Kinder bekommen. Sie ist zäh.« Er zog Helena an ihren Zöpfen so nah an sich heran, dass sie den Schnaps riechen konnte. »Sofort ins Haus mit dir, und zur Strafe gibt es kein Abendessen.« Er stieß sie von sich und hob drohend seinen Zeigefinger gegen Antonius. »Und eines sage ich dir, du Wanderbursche: Wenn ich dich noch einmal in der Nähe meiner Tochter sehe, bring ich dich um.«
Helena klammerte sich am Fensterbrett fest und versuchte, die Erinnerung beiseitezuschieben. Durch den geöffneten Flügel musste sie sich erneut übergeben. Sie spürte, wie ihr der Schweiß aus allen Poren drang, fühlte sich elend und schwach. Schwer atmend, denn es würgte sie noch immer, setzte sie sich auf die Holztruhe unter dem Fenster und verharrte eine Weile. Sie zitterte vor Kälte und Wut.
Leises Schnarchen vom Bett her riss sie aus den Gedanken. Hannah war schon wieder eingeschlafen. Helenas Übelkeit ließ schließlich nach, und ihre kühlen Füße erinnerten sie an ihr warmes Bett, wo Hannah die Decke fast ganz über ihren Kopf gezogen hatte. Im Bett an der Wand gegenüber schliefen ihre jüngeren Schwestern Marie und Theres tief und fest.
Helenas Kopf pochte nach wie vor, der Schmerz hatte sich sogar bis zur Stirn vorgearbeitet. Während sie das Fenster schloss, fiel ihr Blick auf den funkelnden Sternenhimmel. Von Osten her wurde der Horizont schon heller, und der Morgenstern leuchtete über dem schwarz abgegrenzten Wald. Nicht mehr lange und der Tag würde erwachen.
Plötzlich vernahm sie aus der Ferne Stimmengewirr. Sie kniff ihre Augen zusammen und suchte in der Dunkelheit nach dessen Herkunft. Systematisch wanderte ihr Blick über die abgeholzten Waldgebiete, Felder und Matten, bis sie glaubte, winzige Lichtpunkte im südwestlichen Talausgang, dem Lochenbach, ausmachen zu können. Gebannt starrte sie zu dem kleinen Weiher, der sich dort befand. Kein Zweifel, es brannten Feuer, deren Schein jetzt deutlich zu erkennen war, die Lichter spiegelten sich auf der Oberfläche des Wassers. Es sah aus wie ein nächtliches Lager, ein ziemlich großes dazu, soweit Helena es von hier aus erkennen konnte. Außer einem Müller lebte dort unten aber niemand.
Wer außer einem feindlichen Heer würde mitten in der Nacht ein Lager aufschlagen? Helena kamen wieder die schrille Stimme der Hebamme und deren Prophezeiung in den Sinn … dass die Soldaten plündern, brandschatzen und schänden würden. Sie zog den Kopf zurück und fuhr sich mit beiden Händen durch das wirre Haar. Sie spürte, wie ihre Knie zu zittern begannen. Die Panik kroch in ihr hoch und schien ihr die Kehle zuzuschnüren. Nochmals blickte sie aus dem Fenster. Kein Zweifel, da unten tat sich etwas. Sie musste reagieren! Sie wusste, was bevorstand, und sie hatte beileibe kein Verlangen mehr danach.
»Hannah! Wach auf! Die Soldaten kommen! Komm, sieh es dir an!«
»Was? Bist du jetzt ganz übergeschnappt? Lass mich los!«
Helena zerrte ihre Schwester unter Protest aus dem Bett, die schließlich nachgab und schlaftrunken ans Fenster trottete.
»Oh, verdammt! Du hast recht. Da brennen Feuer. Du musst Vater wecken!«
Polternd rannte Helena die Treppenstufen hinunter, der Schmerz vom Vortag stand jetzt hintan. Sie stürzte in die Stube, dorthin, wo ihr Vater auf der Ofenbank schlief, denn er legte sich grundsätzlich nicht neben eine Wöchnerin.
»Vater! Vater wacht auf! Die Franzosen kommen! Sie lagern unten im Lochenbach!« Helena schüttelte ihn, während er brummend um sich blickte, als müsste er sich orientieren.
»Was? Wer ist da?« Sein Haar stand wie meist vom Kopf ab.
»Soldaten! Unten im Lochenbach!« Helena rannte ans Stubenfenster und riss es auf. »Da, seht! Es brennen Lagerfeuer!«
Julius schlurfte missmutig und verschlafen ans Fenster und blickte in die Richtung, die Helena ihm deutete. Plötzlich kam Leben in ihn. Ohne ein Wort zu sagen, streifte er seine Hose über und stürzte aus dem Raum, Helena hinterher.
»Vater?«
Er schaute sich kurz zu ihr um. »Zieht euch an, ich schau nach.«
Hannah stand nun auch in der Tür. »Und? Was meint er?«
»Er geht nachschauen. Komm, wir richten uns, wir müssen uns in Sicherheit bringen.«
Hastig streiften die beiden ihre Kleider über, ehe sie nach draußen liefen, ihrem Vater entgegen, der schon keuchend und mit hochrotem Kopf die Matte hochgerannt kam.
»Schnell, schnell, Helena, weck die Kinder! Hannah, du hilfst mir packen. Ihr müsst weg, das Vieh in Sicherheit bringen. Es sind Hunderte, ein ganzes Heer. Sie müssen heute Nacht ihr Lager aufgeschlagen haben. Es wird nicht lange dauern, bis sie ausschwärmen und alles mitnehmen, was nicht niet- und nagelfest ist.«
Helena stürmte in die Bubenschlafkammer und weckte Johann und die Kleinen, dann eilte sie rüber in die Mädchenkammer und holte die Schwestern aus dem Bett.
»Was ist los? Warum müssen wir aufstehen?« Marie, die Zehnjährige, verstand sofort, dass etwas nicht in Ordnung war.
»Weil die Franzosen kommen.«
»Was machen die?« Theres zog sich die Decke wieder über den Kopf. Sie sah offenbar keinen Grund, zu dieser Zeit das Bett zu verlassen.
»Sie kommen und stehlen uns alles.«
»Warum?« Theres’ brauner Lockenkopf kam wieder zum Vorschein.
Helena schnappte die Dreijährige, ohne weitere Diskussionen einzugehen, und schwang sie über ihre Hüfte. »Darum. Weil Krieg ist.«
Polternd stürmte sie mit den verwirrten Kindern die Stufen hinunter und rannte in die Küche, wo Hannah schon auf dem erkalteten Herd stand und mit Julius die fast zentnerschwere Speckseite vom Rauch abhängte. Nahrung für mehrere Monate. Sie schleppten sie auf den Heustock und versteckten sie unter dem Heu, während Johann und die beiden Buben die Tiere aus dem Stall führten.
Helena füllte in Windeseile die Schlitzsäcke, die man als Umhängetaschen benutzte, mit den nötigsten Lebensmitteln, die ihr gerade in die Hände fielen. »Und Mutter?« Sie blickte fragend zu ihrem Vater, als dieser wieder vom Heustock kam.
»Sie, Anna und das Kind bleiben hier bei mir. Einer Wöchnerin werden sie schon nichts tun. Los, verschwindet.«
Ein erbärmlicher Haufen Kinder mit drei Ziegen, einer Kuh samt Kalb und fünf Schafen stahl sich kurz darauf in der weichenden Dunkelheit in nördlicher Richtung aus dem Ort. Ihr Ziel war die Köhlerhütte tief im wild wuchernden Gestrüpp Richtung Reichenbach. Dort sollten sie warten, bis die Gefahr vorüber war.
KAPITEL 2
Am nächsten Morgen, Andresenhof
Wie aus tiefer Bewusstlosigkeit erwachte an diesem Morgen Josef Burger, der Andresenbauer und Antonius’ Vater. Es war schon hell draußen. Erschrocken griff er im Ehebett neben sich, doch der Platz war leer. Magdalena, sein Weib, war wohl bereits aufgestanden.
Mit einem Schwung stand Josef neben seinem Bett, noch schneller jedoch saß er wieder auf demselbigen und hielt seinen Kopf. Heftiges Dröhnen und ein Anfall von Schwindel mahnten ihn zur Vorsicht. Einen solchen Brummschädel hatte er schon lange nicht mehr gehabt. Nebelhaft konnte er sich an die letzte Nacht erinnern und an den Schnaps. Er schüttelte sich bei dem Gedanken daran.
Vorsichtig angelte er sich im Sitzen seine Hose, die am Bettpfosten hing, und stieg hinein. Ebenso langsam stand er nun erneut auf und fuhr sich mit den schwieligen Händen durch das dünne graue Haar, das ihm immer wieder eigenwillig ins Gesicht fiel. Er war eher klein und von schmächtiger Statur, aber recht zäh und stolz, was sein stets aufrechter Gang bewies. Und er war ein Arbeitstier, was seine kräftigen Hände im Vergleich zum Körperbau verrieten. Doch mit dem Alkohol war er nie gut Freund gewesen, er verabscheute die Trunksucht sogar, denn sie war die Wurzel allen Übels. So zumindest hatte er es immer seinen Söhnen gepredigt. Bis auf gestern. Er konnte sich sein sündhaftes Verhalten selbst nicht erklären, und ihm wurde übel bei dem Gedanken, dass er zusammen mit seinen erwachsenen Söhnen Antonius und Balthasar die ganze Flasche mit teurem Schnaps ausgetrunken hatte.
Sein Blick schweifte aus dem Fenster, die Sonne stand schon über den vereinzelten Tannenspitzen oben auf der Anhöhe des Schillings. Um diese Zeit war er normalerweise längst mit der Stallarbeit fertig.
Seine Erinnerung wanderte wieder zum gestrigen Abend, und sie gefiel ihm auf den zweiten Blick etwas besser. Schließlich schüttelte er selbstgefällig den Kopf über seinen alkoholischen Ausrutscher. Ein zufriedenes Lächeln, eben der Stolz eines Vaters, legte sich auf seinen Mund. Antonius, der erste Uhrenträger der Familie und künftiger Uhrenhändler, war wieder zurück. Und er hatte gutes Geld mitgebracht. Die anderen würden eines Tages bewundernd auf ihn, sein eigen Leib und Blut, schauen. Er würde es zu etwas bringen, dieser Antonius, da war sich Josef sicher. Er hatte Glück mit seinen Söhnen, denn auch Balthasar entpuppte sich als ein guter Bauer und Hoferbe.
Josef fuhr noch einmal durch sein Haar und stieg schließlich die Treppe von der Schlafkammer hinunter. Das Klappern von Geschirr in der Küche ließ ihn kurz innehalten und es sich anders überlegen. Er wollte lieber auf den Frühstückstee verzichten und sich somit das vielsagende Schmunzeln der Frauen bei seinem Anblick ersparen. Also bog er gleich in den Stall ab, wo er seine Söhne vermutete.
»Wenn man dich so hört, könnte man grad neidisch werden, kleiner Bruder«, hörte er seinen Ältesten in diesem Moment sagen.
Und obwohl Josef nicht lauschen wollte, denn das gehörte sich nicht, blieb er stehen und horchte.
»Du bekommst hautnah mit, was draußen in der großen, weiten Welt passiert. Bei mir dagegen ist schon alles geplant, die Hofübernahme, Hochzeit, dann Kinder, nichts von Abenteuern.«
»Mensch, Balthasar, du hast schon eine gesicherte Existenz! Ich muss meine erst noch aufbauen.« Antonius stach kräftig mit der Gabel ins Stroh und verteilte es unter den Hinterteilen der Kühe, die in einer Reihe angebunden standen.
»Sag mal, wie sind denn die Frauen in Florenz? Stimmt es, dass die Südländerinnen, na ja, du weißt schon, eben offenherziger sind?« Balthasars Augen leuchteten bei dem Gedanken an vollbusige schwarzhaarige Italienerinnen.
»Ich dachte, du willst heiraten, Bruderherz! Wo sind deine Gedanken?« Tadelnd wiegte Antonius den Kopf und blickte zu seinem Bruder, der eher Josefs schmächtige Gestalt geerbt hatte. Auch war sein Haar glatt und heller als das von Antonius, der mehr der Mutter glich mit seinem dunklen Teint, den dunklen Augen und Haaren, ebenso mit seiner hochgewachsenen Gestalt, denn Magdalena überragte ihren Gatten um einen halben Kopf. »Du solltest deine Sinne nicht an Straßendirnen verschenken. Die sind überall, wo Händler sind. Aber das sind gerissene Luder, die ihre Freier ausnehmen wie Weihnachtsgänse. Schon manch einer ist morgens nur im Hemd aufgewacht, und alles war gestohlen.«
»Hast wohl auch schon deine Erfahrungen gemacht, wie?« Balthasar warf seinem Bruder einen vielsagenden Blick zu. »Komm, gib’s zu. Du hast doch nicht nur die Schönheit der Kirchen und Dome bestaunt, wie du Vater erzählt hast.«
»Na, wie man’s nimmt.« Antonius grinste zurück, er genoss es, seinen Bruder zappeln zu lassen. »Es gibt natürlich auch zweibeinige Schönheiten, das will ich nicht bestreiten.«
»Antonius!« Josef konnte sich nicht mehr beherrschen und bog um die Ecke, hinter der er ausgeharrt hatte. »Du gottloser Bengel! Wirst du aufhören mit diesem sündigen Gerede! Recht geschieht es diesen … diesen Hurenböcken, wenn sie ausgeraubt werden. Das kommt davon! Haben Frauen und Kinder daheim und treiben sich mit Straßendirnen herum. Sodom und Gomorrha! Wir haben dich zu einem anständigen Kerl erzogen! Damit du mir nicht ganz verdirbst, liest du heute Abend aus der Bibel vor!«
Josefs ganzer Stolz war verflogen, fluchend stürmte er an den Burschen vorbei in den Schweinestall. Es war heute nicht sein Tag. Kaum entließ man die Brut aus seinen Fittichen, benahm sie sich daneben.
»Oh, unser Herr Vater hat wohl schlecht geschlafen.«
»Kein Wunder, er hat auch die Flasche Kirsch fast alleine geleert gestern Abend.«
»Antonius, du bist eine Enttäuschung! Vater war so glücklich über deine Rückkehr.« Balthasars gespielte ernste Miene verzog sich bald zu einem Spötteln, und schließlich fiel auch Antonius in das Gelächter ein. Die beiden Brüder genossen es, wieder beisammen zu sein. Seit Kindesbeinen hingen sie wie Pech und Schwefel aneinander. Keiner hatte je etwas über den anderen kommen lassen. Sie freuten sich auf die nächsten Monate, in denen Antonius zu Hause sein würde, denn die nächste Reise war erst für das kommende Frühjahr geplant. Noch ahnten sie nicht, was sich zu diesem Zeitpunkt wenige Schritte vom Hof entfernt anbahnte.
***
Die letzten Nebelfetzen über dem kleinen Weiher des Lochenbachs verdunsteten und versprachen einen klaren, sonnigen Tag. Unweit von diesem Gewässer, im Lager der Franzosen, erwachte das Leben.
Die unterschiedlichsten Gerüche hingen über dem eilig in der Dunkelheit eingerichteten Lager. Es roch in der kühlen Morgenluft nach Männerschweiß und dampfendem Pferdedung. Hier und da wärmten sich die frierenden Soldaten ihre Finger an einer Tasse dünnem Kaffeeersatz aus gebranntem Getreide. Die Tiere, bewacht von einigen Soldaten der letzten Schicht, wurden langsam unruhig. Sie waren genauso wie die mehreren hundert Mann in diesem Lager hungrig. Der Hafer war ausgegangen, ebenso die Lebensmittel der Soldaten. Ein langer Marsch hatte hinter ihnen gelegen, ehe sie weit nach Mitternacht endlich einen geeigneten Lagerplatz gefunden hatten. Die Männer waren am Rande ihrer Erschöpfung, dementsprechend gereizt war die Stimmung.
Doch bevor die Einheit ausschwärmen konnte, um sich Lebensmittel und Futter in den umliegenden Höfen zu beschaffen, musste noch ein Vorfall geklärt werden. In der Mitte des Lagerplatzes lag ein Toter, einer von ihnen.
Unruhig ging der Hauptmann durch die Reihen der deprimiert dreinschauenden Gestalten. Der Tote war heute Morgen aufgefunden worden. Seine Leiche war im Ufergestrüpp geschwommen, als der Küchendienst Wasser hatte schöpfen wollen. Der Hauptmann hatte den Toten herausziehen und ihm die Uniform abnehmen lassen, doch der Körper zeigte keine Spuren von Gewalteinwirkung. Der Mann musste also ertrunken sein.
Mit strenger Miene musterte der Hauptmann nun seine Leute. Natürlich hatte keiner etwas gesehen oder gehört. Gewalt und Rivalität waren jedoch, je länger sie unterwegs waren, an der Tagesordnung. Die Kriegseuphorie der ersten Tage und Wochen war schon lange verblasst. Der Frust und die Kriegsmüdigkeit mündeten oft in Streitereien.
Einen Mord vonseiten der Einwohner hielt der Hauptmann für unwahrscheinlich. Die Bevölkerung wusste um die harten Bestrafungen und würde sicherlich nicht riskieren, dass ihr Dorf niedergebrannt würde, zumal die wenigsten die Belagerung bisher bemerkt haben dürften. Andererseits konnte er es auch nicht ganz ausschließen, denn der Weiher lag einige hundert Schritte vom Lager entfernt. Hatte sich jemand in der Nähe herumgetrieben und unbeobachtet gefühlt?
Der Hauptmann schaute sich um. Das nächste Gebäude war eine Mühle, etwa fünfhundert Schritte den Hang hinauf. Er beschloss, sich dort später umzusehen, wenn die Truppen ausgeschwärmt waren.
Räuspernd wandte er seine Aufmerksamkeit wieder dem Toten zu, der vor ihm lag. Ein Mann um die dreißig, Familienvater, soviel er wusste. Dessen Gesicht schimmerte bläulich unter der unnatürlichen weißen Haut. Kein schöner Anblick, und die ersten fetten Schmeißfliegen, ansonsten angezogen durch den Pferdedung, hatten den Weg zu dem Toten, der jetzt in der morgendlichen Sommersonne lag, auch schon gefunden.
»Nun ja, ich muss annehmen, dass er ohne fremdes Verschulden zu Tode gekommen ist.« Er hob mit der Fußspitze den nackten, leblosen Körper an und rollte ihn zur Seite. »Keine Verletzungsmerkmale. Ich hoffe für euch, dass er wirklich ohne Fremdeinwirkung in den Weiher gefallen ist. Sollte ich mitbekommen – und glaubt mir, ich kriege alles heraus«, er unterstrich seine Autorität dadurch, dass er kurz auf den Zehenspitzen wippte, um größer zu erscheinen, »dass ihn einer ertränkt hat, dann gnade euch Gott! Auf Mord steht die Todesstrafe! Ich knüpfe den Täter eigenhändig am nächstbesten Baum auf!«
Es war schwierig, in eine meuternde Truppe Ruhe und Ordnung zu bringen. Nur härteste Strafen und äußerste Disziplin wirkten einschüchternd. Mit betroffenen Gesichtern blickten die Soldaten widerspruchslos zu Boden. Einen Augenblick schwieg der Hauptmann noch, um seine Worte wirken zu lassen, ehe sie abtreten konnten.
Er kommandierte zwei Leute ab, um den Toten zu begraben. Die anderen begannen, die Packpferde zu zäumen und die Gewehre zu richten. Ein weiterer Trupp hatte Lagerdienst, das hieß aufräumen, sauber machen und das Lager bewachen. Es war der Strafdienst für diejenigen, die sich in den letzten Tagen nicht an die strengen Regeln gehalten hatten.
Schließlich nahmen die Soldaten Stellung und wurden in je fünfzehn bis zwanzig Mann starke Gruppen aufgeteilt, die gleichzeitig die noch schlafend wirkenden Höfe aufsuchen sollten. Der Befehl lautete: Nahrung und Futtermittel besorgen, und nur bei Gegenwehr der Bevölkerung von der Waffe Gebrauch machen! Abbrennen der Höfe und Häuser ebenfalls nur bei Widerstand. Treffpunkt um die Mittagszeit im Lager.
Erleichterung, Kampfgeist und die Vorfreude auf einen vollen Magen ließen die Männer mit Freudengejohle ausschwärmen. Der Hauptmann wusste, dass sie sich gegenüber den Einwohnern, vor allem den Frauen, nicht immer korrekt verhalten würden. Aber sie brauchten ab und zu ihren Auslauf und Spaß, danach waren sie wieder viel einfacher zu führen. Schließlich herrschte Krieg. Da krähte hinterher kein Hahn mehr danach.
Er griff in seine Brusttasche und holte eine seiner letzten Zigarren aus der flachen Blechbüchse. Er zündete sie an und blickte den davoneilenden Männern nach. Für einen kurzen Moment musste er an seine eigene Jugend bei der Armee denken. Er konnte die Freude der Männer nachempfinden.
Genüsslich nahm er einige Züge und blies den Rauch ringförmig gegen den stahlblauen Himmel. Dabei zwirbelte er sich seinen Schnauzer und strich anschließend wohlwollend über seinen trotz Kriegszeiten noch ansehnlichen Wanst. Er war zufrieden. Heute Abend würde es wieder einmal eine ordentliche Verpflegung geben, denn die Höfe schienen noch nicht allzu sehr gelitten zu haben. Sie waren recht gut im Schuss, soweit er abschätzen konnte.
Schließlich machte er sich auf den Weg den Hang hinauf. Das Mühlrad stand noch still. Das Gepolter des riesigen Holzrades wäre sonst bereits zu hören gewesen. Wahrscheinlich war keine Menschenseele mehr dort. Alle geflüchtet. Der Hauptmann blickte zurück, um zu sehen, ob seine Strafdienstler auch wirklich arbeiteten. Voller Genugtuung darüber, dass alles klappte, näherte er sich der Mühle.
Der hölzerne Schließmechanismus des Wasserkanals war umgeleitet. Das Wasser floss von einem kleinen Stauweiher zum Mühlenhäuschen, in dessen Inneren sich das Mühlrad befand, und in einem Bach wieder ab. War der Schieber wie jetzt geschlossen, plätscherte der Überlauf des Stauweihers direkt den Wassergraben hinunter.
Langsam schritt der Hauptmann auf die Tür zu. Sie war nicht verriegelt. Vorsichtig blickte er sich nach allen Seiten um, warf den letzten Rest seiner Zigarre in das vorbeifließende Gewässer und drückte dann gegen die Tür. Quietschend öffnete sie sich. Der Raum, in dessen Mitte ein Aufgang zum Mühlentrichter war, schien leer. Seine Augen mussten sich erst noch an die Dunkelheit gewöhnen, dann überflogen sie blitzschnell die karge Einrichtung. In einer Ecke standen eine Holzpritsche, die dem Müller wohl als Bett diente, ein Stuhl und ein kleiner Tisch. Gegenüber ein kleiner gemauerter Herd, in dem sich verräterische glühende Holzreste befanden. Eine Blechkanne stand am Rand.
Der Hauptmann ging langsam zum Herd. In der Kanne befand sich noch warmer Tee. Der Müller musste sich hier irgendwo versteckt haben. Wäre er geflohen, hätte er ihn gesehen, denn der nächste Hof, der Michele, war noch gute achthundert Schritte entfernt. Und dazwischen lag nur freie Viehweide.
Der Offizier stieg die Stufen zum Trichter hinauf. Dort hingen leere Getreidesäcke am Geländer. Der Holztrichter selber war ebenfalls leer und gab somit den Blick auf die Walze frei, hier konnte sich niemand verstecken. Dann gab es nur eine Möglichkeit: Der Müller musste sich im Zwischenkanal, dort, wo sich das riesige hölzerne Wasserrad befand, verschanzt haben. Viel Platz konnte er da nicht haben, aber der Hauptmann war ein vorsichtiger Zeitgenosse, darum öffnete er nicht den Durchgang, sondern ging wieder hinaus, wo ihn das Licht der aufgehenden Sonne blendete. Er wollte kein Risiko eingehen und in eine Falle treten.
Sein Augenmerk fiel auf den Schieber. Würde er ihn betätigen, würden die Wassermengen den hölzernen Kanal zum Mühlrad hinunterstürzen und es in Bewegung setzen. Wollte der Müller nicht unter den Wasserfluten begraben werden, musste er herauskommen.
Der Holzschieber saß gut fest, und der Hauptmann brauchte alle Kräfte, doch dann löste er sich, und die Wassermassen donnerten den Kanal entlang. Jetzt musste der Müller sich in Sicherheit bringen. Ein ächzendes Geräusch kündigte die beginnende Bewegung des schwerfälligen Mühlrades an.
Der Hauptmann ließ die Tür nicht aus den Augen, bereit, den Flüchtenden zu fangen. Doch plötzlich übertönte ein gellender Schrei das ohrenbetäubende Gepolter des Mühlrades. Kurz darauf erstarb der lang gezogene Schrei. Nur das gleichmäßige Rumpeln des Mühlrades war noch zu hören.
»Idiot!«, zischte der Hauptmann. Mit voller Wucht rammte er den Schieber wieder zu und eilte um die Mühle herum dorthin, wo der Kanal abfloss und in den Bach mündete. Mit einem ebenso ächzenden Geräusch wie vorhin blieb das Rad stehen. Der Wasserstrom, der ihm von der Mühle aus entgegenkam, wurde zu einem Rinnsal, das sich langsam rot färbte.
Zu spät! Panik erfasste den Hauptmann, die Hitze stieg ihm in den Kopf und pochte an den Schläfen. Er hatte diesen Mann nicht töten wollen, der der Einzige gewesen war, der den Vorfall der letzten Nacht mitbekommen haben könnte.
Als das Rad ganz zum Stillstand gekommen war, kroch er in den Kanal. Vielleicht war der Müller nur verletzt? Am Boden zwischen dem Rad und dem mit schweren Steinen ausgelegten Erdreich sah er den Schädel des Müllers. Oder besser gesagt das, was davon übrig war. Der Körper hing seltsam abgeknickt zwischen Steinmauer und Wasserrad. Er musste oben auf dem Mühlrad gelegen haben. Damit hatte er keine Chance gehabt, sich durch rasches Herunterklettern zu retten, auch wenn er vermutlich das heranrauschende Wasser gehört hatte.
Nun würde er nie erfahren, ob der Müller etwas mit dem Tod des Soldaten zu tun hatte. Fluchend kroch er wieder den Kanal hinaus, wo ihn erneut die Sonne blendete, sodass er schützend die Hand über die Augen legte und sich umblickte. Die Kommandos mussten schon die Höfe erreicht haben, es hatte ihn sicher keiner seiner Leute beobachtet. Er schob seine Kopfbedeckung in den Nacken und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Dann schritt er davon.
***
»Sag mal, wo steckt denn Benedikt nur? Er sollte sich sputen, die Kühe müssen auf die Weide.« Antonius machte sich daran, das Vieh loszubinden. Alle Tiere waren inzwischen gemolken. Er verspürte so langsam Hunger. Es war Zeit für die Morgensuppe.
»Keine Ahnung, wo sich dieser Bengel wieder rumtreibt!« Balthasar blickte sich im Stall nach seinem jüngeren Bruder um, irgendeinen Unsinn heckte er bestimmt wieder aus. Und meist war auch Leonhard, sein etwas jüngerer Cousin, nicht weit. Er hob eine Schulter. »Er war doch vorhin gerade noch hier. Benni! Benni!« Er horchte kurz und meinte dann: »Also ich höre kein Gegacker im Hühnerstall und kein Gemecker bei den Ziegen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen: Er klaut keine Eier und trinkt nicht heimlich die Milch. Was könnte er sonst noch anstellen?«
Doch die Frage erübrigte sich. Quietschend schwang die Stalltür auf, und das hereinfließende Sonnenlicht schien dem Jungen den Weg zu bereiten. Mit hochroten Wangen stand Benedikt da, die Haare zerzaust und um den Mund einen eingetrockneten Milchbart.
»Habt ihr schon gesehen? Die Soldaten sind da!« Voller Aufregung zeigte er zur Stalltür hinaus. »Echte Soldaten! Sie sind überall und haben sogar Gewehre dabei!«
»Soldaten? Benni, du veräppelst uns doch nur.«





























