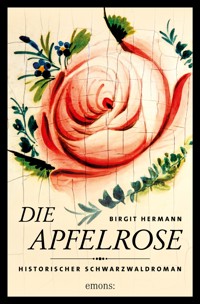Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Historischer Schwarzwaldkrimi
- Sprache: Deutsch
Ein facettenreicher Roman, der tief in das Glasmachermilieu des historischen Schwarzwaldes eintaucht. Hochschwarzwald 1718. Auf dem Totenbett bittet der Meister der Glashütte Äule seine Nichte Marie, sein Lebenswerk fortzuführen: Sie soll eine Rezeptur vollenden, die eine Revolution in der Glasveredelung bedeuten würde. Doch die Entdeckung hat Begehrlichkeiten geweckt, und Maries Leben ist in Gefahr. Hilfe erhofft sie sich von dem Mann, der ihrem Onkel die geheimnisvollen Zutaten verkauft hat. Doch die Ereignisse nehmen eine jähe Wendung, und Marie muss sich mehr als einmal die Frage stellen: Wem kann sie noch trauen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 593
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Birgit Hermann lebt mit ihrem Mann in Titisee-Neustadt, ist gebürtige Schwarzwälderin und liebt die blauen Höhen und dunklen Wälder ihrer Heimat. Die Mutter dreier erwachsener Kinder arbeitet als Naturparkführerin und als medizinische Fachangestellte in einer Klinik und hat bereits mehrere erfolgreiche Romane veröffentlicht.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2021 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: schiffner/photocase.de
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer
Lektorat: Susann Säuberlich, Neubiberg
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-767-5
Historischer Schwarzwaldkrimi
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Dieser Roman wurde vermittelt durch die
Literaturagentur Beate Riess, Freiburg.
Wie ein Geistesblitz sah er plötzlich das Gesicht der jungen Aschenbrennerin vor sich. Die Bedrohung verstärkte sich. Konnte es sein, dass er Unheil spürte? So etwas durfte er nicht glauben, das war Aberglaube, Zauberei! Hatten Cajetanos Dämonen seinen Geist vergiftet?
KAPITEL 1
Sie musste eingeschlafen sein. Ihr Nacken schmerzte, der Kopf war zur Seite gerutscht.
Mit einem leichten Seufzen setzte sich Marie aufrechter auf den Stuhl, zog die Decke zum Kinn und massierte ihren Hals. Was hatte sie, außer der misslichen Schieflage, geweckt?
Im Raum war es kühler geworden, das Feuer im Ofen musste erloschen sein. Sie konnte weder das Knacken der brennenden Holzscheite noch das Sieden des Wassers im Kessel in der Küche nebenan vernehmen. Wie lange hatte sie geschlafen?
Sie blickte durch das Fenster zum Gasthaus gegenüber, dort war das Licht bereits gelöscht worden.
Neben ihr, in seinem Bett, lag Onkel Theis. Er hatte sich am Abend unwohl gefühlt und sich kurz darauf vor Schmerzen gekrümmt. Schmerzen am ganzen Leib, die er nicht genau benennen konnte.
Marie lauschte in die Dunkelheit. War er aufgewacht? Sein Atem ging gleichmäßig. Der Trunk, den sie ihm verabreicht hatte, schien beruhigend und lindernd gewirkt zu haben.
Sollte sie es wagen, nach nebenan zu gehen, ins eigene Bett? Dort, wo ihr Sohn Jakob schlief? Es war gemütlicher und wärmer, und morgen wartete ein langer Arbeitstag.
Was diese seltsame und plötzliche Erkrankung ausgelöst hatte, wusste Marie nicht. Sie vermutete, dass Theis wieder einmal mit irgendwelchen fragwürdigen Mitteln experimentiert hatte. Er war der Aschenbrenner im Glasmacherdorf Äule bei Schluchsee im Schwarzwald.
Das Brennen der Pottasche war inzwischen die wichtigste und arbeitsreichste Tätigkeit eines Aschenbrenners. Viel aufwendiger und wissenschaftlicher war aber die Herstellung der Rezepturen. Jede Hütte hatte ihre eigenen Zutaten. Sie waren geheim, den jeweiligen Örtlichkeiten geschuldet. Aufgrund der natürlichen eingeschlossenen Eisenoxide im Quarzsand war das Waldglas aus dem Schwarzwald grundsätzlich grün. Durch Experimentieren war es den findigen Alchemisten unter den Glasmachern im Laufe der Jahrhunderte gelungen, die Farbe des Glases zu beeinflussen. Den Grünton auszuwaschen. Dazu benötigten sie unterschiedliche Erze.
Arsenik war solch ein Stoff. Nicht ungefährlich. Theis litt schon lange an der sogenannten Hüttenkrätze, einem Ausschlag, einhergehend mit Blutarmut und einer körperlichen Auszehrung, ausgelöst durch die schleichende Vergiftung des Körpers. Seit der Erfindung der Pottasche vor einigen Jahrzehnten wurde dieser giftige Stoff kaum noch gebraucht. Weißes Glas ließ sich nun ungefährlicher herstellen; die einfachen Waldhütten waren imstande, das edle und reine Muranoglas der Venezianer zu imitieren. Mit dem Nachteil des immensen Raubbaus am Wald. Man brauchte ein Vielfaches an normaler Holzasche, um sie zu Pottasche zu brennen. Kalzinieren hieß dieser Vorgang.
Seit weißes Glas leichter verfügbar war, schien es den Herrenhäusern nicht mehr erlesen genug. Es war alltäglich geworden. Geschliffene und gefärbte Gläser waren nun die Objekte der Begierde. Kobaltblau beispielsweise, selten, edel, teuer. Äule war dabei, sich den Wünschen anzupassen. Die Verzierungen waren eine der Neuerungen im Glasmacherdorf. Allen voran das Rutschen, wie man das mühevolle Einritzen von Motiven auf den Gläsern nannte. Eine andere beliebte Methode war das Auftragen und Einbrennen von Farbmotiven.
Auf Geheiß des Klosters St. Blasien waren die Hütten Grünwald und Windbergtal vor zwei Jahren, im Jahr 1716, zusammengelegt worden. Der Abt fungierte als Lehens- und Landesherr der Glasmacher. Sie mussten Pachtzins für die Güter, die sie bewirtschafteten, bezahlen, zusätzlich Glas im Kloster abliefern. Früher waren dies Kelche, Gläser und Flaschen, heute tausendfünfhundert flache Glasscheiben pro Jahr. Seit dem Zusammenschluss hatten sie eine Streck- und eine Glasschneidehütte. Eine weitere Neuerung. In der ersten Hütte wurde das heiße Glas gewalzt und in der zweiten zugeschnitten. Die Glasscheiben waren einfacher in der Ausarbeitung und billiger als die Fenster aus runden verbleiten Butzenscheiben, die man schon im Mittelalter verwendete.
Das Kalzinieren hatte Theis in die Hände seiner Nichte gelegt. Offiziell durfte Marie den Beruf der Aschenbrennerin noch nicht ausüben, sie war zu jung. Das aetas legitima, das Alter der Geschäftsfähigkeit, hatte ihr Abt Augustinus mit Erreichen des fünfundzwanzigsten Lebensjahres oder dem heiligen Stand der Ehe zugestanden. Zur ersten Bedingung fehlte noch ein halbes Jahr. Die zweite hatte sie mit Theis’ Hilfe erfolgreich ihrem Vater und dem Auserkorenen verweigert.
Dank Theis’ Cousin Bruder Stephanus, dem Sekretarius des Abtes zu St. Blasien, existierte eine beglaubigte Urkunde, die Marie die Nachfolge zusicherte. Früher war diese unter einer losen Platte in der Aschenküche versteckt gewesen. Seit der Aussöhnung mit ihrem Vater lagerte sie bei ihm. Michael Sigwarth war der Glasvogt, der Vorsteher der Glasmacher.
Vor einigen Tagen war ein fremder Händler ins Dorf gekommen, hatte am Aschenhaus angeklopft und den Aschenbrenner sprechen wollen. Allein. Marie war sein Wiesentäler Dialekt aufgefallen. Das harte, ja fast gutturale ch, das an die Sprache der Eidgenossen erinnerte. Jenes Tal lag auf der anderen Seite des Feldbergs und öffnete sich Richtung Basel.
In den Folgetagen war Theis oft stundenlang verschwunden gewesen oder hatte sich in seiner Giftküche – wie er das Laboratorium nannte – verschanzt. Ein neues Rezept, hatte er schelmisch grinsend verraten, als sie ihn darauf ansprach.
Gestern hatte er sich wieder den ganzen Tag im Laboratorium eingeschlossen. Nach dem Abendbrot klagte er zunehmend über Schmerzen in der rechten Hand. Schmerzen, die bis in die Knochen reichten. Zunächst erkannte man nicht viel, dann wurde die Haut weiß, als läge Raureif über ihr. Ab da ging es ihm stündlich schlechter. Nichts brachte Linderung, weder die Umschläge mit Beinwell noch eine der ihr bekannten schmerzstillenden Tees oder Tinkturen, der Schmerz breitete sich auf den ganzen Körper aus. Da war Marie auf ein altes geheimes Mittel umgestiegen, von dem nur noch wenige wussten – Bier mit einigen Samen Bilsenkraut. Ein Hexenkraut. Sie hatte um die Giftigkeit des Nachtschattengewächses gewusst, auf dessen narkotische Wirkung gehofft.
Theis schien in einen tiefen Rausch gefallen zu sein. Leise stand Marie auf, löschte die Kerze auf dem Nachttisch und schlich in völliger Dunkelheit in ihr eigenes Bett.
War es der Hauch der erloschenen Kerze, der ihr in die Nase stieg? Nicht nur, da war ein seltsamer süßlicher Geruch, der den ganzen Raum durchzog. Sie konnte sich dessen Herkunft nicht erklären.
Plötzlich glaubte sie, seinen Blick im Rücken zu spüren; hielt inne und traute sich kaum zu atmen. Ihre Nackenhaare sträubten sich, die Luft knisterte förmlich; dabei überkam sie das Gefühl, als stünde jemand neben ihr. Sie erstarrte.
»Marie, es geht zu Ende mit mir. Ich muss dir etwas anvertrauen.«
»Theis? Du bist wach?«, fragte sie mit einem leisen Zittern in der Stimme, wandte sich um, doch da war nur Stille. Hatte sie sich das eingebildet? Sie lauschte, schüttelte den Kopf und setzte ihren Gang in die eigene Schlafkammer fort.
»Ich war fast drüben«, hörte sie nun klar und deutlich, »es war wie fliegen, Marie. Ich habe den Wald von oben gesehen.«
Sie blieb stehen. Theis war von seinem Rausch aufgewacht.
»Das kommt vom Bilsenkrautsamen, es sind keine realen Träume.«
»Ich habe dich gesehen. Du verwandelst Glas in eine schimmernde Blumenwiese«, flüsterte er.
Marie trat erneut an sein Bett und entzündete die Kerze. Sie erschrak bei seinem Anblick, er hatte sich verändert. Die Augen waren blutunterlaufen, die Stirn glänzte schweißnass, die Haut fahl und blass. Totenblass. Sprach er im Fieber?
Die folgenden Worte ließen keinen Zweifel, dass er noch Herr seiner Sinne war: »Das Rezept für die Ätzsubstanz glaube ich entschlüsselt zu haben. Finde heraus, woher die Steine stammen; es ist Flussspat. Du musst sie zerreiben und mit rauchender Schwefelsäure mischen. Gehe morgen in die Laborküche und löse den Stein im Boden, dort, wo wir deine Urkunde versteckt hatten.«
»Welches Rezept?«, fragte sie leise.
Theis schloss die Augen, sie lagen tief in ihren Höhlen und wirkten furchterregend. Er ließ sich auf das Kissen sinken, stöhnte.
»Für die Blumenwiese«, flüsterte er, »aber pass auf, es ist ätzend. Es ist mir auf die Hand getropft, jetzt frisst es sich bis in meine Eingeweide. Meine Todesstunde ist nahe.«
Zum Beweis hob er seine gefrostete Hand. Marie erschrak. Sie sah gespenstisch aus.
»Nein, Theis«, sagte sie unter Tränen, »ich will mit dem Zeug nichts zu tun haben.«
»Heule nicht wegen eines alten, unvorsichtigen Mannes. Meine Tage waren gezählt wie die Zeiten des Waldglases, das weißt du.« Er war nun wieder ganz bei sich und schaute ihr beschwörend in die Augen. »Bleiben wir auf dem alten Stand, stirbt die Glashütte wie die Wälder ringsum. Wir müssen Kostbares und Begehrliches schaffen. Wenn jemand das kann, bist du es. Erzähle niemandem von meinen Versuchen, auch nicht Rupert, so heißt der junge Mann, von dem ich das Mittel habe. Es wird Flusssäure genannt. Ich habe von Glasmachern in Böhmen gehört, die damit arbeiten und gut verdienen. Es sind nur wenige. Schau mich an und du weißt, warum. Frage in den alten Bergarbeitersiedlungen hinterm Feldberg nach dem Gestein. Du erkennst es an seinem Leuchten. Versprich mir, dich darum zu kümmern.«
Theis schloss die Augen. Marie wusste, die Schmerzen waren zurück, seine Mundwinkel zuckten. Sie strich ihm sacht über die Stirn.
»Ich verspreche es.«
Seine Atmung wurde allmählich gleichmäßiger, er schien wieder zu schlafen.
Ihr war das Zubettgehen vergangen, sie ließ sich auf dem Stuhl nieder und zog erneut die Decke über sich. In Bälde würde der Morgen grauen.
Ihr Kopf schwirrte, was sollte sie von dem Gerede halten? Waren seine Sinne vernebelt? Flusssäure! Sie hatte noch nie davon gehört.
***
»Mama!«
Jakob riss Marie aus wirren Träumen. Die Erschöpfung hatte sie übermannt, sie musste sich erst orientieren.
»Jakob? Was brüllst du so?«, fragte sie verstört und rieb sich die Augen. »Oh, ich muss eingenickt sein.«
Sie strich dem Sechsjährigen wie jeden Morgen über die wilden blonden Locken, um sie zu bändigen. Der Bub sah besorgt aus und deutete auf das Bett.
»Ist Onkel Theis tot?«
Mit einem Schlag war Marie hellwach. Theis! Sie sprang vom Stuhl und beugte sich über ihn. Der Tag dämmerte und ließ schemenhaft die Umgebung des Raumes erahnen. Die Augen ihres Onkels waren geschlossen, ein schmerzverzogenes Lächeln beherrschte sein eingefallenes Gesicht. Sie griff an seine Halsschlagader. Nichts.
»Jakob«, ihre Stimme klang belegt, »ich glaube du hast recht, Onkel Theis’ Seele ist auf dem Weg zum lieben Gott.«
Sie fühlte sich traurig, wütend und alleingelassen, er war gegangen, während sie geschlafen hatte. Ohne großen Aufwand, so wie er im Leben gewesen war, hatte er sich davongemacht.
Sie verharrte eine Weile, zündete wie in Trance die Kerze an, bekreuzigte sich und sprach ein Gebet. Jakob fiel in das halblaute Gemurmel ein.
Marie faltete Theis’ Hände über dem Leib, die rechte wirkte wie eingefroren, band ein Tuch unter dem Kinn des Toten bis über den Schädel und zurrte es fest. Die Leichenstarre hatte noch nicht eingesetzt, der Körper war kaum merklich abgekühlt. Er musste eben erst gestorben sein. Sie wollte verhindern, dass Jakob sein verzerrtes Antlitz zu sehen bekam, wenn die Muskulatur sich zusammenzog und der Schlund sich öffnete.
»Warum bindest du sein Gesicht ein, Mama?«
»Damit ihm nicht kalt wird und er lächelt, wenn er die Himmelspforte betritt. Geh und schiebe das Küchenfenster einen Spaltbreit auf, so findet seine Seele den Weg.«
Der Junge lief in die Küche. Er kam kurz darauf unverrichteter Dinge und mit ängstlichem Gesichtsausdruck zurück.
»Was ist? Klemmt das Fenster?«
»Nein, da war jemand.«
»Wo?«
»Beim Küchenfenster, ich habe ihn nicht erkannt, ein Mann wie ein schwarzer Schatten. Mit einer Kapuze über dem Kopf. Und er hat komisch geschaut.«
»Ein Mann? Wie hat der geschaut?« Marie lief ein Schauer über den Rücken, Jakob erfand solche Dinge nicht.
»Mit ganz großen weißen Augen. Ist das der Tod, der ihn holen will?«
Sie überlegte, wer das gewesen sein könnte, es fiel ihr niemand aus dem Dorf ein. Sie durfte vor dem Jungen nicht in Panik verfallen.
Mutiger, als sie war, schlich sie in die Küche und schob mit einem Ruck das Fenster auf. Da war niemand. Sie lauschte in die Dämmerung. Es war still, unheimlich still.
Als sie sich wegdrehte, knackte ein Ast. Hinter dem Haus des Aschenbrenners stieg ein Pfad in den Wald an. Ein Tier, beruhigte sie sich.
»Da ist keiner. Alles gut, du brauchst dich nicht zu fürchten.«
Jakob nickte, sowohl er als auch Marie wussten, dass das nicht stimmte.
Maries Aufgabe war es, in die kleine hölzerne Kapelle zu gehen und die Totenglocke zu läuten. Was, wenn jemand dort draußen auf sie lauerte?
Warum sollte dieser Jemand das tun, fragte sie sich. Vielleicht hatte ein hungriger Landstreicher einen Blick in das Haus geworfen, weil ein schwacher Kerzenschein zu sehen gewesen war.
Sie beschloss zu warten, bis der Tag vollends anbrach. Mit dem ersten Morgenlicht würde das halbe Dorf auf den Beinen sein; die Glasmacher würden in die Glashütte gehen, um das Gemenge abzufeimen, wie man das Abschöpfen von Verunreinigungen der aufgeheizten flüssigen Glasmasse nannte. Die Schürbuben hatten in dieser kühlen Nacht sicherlich ordentlich eingeheizt und durften bald nach Hause in ihre eigenen Betten. Die Frauen würden ihre Ziegen und Schweine versorgen.
Jakob stand noch wie versteinert. Marie beschloss, Normalität aufkommen zu lassen.
»Wir sollten Feuer im Ofen machen, es ist kalt, findest du nicht? Wenn die Sonne über den Berg kommt, verjagt sie die Gespenster der Nacht und die herumlungernden Landstreicher. Sobald sie auf die Kapelle scheint, werden wir für Theis die Glocke läuten.«
Jakobs Züge entspannten sich, er schichtete dünne Späne in das Ofenloch, oft hatte er zugeschaut und wusste, wie man das Feuer schürte.
Marie schaute durch das Fenster auf den Dorfplatz, die ersten Umrisse der Hütten waren im aufkommenden Tageslicht zu erkennen. Das helle Orange der feuerspeienden Glasöfen entwich durch die Spalten der Glashütte, es wirkte von Weitem, als brenne der ganze Dorfmittelpunkt. Ein beruhigendes Bild, es gehörte zum Glasmacherdorf wie der Brunnen inmitten des Platzes. Erlosch das Feuer, starb das Dorf. Dann zogen die Glasmacher weiter. Griff es wild um sich, kam der Brunnen ins Spiel.
Sie versuchte sich vorzustellen, wie die Bewohner Äules reagieren würden, wenn sie nachher die Glocke läutete. Theis’ Tod würde die meisten überraschen, zumal er gestern noch gesund gewirkt hatte.
Es war üblich, ins Haus des Verstorbenen zu kommen, sein Beileid zu bekunden und am Totenbett zu beten. Am Todestag ruhte im Haus die Arbeit. Es durfte nur leise gesprochen werden.
Kämen die Äulemer aus echter Trauer oder aus Neugier? Vermutlich aus beiden Gründen. Theis war bei allen gleichermaßen beliebt gewesen, außer beim Vogt. War der Schwager ihm doch in den Rücken gefallen und hatte die schwangere Tochter bei sich aufgenommen, um sie so vor einer erzwungenen Heirat zu schützen.
Ihr Augenmerk fiel auf die seltsam entstellte Hand des Toten, sie würde Fragen aufwerfen. Fragen, die sie nicht beantworten wollte, um sein Geheimnis nicht preisgeben zu müssen. Sie zog das Leintuch darüber, suchte den Rosenkranz in seiner Nachttischschublade und wickelte ihn über dem Stoff um die gefalteten Hände. Auf diese Weise war nichts zu sehen. Dass sie seine Hände zugedeckt hatte, würde man ihr als junge, in solchen Dingen unerfahrene Frau zugestehen.
Es war keinem entgangen, dass ein fremder Händler nach Theis, dem Aschenbrenner, gefragt hatte. Marie nahm sich vor, den Namen des Mannes vorsichtshalber nicht zu nennen. Wollte unbehelligt nachfragen, ob man wisse, wer er war.
Da fiel ihr das Versprechen ein, das sie ihrem Onkel gegeben hatte. Sie musste nachsehen, womit er experimentiert hatte; was es mit der Blumenwiese auf sich hatte, die sie auf Glas bannen sollte.
Das Rezept! Sogleich dämpfte sie ihre Hoffnung, sie würde keine Anleitung finden. Theis war des Lesens und Schreibens nicht fähig gewesen. Als »unnötiges Zeug« hatte er ihre Mühen, die Buchstaben nach den Vorgaben seiner Schwester – einer ehemaligen Ordensfrau – zu zeichnen, abgetan. Mühevoll hatten sie und Jakob die Schnörkel in einer Sandkiste nachgezogen, die Wiltrudis vorgeschrieben und als Buchstaben benannt hatte. Im Frühjahr war sie zu einer Pilgerreise nach Rom aufgebrochen.
Das Feuer im Ofen prasselte inzwischen und riss sie aus ihren Gedanken. Jakobs’ Wangen glühten wie die Holzscheite. Marie lobte und beauftragte ihn, gut darauf aufzupassen, sie müsse nur schnell hinüber in die Giftkammer von Onkel Theis, um zu sehen, ob er alles aufgeräumt und abgeschlossen hatte. Jakob wusste, dass Theis vergesslich war und die Kammer gelegentlich offen stand, was angesichts der darin gelagerten giftigen Substanzen verboten war. Die Aschenküche musste verschlossen sein, das war ein ungeschriebenes Gesetz im Glasmacherdorf.
Jakob ließ sich nicht ablenken, er senkte den Kopf und jammerte: »Kann ich nicht mitkommen? Ich will nicht allein sein.«
Marie seufzte und hielt ihm auffordernd die Rechte hin. Mit klopfendem Herzen und dem Jungen an der Hand ging sie hinüber in die Giftküche, die einige Schritte vom Wohnhaus entfernt lag. Vorsichtig schaute sie zum Hang hoch, konnte nichts Ungewöhnliches entdecken oder hören. Die Tür war nur angelehnt. Hatte Theis vergessen abzuschließen, oder war jemand in der Kammer?
Marie lauschte, gab dem Gedanken keine Nahrung und zündete eine Kerze an, die neben dem Eingang auf dem Fenstersims bereitstand. Sie beleuchtete den Vorraum mit den unterschiedlichen Aschengruben, schlich auf leisen Sohlen in die eigentliche Küche. Dort stellte sie das Licht auf den Boden vor den Herd. Die Küche der Aschenkammer hatte zum Glück kein Fenster, nur einen Abzug über dem Herd, der nach oben ins Freie führte. So konnte sie niemand unbemerkt beobachten.
Langsam hob sie die besagte Platte an. Zwei in Stoff eingewickelte Scheiben lagen in der Vertiefung. Sie schlug das Tuch zur Seite.
Eine war aus reinstem weißem Glas mit matten filigranen Gravuren. So etwas hatte sie noch nie gesehen. Die Ausarbeitungen waren exakt und hatten einen edlen Schimmer. Die Blumenwiese!
Auf der anderen Platte war ein wachsartiger dunkler Überzug erkennbar. Die Vertiefungen waren dagegen genauso mit matten Ornamenten überzogen.
Marie konnte sich keinen Reim darauf machen. Vorsichtig fuhr sie mit den Fingern darüber. Die Ätzungen waren von einer gleichmäßigen Struktur, keine groben Schleifstellen, keine Untiefen.
Ein plötzlicher Gedanke ließ sie die Hand zurückziehen. Was, wenn die Verzierungen auch ihre Hand zerfraßen? Sie besah zuerst die Finger, dann das Glas. Alles war trocken.
Behutsam legte sie die Schätze in das Bodenloch zurück, dabei entdeckte sie ein Fläschchen und zerkleinerte Steinchen in einer Schale. Die Kiesel waren fast durchsichtig mit einem violetten Schimmer. Sollte dies das Leuchten sein, von dem Theis gesprochen hatte?
Ob das Behältnis die besagte Flusssäure enthielt? Marie schüttelte es, nahm ein Tuch von der Ofenstange und schraubte das Gefäß vorsichtig auf. Sie hielt es weit von sich entfernt, damit nichts auf ihren Körper tropfen konnte. Sie zögerte kurz, dann schaute sie hinein. Sogleich wich sie zurück. Ein stechender Geruch breitete sich aus. Was sollte sie damit anfangen?
Sie legte die Flasche in die Spalte zurück. Hatte Theis diese Flüssigkeit hergestellt? Oder hatte er die Säure von dem Fremden erhalten?
Nichts im Versteck deutete auf eine Antwort hin. Marie beschloss, das Geheimnis vorerst zu wahren, und schob die Bodenplatte über die Vertiefung. Sie sah in das fragende Gesicht ihres Sohnes.
»Das war Onkel Theis’ Geheimnis, und nun ist es unseres. Wir dürfen keinem davon erzählen. Die Flüssigkeit hat Theis krank gemacht. Du musst mir versprechen, sie nie zu öffnen.«
»Mama, das verspreche ich dir. Ist das Stinkezeug genauso giftig wie das Arsenikpulver? Warum hat Onkel Theis die Flasche aufgemacht? Hat er es nicht gewusst?«
»Er wusste, dass es gefährlich ist, darum hat er uns nichts gesagt, sicherlich wusste er nicht, wie gefährlich es ist. Man kann die kostbaren Glasplatten damit verzieren, wie du gesehen hast. Das dürfen wir keinem verraten, hörst du?«, wiederholte sie und beschloss, die »Warum«-Frage erst gar nicht aufkommen zu lassen. »Sonst wollen es alle haben, und das ist nicht gut.«
»Sterben die anderen dann auch?« Seine himmelblauen Augen waren vor Entsetzen geweitet.
»Ja. Und das wollen wir doch nicht, oder?«
Jakob schüttelte bedächtig den Kopf.
***
Marie suchte mit Jakob das Haus des Glasvogts auf. Sie hatte beschlossen, ihren Vater als Ersten zu informieren.
Herbstlicher Nebel hing über den Hütten, der Bergrücken Richtung Menzenschwand verschwand im Einheitsgrau des beginnenden Tages. Die obersten Baumwipfel trugen weißen Raureif. Aus der Glashütte drang nicht nur der Feuerschein, auch die Wärme kroch aus allen Ritzen und Spalten der Bretterwände. War das Gras andernorts gefroren, lagen vor dem Eingang Tauperlen auf den letzten Halmen. Der Winter kam früh und heftig in den höheren Regionen rund um den Feldberg. Seit Tagen blies ein kalter Wind. Heute würde die Sonne länger brauchen, bis sie durchkam.
»Vater?«
Marie schob die Tür auf und betrat den langen dunklen Flur des größten Hauses am Platz. Der Vogt lebte mit ihren Stiefschwestern allein. Er war seit zwei Jahren Witwer.
Ein mächtiger Schatten baute sich hinter ihr auf.
»Du suchst nach mir? Dann muss es wahrlich wichtig sein.«
Michael und Marie hatten sich zwar ausgesöhnt, aber dass seine Tochter lieber bei seinem Schwager lebte und arbeitete, als seine Wünsche zu respektieren, ärgerte ihn noch immer. Er konnte seine Gefühle nicht verbergen.
»Vater, Theis ist tot.«
Wortlos ging er an ihr vorbei, ließ sich am Tisch nieder, wo sein Haferbrei dampfte, und bedeutete ihr, sich zu setzen. Als sei nichts gewesen, schaufelte er den Brei in sich hinein.
Der hungrige Blick Jakobs entging Marie nicht. Ans Essenmachen hatte sie heute früh nicht gedacht.
Die zwölfjährige Franziska – die mittlere ihrer drei jüngeren Stiefschwestern – trat schweigsam aus dem Halbdunkel am Herd und stellte den Besuchern eine Schüssel hin.
»Erzähl«, sagte schließlich der Vogt.
Sie berichtete vom überraschenden Tod des Aschenbrenners in den frühen Morgenstunden. Von den Experimenten und der Bodenplatte sagte sie nichts. Jakob schwieg ebenfalls.
»So plötzlich? Na, der Gesündeste war er schon lange nicht mehr. Hm, wir werden ihn wohl bestatten müssen. Ich schicke nachher einen Boten nach St. Blasien zu Bruder Stephanus und einen nach Schluchsee. Danach sehen wir weiter.« Mehr fiel Michael dazu nicht ein.
Michaels Halsschlagader schwoll an, ein untrügliches Zeichen, dass es in seinem Innern kochte. Theis’ Tod passte ihm nicht in den Kram, das wusste Marie. Die Glashütte brauchte dringend einen Nachfolger.
Woran ihr Vater dachte, ahnte sie: an das halbe Jahr bis zu ihrer Geschäftsfähigkeit, welches der Abt als Klausel eingesetzt hatte. An dieser Klausel war der Vogt jedoch nicht ganz unschuldig. Hatte er doch gehofft, sie bis dahin mit einem Glasmacher verehelicht zu haben.
Konnte es sein, dass er ernsthaft überlegte, im Kloster Widerspruch einzulegen, um sich an dem Verstorbenen und seiner Tochter im Nachhinein zu rächen? Er würde sich nur selbst schaden, denn wer sollte die Asche brennen? Der alte Greiner, der ehemalige Aschenbrenner aus Grünwald, war dazu nicht mehr in der Lage. Das wusste der Glasvogt. Der Grünwälder war »wisslos« geworden, wie man alte Menschen nannte, die in die Nebel des Vergessens eingetreten waren.
Da Marie mit keiner weiteren Anteilnahme seitens ihres Vaters rechnen konnte, verabschiedete sie sich, um in die Kapelle zu gehen und ihre Pflicht zu tun.
***
Der Wind fegte am Folgetag über die Grabreihen in der kleinen Gemeinde Schluchsee, als wolle er die Äulemer vom Gottesacker verjagen. Zur Beerdigung hatten sich die Bewohner der Glasmachersiedlung auf den weiten Weg von Äule auf die andere Seite des Sees zum Gotteshaus und zum Friedhof aufgemacht.
Bruder Stephanus von St. Blasien war direkt über den Blasiwald nach Schluchsee gekommen, Theis’ Cousin und Maries Fürsprech im Kloster. Man war gespannt, ob er eine Nachricht vom Abt übermittelte, die die Zukunft des Aschenhauses regelte.
Marie stand mit ihrer Familie neben dem Grab und blickte durch einen Tränenschleier, wie die Äulemer – Windbergtäler wie Grünwälder – am offenen Grab Abschied von Theis nahmen. Sie verneigten sich vor dem ins Erdreich hinuntergelassenen Sarg, bekreuzigten sich und tauchten den Weihwassersprenkler in den kleinen Kessel, um den Sarg zu benetzen.
Als die letzten Trauergäste mit der Abschiedszeremonie fertig waren, kam Bruder Stephanus auf Marie zu und nahm sie zur Seite. Unter der kritischen Zurkenntisnahme der Umstehenden.
»Marie, herzliches Beileid. Wie geht es euch, dir und dem Jungen? Kommst du allein klar in der Aschenhütte? Wenn es Ärger gibt, du weißt, ich bin für dich da. Es ist nur noch ein halbes Jahr bis zur offiziellen Anerkennung als Aschenbrennerin. Das dürfte kein Problem sein, wenn dein Vater hinter dir steht.«
»Danke, Stephanus, Ihr habt schon genug für mich getan. Man wird sich daran gewöhnen müssen, dass ich in Äule ab heute alleinige Ansprechpartnerin im Aschenhaus bin. Was meinen Vater betrifft, bin ich mir noch nicht sicher, ob er mir wirklich den Rücken stärkt. Er redet nicht darüber. Ihr kennt ihn ja.«
»Ja, er ist ein alter nachtragender Sturbock. Ich werde in den nächsten Tagen bei euch vorbeikommen und nach dem Rechten schauen. Eine Respektsperson aus dem Kloster kann nicht schaden, was meinst du?«
»Das kann ich nicht verlangen, Bruder Stephanus.«
Ein plötzlicher Tumult ließ sie aus ihrem Gespräch aufschauen. Die Menschen riefen wild gestikulierend durcheinander. Sie stürmten vom Friedhof.
Marie und Stephanus brauchten eine Weile, bis sie mitbekamen, was die Menge aufgebracht hatte. Eine dicke dunkle Rauchwolke stand über dem See. Sie kam aus dem Wald, von dort, wo Äule lag.
»Es brennt!« Jakob kam angerannt. »Mama, unser Dorf brennt!«
***
Beim Erreichen der kleinen Hochebene von Äule erkannte Marie als Erste, dass das Aschenhaus seinem Namen alle Ehre machte – es lag in Schutt und Asche. Die Giftküche, ein Steingebäude, stand noch. Kein anderes Gebäude schien beschädigt zu sein.
Mit zitternden Knien ging sie auf das Laboratorium zu, gefolgt von den neugierigen Augenpaaren der Anwohner. Die Tür war aufgebrochen worden, sie stieß sie ganz auf und erschrak. Alles war kurz und klein geschlagen, die Fläschchen, die Tiegel. Die Erz- und Aschegruben vermengt und verstreut. Marie schielte auf den Boden neben dem Herd. Die Bodenplatte schien unberührt.
»Da hat jemand etwas gesucht«, stellte Michael Sigwarth lapidar fest und schaute in die teils verschwiegenen, teils betroffenen Gesichter der Glasmacher. Einige senkten beschämt ihr Haupt. »Die Urkunde liegt bei mir, und dort ist sie sicher. Merkt euch das. Ich habe im Dorf das Sagen, und ich warne euch. Ich finde den Übeltäter«, verkündete er in seiner Eigenschaft als Glasvogt und zeigte damit, dass keine Widerrede geduldet wurde.
Bruder Stephanus und Marie tauschten fragende Blicke.
Michael Sigwarth nahm sich noch die Schürbuben vor. Sie hatten mit ihren höchstens zwölf Jahren einen Heidenrespekt vor dem Glasvogt und wollten nichts gesehen haben. Michael ging ins Gasthaus.
»Theis soll ein ordentliches Fest haben. An der Brandruine lässt sich heute eh nichts ändern. Wir vertagen das Thema ›Aschenhaus‹ auf morgen«, beschloss Michael.
Er war seit dem Tod seiner Frau und des Neugeborenen ruhiger geworden, früher hätte er getobt, bis der Täter – oder der, den er dafür hielt – vor seinen Knien um Vergebung gewimmert hätte.
Marie blieb stehen und schluckte trocken. War das eben ein Schulterschluss gewesen? Die Anerkennung seiner Tochter als Aschenbrennerin? Sie konnte es kaum glauben. Michael hatte tatsächlich gedroht, den Übeltäter zu finden, eine Warnung ausgesprochen. Thomas Raspiller aus Grünwald galt als Aufrührer im Glasmacherdorf. Er gehörte nicht zu denen, die bei den Anschuldigungen beschämt zu Boden gesehen, sondern provokant aufgeschaut hatten. Marie und die Sippschaft des Glasvogtes waren ihm ein Dorn im Auge, hatte Marie damals doch seinen Bruder als Gemahl abgelehnt.
Niemand der Umstehenden widersprach, alle waren durchgefroren und freuten sich auf den Leichenschmaus. Trotz des Freibieres, das der Vogt seinem Schwager zum ewigen Gedenken spendete, war die Stimmung gedämpft. Und das lag nicht an der Trauer um den Aschenbrenner. Befand sich ein Verräter im Dorf? Gab es einen Aufstand, eine Verschwörung?
Misstrauen lag in der Luft. Kurz kam die Frage auf, was der fremde Händler – sein Name lautete wohl Rupert – neulich so lange mit Theis zu bereden gehabt hatte.
Marie bemerkte, dass Thomas Raspiller sich kurz räusperte, wohl aber die feindliche Stimmung, die ihm entgegenschlug, spürte und schwieg. Es war nicht der richtige Zeitpunkt, Anschuldigungen gegen den verstorbenen Aschenbrenner Theis vom Zaun zu brechen.
Niemand hatte den Fremden zuvor gesehen. Er käme wohl von den Bergbausiedlungen überm Berg, raunte einer, ohne Genaueres zu wissen.
»Oder ein Spitzel der Aufständischen aus dem Hauensteinischen«, murrte einer der Alten.
Dass es unter den südlich von St. Blasien gelegenen Untertanen – in der alten Grafschaft von Hauenstein – gegen das Kloster brodelte, war nichts Neues. Immer wieder keimten die Widerstände gegen das strenge Regiment von Abt Augustinus auf. Aber gehörten deshalb die Glasmacher als Pächter des Abtes zu der Zielgruppe der Aufrührer? Diese hatten sich vor allem unter der Einung der Salpetersieder zusammengeschart.
Marie hörte scheinbar gelangweilt zu, sog aber jedes Detail in sich auf. Sie erfuhr jedoch nicht mehr, als sie von Theis schon wusste.
Die Dunkelheit kroch den Hang herunter. Die meisten hatten zur vorgerückten Stunde dem Alkohol gut zugesprochen, als sich Marie unbemerkt davonschlich. Jakob war bei ihren Schwestern auf der Wirtshausbank eingeschlafen.
Sie musste wissen, ob die geheimen Utensilien noch im Versteck waren, und huschte ins Laboratorium hinüber. Sie verzichtete darauf, ein Licht zu entzünden, und tastete sich im Dunkeln zur Bodenplatte. Vorsichtig schob sie diese zur Seite. Das Fläschchen, die Schale samt Granulat, alles war noch da.
Erleichtert ergriff sie das Tuch und schlug es auf, um die Glasplatten zu befühlen, dabei schnitt sie sich an den Scherben. Sie waren zerbrochen und fein säuberlich wieder eingepackt worden! Jemand hatte die Luke geöffnet, alles inspiziert, aber nichts gestohlen. Eine Warnung?
Marie erschrak, als sie das Quietschen der Tür vernahm. Schritte kamen vom Vorraum Richtung Küche. Sie drückte sich in die dunkle Ecke und hielt den Atem an.
***
Mit schwerem Gepäck erreichte Borromäus die Gaststube von Aftersteg, einer Siedlung mit ein paar Höfen und einigen alten Bergarbeiterhäusern, die vom Glasmacherdorf Äule aus auf der anderen Seite des Feldbergs gelegen war.
Über die Bedeutung des Ortsnamens gingen die Meinungen auseinander. Während die Gelehrten »hinter« – was althochdeutsch aftero heißt – als Ursprung des Namens Aftersteg ansahen, wobei als Steg die Brücke über den Stübenbach gemeint war, glaubten die Einheimischen nur an eine Verunglimpfung der Aussprache im Laufe der Jahrhunderte seit der Bergbauzeit. Sie meinten, Uffdstieg, also »auf der Steige«, herauszuhören. Womit die Steighilfen des Ortes hoch zum Stollen neben dem tosenden Hangloch-Wasserfall zwischen Todtnauberg und Todtnau gemeint waren. Inhaltlich stimmten beide Varianten.
Aftersteg gehörte seit dem 14. Jahrhundert zur Talvogtei Schönau und unterstand dem Kloster St. Blasien. Das Kloster war, neben der Glasherstellung in den bewaldeten Gegenden, vor allem am Silberbergbau diesseits des Bergmassivs interessiert gewesen. Kaiser Maximilian I. von Österreich, ein großzügiger Förderer des Bergbaus, war es nicht gelungen, den Niedergang im 16. Jahrhundert aufzuhalten. Die oberflächlichen Gruben waren ausgebeutet, die Stollen mussten immer tiefer in die Erde getrieben werden, was zu Streitigkeiten mit dem Bergvogt wegen der höheren Kosten geführt hatte. Letztendlich kam das Haus Österreich über Tirol und Böhmen leichter an Bodenschätze. Nach der Entdeckung Amerikas überschwemmten die billigen Silbereinfuhren den Markt und legten den Bergbau größtenteils lahm. Die Bergarbeitersiedlungen im Schwarzwald waren infolge zu armseligen Bergbauerndörfern verkommen.
Einzig die Händler zogen noch durch, auf ihren Wegen vom Schwarzwald in die Rheinebene. Allen voran die Glasträger, die die Märkte an den Rheinstädten aufsuchten.
Borromäus war in die andere Richtung unterwegs, er wollte noch vor Wintereinbruch hoch in den Schwarzwald.
»Gibt es bei euch ein ordentliches Mahl und ein gutes Bett für einen Reisenden?«, fragte er in Richtung Küche und stellte seine schwere Krätze auf dem Boden vor der Theke ab. Der Geruch von Suppe und Bier stieg ihm angenehm in die Nase und ließ hoffen, das Gewünschte zu erhalten. Der Raum selbst wirkte wenig einladend, er war düster und niedrig. Borromäus, von großer Statur, musste den Kopf einziehen, um unter den Deckenbalken durchzukommen.
Erst nach und nach gewöhnten sich seine Augen an die Dunkelheit. Die Gaststube war nicht leer, wie sie im ersten Moment gewirkt hatte. In der dunklen Ecke saßen schweigend Einheimische, ihre Aufmerksamkeit galt der Musterung des Neuankömmlings.
»Kann Er das Bett und die Suppe im Voraus bezahlen, kann Er bleiben«, kam die Antwort der Wirtin aus der Küche.
Borromäus zählte die Münzen für den üblichen Preis auf die Theke und suchte sich einen Sitzplatz an der Wand. Er mochte es nicht, mit dem Rücken zur Gaststube oder zur Tür zu sitzen. Eine Eigenart aus seiner Zeit als Soldat.
Es dauerte nur bis zum Auftragen der einfachen Mahlzeit, bis die Männer nach seinem Namen, seiner Herkunft und seinem Ziel fragten. »Wer bisch, wo chunsch her? Wo wötsch ane?« Das Gasthaus war das einzige Sprachrohr in die Welt.
Borromäus hatte gelernt, in fremden Gasthäusern mit Durchreiseverkehr nichts von sich preiszugeben. Die Krätze, zwischen seinen Beinen unter dem Tisch abgestellt, beinhaltete alles, was er in den letzten beiden Jahren erarbeitet hatte. Das Wertvollste aber befand sich sicher verschlossen in seinem Kopf: das Wissen um die Herstellung von Kobaltfarbe. In seinem Rucksack ruhte lediglich die Erstausstattung für sein neues Geschäft im Wert des Gesteins, das er einst mühevoll in mehreren Etappen in die Blaufärberei getragen hatte.
»Ich trag en Sack voll Schtei über d’ Berg«, antwortete er Richtung Stammtisch.
Ein missmutiges Gemurmel folgte. Sie glaubten, dass er sie auf den Arm nehmen wollte. Dabei war es nicht einmal gelogen, die Steine waren nur im verarbeiteten Zustand – als Farbpigmente – in seiner Krätze verstaut, und über den Berg, den Feldberg, wollte er tatsächlich. Sein Ziel war die Glasmachersiedlung Äule.
»Wenn mir dir it fein gnueg sin, hocksch halt allei«, bemerkte ihr Wortführer und wandte sich ab.
»Könnt langwiilig werre, es schmeckt noch Schnee«, meinte die Wirtin.
Mit ihrem schweigenden Nicken stimmten die Stammtischler der Wirtin zu, auch sie hatten den kommenden Schnee gerochen.
Borromäus löffelte seine Suppe aus und erbat sich noch einen Nachschlag. Nebenbei lauschte er den Gesprächen am Nachbartisch, die sich um die Händler drehten, die mit ihren Waren ins Elsass gezogen waren. Wohlwollend nahm er wahr, dass man auf edles Glas setzte, vor allem in den größeren Städten wie Straßburg. Vorbei waren die Zeiten, in denen die Venezianer das Monopol gehabt hatten. Die Glashütten auf dem Wald hatten sich den Wünschen der gehobenen Gesellschaft angepasst und moderne Verfahren ausprobiert. In Äule hatte man gleich beim Zusammenschluss der beiden Hütten mit neuen Techniken experimentiert. Mit ausdrücklicher Billigung des Klosters. Das wusste er von seinem letzten Besuch vor zwei Jahren.
Die Tür ging auf und wehte eine Handvoll trockenes Buchenlaub herein. Den Blättern folgten zwei vermummte junge Männer, die sich am Nachbartisch niederließen. Sie redeten leise mit den Einheimischen und drehten sich immer wieder zu ihm um. Es war offensichtlich, dass sie sich über ihn unterhielten.
Es ärgerte Borromäus, dass er die Annäherungsversuche der Einheimischen vorhin so unwirsch abgewimmelt hatte. Während er überlegte, wie er ihre Gunst zurückgewinnen konnte, wandte sich einer der Neuankömmlinge an ihn.
»Schtei tragsch du über d’ Berg? Darf ma wisse, wa für Schtei?«
Diese Frage war Borromäus’ Chance. Er rückte zum Nachbartisch auf. »Blaue.« Wollte er in das Gespräch der Einheimischen einbezogen werden, musste er sich nach den Gesetzen der Schwarzwälder öffnen. Langsam und ohne Überheblichkeit.
»Kobalt?«
»Schmalte.« Er lehnte sich zurück und wartete ab, ob die Anwesenden etwas mit dem Begriff anzufangen wussten. Doch sie schwiegen abwartend.
Um den Farbstoff Schmalte oder Smalte, wie er andernorts hieß, zu gewinnen, benötigte man Kobaltoxid, das in einem Gemisch namens Zaffer vorhanden war, das durch das Rösten von Kobalterz geschaffen wurde. Die Herstellung von Kobaltfarbe war schon in der Antike bekannt gewesen, die Entdeckung in Nordeuropa hatte angeblich erst um 1540 in Böhmen stattgefunden. In einer Glashütte.
»Woher?«, fragte schließlich der junge Bursche.
»Aus einer Blaufärberei«, antwortete Borromäus genauso vage.
»Die näscht isch in Wittichen. Du chunsch vu d’ falsche Richtig«, merkte einer der Älteren an.
Wittichen lag in Kaltbrunn bei Rottweil, tatsächlich kam Borromäus aus der falschen Richtung. Zwar war das Dorf sein letzter Aufenthaltsort gewesen, aber er hatte auf dem Heimweg einen Abstecher nach Freiburg gemacht. Dort saß die Landesvertretung des habsburgischen Kaiserreichs, zu dem die St. Blasianischen Gebiete gehörten. Mit den Zeugnissen seines Meisters und dem Gesellentitel eines Blaufärbers hatte er gewagt, neue Papiere zu beantragen. Die Kriegszeiten waren vorbei. Das Land brauchte Handwerksgesellen für den Aufschwung. Auf die Frage, warum er sein Heer verlassen habe, hatte er angegeben, beim Wasserholen verschleppt worden zu sein. Nach all den Jahren interessierte sich keiner mehr für die Einzelheiten, zumal ein ausgebildeter Handwerker vor den Regierungsvertretern stand. So erteilte man ihm den nötigen Stempel, und aus dem geflüchteten Infanteristen wurde der ehrenwerte Handwerksgeselle Borromäus Spindler. Zur Feier des Tages hatte er einen Schneider in der Stadt aufgesucht und sich neu ausstaffieren lassen. Diese Kleidung hatte er ganz unten in seiner Krätze verstaut, sie wäre eine Aufforderung für jeden Straßenräuber gewesen.
»Ich habe nicht behauptet, direkt aus Wittichen zu kommen«, sagte er.
»Rupert.« Der junge Kerl reichte ihm die Hand.
»Borromäus.«
»Kobaltfarbenhändler also – und wohin soll’s gehen? Der Winter steht bevor.«
Borromäus zuckte die Schultern, als wisse er es nicht. Er konnte die Männer noch nicht einschätzen und wollte nichts verraten. Die Konkurrenz unter den Glashütten wurde mit den neueren Verfahren größer. Er wollte Äule, und damit Theis und Marie, die neuen Färbeverfahren angedeihen lassen, um in der Gunst des Glasvogtes zu steigen. Einer, der gelernt hatte, Kobaltfarben herzustellen, war sicherlich nicht uninteressant für das Glasmacherdorf Äule.
»Kennt Er sich auch mit Flussspat aus?«, fragte Rupert.
»Flussspat? Ihr meint das violette Mineralgestein?«
»Ja.«
»Es ist meines Wissens wertlos, oder?«
»Das weiß ich nicht«, sagte Rupert ausweichend, »ich dachte nur, weil es auch farbig ist.«
»Woher kennt Ihr es?«
»Man findet es hin und wieder in den alten Stollen. Ihr habt wohl recht. Es taugt zu nichts.« Rupert blickte sich zu seinem stummen Begleiter um. »Komm, Kleiner, Zeit heimzugehen.«
»Zwei Glücksritter«, erklärte der Wortführer aus der Gruppe der Einheimischen, als die beiden gegangen waren. »Die Brüder Abele auf der Suche nach einem Geschäft. Wollten neulich schon einem böhmischen Händler ihre Mineralien aufschwatzen.«
Als die Männer beschlossen, nach Hause zu gehen, war der Wind, der in die Gaststube fegte, deutlich kälter geworden. Borromäus nahm seine Krätze und suchte im oberen Stock seine gemietete Kammer auf. Diese war zwar teurer, dafür aber sicherer. Im öffentlichen Schlafraum trieben sich genug neugierige Nasen herum, die keine Skrupel hatten, das Eigentum von anderen zu untersuchen oder sich nützlicher Dinge zu bemächtigen. Noch wusste er nicht, welche Bekanntschaft er gemacht hatte.
***
Mit schweißnassen Fingern umklammerte Marie die Steine des Mauerwerks. Die Schritte hatten die Giftküche erreicht. Die Person blieb stehen. Marie hörte, wie der Feuerstein geschlagen wurde und kurz darauf der Zunderschwamm knisterte. Ein warmer Kerzenschein flackerte auf, der Lichtkegel kam näher.
»Marie?«, rief eine Männerstimme. »Bist du hier?«
Im Türrahmen erschien eine Gestalt mit einer Kapuze, sofort fiel Marie Jakobs Beobachtung ein. Erleichtert erkannte sie unter der Kopfbedeckung die kleinen Äuglein des Bruders Stephanus, seine runden Wangen. Es war nicht der Tod unter der Kapuze gewesen, den Jakob glaubte gesehen zu haben.
»Ihr habt mir einen gehörigen Schrecken eingejagt«, rügte sie den Gottesmann. »Was führt Euch hierher?«
»Deine Schwester Franziska hat mir verraten, wo sie dich vermutet. Ich habe mich um dich gesorgt. Erst verlierst du deinen Onkel, zu allem Unglück brennt kurz danach die Aschenhütte ab.«
»Sie wurde abgebrannt, Bruder Stephanus, da versucht mir jemand das Handwerk zu legen, und ich habe keinerlei Rechte und Handhabe. Mir fehlt offiziell ein halbes Jahr. Kann der Abt nichts daran ändern? Ich bitte Euch«, flehte Marie.
»Der Abt ist auf Reisen, mit einer Urkundenänderung kann ich dir nicht helfen. Ein halbes Jahr kann die Glashütte nicht stillstehen. Im Frühjahr wird man das Aschenhaus wieder aufbauen. Sicherlich kannst du so lange bei deinem Vater wohnen. Die Äulemer brauchen dich, und letztendlich werden sie dich akzeptieren. Wichtig ist: Dein Vater muss ein Machtwort sprechen. Das hat er heute Nachmittag doch schon ganz gut gemacht, findest du nicht?«
»Ja, hat er, aber mir will jemand Angst machen, Bruder Stephanus.«
»Warum glaubst du das? Gibt es außer den Brennrechten andere Dinge, die man dir missgönnt? Dinge, die jemand haben will? Ich habe im Gasthaus von einem fremden Händler gehört, er soll Theis aufgesucht haben.«
Marie räusperte sich verlegen. Wenn sich der Mönch darüber Gedanken machte, würden es andere auch tun. Es war nur eine Frage der Zeit. Wusste jemand von Theis’ Experimenten? Wollte der Brandstifter eigentlich nicht die Aschenhütte zerstören, sondern die Flusssäure finden? Ein Zeichen setzen? Ein Spion aus einer anderen Glashütte? Der Fremde, den Jakob für den Tod gehalten hatte!
Warum hatte der Unhold die Schätze nicht mitgenommen?
Er konnte nichts damit anfangen. Er wollte das Rezept. Mit Sicherheit. Und er glaubte, sie habe es. Er würde wiederkommen.
Maries Herz klopfte bis zum Hals. Konnte sie sich Stephanus anvertrauen? Theis hatte viel von ihm gehalten. Sie musste es versuchen.
»Stephanus, es ist etwas anderes, Ihr habt recht. Es geht um ein neues Rezept. Ich kenne es nicht. Theis hat mir nur verraten, dass er daran gearbeitet hat. Man braucht dazu ein besonderes Gestein, Flussspat. Ich muss es zuerst finden, es war Theis wichtig, und ich habe ihm versprochen, mich zu kümmern und keinem etwas darüber zu verraten. Kann ich auf Euch zählen?« Sie hatte ihn unmerklich an seiner Kutte gepackt.
Stephanus legte seine Hände auf die ihren. »Gemach, du solltest jetzt nicht den Kopf verlieren. Wie willst du das anstellen? Wo willst du suchen, und wer soll deine Arbeit machen?«
»Meine Schwester Franziska hat mir oft beim Aschebrennen geholfen. Sie könnte für ein paar Tage die Produktion aufrechterhalten. Überzeugt meinen Vater, ich werde noch heute Nacht mit Jakob aufbrechen.«
»Das kann ich nicht zulassen. Wohin willst du?«
»Auf die andere Seite des Berges. Ich bin es Theis schuldig.«
»Über den Feldberg? Du bist wahnsinnig, es könnte zu schneien beginnen.«
»Wenn ich mich beeile, schaffe ich es vor dem Wintereinbruch, und wenn ich zurückkomme, trete ich in Theis’ Fußstapfen. Versprochen. Es war ihm wichtig. Ich muss das Gestein finden und den Handel besiegeln, bevor es ein anderer tut. Außerdem muss ich das Rezept fertig entschlüsseln. Dieser Händler kam von den Bergbausiedlungen drüben am Feldberg, ich werde ihn suchen. Er weiß sicherlich mehr. Bruder Stephanus, ich danke Euch.«
»Ich habe noch nicht zugestimmt. Und nichts getan, wofür du dich bedanken müsstest.«
»Ihr habt mir die Augen geöffnet. Ich packe. Könntet Ihr dafür sorgen, dass mir keiner folgt? Ich kenne meinen Widersacher nicht.«
Stephanus schnaubte. »Ich würde dir gern Geleitschutz geben, mir fällt auf die Schnelle niemand ein. Kennst du den Weg überhaupt?«
»Das lasst meine Sorge sein.«
Bruder Stephanus stöhnte auf. »Marie, du hast den berüchtigten Dickschädel der Glasmacher, du würdest nicht zugeben, dass du den Weg nicht kennst.«
Er kniete sich auf den Boden, nahm eine Handvoll Asche aus dem umgeworfenen Korb und strich sie glatt.
»Hier ist Äule, du musst über den Kamm nach Menzenschwand. Folge dem Bach hoch bis zum Wasserfall, umgehe diesen, oberhalb erkennst du die Klusen-Moräne. Laufe weiter am Wasser entlang bis zum Maria Loch, der Albquelle. Von dort musst du steil ansteigen, bis du auf einen einfachen Saumweg stößt, er ist die einzige Verbindung, außer ein paar einsamen Hirtenpfaden. Der Weg ist kaum begangen, du kannst auf keine Hilfe hoffen und musst alles allein zu Fuß gehen. Ist dir das klar?«, fragte er eindringlich.
Marie nickte.
»Gut. Folge dem Pfad nach links dorthin, wo die Sonne untergeht, er führt hinunter ins Wiesental bis Todtnau, dort überquere den Fluss, die Wiese und biege rechts zu den Bergarbeitersiedlungen ab. Beim großen Hangloch-Wasserfall gibt es einen Steg. Aftersteg ist der erste Ort nach dem Steg. Im Gasthaus kennt man jeden.«
»Vergelt’s Euch Gott, Bruder Stephanus.«
»Ich kann dich nicht zwingen hierzubleiben. Bedenke, der Weg ist weit und anstrengend, mit Kind nicht in einem Tag zu schaffen. Lass Jakob bei deiner Schwester und deinem Vater. Es wird schwierig werden, den Pfad zu finden. Falls es schneit, unmöglich. Der eigentliche Handelsweg geht von St. Blasien über die Hohe Wacht bei Bernau und von dort ins Prägtal nach Todtnau, er wäre sicherer, aber dazu brauchst du mindestens zwei Tage länger.«
»Ich nehme die Abkürzung und Jakob mit. Ich kann nicht einfach verschwinden, ohne dass er weiß, wo ich bin. Niemand darf von meinem Aufbruch erfahren. Noch nicht.«
Marie verschwand, um die Vorbereitungen zu treffen. Sie würde vor Sonnenaufgang losziehen.
Stephanus nickte widerwillig, obwohl sie schon zur Tür raus war. Dieses Mädchen behandelte ihn wie einen Vertrauten, nicht wie eine Respektsperson aus dem Kloster. Er mochte sie und hatte ihr versprochen, darauf zu achten, dass ihr niemand folgte. Nach den Benediktinischen Regeln müsste er ins Kloster zurück, ausnahmsweise würde er im Gasthaus ein Zimmer nehmen. Zum einen war der Weg zurück nach St. Blasien weit und bei Nacht nicht ungefährlich, zum anderen war Theis sein Cousin und Marie in gewisser Weise sein Mündel. Der Abt war unterwegs. Wer sollte ihn zurechtweisen?
Stephanus wollte gehen, als er die lose Bodenplatte unter seinen Füßen spürte. Er bückte sich, hob sie hoch und entdeckte einen Hohlraum. Vorsichtig schlug er die Tücher zurück. Geätztes Glas! Zerstört! Das also war das Geheimnis. Marie hatte richtig vermutet: Jemand war hinter dem Rezept her.
Ihm fiel ein, wer sich brennend für diese Neuerung interessieren würde. Seine Nackenhaare stellten sich auf.
***
In dieser Nacht schlief Borromäus sehr unruhig, der Sturm heulte, und der Wind ließ die Fensterläden an den Rahmen krachen.
Gegen Morgen stand er auf und öffnete die Flügel für einen kurzen Moment. Die Wirtin hatte recht behalten, draußen tobte ein Schneesturm. Früh in diesem Herbst, aber nicht ungewöhnlich.
Borromäus legte sich wieder hin und zog die Decke über die Ohren. In der Dunkelheit war das ganze Ausmaß des Wintereinbruchs noch nicht abzusehen. Er würde bei Tagesanbruch entscheiden, ob er die Überquerung angehen sollte oder nicht. Vielleicht war es besser, nach Todtnau hinunterzuwandern und den Händlerweg über die Hohe Wacht zu benutzen. Was waren zwei Tage mehr bei den zwei Jahren, die er schon unterwegs war?
Er drehte sich um und schlief endlich ein.
Als er wieder erwachte, war die Stille im Raum fast unheimlich. Hell leuchtete es zwischen den Streben der Fensterläden. Er hatte verschlafen.
Schwerfällig stieg er aus dem Bett, die gestrige Tour steckte ihm in den Knochen, und die schlaflose Nacht trug das Ihre dazu bei. Vorsichtig schob er die Läden erneut auf, eine ganze Schneewand brach weg und stürzte auf den eingeschneiten Misthaufen unter seinem Fenster.
Das grelle Licht blendete ihn. Ausgebreitet wie ein weißes Himmelbett, lag das Tal zu seinen Füßen. Die Sonne schien und spiegelte sich in Abermillionen von Schneekristallen, wenige Augenblicke später jagten düstere Wolken wie übergroße Reiter über die Matten und hauchten der Landschaft eine unheimliche Mystik ein.
Borromäus lief eine Gänsehaut über den Rücken. Reiter! Was, wenn heute Nacht die berüchtigte wilde Jagd der Heidengötter losgebrochen war? Ihr Erscheinen brachte Unheil dem, der ihr Zeuge wurde. Die Unglücksboten des alten Gottes Wotan. Es war eindeutig noch zu früh für solche Phänomene, ihre Zeit war erst zwischen den Jahren, in den Raunächten. Doch kannte er Berichte von verfrühten oder verspäteten Erscheinungen. Manchmal führten sie Seelen von kürzlich verstorbenen Familienmitgliedern mit, von Menschen, die vor ihrer Zeit abberufen worden waren und noch keine Ruhe gefunden hatten.
Ein seltsames Schweigen lag über allem. Borromäus verharrte wie gelähmt, er beobachtete Männer und Pferde, die auf dem Pfad Richtung Steg gingen, den er aber von seinem Fenster aus nicht einsehen konnte. Der Schnee dämpfte die Schritte von Mensch und Tier, und falls sie sich unterhielten, auch ihre Worte. Die Ruhe nach dem Sturm – oder kam der eigentliche Sturm erst noch?
Borromäus ließ sich von der Stille nicht irritieren. Die ruhelosen Geister hatten heute Nacht an seinem Fensterladen gerüttelt. Er war gewarnt.
»Ihr habt lange geschlafen«, sagte die Wirtin vorwurfsvoll, als er die Stiege herunterkam. »Es ziemt sich, dass die Gäste bei diesen Schneemengen helfen, den Pfad bis zum Weg freizuschaufeln.«
»Entschuldigt, ich habe schlecht geschlafen. Was kann ich tun?« Er griff sich in den Bart, der nicht mehr so lang und wild wie früher war.
Wie ein Paukenschlag trafen ihn die folgenden Worte der Wirtin: »Der Steg ist heute Nacht von einem Baum zertrümmert worden. Ihr könnt Euch behilflich zeigen. Es gibt keinen anderen Weg hinunter nach Todtnau. Und am Berg«, sie machte eine unwirsche Bewegung mit der Linken, »hat der Sturm alle Pfade zugeweht.«
***
Noch vor Anbruch des Tages war Marie mit Jakob aufgebrochen. Sie hatte Franziska – mit der sie letzte Nacht die Kammer geteilt hatte – grob in ihr Vorhaben eingeweiht. Sie würde bis zur Rückkehr Maries die Asche brennen. Martha und Klara schliefen oben unter der Dachspitze und hatten von ihrem Weggang genauso wenig mitbekommen wie Vater Michael Sigwarth, der seinen Rausch ausschlief.
Am Waldrand hielt Marie inne und schaute sich um. Bruder Stephanus stand wie vereinbart am Fenster des Gasthauses und beobachtete ihren Weggang. Er würde noch eine Weile jenen Punkt im Auge behalten, an dem sie in den Wald verschwand. Marie unterdrückte den Wunsch, ihm zuzuwinken. Sie könnte einen möglichen Verfolger auf den Mönch als Aufpasser aufmerksam machen.
»Mama, wie lange müssen wir laufen? Mir ist kalt, und ich habe jetzt schon Hunger«, jammerte der unausgeschlafene Junge an ihrer Seite.
»Wir gehen über den Berg ins Menzenschwander Tal. Wenn wir an den Höfen vorbei sind, machen wir eine Pause und essen etwas«, versprach sie und hob ihren Beutel. »Ich habe genug dabei. Und bis zum Frühstück ist dir warm.«
Es wäre einfacher gewesen, auf dem Höhenkamm zu bleiben, als erst ab- und später weiter hinten im Tal wieder aufzusteigen. Es zogen sich viele kleine Trampelpfade über den breiten Rücken in alle Richtungen. Zu viele, man konnte sich leicht verirren. Und das wäre lebensgefährlich gewesen. Dort oben lauerte das Hirschbäder Moor. Daraus gab es kein Entrinnen. Erschwerend kam hinzu, dass der Sturm der letzten Nacht Graupelkörner über den Feldberg gejagt und über Moor und Wege abgelegt hatte.
Schweigend gingen Marie und Jakob nebeneinander her, jeder hing seinen Gedanken nach. Es war beiden zu früh für eine angeregte Unterhaltung. Die Müdigkeit hing wie zäher Morgennebel in ihren Köpfen.
Am Äulemer Kreuz, dem höchsten Punkt, schnitt ihnen ein eisiger Wind aus Westen die Luft zum Atmen ab. Das Spießhorn gegenüber trug bereits eine weiße Kuppe. Der höher gelegene Feldberg war vermutlich schon eingeschneit.
Marie nahm Jakob an die Hand und stemmte sich gegen den Wind, sie mussten die Anhöhe so schnell wie möglich verlassen, um in den Windschatten der Bergkette zu gelangen. Sie betete, dass der Wind keinen weiteren Schnee mehr bringen mochte, ehe sie über dem Pass waren.
Bald erreichten sie den oberen Weidepfad, der an den Höfen vorbei Richtung Wasserfall führte. Von da hatten sie den Verlauf der Alb im Auge und konnten ein paar Höhenmeter sparen, die sie sonst wieder hätten aufsteigen müssen.
»Siehst du die Dampfwolke dort hinten zwischen den Bäumen?«
Jakob nickte, und Marie wusste, dass er auf eine Erklärung wartete, was sich dort befinden würde.
»Es ist der Wasserfall. Du wirst staunen. Dort werden wir etwas essen, danach müssen wir hoch zum Pass. Komm, wir sind bald da.«
Jakob schien erleichtert. Marie bemerkte, wie sich seine Angst vor dem Unbekannten löste und er gespannt auf den Wasserfall zulief. Eigentlich liebte ihr Sohn solche Abenteuer.
Wäre da nicht das Wetter gewesen! Es schlug um. Wolkenberge türmten sich auf.
Als sie dem Tosen und Rauschen des Wassers immer näher kamen, wurde die Luft feuchtkalt. Sehr ungemütlich für eine Rast.
»Lass uns zwischen den Felswänden hinunterschauen und noch ein paar Schritte gehen«, sagte Marie. »Richtung Kluse ist der Bach ruhiger und die Luft nicht mehr so eisig.«
Links und rechts der Felswände hatten sich mannshohe Eiszapfen und ganze Eiswände gebildet. Kein Sonnenstrahl traf im Winter an dieser Stelle herein. Es wirkte, als hätten die Glasmacher ihre Häfen über den Felsen ausgeleert und das Glas sei erstarrt. Eine bizarre Welt, wie im Märchen.
»Mama, glaubst du, dass der Schatzhauser hier war?«, fragte Jakob staunend und zugleich wehmütig.
Diese Frage traf Marie wie ein Schwerthieb, der Schatzhauser war das Glasmännlein aus dem Märchen, das Theis ihm immer erzählt hatte. Eines Tages hatte der kleine Jakob geglaubt, ihm im Wald begegnet zu sein. Er hieß in Wirklichkeit Borromäus, wie Marie später erfahren hatte.
»Der Schatzhauser ist verschwunden, wie alle Märchenwesen es irgendwann einmal tun, wenn man älter wird«, log Marie. Sie wollte sich nicht anmerken lassen, dass sie den Waldmenschen Borromäus auch vermisste. »Komm, wir müssen weiter.« Sie zog Jakob weg und deutete an den Himmel. »Das hält nicht mehr lange, wir sollten etwas essen, bevor es hoch zum Pass geht. Dort hinter dem großen Stein scheint mir ein guter Platz zu sein.«
»Erzähl mir eine Geschichte von früher, wie Onkel Theis.« Tränen kullerten über Jakobs Wangen.
Marie nahm ihn stumm in die Arme. Das arme Kind. Sie hatte ihm keine Zeit für die Trauer gelassen. Nicht nur ihm, auch sich selbst nicht. Sie zog die Nase hoch, ihre Augen wurden ebenfalls feucht.
Theis! Wo führt dein Geist uns hin?
KAPITEL 2
»Franziska!« Michael brüllte die Stiege hoch. »Wo bleibt mein Frühstück!«
»Franziska ist in der Aschenküche drüben«, rief Klara aus dem Ziegenstall nebenan.
»Was treibt die in der Giftküche?«
»Was man dort treibt, Vater, die Asche brennen.«
»Mit Marie?«
»Nein, allein. Marie musste weg.«
Michael streckte seinen Kopf in den Ziegenstall. Die Ungeduld stand ihm ins Gesicht geschrieben. »Wohin? Herrgott noch mal, muss man dir alles aus der Nase ziehen?«
»Das weiß ich nicht«, antwortete Klara gereizt, »sie hat nur gesagt, dass sie etwas erledigen muss. Bis sie wiederkommt, brennt Franziska die Asche. Jakob hat sie mitgenommen.«
»Ich bin der Glasvogt und obendrein euer Vater, mit mir hat man zu reden! Verstanden? Mit mir! Ihr gottverdammtes Weiberpack! Wo ist der scheinheilige Mönch? Ist sie vielleicht mit ihm ins Kloster, um den Vertrag auszuhandeln? Ohne mich zu fragen?« Michael stampfte wütend auf, seine Halsvene schwoll dick an.
Klara zuckte scheinbar gelassen mit den Schultern und bekräftigte, dass sie weder Bruder Stephanus noch Marie heute Morgen gesehen habe.
Wutentbrannt ging Michael hinüber ins Laboratorium, die Tür war nur angelehnt.
In der Küche herrschte noch das gleiche Chaos wie am Vortag. Die Tiegel waren umgeworfen, die Asche verstreut. Michael kratzte sich am Hinterkopf. Vor ihm lag das Wohnhaus von Theis, abgebrannt bis auf die Grundmauern, einzig ein paar Balken ragten in den Himmel. In der Aschenküche war alles zerstört. Offensichtlich hatte im Raum jemand gewütet, etwas gesucht. Diesen Jemand wollte er ausfindig und verantwortlich machen. Das war gestern gewesen, heute stellten ihn seine Mädchen vor neue Herausforderungen.
»Franziska? Bist du hier?«
Stille.
Polternd trat er in die eigentliche Küche, keine Spur von Franziska. Es sah nicht so aus, als sei sie da gewesen. Der Herd war kalt. Ohne Feuer kein Aschebrennen. Die Bütten standen bereit, die Asche war ausgelaugt. Wenn er sich richtig entsann, standen die gestern schon hier. Auf dem Herd lagen schwarze Rußkrümel, die konnten nur vom offenen Kamin stammen, der über dem Herd als Abzug diente. Es war schon vorgekommen, dass sich ein Tier in den vermeintlich warmen Schacht geschlichen hatte und heruntergefallen war. Vielleicht hatte auch der Sturm letzte Nacht durch den Schacht geblasen.
Da Michael niemand fand, ging er um die Hütte herum und entdeckte Spuren im Raureif hinauf in den Wald. Zwei Spuren. Die eine, die kleinere, war etwas verwischt. Weiter oben ging sie in eine Schleifspur über, ehe sie sich verlor. Dafür die andere etwas deutlicher und tiefer.
Wieder rief er nach Franziska, seine Worte verhallten. Irgendetwas stimmte nicht.
»Meister Michael, was brüllt Ihr so?«
Der Sekretarius des Abtes stand plötzlich hinter ihm. Erschrocken fuhr Michael herum.
»Ihr habt mir heute Morgen gerade noch gefehlt. Wo sind meine Töchter? Da steckt doch Ihr dahinter, oder?«
»Töchter?«, fragte Stephanus mit Betonung auf der letzten Silbe.
»Ja, Marie und Franziska! Und Jakob.«
»Franziska? Wieso Franziska? Sollte sie nicht Marie in der Aschenküche vertreten?«
»Vertreten?«, blaffte Michael. »Aha, Ihr wisst also etwas? Dachte ich mir.«
»Darüber wollte ich mit Euch reden.« Stephanus war sichtlich unwohl, doch den Vogt beschäftigte etwas anderes. Er deutete auf die seltsamen Spuren.
»Hier ist keine Franziska. Oder sollte ich sagen, hier war einmal eine Franziska?«
Stephanus kam näher, bückte sich und begutachtete die Fußabdrücke. »Sieht so aus, als sei jemand verschleppt worden.«
Michael wurde mit einem Schlag ganz blass. »Verschleppt?«
Stephanus sprach aus, was er insgeheim befürchtet hatte. Der Gedanke war also nicht abwegig.
»Meister Michael, ich weiß nicht mehr als Ihr. Das«, Stephanus zeigte auf die undeutliche Fährte im Raureif, »sieht für mich aus, als wenn zwei Menschen, der Größe nach Mann und Frau oder ein jüngerer Mensch, Richtung Wald gegangen sind. Hier werden die Stapfen undeutlich, da zu einer Schleifspur und schließlich ist es nur noch eine. Was können wir daraus schließen?«
Michael atmete tief ein und aus. »Was glaubt Ihr?«
»Eine der beiden könnte Franziskas gewesen sein. Sie sollte die Asche brennen, oder? Ihr habt sie aber nicht gefunden. Ist Euch außer der Sauerei im Laboratorium noch etwas aufgefallen, bevor wir blindlings in den Wald und vielleicht in eine Falle rennen.«
Michael überlegte und wiegte langsam den Kopf. »Halt, die Rußkrümel auf dem Herd, als wenn ein Tier durch den Schornstein gekrochen wäre.«
»Lasst uns das anschauen.«
Sie machten kehrt und umrundeten erst einmal die Aschenküche. Hinter dem Gebäude entdeckten sie eine weitere Ungereimtheit. Die Holzschindeln auf dem tief gezogenen Dach wiesen weitere Abdrücke im Raureif aus.
»Hier! Wenn nachher die Sonne draufscheint, ist nichts mehr zu sehen. Da hat jemand durch den Kamin geschaut. Was sieht man von dort oben?«
»Vermutlich den Herd.«
Bruder Stephanus schürzte seine Kutte und kletterte auf einen größeren Stein. Oben angekommen, hangelte er an der hölzernen Dachrinne entlang und zog sich schließlich behände daran hoch. Auf allen vieren kroch er zum Kamin und lugte hinein. Er lieferte ein komisches Bild ab.
»Bruder, das macht Ihr nicht zum ersten Mal. Verschwindet man nachts so aus dem Kloster?«
»Auch ich war einmal jung, und es gab eine Zeit vor dem Kloster. Kennt Ihr einen Bub, der nicht auf Bäume geklettert ist?«
»Schon, aber mit Eurem Leibesumfang?«, antwortete Michael eine Spur versöhnlicher. »Seht Ihr was?«
Bruder Stephanus wäre ums Haar abgerutscht, fing sich im letzten Moment und zog sich abermals nach oben. Beim Blick durch den Kamin stieß er einen Pfiff aus.
Michael wurde ungeduldig.
»Wie Ihr schon sagtet, man sieht den Herd, vielleicht ist einfach nur einer der Lausebengel aufs Dach geklettert.«
Diese Aussage wurmte Michael. Er hatte das Gefühl, dass der Mönch nicht alles sagte. Kurz überlegte er, ob er selbst hochklettern sollte, verwarf den Gedanken aber wieder, um sich nicht der Lächerlichkeit preiszugeben. Was, wenn einer der Dorfbewohner die beiden Schwergewichtigen beobachtete?
»Wir sollten zwei oder drei Leute mitnehmen und die Verfolgung aufnehmen«, schlug Bruder Stephanus schließlich vor, rutschte auf den Sohlen vom Dach herunter und landete mit einem beherzten Sprung auf dem Boden.
»Gut, ich kommandiere zwei Mann ab, das Gemenge ist noch nicht aus dem Sande, vor heute Nachmittag können wir das Glas nicht ausarbeiten. Ich beauftrage Klara oder Martha, uns etwas zu essen zu richten.« Michael war in seinem Element, das Kommando zu führen, lag ihm.
»Aus dem Sande?«, fragte Stephanus verwundert.
»Sag ich doch«, konterte Michael überheblich, »rumhocken und studieren, aber keine Ahnung vom Leben. Ordensbrüder! Der Quarz ist noch nicht geschmolzen, wir können das Glas erst verarbeiten, wenn das Gemenge rein ist.«
»Man kann nicht alles wissen. Ich hole meine Sachen aus dem Gasthaus. Bin gleich wieder da.«
Stephanus wollte davoneilen, doch Michael hielt ihn zurück. »Halt, mein Freund, Ihr seid mir noch eine Antwort schuldig. Wo ist Marie?«
»Sie hat Theis versprochen, eine Arbeit zu Ende zu bringen.«
»Wo?«
»Das kann ich nicht sagen.«
»Das könnt oder wollt Ihr nicht?«
»Ich kann es nicht, sie hat mir nur anvertraut, dass sie eine Weile weg ist. Ich soll es Euch ausrichten. Wenn sie wiederkommt, übernimmt sie die Arbeit in der Aschenküche. So lange hilft Franziska aus. Ähm, sollte aushelfen.«
Michael wurde plötzlich klar, dass Franziskas Verschwinden die Arbeit in Äule zum Stillstand bringen konnte. War dies eine Sabotage am Dorf? An den Glasmachern oder der Aschenbrennerin?
***