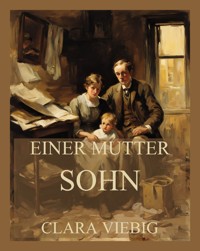Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rhein-Mosel-Vlg
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Hohelied auf die Schönheit der Mosellandschaft, aber auch eine realistische Schilderung der Winzernot in den Jahren nach dem 1. Weltkrieg bietet die Autorin ihren Lesern in 'Die goldenen Berge'. Voller Bewunderung beschreibt sie die klimatischen Vorzüge der Region, ihre Pflanzen und Blumen, die üppigen Weinstöcke und dazu die herbe Schönheit der Schieferfelsen über dem Band des Flusses, der sich friedlich durch das Tal schlängelt. Doch nicht immer ist die Mosel friedlich. Clara Viebig schildert, wie sie wild und mächtig werden kann, wie bei Hochwasser ihre braunen Fluten Verderben und Not bringen. Doch schließlich gehen die Wassermassen wieder zurück, die Menschen räumen auf - wie seit eh und je an der Mosel - und das Leben geht weiter. Clara Viebig hat mit 'Die goldenen Berge' nicht nur einen spannenden und unterhaltsamen Roman geschrieben, sie hat auch das Leben der Moselaner in den 20er Jahren in einer berührenden Schilderung festgehalten, die den Leser von heute immer noch fasziniert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 411
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Clara Viebig
Die goldenen Berge
Roman
Rhein-Mosel-Verlag
Erstes Kapitel
Das Mädchen kam, vor sich hin summend, des Weges. Maria Bremm ging auf der weißbestäubten harten Chaussee, die sich in runder Windung durchschlängelt zwischen dem Fluß und den Bergen. Steil steigen die auf zur Rechten, mit ihrem schroffen Geklipp mehr Felsen gleichend als Bergen. Kaum Erde an ihren Hängen, nirgendwo weicher Boden, den der Fuß bequem tritt; alles Schotter, Geröll, blaugraues Schiefergerinnsel, Platten und Plättchen, die jeden Sonnenstrahl auffangen und verschlucken.
Heiß stehen im bis zum Sprühen erhitzten Schiefer die Weinstöcke; Sonne, noch immer mehr Sonne wollen sie haben. Die Füße im Feuer, das tut ihnen gut, dann rinnt den Reben das volle Leben bis in die äußerste Spitze, dann sind sie gesund. Dann sind aus versteckten Gescheinen im grünen Laub überall Beeren geworden; noch sind sie klein, nicht um vieles größer als Stecknadelköpfe, aber der Behang ist schon gut zu erkennen. Der Sommer und seine Glut sind auf der Höhe, die Mittagssonne ist einem Funkenbrand gleich, einer lodernden Fackel, die ihren Feuerregen in die Weinberge wirft. Die Luft steht still, sie ist wie kochend im Weinberg. Luft und Berg versprühen Hitze, nur die Mosel, die unten, zur Linken der weißschimmernden Straße gleitet, spricht noch von Kühlung; aber sonnenbeglänzt ist auch sie.
Dem Mädchen, das auf leichten Füßen die tennenhart gebrannte Erde ging, rannen Schweißperlen unter den schwarzblauen Flechten vor, die sich in dickem Kranz tief um die schmale Stirn legten, liefen an dem geraden Näschen herab und an den warmgefärbten, beflaumten Wangen. Die Sonne hatte es gut gemeint mit diesem Gesicht, sie hatte es so goldig getönt von erster Kindheit an.
Maria Bremm wischte sich mit dem Handrücken über das heiße Gesicht: Was für ein schöner Tag! Ihr Summen wurde zum Singen, ihr Gang bekam etwas Wiegendes; so gefiel es ihr heute. Wenn das Wetter so warm blieb, war es gut für die Reben. An viertausend Stöcke hatte der Vater im Warmenberg, vier Fuder konnte man davon kriegen! Sie lächelte. Ein Zug von Stolz legte sich um ihren Mund: viertausend Stöcke, da ist man schon ein mittlerer Winzer, keiner im Dorf hatte mehr.
Maria kam vom Weinberg her, sie hatte ihrem Vater das Essen gebracht. Der Weg war zu weit und zu zeitversäumend, Simon Bremm kam nicht heim zu Mittag. Heute hatte die Tochter den Essenstopf nicht in ein Tuch zu binden gebraucht, damit er warm blieb, er dampfte noch, als sie den Deckel abhob, als sei er eben vom Feuer genommen. Der Krug war freilich leider auch warm, obgleich sie ihn mehrmals unten am Wasser gekühlt hatte; der Fluppes, den sie im Weggehen erst aus dem Keller geholt hatte, schmeckte wie laues Spülicht. Der Mann hatte ausgespien in großem Bogen, und dann doch getrunken bis zum letzten Rest, war er doch ausgetrocknet, verdurstet, ganz ausgedörrt, kein Tropfen Feuchtigkeit mehr in seinem Körper.
Der arme Vater! Auf Marias Gesicht legte sich ein Schatten, sie zog die Stirn kraus: O Jesus, nein, sie möchte nicht mit in den Weinberg gehen! Die Frauen bekamen alle von dem Schleppen bergauf einen Kropf; und so rasch alt wurden sie, mit vierzig Jahren schon sahen sie aus, wie ihre Mutter auch aussah. Nein, einen Winzer würde sie niemals heiraten. Da kriegte man auch zu viele Kinder. Nur bei der Lese war’s schön; bei der zu helfen war’s auch nicht schwer, und man hatte viel, viel Spaß dabei! Unwillkürlich machte die Junge einen hüpfenden Schritt, ein lustiges Lachen erschien auf ihrem Gesicht, alle Schatten verflogen und alles Nachdenken: Ha, war das schön auf der Welt!
Die Sonne vergoldete alles. Der Fluß war nicht Wasser mehr, sein Spiegel war aus blankem Metall. Selbst der Staub, der sich auf die Schuhe legte, war Goldstaub. Der Klosterberg drüben war wie mit Gold begossen, und die Wiese um die Klosterruine, über der droben das Kirchlein liegt, auch. Alles, alles so herrlich und reich – ach, und so froh! Maria jubelte auf.
Es war die Jugend, die aus ihr jubelte, das Land, dessen Kind sie war. Ein Land, in dem Walnüsse und Edelkastanien in Hainen wachsen, in dem das feinste Obst reift, in geschützten Gärten die süße Mandel gedeiht, immergrüne Sträucher den Winter überdauern, an den Felsen üppig der milde Goldlack duftet und Rosen noch zu Allerseelen die Kirchhöfe überblühn. Ein Land, das mit dem Glanz seiner Sonne vergessen macht, daß auch hier, wie einst im Garten des Paradieses, die Schlange versteckt liegt, die in die Ferse sticht.
Das Mädchen sprang von der Chaussee die niedrige Uferböschung zur Linken hinab: geschwind ins Wasser! Ei, die Mosel, die war das beste am heutigen Tag, und die war einem so vertraut. Sie floß am Dorf vorbei, nur schmal war das Uferland bis zu den Häusern. In sanfter Lautlosigkeit glitt sie freundlich dahin, ihr Flüstern war nur zu hören bei Nacht, wenn alles ruhig war, wenn das Schreien der Kinder verstummte, das Klappern der Schuhe, das Poltern der Karren, das Brüllen des Viehes. Wenn alle Geräusche der Wohnstätten versunken waren in stiller Dunkelheit.
Das Mädchen schleuderte die grobbesohlten Schuhe von den brennenden Füßen, streifte die Strümpfe ab, das bunte Kattunkleid, Röckchen und Hemd, mit lächelnder Lieblichkeit winkte der Fluß – schon war sie im Wasser. Mit kräftigem Schwung holte sie aus, sie schwamm wie ein Fisch. Das hatte sie niemand gelehrt, das konnten sie alle hier. Auf dem Rücken liegend, die Augen geschlossen, ließ sich Maria jetzt treiben. Kleine Wellen berührten sie weich, gleich zärtlichen, streichelnden Händen, wie lauter Liebkosung umschloß es sie. Da stieß sie einen laut juchzenden Schrei aus und schnellte sich wie ein schnalzender Fisch aus dem Wasser. Von irgendwo antwortete eine Stimme – wo kam die her? Vom Klosterberg? Aus dem alten Gemäuer aus der Tiefe? Oder rief sie jetzt in der Felsenwand des Weinberges? Das Echo war erwacht; in kindlichem Übermut forderte die Schwimmerin wieder und wieder seine Antwort heraus.
Simon Bremm im Warmenberg hatte einen Augenblick aufgehorcht: Da rief die Maria! Ein freundlicher Ausdruck überflog für Augenblicke sein ernsthaftes Gesicht, dessen Haut braungedörrt war wie gegerbtes Leder. Hör einer die an!
Der Winzer stand zwischen seinen obersten Stöcken im Warmenberg, so hoch oben, daß es nicht viel weiter hinauf mehr ging. Nur ein kurzes Stück brüchiger Felswand kam noch, und dann Luft, lauter Luft, darüber Himmel. Der Platz für die obersten Stöcke war gering, knapp genug Raum für ihrer sechs Stück und für Simon Bremm. Einem Gärtchen der Berggeister gleich schien die bepflanzte Klippe, die der felsige Berg wie ein Tellerchen vorstreckt. Senkrecht ging es hinab; aber es waren gute Stöcke hier oben, hierher kam die Sonne zuerst und blieb auch am längsten, hier gab es Trauben, wenn der Behang weiter hinunter nur spärlich war.
Der Mann beugte sich weit vor zwischen den Stöcken, er trat ganz vorn an den äußersten Rand, um in die schwindelnde Tiefe hinab nach der Tochter zu spähen. Aber er konnte sie nicht entdecken. Ach je, die Augen, die waren so gut nicht mehr! Der scharfe Sonnenbrand hatte sie angegriffen und der beizende Dunst beim Spritzen; ihre Lider waren rot mit eitrig geschwollenen Rändern.
Den Rücken gebeugt unter der schweren Last der von Kupfervitriolbrühe giftigblau angelaufenen Pumpe, stand der Winzer auf dem gleichen Berg, auf dem einst die Römer schon Wein gebaut hatten; die hatten ihm auch den Namen gegeben: »Warmer Berg«, der älteste Weinberg der Mosel. Von den Römern wußte Simon Bremm nichts, aber das wußte er, daß sein Vater, sein Großvater, sein Urgroßvater auch, hier in den Reben gearbeitet hatten, von der Sonne verbrannt, von der Naßkälte des Winters durchschauert, und immer in denselben, zu aller Zeit sich gleichbleibenden Ängsten des Winzers: wird auch keine Krankheit den Weinstock befallen, keine schädliche Motte ihre Eier legen, nicht Schimmel und Brand das Land ergreifen, daß die Berkel darunter schwarz werden? Wenn man die Hoffnung nicht hätte, nicht den Glauben an die segnende Hand Gottes und die Fürsprache seiner Heiligen, man könnte wahrlich den Mut nicht aufbringen, hier immer wieder aufs neue zu bauen. So wie Einundzwanzig konnten ja nicht alle Jahre sein – da war’s ein seltener Herbst – aber nun waren schon zwei Ausfälle hintereinander. Im ersten Jahr wäre wohl der Ertrag leidlich geworden, aber die Trauben erfroren, und das Jahr darauf, nun, da erntete man kaum etwas, es hing ja nichts an den Stöcken. Aber dieses Jahr konnte es wieder was geben, soviel geben, daß man Inflation und Besatzung vergaß und noch andere Unbill, die hierzuland über die Menschen gekommen.
Ein Hoffnungsstrahl ließ das Gesicht des Mannes jünger erscheinen, mit einem Aufatmen blickte der Winzer umher: Ließ es sich denn nicht gut an? Des Wurmes war man Herr geworden, und der Behang war ausreichend. Jetzt nur noch fleißig gespritzt! Und als hätte er sich schon auf einer Saumseligkeit ertappt, faßte seine Hand nach dem Schlauch, der wie ein sich windender Wurm aus der Pumpe herabhing.
Hinauf und hinab, unterm kletternden Schuh Geprassel von Schiefer, die Schulter geduckt unterm Trageriemen, der wie Joch drückt; brennender Durst in brennender Sonnenglut. Zwischen die Reben fliegt zerstäubender Strahl, das Grün der Blätter überzieht sich weißbläulich, und auch die Beeren der Träubchen bekommen den gleichen Anhauch. Und auch der, der da spritzt. Vom beizenden Staub tränen die entzündeten Augen.
Simon Bremm atmete schwer; die Kehle war ihm wie zugeschnürt vom Dunst zwischen den Stöcken. Es mochten an fünfzig Grad und mehr noch sein im glühheißen Ofen des Weinbergs. Aber daran dachte der Mann jetzt nicht; er dachte an seine Tochter. Wie froh die Stimme der Maria geklungen hatte! Die konnte ja auch noch froh sein, die war knapp siebzehn. Als er so jung gewesen war, hatte er’s auch noch nicht empfunden, wie hart doch eigentlich das Leben ist. In jungen Jahren ist es ein Spaß, im Weinberg zu klettern, man ist ohne Verschnaufen oben und ebenso schnell wieder unten, man fühlt kaum, daß man ein Herz hat, das pocht. Jetzt ging es schwerer hinauf, man mußte langsamer tun, Schritt für Schritt. Es war saure Arbeit im Weinberg – nein, seine Tochter sollte es nicht so schwer haben! Er wollte nicht dagegen sein, wenn sie sich eine Stelle suchte in einem Haushalt oder in einem Hotel, vielleicht ins Bad Bertrich ging; da hatte sie’s leichter. Sie konnte dann noch lange so fröhlich bleiben, sie war ein braves, ein gutes Kind – und hübsch war sie auch!
Es gibt an der Mosel viele schöne Mädchen, dunkelhaarig und dunkelhäutig, aber die schönste von allen war die Maria aus Porten. Ihre Schönheit war in der ganzen Gegend bekannt. Die kam daher, so erzählte man sich´s, daß die Bremm, als sie mit diesem Kind ging, oft fromm hinaufgewandert war zu dem Kirchlein, das oben auf dem Klosterberg inmitten eines Friedhofes steht. Dort hinauf trägt Munden, das Dorf, das schrägüber von Porten an der anderen Seite der Mosel liegt, seine Toten. Aus diesem Dorf war die Bremm gebürtig, und ihre Eltern waren da oben begraben; ihr Vater, ein Winzer, wie alle hier sind, ihre Mutter eine der Frauen, wie auch sie eine war: die heiraten jung, tun ihre Arbeit, gebären viele Kinder und sterben noch nicht sehr alt. Wenn Anna Bremm nun den Stationsweg, der von Munden steil und sonnig durch Weinberge führt, hinaufklomm, betete sie bei jeder der sieben Stationen inbrünstig ein Gebet für die Seelen ihrer Verstorbenen und zugleich ein Gebet für das neue Leben, das sie trug. Und während sie auf den Gräbern der Eltern das Unkraut rupfte, hatte sie sich viel Gedanken gemacht – sie erzählte es nachmals – drei Knaben hatte sie schon, nun wollte sie gern ein Mädchen haben, eine Tochter, die ihr beistand im Haushalt und einst auch auf ihrem Grabe das Unkraut ausrupfte. Sie erbat das dann flehentlich vor dem Bild der heiligen Jungfrau, das gnadenspendend im alten Kirchlein hängt; sie wandte ihre sehnenden Blicke nicht von dem ab. Und das Mädchen, das ihnen geboren wurde, war darum so schön wie ein Bild.
Ja, die Maria! Der unter der Last der Pumpe im glühenden Sonnenbrand keuchend Daherschreitende lächelte. Aber dann wischte er sich mit der von der spritzenden Brühe besprenkelten Hand über die Stirn, die nicht schwitzte – von Feuchtigkeit war nichts mehr im Körper – und seufzte: wenn er nur mit seinen drei Ältesten mehr Glück gehabt hätte! Neun Kinder hatte sein Weib ihm geboren, nun waren es nur mehr sechs. Der Toni und der Aloisius waren im letzten Kriegsjahr gefallen, beide noch so sehr jungen Brüder fast auf einen Tag. Sie waren begraben irgendwo. Aber daß sie in geweihter Erde lagen, das hoffte er; um sie trug er weniger Leid. Aber der dritte, der dritte, der Joseph?! Der war am Rhein, aber an welchem Ort sich der jetzt herumtrieb, das wußte er nicht. Er wollte es auch gar nicht mehr wissen. Wozu brauchte der sich zu jenen zu schlagen, die die rheinische Republik ausriefen? Gehörte man nicht zum Reich in guten und bösen Tagen? Jetzt in den bösen erst recht. Der ist ein schlechter Mensch, der seinen Herrn im Stich läßt, weil es dem nicht mehr so gut geht wie früher. Und faule Tage hatte der Joseph sich immer gern gemacht. Dem möchte es passen, in einem Haufen mitzulaufen, der mit Müßiggang, wenn nicht mit Schlimmerem, die rheinische Republik ausrief, von der jeder, der anständig dachte, nicht gern hörte. Nein, von der rheinischen Republik wollte hier im Dorf, wollte kein Mensch an der ganzen Mosel was wissen. Dazu hatte man nicht seine Söhne hingegeben, hatte nicht in Scharen die Ausgewiesenen durchkommen sehen – die Mosel herunter fuhren Schiffe verzweifelter Männer, weinender Frauen, schreiender Kinder – war nicht umsonst »besetztes Gebiet«. Zu Koblenz auf dem Ehrenbreitstein wehten nacheinander die Flaggen fremder Nationen, zu Trier trieben die Spahis mit ihren Lanzen harmlos gehende Bürger vom Bürgersteig. Man hatte so viel gelitten. Und jetzt, wo es mit den Fremden um ein weniges besser ging, wo doch wieder Friedlichkeit herrschte, man unbelästigt seiner Arbeit nachgehen konnte, jetzt brachten die, die – der Mann im Weinberg fluchte plötzlich ganz laut: die verfluchten Saukerle, die Gott verdammen möge, die brachten nun neue Unruhe ins Land. Nein, die Anna sollte nur schweigen, er wollte nichts hören von ihrem: »Der Joseph ist ja noch so jung und unverständig, sie haben ihn nur beredet, der besinnt sich schon wieder« – und wenn er sich auch besinnen sollte, die Schande, die blieb. In des Mannes Seele nagten Kummer und Zorn: sein Joseph, sein Sohn bei denen! Nicht die, die zum Reich hielten, waren Hochverräter an Deutschlands Freiheit, wie’s in dem Zeitungsblatt stand, dem blöden Wisch, den der Joseph hergeschickt hatte. Alle im Dorf hatten die Zeitung gelesen – der Herr Pastor hatte sogar in der Predigt etwas davon gesagt – die einen hatten darüber geschimpft, die anderen gelacht, er selber hatte kein Wort sagen können. Die Hände in den Taschen seiner Hose zu Fäusten geballt, hatte er stumm dagestanden.
»Donner und Doria!« Dem Mann im Weinberg ging der Atem aus. Die Hitze des Mittags, stark wie das Fegfeuer, war nicht so schwer zu ertragen gewesen, wie jetzt die stickige Dumpfheit zwischen den dichtbelaubten Stöcken. Die Sonne war im Sinken, aber der Berg hielt all ihre Glut eingeschluckt; die Sohle, die den schiefrigen Felsboden trat, wurde fast verbrannt, als ginge sie über glimmende Kohlen. Simon Bremm schnallte den Tragriemen los und ließ die Pumpe herunter. Aufstöhnend reckte er den Rücken grade; der war krumm geworden, die Schultern schmerzten. Seit Mittag waren viele Stunden vergangen. Sein Ohr fing jetzt den schwachen Klang fernen Läutens auf: das Ave. Als der Morgennebel noch über der Mosel dampfte, hatte er angefangen – vierzehn Stunden im Berg – nun durfte er ans Heimgehen denken.
Steif geworden vom Tagwerk und wie zerbrochen an allen Gliedern, stieg der Winzer jetzt abwärts. Langsam schlurrten seine Schuhe mit schweren nagelbeschlagenen Sohlen über die harte Chaussee. Sehr müde war er, aber sein Auge sah doch noch die Schönheit der Landschaft: Ist es irgendwo schöner?
Es dämmerte bereits, über der Mosel webte es silbrig und ums Klostergemäuer auch. Wie schon eingeschlafen, senkten Obstbäume, die auf der Wiese standen, ihre schwerbeladenen geduldigen Äste. Auf den Buchenkronen des auf der Seite zur Wiese hinunter bewaldeten Abhangs des Klosterberges kam süß das Abendlied schläfriger Vögel; Grillengezirp aus den Steinen der Weinbergsummauerungen und leises Froschgequak an der Uferböschung stimmten dazu. Es machte die Seele des Müden zufriedener. Alles, was ihn verstimmt und beängstigt hatte, ging nun zur Ruhe.
Näher schon kam er jetzt seinem Dorf, das eng, dicht am Moselufer, sich den Weinbergen anschmiegt. »Zuckerberg, Paradiesgarten, Kirchberg« – sie waren trotz ihrer Namen nicht halb so gut wie seine Kreszenz vom Warmenberg. Er sah den Rauch der Dorfhäuser in dünnen Säulchen sich aus den Schornsteinen heben und, von stark tauig werdendem Abend nach glühenden Tag, sanft niedergelegt werden auf die dunkelnden Dächer. Überall kochte die Abendmahlzeit. Kein Mensch war mehr zu sehen in den Weinbergen. Nun würde er auch gleich daheim sein; andere waren schon eher zu Hause, er hielt immer am längsten aus.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Fernblaue Berge verschwimmen im Dämmergrau, ihre Umrisse, die, sich spiegelnd, den Strom geküßt, lösen sich auf. Das Diesseits der Flusses und das Jenseits rücken zusammen, es umschlingen sich Hüben und Drüben, Höhen und Tiefen im zarten Duft. Ein Himmel, ehrfurchtgebietend, andachtheischend, spannt sich hoch voller Majestät, und doch liebevoll menschlich nah, übers nächtlich werdende Moselland. Vom Dunkel gemildert, weht nun sein Atem samtwarm und streichelnd.
Zweites Kapitel
Porten, das Moselnest, hat alte Häuser. In der Gasse, die vom Ufer gegen den Berg hin ansteigt und oben beim Kirchlein endet, stehen sie sich sehr nah gegenüber. Es sieht aus, als streckten sie alle den Bauch heraus, denn das obere Stockwerk springt rund gewölbt über das untere vor, darinnen Haustür und Stalltür sind und das Stubenfenster. Der Misthaufen liegt im Gäßchen vor jedem Haus, man wirft den Dung gleich aus der Stalltür darauf und kann vom Stubenfenster aus ihn dampfen sehen; das Hüben in der engen Gasse duftet das Drüben an. Aber auch Blumen duften im Gäßchen. Auf jedem Sims, an jedem Fenster stehen sie: Geranien, Fuchsien, Nelken, Balsaminen, Myrten, Fleißiglieschen und noch viele andere; in Töpfen, in Scherben, in Kochgeschirr, in Kübeln, in Kästen, in Zigarrenkistchen sogar und alten Konservenbüchsen. Nie und nimmer würden anderswo so die Blumen gedeihen, aber hier blühen sie in üppigster Fülle, leuchten in glühenden Farben.
Simon Bremms Haus stand vorn am Ufer; nur die Schule, die Metzgerei und Gastwirtschaft und noch zwei Häuser lagen hier. Die Häuschen in der Gasse waren alle rosa, grünlich, bläulich ganz übertüncht, Simon Bremms Haus zeigte noch sein braunes, eichenes Fachwerk. Ein altes Haus mit dem Weinstock, der als Laube gezogen ist über den Treppenstufen der Haustür, mit den beiden Oleandern, die alle Jahr blühen in mandelduftenden rosa Büscheln, und mit einem Feigenbaum, der in einem Waschkübel gepflanzt ist. Die Feigen wurden nicht groß wie die jenseits der Alpen, aber süßlich schmeckten auch sie.
1730 stand über Simon Bremms Haustür, aber auch 1621 war deutlich noch zu erkennen über dem Eingang des Hauses, das seinem Ohm, dem Jakob Bremm gehörte. Das lag an der Ecke vom Gäßchen der Uferstraße, sehr hoch gebaut und unten ganz ohne Fenster; nur oben waren deren ein paar und im Giebel eine Luke, aus der sich unter einer seltsamen Götzenfratze, gleich einem Arm, ein Kranen herausstreckte. Aber sein Fachwerk – schwere eichene Balken – war reich mit Kerbschnitt geziert, und auch die Rahmen der Fensterchen und der Sims, der unter dem Dach herumlief. Unter den blinden Scheiben der Fenster zeigten sich kunstvoll geschnitzte, erhabene Sonnenblumen, über der Jahreszahl der Haustür zwei runde Wappen, in dem einen ein Storch, der mit langem Schnabel ein sich krümmendes Schlänglein aufspießt, in dem anderen das Pausbackgesicht eines Wassergottes, dessen breites Maul ein Schloß verschließt.
Hier im Eckhaus wohnte der alte Junggeselle, den Achtzigern näher als den Siebzigern; er wohnte ganz allein. In Porten sagten sie, er hätte Geld. Aber er machte sich alle Arbeit selber, er kochte sich auch allein, nur daß die Schommer, ein schlampiges Weibsbild, seine paar Hemden in der Mosel mit dem Holzschlegel schlug und dann zum Bleichen auf den Uferkies breitete. Seine Verwandten merkten nicht viel von ihm, er besuchte sie nie. Den Joseph hatte er noch am besten von allen leiden mögen, der ließ sich nicht abschrecken, keck schrie ihm der als Junge nach »Tag Uehm!«.
Der alte Bremm arbeitete noch immer in seinem Weinberg. Seine hagere lange Gestalt, die noch nicht greisenhaft gebückt war, schien ebenso unempfindlich gegen glühenden Sonnenbrand wie gegen erkältenden Regen, und unempfindlich auch gegen Anstrengung, Er trug noch die Erde, den Dung den Schiefer in der Hotte herauf, beschnitt die Reben und band selber die Ruten an. Es war ein Wunder, daß er das noch fertig brachte. »Der Geiz schafft et bei dem,« sagten die Portner. Aber war es den Geiz allein? Simon Bremm hatte sich einmal gutmütig angeboten, dem Oheim zu helfen – der war doch der Bruder des Vaters, so nah verwandt, er konnte es kaum mehr mit ansehen, wie der Alte sich quälte – aber kurz hatte der ihn zurückgewiesen: »Merci, brauchen keinen.« Einen anderen in s e i n e n Weinberg lassen?! In seinen Weinberg sollte ihm keiner kommen, an seine Reben kein anderer rühren! Er bewachte sie mit der eifersüchtigen Liebe des Vaters, der seinen Töchtern keinen Freier nahkommen lassen will.
Simon Bremms Wingert am Warmenberg hatte die bessere Lage, aber Jakob Bremm gab das niemals zu: Sein Zuckerberg hatte die beste Lage, sein Zuckerberger war das feinste Gewächs an der Mittelmosel, nichts Besseres hatte je in einem Winzerkeller gelagert. Er verstand es großartig, anzupreisen. Weil er selber im Innersten überzeugt war von der Güte seines Gewächses – er dachte nicht daran, betrügen zu wollen –, konnte er das auch anderen glaubhaft machen, die es eigentlich besser hätten wissen müssen.
»Ach, wenn du doch nur halb so reden könntst wie der alte Filu«, sagte die Bremm, halb traurig, halb vorwurfsvoll zu ihrem Mann. »Du hast zwei gute Fuder noch liegen, du tätest mit denen wahrhaftig die Leut nit so anschmieren, wie der mit seinem Zuckerberger. Den Zuckerberg müßt mer eigentlich Sauerlay heißen.«
»Laß ihn nur«, wehrte der Mann.
»Willst du dann nit verkaufen?« Die Frau seufzte. Sie dachte an vieles, das dem Haushalt not tat, an das Schuhwerk besonders, das Peter und Paul gebrauchten, wenn sie nun mit in den Berg gehen sollten. Winzerschuhe sind teuer. und die Maria wollte auch gern ein Kleid haben, zur Lese bekam doch jede ein neues; und neue Hemden mußten ihr angeschafft werden, bevor man daran denken konnte, daß sie eine Stelle annahm. Man hatte die letzten Jahre kaum etwas kaufen können. »Verkaufste jetzt?« fragte sie dringend.
Er schüttelte verneinend den Kopf und ging aus der Tür.
Bekümmert sah die Frau ihm nach: daß er sich doch immer noch nicht zum Verkaufen entschließen konnte! und man hatte doch gerade jetzt soviel nötig. Ja, es würde schon gut sein, wenn die Maria sich selber etwas verdiente! Freilich, ihr würde es hart sein, wenn sie jetzt schon ihre Älteste entbehren mußte – bei den anderen war alles noch Kinderwerk – aber dann konnte die Maria sich selber kaufen, was sie gebrauchte. Ach, man sollte doch nicht so viele Kinder haben, es kostete alles zuviel. Ihr Bremm sagte zwar immer: »Dat is bei uns nit wie in der Stadt, ein Winzer muß viele Kinder haben, denn der Weinberg braucht viele Händ.« Freilich, das sah sie ein, und sie hatte sich auch geduldig darein gefunden, daß immer wieder ein Kind kam, sie hätte keines von ihnen nicht haben mögen, sie trug schwer genug daran, daß der Toni und der Aloisius nicht mehr waren – ach und ihr Joseph?! Aber wenn sie nächtens neben dem Mann lag, den sie von Herzen liebte, dann betete sie jetzt doch heimlich zur heiligen Jungfrau, daß die sie in Gnaden bewahre. Jedes weitere Kind wäre ein Unglück – ach, die Zeit jetzt, die war nicht danach!
Simon Bremm war nicht so verzagt. Er verließ sich auf seinen Weinberg. Dieses Jahr ließ ihn der nicht im Stich. Es war zwar nicht ganz übermäßig, was an den Stöcken hing, aber da anderswo sehr wenig war, kam er mit seinem Warmenberger hoch. Er würde zudem seine noch lagernden zwei Fuder dann sehr günstig verkaufen.
Er ging jetzt über den Hof nach seinem Keller; der lag unterm Kelterhaus. Das war noch viel älter als sein Wohnhaus, die drüben vom Kloster hatten sich’s wohl gebaut. Im Vorraum ließ er das Licht aufflammen und ärgerte sich: daß die Weiber auch hier immer ihre Ablagerungsstätte hatten! Er gab einem Waschzuber, der umgestülpt am Boden lag, einen derben Tritt. Hier durfte nur die Traubenmühle stehen neben der Kelter und die Gerätschaften, die er notwendig brauchte. Er trat dicht neben die Kelter, liebevoll ruhte sein Blick auf ihr. Es gab manch eine, die leichter zu handhaben war – die neumodischen wurden sogar elektrisch betrieben – seine hier ging schwer, es knarrte der eichene Kelterbaum, und man selber ging fast aus den Fugen dabei, aber sie hatte schon Vater und Großvater gedient. Eine gute, eine brave alte Kelter. Fast zärtlich betasteten seine Finger den Kelterbaum. Und dann stieg er die Stufen hinab in den Keller; sie waren von der steten Feuchtigkeit schlüpfrig. Der Keller selber war wie ein Burgverlies, keine Luke, kein Lichtstrahl und auch kein Luftzug. Dunkel, sehr dunkel, weit ging´s in undurchdringliche Schwärze hinein. An den unbehauenen Steinen der dicken Mauern, von der schwarzen Decke herab, sickerte in langen Gehängen, wie in Tropfsteinhöhlen, gleichsam versteinert die Feuchtigkeit. Ein guter Keller, ein ausgezeichneter Keller, im Winter warm, im Sommer kühl, man merkte es, daß er einst den Klosterfrauen von drüben gedient hatte. Die wußten, wie man guten Wein zu lagern hat. Und statt der paar Fuder jetzt, lagen damals sicher dreimal so viele hier, große Stückfässer. Das reiche Kloster hatte eine Menge Weinberge, und die adligen Klosterdamen hatten immer viel Durst.
Simon Bremm trat zum vorderen Faß: spundvoll. Er klopfte wohlgefällig schmunzelnd daran, und dann an das zweite. An tausend Liter in jedem. Er brachte seine Nase ans Spundloch oben – hei, wie das duftete! Es gelüstete ihn sehr, einmal zu probieren, aber er versagte es sich, schnupperte nur noch am Kranenloch vorn. Gut, gut! Man roch schon, was das für ein Wein war. Aber für ihn viel zu schade zum Trinken, für ihn war der Fluppes. War der nicht auch gut? Er hatte ja den Trester mit reichlich Zuckerwasser gelöst und nochmals gekeltert. Er holte sich die Stütze aus dem Vorraum, deren Blechbehälter gut zwei Liter faßt, ging ans Haustrunkfaß, das, bescheiden und klein, neben den Fuderfässern fast verschwand, drehte den Kranen auf und ließ in sein Gefäß rinnen. Die Stütze war halbvoll, er hob sie mit beiden Händen an den Mund und trank durstig und rasch. Der Fluppes war farblos, ein dünner, verwässerter letzter Aufguß, der apfelsäuerlich roch; aber hier unten getrunken hier in dem Raum, dessen Wände seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten schon den nie ersterbenden Duft von Weinen bewahrten, die einst hier gelegen, schmeckte auch er wie Wein und berauschte wie Wein. Dem Mann, der hastig getrunken hatte, wurde auf einmal so leicht ums Herz, er fühlte ordentlich, wie etwas von ihm abfiel. Er mußte lachen, wenn er bedachte, was Anna gesagt hatte – Schuhe, Kleider –?! Pah, was sorgte sie! Da war nichts zu sorgen. Und die Maria konnte sich ruhig den Stoff kaufen, das Kleid nähen lassen, er war den Leuten schon so lange gut, bis er´s bezahlte; Schulden hatte er noch nie gehabt. Und er hatte ein kreuzbraves Weib, und bis auf den Joseph, den faulen Kopf, lauter wohlgeratene Kinder, und Ackerland noch außer dem Weinberg, und das Haus mit einem Feigenbaum vor der Tür, und eine eigene Kelter – und hier, hier ein Vermögen! Er legte seine Rechte und auf das eine Faß und seine Linke auf das andere.
Zwischen seinen Fudern stehend, lächelte Simon Bremm verträumt ins Kellerdunkel hinein – da sah er seinen Weinberg. Er sah Trauben hängen an jedem Stock, die Beeren waren klein, aber goldig, die Sonne machte sie durchsichtig – sie waren schon alle im Wein. Oh, die neue Ernte! Des Mannes Herz klopfte stark: Oh, welch ein Ausblick! Alle Hoffnung erfüllte sich.
»Vater! Vater!«
Nun hörte er doch in seine Träume hinein, daß man nach ihm rief. Maria stand oben am Kellereingang; hinter ihr war die Stelle des Tageslichtes, in die Bremm jetzt blinzelte.
»Vater, geschwind, et is einen da!«
Herr Feiden, der bekannte Kommissionär, war gekommen. Simon Bremm verwunderte sich: schon jetzt? Man wußte ja noch gar nicht bestimmt, was die diesjährige Ernte brachte, vielmehr nicht brachte, und schon hatte der heraus, wo noch was lagerte? Er nahm sich vor, vorsichtig zu sein. Die Preise würden steigen, bei der geringen Ernte unbedingt steigen, seine Fuder, die lagen hier noch lange gut, er konnte es abwarten. Kühl hielt er zurück.
»Braucht Ihr denn kein Geld?« fragte der Kommissionär ganz verwundert. Das war ihm noch nie vorgekommen, ein Winzer vor der Lese, der kein Geld brauchte? Er bot Milliarden, Billionen!
Bremm spuckte in großem Bogen. »Meine Fuder sind mir lieber. Die kann ich noch lang verkaufen. Überhaupt dieses Jahr!«
Da fing Herr Feiden an zu erzählen, daß die Herbstaussichten doch durchaus nicht so ungünstig waren, wie man zuerst angenommen hatte. Der Behang war gut, es gab sogar glänzende Lagen. An der ganzen Obermosel war man einer Dreiviertelernte gewiß.
Der Winzer blieb ungerührt: »Ich verkaufen nit.«
»No, aber, wenn Ihr jetzt kein bar Geld kriegt, wovon wollt Ihr dann den Zucker anschaffen, und wovon nachher in Eurem Berg die notwendigen Reparaturen machen?« Der Kommissionär erregte sich: »Ihr seid ja verrückt!«
Bremm zuckte die Achseln: was dem Weinberg not tat, würde auch beschafft werden, lieber hungern, als dem was fehlen lassen. »Der Weinstock zieht dem Winzer den Rock aus, aber er zieht’n ihm auch wieder an«, sagte er mit einem gewissen Triumph. »Was ich jetzt nit hab, hab’ ich nachher doppelt und dreifach. Geht nur, bei mir is heut nix zu wollen!«
Der Kommissionär ging ärgerlich. Simon Bremm sah ihm nach mit halbem Lächeln: Bildete der sich ein, die Fuder billig zu kriegen? Warten, nur warten, bis so gut wie kein Angebot da war, dann stiegen die Preise!
»Vater, haste verkauft?« fragte Maria neugierig. Ihre Augen glänzten: Wenn er verkauft hatte, bekam sie Geld für ein neues Kleid. Der Kaspar aus Munden fuhr morgen nach Cochem, der nahm sie mit. Sie hatte heute mit ihm gesprochen, als sie am Rittweg Gras für das Vieh holte. Er angelte im Kahn drüben auf der Mundener Seite, aber als er sie sah, kam er rasch über die Mosel zu ihr gerudert, hielt sich am hängenden Weidengebüsch fest, und sie hatten lange geschwatzt.
Er sagte, er müßte nach Cochem, aber sie wußte genau, er fuhr nur hin, spannte nur an, weil sie gern hin wollte. Er tat ihr ja alles zulieb. Aber wenn er ihre Hände fassen wollte, zog sie die ihren rasch weg, hielt sie hinter den Rücken und lachte ihn aus. Und doch würde es nett sein, mit ihm zusammen zu fahren. Das Kleid, ach ja, das Kleid, konnte sie sich das denn nun endlich kaufen?! Marias Augen hingen bittend am Vater: »Haste verkauft?« Als er kurz sagte: »Nein«, war sie bitter enttäuscht.
»Wann verkaufste dann?«
»Noch gar nit!«
Da stieg es naß in ihre Augen, sie konnte das Weinen nicht unterdrücken: Das war aber traurig, zu traurig, nun kriegte sie das versprochene Kleid noch immer nicht. Sollte sie denn schlechter als andere gekleidet gehen?
Bremm fühlte plötzliches Mißbehagen: seine Maria, sein bestes Kind, sein gutes fleißiges Mädchen kränkte sich so.
Indem kam seine Frau: »Bremm, haste verkauft? Gott sei gedankt, dat ich Schuh für die Jungens kaufen kann – nä?! O Jeses Maria!« Sie war mindestens so unglücklich wie die Tochter, als er »Nein« sagte. Ach, warum hatte er denn nicht verkauft? Gerade war sie im Dorf gewesen, alles was Beine hatte, stand an der Ecke des Gäßchens vorm alten Bremm seinem Haus. Die Leute gafften, als wenn’s da was zu sehen gäbe, sie waren ganz aufgeregt: Der Jakob hatte eben verkauft, alles verkauft, was er noch liegen hatte. Oh, der alte Fuchs, der war schlau! Bis jetzt hatte er immer zurückgehalten, nun da es Millionen, Milliarden, Billionen, noch viel mehr Geld dafür gab, nun schlug er zu. »Und du hast nit verkauft? Ach, Bremm, warum nit?« Die sonst so ruhige Frau geriet außer sich: Wußte er denn nicht, daß sie das Geld brauchten? Bedachte er das denn nicht? Es quälte sie, daß sie den Söhnen keine Schuhe anschaffen konnte und der großen Tochter zur Lese kein Kleid. Die Jungens würden noch barfuß laufen, und die Maria in ihrem alten Kleid sich zeigen müssen. Schickte sich das wohl für die Kinder von einem Winzer, der viertausend Stöcke im Berg hat?
Aber Bremm blieb stiernackig. Er konnte sich nicht zum Verkaufen entschließen, es war ihm, als hielte ihn etwas zurück.
Drittes Kapitel
Die Leseglocke hatte geläutet. Die geschlossenen Weinberge waren jetzt aufgemacht. Langsam ratterten die Fuhren mit den großen Herbstbütten den Weinbergen zu; unter den schwerfälligen Tritten der Kühe spritzten die Schmutzlachen völlig durchweichter Straßen hoch auf. Leser und Leserinnen, meist junge Burschen und Mädchen, rannten den Gespannen voraus, sie rannten so, um sich warm zu machen. Oh, wie war es schon kalt! Tiefes Grau deckte nässend die Erde. Es war kein Herbst, der Lust und Frohsinn weckt, keine Lese wie im Jahr einundzwanzig. Da hatte man schon im Oktober ernten können, ein goldenes Netz von schier sommerlichen Strahlen hatte die Weinstöcke übersponnen und goldene Trauben hingen daran. Den Lesern und Leserinnen hatte die Sonne warm gemacht, sie schien bis ins Herz, die Burschen hatten in Hemdärmeln geschafft, die Mädchen sich immer mehr ausgeschält. Dieses Jahr war es spät geworden, es war ein spätes Frühjahr für den Weinberg gewesen, nun war es November, man hatte die Lese hinausgezögert und hinausgezögert, jetzt konnte man aber nicht länger mehr warten, jetzt mußte man die Trauben schneiden. Sie wurden ja doch nicht mehr reif.
Nach der großen Hitze des Sommers war eine lange Zeit unablässigen Regens gekommen. Ein starkes Gewitter hatte plötzliche Abkühlung gebracht, der keine Erwärmung mehr folgte, nur Regen. Vergebens spähte das sehnende Auge nach einem Stückchen Blau: Ach, wäre das nur so groß, um der heiligen Jungfrau einen Mantel daraus zu machen! Aber der Himmel blieb schwer und dicht wie ein Sack und zog den den Bergen über den Kopf. Auf den Dächern trommelte es, durchs Gäßchen schoß ein Bach und spülte von den Misthaufen mit hinunter. Die Mosel war angeschwollen, auf ihrem bleigrauen Spiegel warfen schwere Tropfen große Blasen auf. Das waren andere Blasen als die weißen Schaumbläs-chen, die einen vorübergehenden Sommerregen ankünden; jetzt »blühte« die Mosel nicht, jetzt zeigte sie den Landregen an. Es rauschte und rauschte fort und fort, den Weinbauer faßte die Angst. Wenn Septemberwochen den Wein nicht kochen, dann wird’s nichts mehr mit dem. Und sie kochten ihn nicht, die Sonne schien für immer verschwunden. Viele hundertmale schaute Simon Bremm nach der Ecke zwischen den Bergen, die gut und schlecht Wetter zeigt – noch blies kein aufstöbernder Wind von dort, der Sack blieb zu.
Jetzt lag schon morgens Reif im Berg. Auf dem Fluß lasteten Nebel; für ein, zwei Stunden am Mittag hoben sie sich, aber zu einem Lächeln brachte die Mosel es nicht mehr, sie blieb verdrießlich. Unerhellt war der Tag, die Luft schwer und naßkalt. Bäume standen und weinten, an jedem Ästchen hingen die Tränen, kein säuselndes Windchen trocknete sie; letzte Blumen, vom erkältenden Hauch der Nacht getroffen, weinten mit um ihre schwarz gewordene, verlorene Schönheit.
Bis an die Nase eingewickelt gingen die Frauen in den Berg; die Männer hatten übereinandergezogen, was sie an Wämsern besaßen. Maria Bremm, ein rotwollenes Tuch um den Kopf gebunden, das Lesebüttchen im Arm, die Traubenschere in den verklammten Fingern, suchte stumm im Berg des Vaters die ihr zugewiesenen Stöcke ab. Bremm hatte sich keine Mädchen aus der Eifel oder dem Hunsrück gedungen, er schaffte es mit den Seinen allein. Auch Frau Anna ging mit. Es war nicht Sitte für Hausfrauen, die blieben zumeist daheim – man backte Kuchen wie bei der Kirmes und frisches Brot – aber ohne viel Worte darüber zu machen, hatte sie sich der Tochter und dem Peter und dem Paul angeschlossen. Als Bremm seine Frau in der Zeile unter sich auftauchen sah, glitt das erste Lächeln an diesem Tag über sein ernstes Gesicht.
Was dem Mann vor zwei Monaten so vielversprechend gedeucht hatte, so hoffnungssicher, das sah ihn heute ganz anders an. Die Trauben hingen wohl noch an den Stöcken, aber sie waren kaum mehr gewachsen; kleine Perlen, grün und hart, so waren sie geblieben. Das wurde ein saurer Wein, kein Wein zum Sichdaranerfreuen – ach, nichts war zum Freuen, ganz unfreudig der Tag, unfreudig das Wetter und das, was noch kam! Sollte es wirklich wahr sein, daß tausend Milliarden nicht mehr wert sein würden als eine Mark? Das war ja nicht möglich! Er glaubte es nicht, und war doch beunruhigt.
In der Volkszeitung stand es wohl. Sonst hatte zur Zeit der Lese kein Mensch etwas anderes gedacht, jetzt beschäftigte die neue Währung doch die Gemüter – sollte sie wirklich kommen? Die Währung wurde fest, und die Millionen, die Billionen –?! Bremm holte tief Atem: Was waren seine Scheine dann noch wert? Gott sei Dank, daß er wenigstens nur ein Fuder verkauft hatte!
Der Mann hatte sich nicht mehr wehren können, Frau und Tochter hatten ihn so bedrängt – Kleid, Schuhe, das hörte er immerfort. Hatte einer den Feiden herbeigerufen? Der fand sich auf einmal wieder ein. Aber, seltsam, als er mit dem Kommissionär in den Keller hinabgestiegen war, den dünnen Schlauch ins Spundloch senkte, um Wein ins Probiergläs-chen hinaufzuziehen, da war es ihm plötzlich, als höre er etwas. Aus dem Faß, aus dem Faß sprach etwas zu ihm. Nicht der Duft allein war es, der zu ihm sprach, er hörte eine Stimme, und er erschrak: »Ist es auch richtig, auf das Reden der Weiber zu hören? Ist es auch klug, daß du jetzt verkaufst? Man weiß nicht, wie´s werden wird mit der Währung – behalt du mich noch!« Gott sei gedankt, gepriesen die Stimme, die ihn warnte! Er hatte das zweite Fuder behalten.
Er dachte an Jakob Bremm. Der hatte alles verkauft. Was würde er nun fluchen und jammern! Ein Mitleid mit dem alten Mann überkam ihn. Wo steckte der eigentlich heute? War er krank vor Kummer? Simon Bremm ließ seine Blicke im Zuckerberg herumgehen: die Raben, die überall schon verscheucht waren, die saßen noch dort, von niemandem gestört, frech auf den Stöcken. Aha, aber jetzt kam der Alte!
Unten auf der Chaussee sah man Jakob Bremm kommen, langsam, den Rücken ein wenig geneigt, es war fast, als kröche er. Vor ihm her schob das Pittchen, der Trottel, der zu keiner Arbeit recht taugte, den Karren, und die Schommer, die Hexe mit den schwarzen Augen, die sonst keiner haben mochte, trabte nebenher. Ein schönes Gespann, das der Ohm Jakob sich da gedungen hatte! Aber die waren billig.
Langsam kroch der Alte in seinen Berg. Doch kaum, daß er in der ersten Zeile seiner Weinstöcke war, wurde er behende, es strömte ihm von hier wie eine neue Kraft. Hastig faßte seine dürre Hand, auf deren Magerkeit die Adern gleich Strängen lagen, nach den Trauben, schloß sich so fest darum, daß die Beeren zerquetschten. Schmatzend schleckte er sich den sauren Saft von den Fingern: ei, wie süß, wie ganz köstlich süß! »Daß du dich nit unterstehst, Trauben zu fressen«, fuhr er den Trottel an. Der hatte bereits probiert und schnitt eine Grimasse.
»Diebsgesindel!« Der Alte hob drohend die Traubenschere.
Das Pittchen grinste, die Raben flogen davon.
Die Schommer murrte schimpfend: wenn sie wo anders hätte ankommen können, würde sie sich gehütet haben, sich hier bei dem alten Geizhals zu verdingen. Nicht einmal ein paar Trauben gönnte einem der! Widerwillig schnitt sie darauf los, ohne Lust, nur darauf bedacht, soviel als möglich zu naschen. Die Trauben schmeckten noch höllisch unreif, ganz grasig, es rumpelte ihr auch schon mächtig im Leib, aber es hungerte sie. In ihrer für die heutige Naßkälte viel zu dünnen Kleidung fror sie erbärmlich, sie schnatterte vor Frost.
Kein lautes Wort, kein fröhlicher Zuruf, kein munteres Lied stieg auf aus des alten Jakob Bremm Zuckerberg. Unheimlich fast in seiner ingrimmigen Schweigsamkeit, klappernd wie der Knochenmann selber, stand er zwischen den Reben und schnitt und schnitt.
In Simon Bremms Weinberg lachte jetzt wenigstens die Maria. Ihre gute Laune war wiedergekehrt, ihrer Jugend machte es nicht viel aus, daß das Wetter naß war und unfreundlich, einer schöner Tag war´s doch. Die Lese war nun einmal zum Freuen da, und so freute sie sich denn, obgleich sie im Grunde nicht recht wußte warum; freute sich über das Krachen der Böller diesseits der Mosel und jenseits, über die vielen Karren, die von und zu dem Weinberge fuhren, über all die Menschen, deren man sonst nie so viele beisammen sah. Oder freute sie sich, daß der Kaspar sie heute abend abholen kam? Am Klosterberg hatten sie schon eher begonnen, die Lese war da weiter voran, in Munden war heute schon Tanzmusik. Wenn sie ihm auch nichts versprochen hatte von dem, was die Mädchen sonst alle dem versprechen, der sie »bei die Muhsik« holt, sie wußte, er holte sie doch.
Sie fing an zu singen. Hell stieg die klare Mädchenstimme in den nebligen Tag und schien dessen niederdrückende Schwere leichter zu machen. Ha, das tat wohl! Aus den benachbarten Rebstöcken fielen noch andere Stimmen jetzt ein, immer mehrere und mehrere fanden sich zu, es hatte nur des Anstoßes bedurft, der einer führenden Stimme:
»O Moselland, o selig Land, Ihr grünen Berge, du Fluß im Tal –«
Simon Bremm lächelte stolz: seine Maria, ja die verstand es, froh zu machen!
Auch Frau Anna lächelte. Aber es war ein wehmütiges Lächeln. Seit Wochen hatte sie gebetet, daß der Joseph heimkehren möge, zuletzt hatte sie alle Nacht von ihm geträumt und ihn jetzt ganz bestimmt erwartet. Zur Lese kommt doch jeder aus der Familie nach Haus, nicht nur, daß man da jetzt jede Hand gut gebrauchen kann, man weiß auch, da gehört man zusammen! Vorige Lese war er noch hier gewesen, obgleich er auch damals schon nicht mehr gut mit dem Vater stand. Der Joseph war dazumal in Cochem gewesen, bei einem, der Gastwirtschaft hatte und Wein verkaufte und einen Schleppkahn hatte auf der Mosel fahren. Es war Bremm ärgerlich, daß der Joseph nicht Weinbauer werden wollte und mit ihm arbeiten in den Bergen .Aber der Joseph hatte ausgespien: »Winzer –?! Pfui Deibel! Nä, so dumm sein ich doch nit!« Darüber hatten sie Händel bekommen. »Faulheit,« schrie Bremm, und »Frechheit!« Ach, daß Bremm sich doch nicht so aufgeregt hätte darüber! Das war ja nicht so bös vom Joseph gemeint gewesen und auch nicht geringschätzig, es war nur dumm. Aber Bremm war gleich das Blut zu Kopf gestiegen, er hatte den Jungen, der dastand, die Hände in den Hosentaschen., wütend angefahren: »Lach nit so dreckig!« »Ich lach ja gar nit.« Aber der Junge hatte doch wohl gelacht, denn der Vater hob die Hand und schlug ihm eins auf den Mund, daß es flatschte. Da hatte der Joseph sich die Kappe aufgestülpt, hatte sich umgedreht und war aus der Tür gegangen.
Seither hatten sie ihn nicht mehr wiedergesehen. Er schrieb auch nicht. Ein paar Monate, fast ein halbes Jahr hielt die Mutter das aus, dann machte sie sich heimlich auf, fuhr nach Cochem. In seiner früheren Stelle war er nicht mehr. »Ein ganz anstelliger Bursch, nicht dumm, aber nicht arbeitsam, faul,« sagte der Prinzipal. O Jesus! Betrübt machte die Mutter die Türe wieder hinter sich zu. Und wo sollte sie ihn nun suchen? Von Beschämung und Unruhe überkommen, stand sie unschlüssig noch vor dem Haus, da streckte ein Küfer den Kopf aus der Kellerluke: »Sucht Ihr den Joseph? Den is nit mehr hier. Den is nach dem Rhein erunter.«
Der Rhein, der Rhein, der war doch nicht aus der Welt, die Mosel floß in den Rhein. Das war nicht zu weit, um zurückzukommen.
Oft, wenn jemand im Dunkeln am Haus vorbeikam, hatte die Mutter aufgehorcht: war das nicht sein Tritt? Er kam sicher nur, wenn alles still war am Abend, wenn er wußte, der Vater war müde vom Weinberg und schlief schon. Er stand vor der Tür, er traute sich noch nicht herein – ach, der arme Jung! Sie hatte beständig großes Mitleid mit ihm. Oh, wie ist das so traurig, wenn ein Kind sein Elternhaus verloren hat! Aber der Joseph hat es ja nicht verloren, sie war doch noch da. Und sie legte es sich zurecht, was für gute Worte sie ihrem Mann geben wollte, was sie tun würde, um die beiden zu versöhnen.
Ach, wenn der Joseph doch heute käm’! Anna Bremm wischte sich über die schwere Stirn und gähnte; vor allem Lauschen war sie heute nacht sehr wenig zum Schlafen gekommen. Ihr wehmütiges Lächeln war verschwunden, ihre Miene wie immer gelassen, scheinbar unbewegt, aber tief in ihren Augen saß Trauer. Und sie fühlte sich müde. Trotzdem war es ihr lieber, mit hier draußen zu sein – nur nicht so allein zu Haus! So sah sie, wie emsig der Peter und der Paul ihre Stöcke absuchten. Die beiden würden ganz recht, sagte Bremm – aber wer konnte das für gewiß sagen? Steckt man in seinen Kindern drin? Ach, man sollte lieber nicht so viele Kinder haben! Es war eine große Unsicherheit in der Frau.
Maria kam gesprungen, das blasse Gesicht der Mutter mochte ihr auffallen: »Bist arg müd?« Sie nahm der Mutter das Traubenbüttchen ab und leerte es in den Beschof, den sie sich aufgehuckt hatte. Sie trug den jetzt herunter zum großen Traubenbottich auf dem Karren; leichtfüßig und aufrecht, als spüre sie die Last auf ihrem Rücken gar nicht, lief sie die steilen Treppchen und den noch schwerer zu gehenden, durch die Nässe glitschigen Pfad hinab.
Vom Zuckerberg her plötzlich lautes Geschrei. Die Schommer war ausgerutscht beim Heruntertragen. Sie war zwar zu sitzen gekommen, aber blitzschnell sauste sie abwärts wie auf der Rodelbahn, mit dem Hinterteil den glatten Schiefer scheuernd. Aus ihrer Hotte schwuppte es – Trauben zerplatzten – schreiend und strampelnd suchte sie irgendwo anzuhalten. Zuletzt gab sie’s auf; nun rollte sie vollends das letzte Stück.
Ei, war das schade, daß es keine Hübschere war! Eine ganz Junge! Da hätte man andere Waden zu sehen gekriegt und rundere Knie, als die mageren nackten, die sich über den zu kurzen, mit alten Leinenbändeln umwundenen blauen Strümpfen zeigten. Ein paar Witzbolde versuchten ihren Witz, die Mädchen kicherten und versteckten ihre Gesichter.
Die Schommer, nicht faul, war gleich wieder auf den Beinen. Oh, sie hatte sich gar nichts getan, man muß einen Puff vertragen können! Sie lachte selber am allermeisten.
Jetzt war überall Lachen. Die allgemein etwas gedrückte Stimmung hatte sich vollends gehoben. Man hatte schon so vieles überstanden: Krieg, Besatzung, Inflation, was jetzt noch kam, konnte nicht halb so schlimm mehr sein. Eine Wolke hatte überm Weinberg gehangen, das Lachen hatte sie fortgescheucht. Ha, war das komisch gewesen, urkomisch! Zum Totlachen war’s.
Als der alte Bremm zu schimpfen anfangen wollte, wurde ihm von allen Seiten Ruhe geboten. Was, schimpfen wollte der noch? Froh sollte er sein, daß die Schommer sich nichts getan hatte bei der Rutschpartie, da hätte er schöne Kurkosten zahlen müssen. Aber freilich, er konnte das ja, er war reich, er hatte seinen Wein ja so gut verkauft! Wieder hob lautes Gelächter an.
Simon Bremm lachte nicht mit, er sah nach dem Alten hin und fühlte, etwas Grausames war in diesem Lachen. Aber der Jakob tat, als höre er und sähe er nicht mehr.
Die Kinder, die mit in den Berg gekommen waren, sich da unnütz aufführten, machten’s der Schommer nach. Sie rutschten unter lautem Gekreisch die Steile hinab; andere haschten sich zwischen den Stöcken. Waren sie hier fortgejagt, tauchten sie dort wieder auf. Als sei der trübgraue säuerliche Traubensaft, den sie naschten, schon goldklarer süßer Wein, so gebärdeten sie sich. Sie torkelten, schrien, kreischten, fielen übereinander und lachten unbändig.
Ob gute oder schlechte Ernte, so war’s bei der Lese eigentlich immer – allerlei Späße und Neckereien, verstohlene Küsse hinter schützenden Rebwänden, und Hoffnungen, die, wie die Beeren der Traube am Weinstock, am Himmel der Zukunft hängen. Wem so oft die Krankheit, die das Blatt versehrt, die Traube vertrocknen oder verschimmeln läßt, in den Weinberg gekrochen ist, wem allezeit Frost, Hagel, Bergrutsch über den Hals kommen können, der ist bescheiden. –
Als Simon Bremm in schwarzsinkender Nacht mit seinen beiden Jungen den Traubenbottich in den Kelterraum schaffte, war er für heute zufrieden. Da hörte er plötzlich vom Haus her einen lauten Aufschrei. Er erschrak: Was war? Die Frau war allein, die Maria nach Munden, die Kleinen schliefen – war etwas passiert? Er rannte ins Haus. Da stand seine Frau in der Küche und hielt ein Mannsbild umschlungen.
Der Joseph! Hastig fuhr der Vater zurück. Dann tat er doch ein paar Schritte nach vorn. Das hatte er nicht erwartet, daß der Junge kam, aber da er nun einmal da war, sollte er auch ihm willkommen sein. Was vordem gewesen war, mochte vergessen sein heute. Er sprach: »Guten Abend!«
Der Joseph, sich von der Mutter los machend, sagte auch: »‘n Abend.« Er war gar nicht verlegen, weniger verlegen als der Vater es war.