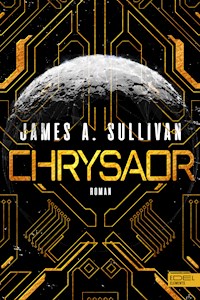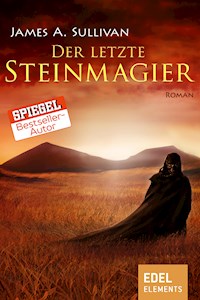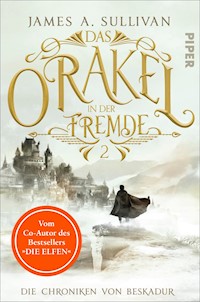9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Cosima Amberson und John A. Glennscaul sind erbitterte Konkurrenten. Im Kampf um Macht und Geld schrecken die intergalaktischen Konzernbosse vor nichts zurück. Doch nachdem die beiden zwei Jahre lang gemeinsam auf einem defekten Raumfrachter festhingen, müssen sie zusammenarbeiten, um ihre Imperien wieder zu Stärke zu führen und ihre zahlreichen Feinde in die Schranken zu weisen. Der Diebstahl eines KI-Moduls könnte ihre Probleme lösen – aber ihre Verfolger sind so gerissen und skrupellos wie Cosima und John selbst. Eine wilde Jagd durch den Weltraum beginnt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
ISBN 978-3-492-97883-5© Piper Verlag GmbH, München 2017Covergestaltung: Guter Punkt, MünchenCovermotiv: Stephanie Gauger, Guter Punkt, unter Verwendung von Motiven von thinkstock und shutterstockDatenkonvertierung: Fotosatz Amann GmbH & Co. KGSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalt
Cover & Impressum
Zitat
Amberson & Glennscaul
Manderton
Zu Gast auf der INANNA
Chimaira & Triptycian
Geöffnete Tore
Mikro-KI
Komplizen
Auf der Flucht
Pandaros-3
Heimkehr
Auf alten Spuren
Von Freunden und Feinden
Zuflucht
Ganz unten
Inanna
Die Crew
Von Begegnungen und Plänen
Arandis
Der Anfang einer Operation
Noboru-14
Das Ende einer Operation
Das Geständnis
Neutraler Boden
Eine Frage des Weges
»Mit einem Schwarm Nanomaschinen sank ich in die Tiefe und fand dort im Kleinsten die Vergangenheit geschrieben. Als Beobachter reiste ich zurück in der Zeit – durch die Sinne und Gedanken der Menschen schwebend.
Mal war ich beim einen zu Gast, mal beim anderen, und fließend vermochte ich zwischen ihnen zu wechseln. So fand ich sie – die Granden von Pandaros-3.«
(Die KI Chrysaor im Jahr 2495)
Amberson & Glennscaul
In der zentralen Halle des automatisierten Raumfrachters VANYA-17 standen Cosima Amberson und John Glennscaul einander vom Kampf gezeichnet gegenüber und machten sich schwer atmend ein weiteres Mal bereit, aufeinander loszugehen. Das ganze Schiff war ihre Arena gewesen, und seit Cosimas Lasergewehr überhitzt war und John keine Munition mehr für seine Pistole hatte, kämpften sie mit bloßen Händen gegeneinander. Weder das Feuer, das um sich griff und dessen Flammen an einer Stelle bereits die Wand emporkrochen, noch die Explosionen, die das Schiff immer wieder erschütterten, würden sie dazu bringen, den Kampf abzubrechen.
Während Cosimas Crew lauthals damit drohte, sich ohne sie zurückzuziehen, falls sie nicht endlich zur Vernunft käme und einsähe, dass ein Ausharren auf dem umkämpften Frachter den sicheren Tod bedeutete, bettelten Johns Leute geradezu darum, den Kampf auf einen anderen Tag zu verschieben. Statt jedoch auf die Zeichen der Zerstörung zu reagieren und auf die Worte ihrer Leute zu hören, bewegten sich Cosima und John wie hungrige Raubkatzen aufeinander zu.
Verächtlich lächelnd breitete Cosima die Arme aus und lockte John. Er holte zu einem schnellen Schlag aus, verfehlte sie aber, und schon war ihre Faust in seinem Gesicht. Unwillkürlich drehte er sich um; nach einem Tritt in die Kniekehlen knickte er ein, und kaum war er zu Boden gegangen, war sie über ihm und drückte ihm mit aller Gewalt die Kehle zu.
John schüttelte sich und schaute hoch in Cosimas glänzendes Gesicht. Ihre Wangen waren so rot, dass sie das Braun ihrer Haut übertünchten. Sie machte sich groß, um ihre langen Arme auszuspielen, doch seine waren nicht minder lang. So drückten sie sich gegenseitig die Luft ab, während die Stimmen um sie herum verstummten und nur das andauernde Warnsignal des Frachters erschallte.
Nein, John würde sich nicht von ihr brechen lassen – und Cosima würde sich nicht von ihm brechen lassen. Beide hatten immer wieder bewiesen, dass sie selbst die schlimmsten Niederlagen einsteckten, um dann mit umso größerer Macht zurückzuschlagen. Doch wie sie einander nun in die blutunterlaufenen Augen schauten, überkam John die Verzweiflung, während sich in Cosima die Gewissheit festsetzte, dass ihr Feind unterliegen würde. Er hatte jetzt schon verloren. War er eben noch blass gewesen, hatte er nun einen roten Kopf. Sie durfte nur nicht nachlassen, dann hätte sie ihn.
John war bereit aufzugeben. Die Erinnerung an ihre Anfänge und ihren Aufstieg – die Erinnerung an eine Zeit, in der das, was gerade geschah, undenkbar gewesen wäre – trieb ihn ebenso dazu wie ein altes Schuldgefühl. Cosimas anklagender Blick konnte nur bedeuten, dass es auch ihr um den Tod Nerina Bohligs ging – einen Tod, den er nicht hatte verhindern können und für den er sich trotz allem, was geschehen war, verantwortlich fühlte. Mit diesem nun freigelegten Schuldgefühl im Kopf konnte er sich nicht dazu durchringen, sie zu töten. Im gegenseitigen Würgegriff hatten sie stumm ihre Taten gegeneinander abgewogen, und er war der Unterlegene gewesen.
John wollte ihr sagen, warum er nun nachgeben würde, doch Cosima ließ mit ihrem Griff nicht mehr als ein Röcheln zu. Und er ahnte nicht, dass sie in diesem Augenblick überhaupt nicht an Nerina dachte. John hatte sich ihr einmal zu oft in den Weg gestellt. Er hatte sie durch die Niederlagen, in die er sie gezwungen hatte, gedemütigt und ihr zu viele liebgewonnene Menschen genommen. Nun stellte er das einzige Hindernis auf dem Weg an die Spitze dar. Es gab kein Zurück mehr. Die Explosionen, die das Schiff erbeben ließen, würden sie ebenso wenig von ihrem Ziel abbringen wie die Hitze der Flammen, die ihren Rücken emporkroch.
Fort, nur fort hier, dachte John. Er ließ von Cosimas Hals ab und versuchte sie von sich zu stoßen, doch Cosima blieb unerbittlich. Gleich wäre es so weit; gleich würde sie das Leben aus ihm herausquetschen.
Mit einem Mal überkam Cosima ein Hustenreiz. Diese Chance nutzte John, versetzte ihr einen klatschenden Schlag ins Gesicht und stieß sie mit einem wuchtigen Tritt von sich.
Cosima prallte gegen die kupferfarbene Wand. Sie wandte sich sofort wieder John zu und wollte erneut auf ihn losgehen, aber die Art, wie er dort gebückt auf allen vieren hustete, erinnerte sie an etwas. Zuerst wusste sie nicht, was es war, doch als er den Kopf drehte und zu ihr herüberschaute, war es, als wäre sie wieder daheim auf der Raumstation Pandaros-3 beim Jupiter. Dort hatte sie John vor anderthalb Jahrzehnten, im Frühjahr 2299, im Club Galactic Requiem am Boden gesehen, niedergeprügelt von drei Schlägern aus ihrem Schattenkonzern – nur weil er es gewagt hatte, mit ihr zu reden. Damals war sie noch weit davon entfernt gewesen, die Grande von Amberson Unbound zu sein. Die Schläger hatten nur einen Vorwand gesucht, um gegen John vorzugehen; immerhin war er der Neffe des damaligen Granden von Glennscaul Unlimited. Wäre sie nicht eingeschritten, hätten sie ihn vielleicht sogar getötet. Und sie fragte sich, was Johns Tod damals zur Folge gehabt hätte. Allein der Gedanke daran machte ihr Angst.
Neben Cosima schlugen Flammen aus dem Gang, aus dem sie mit ihren Leuten gekommen war, und der Gestank von verbrannten Kabeln stieg ihr in die Nase. Sie schaute sich um, doch außer den Toten, deren Anblick ihr einen Schauer durch den Körper trieb, konnte sie keinen ihrer Leute sehen. Sie hatten tatsächlich das Weite gesucht.
John erhob sich taumelnd und sprach nach Luft ringend in den runden Patch-Computer, der an seiner linken Handfläche haftete: »Meldet euch!«
»Haben sie dich sitzen lassen?«, fragte Cosima und lachte und hustete. Mit einem Schlag war die Angst verflogen, die sie eben noch verspürt hatte. Aber die Mordlust war ebenso verschwunden. Dafür traten die Schmerzen hervor: Ihr Kiefer pochte, ihre Fäuste waren blutig geschlagen, und ihr Hals brannte – besonders auf der rechten Seite, wo die Kante von Johns Patch in ihre Haut geschnitten hatte.
»Ja, meine Teuerste«, erwiderte John und hustete abermals. Die Rauchschwaden krochen bereits über die Decke. »Deine haben dich aber auch im Stich gelassen.« In seinem Hals spürte er einen Druck, als würde Cosima ihn noch immer würgen.
»Das würden sie nie tun«, erwiderte Cosima. »Deine melden sich nicht, weil meine sie erledigt haben.«
John musste lachen. »Hier ist niemand mehr.« Der Gestank von verbranntem Kunststoff stieg ihm in die Nase und ließ ihn niesen. Er wischte sich über die Stirn, und ein starker Schmerz zog sich von der Augenbraue bis zur Wange.
Cosima tippte auf den tränenförmigen Patch auf dem Rücken ihrer linken Hand. Trotz des heftigen Schlags, den sie John damit versetzt hatte, war der Computer unversehrt und baute seinen transparenten Bildschirm flackernd auf. Sie ließ ihre Fingerspitzen über dessen warme Oberfläche gleiten. Tatsächlich kam keine Verbindung zustande. Die Scanner verrieten, dass keiner ihrer Leute und keines ihrer Schiffe in der Nähe war.
»Du bekommst deinen Wunsch, Schätzchen«, sagte John. Für seine eigenen Ohren klang er zu souverän. Sie hatte sie gesehen – seine Verzweiflung. Sie hatte gemerkt, dass er im Grunde aufgegeben hatte. »Du hast versucht, mich zu töten. Und nun werde ich sterben. Aber mein Tod ist auch dein Ende.«
»Ich habe nicht vor zu sterben«, erwiderte Cosima. »So wichtig bist du mir auch wieder nicht, John.« Leichtfüßig lief sie auf einen Gang zu, in dem das Feuer noch nicht wütete, drehte sich dann aber noch einmal zu ihm um. »Ich habe es bemerkt, John!«, rief sie. »Dass du schwach geworden bist; dass du es nicht bis zum Ende durchziehen konntest. Ich habe es bemerkt!« Sie rief es ihm entgegen, fürchtete aber zugleich, dass er seinerseits ihr Zögern gesehen und ihre Angst erkannt hatte. Als er nicht reagierte und sie einfach gehen ließ, war sie erleichtert.
John schaute ihr nach. Dass ihr seine Schwäche aufgefallen war, machte die Lage schlimmer als jeder andere Verlust dieses Tages. Selbst die Toten, die hier lagen und von denen er die meisten kannte, gingen ihm nicht so nahe wie die Worte seiner Feindin. Er wäre lieber durch ihre Hand gestorben, als im Schatten ihres Triumphes weiterzuleben.
Ein Schmerz in der Brust ließ ihn nach seinem Glücksbringer tasten, den er unter dem Hemd an einer leichten Halskette trug. Einer von Cosimas Tritten musste die kleine Kugel, die früher einmal Teil eines wertvollen Schlüsselmoduls gewesen war, gegen Johns Brustbein gepresst haben. Lächelnd zog er die graue Kugel an der Kette hervor. Er mochte es, wie das kleine Computermodul, das im Grunde wertlos war, in seiner Hand lag.
Er schaute sich um. Ein Tod hier, von Flammen umgeben – das war nicht nach seinem Geschmack. Die Schmerzen rüttelten nun zwar seinen Lebenswillen wach, änderten aber nichts an dem Gefühl, eine schwere Niederlage erlitten zu haben. Er hatte die Chance, Cosima zu erledigen, nicht genutzt. Und dafür hasste er sich. Der Augenblick der Schwäche beruhte darauf, dass er einst das Leben von Nerina Bohlig nicht hatte retten können. Sie war Cosimas Vertraute gewesen und hatte mit ihm über das Ende der Fehde verhandelt, die sich zwischen Amberson Unbound und Glennscaul Unlimited entwickelt hatte. Sie waren zu einer Einigung gekommen – Nerina im Namen Cosimas, John stellvertretend für seinen Onkel, Ward Glennscaul, der damals der Grande des Schattenkonzerns gewesen war. Dann hatte sein Onkel Nerina umgebracht, und John hatte es nicht verhindern können.
Während John in den Gang, den er gekommen war, zurückkehrte, fand Cosima nach einem Umweg abseits des mit Gravitationspanels ausgestatteten Bereichs zu der Schleuse zurück, an der sie mit ihren Leuten angedockt hatte. Doch die Fähre war fort. Ihre Leute hatten sie tatsächlich im Stich gelassen. Eine Explosion und eine Stichflamme in einem Seitengang brachten Cosima ins Taumeln. Sie stützte sich an der Wand ab und versuchte erneut, über ihren Patch Verbindung zu ihren Leuten aufzunehmen. Ihre Signale liefen ins Leere.
Auf der Flucht vor dem Feuer und der Suche nach einer Rettungskapsel fand Cosima auf einer Kreuzung ein Kommunikationspanel. Schon die roten Anzeigen auf der runden Fläche machten deutlich, dass es Probleme gab. Sie versuchte auch hier, eine Verbindung nach draußen zu etablieren, indem sie ihre Signale über das Com-System der VANYA-17 leitete. Doch auch auf diesem Wege konnte sie keinen Kontakt zu ihren Leuten aufnehmen.
Die blinkende Anzeige zur Luftqualität bereitete ihr Sorgen. Der Sauerstoffgehalt war gerade von siebzehn auf sechzehn Prozent gesunken, und die Löschsysteme waren für weite Teile des Schiffes gestört. Der Wohnbereich im Herzen des Frachters war aber unversehrt.
Nachdem das Panel ihren Befehl, die Schutztore zwischen den Bereichen zu schließen, zurückgewiesen hatte, machte Cosima sich auf die Suche nach der Kommandozentrale. Von dort aus konnte sie das Schiff vielleicht vor der Zerstörung bewahren – nur so lange, bis ihre Leute sie holten.
Noch ehe sie den Fuß in die Zentrale setzte, vernahm sie ein Fluchen. »Verdammte Scheiße!«, rief eine vertraute Stimme. John Alfred Glennscaul war ihr zuvorgekommen. Kaum hatte er Cosima erblickt, verzog er die Miene und schüttelte den Kopf. »Du bist also noch hier.«
Cosima lehnte sich gegen den Türrahmen und musterte John. Seine linke Gesichtshälfte war ein wenig geschwollen, besonders am geröteten Wangenknochen. Eine kleine Wunde über der Augenbraue blutete. Er strich immer wieder mit den Fingerspitzen darüber und wischte sich diese dann an seinem bereits blutigen Hemd ab. Seine Jacke, die an vielen Stellen aufgerissen war, lag auf der Konsole. »Hast du von hier aus dafür gesorgt, dass ich nicht entkommen kann?«, fragte sie ihn.
»Leider nicht«, entgegnete er. »Unsere Leute sind abgehauen.« John wies auf einen der Schirme, der die Bilder einiger Außenkameras wiedergab. Da bewegten sich Schiffe von einem Trümmerfeld fort. »Du kannst Freund und Feind kaum unterscheiden. Die wollen nur noch weg.« John fielen die Kratzer an Cosimas Hals und an ihrer Stirn auf. Als er ihre blutigen Handrücken sah, ahnte er, wie sein Gesicht aussehen musste.
»Wie ist unsere Position?«, fragte Cosima.
John konnte keine Daten finden; sie wurden einfach nicht angezeigt. »Keine Ahnung«, sagte er, fand dann aber immerhin einige Statusinformationen unter den Warnmeldungen. »Wir haben keine Peilung zum Flugkorridor«, erklärte er. »Die Hälfte aller Systeme ist ausgefallen.«
»Dann ist das wirklich unser Ende?«, fragte Cosima und überlegte, ob sie John angreifen sollte.
John strich sich über die unrasierten Wangen und stöhnte leise, als er dem linken Wangenknochen zu nahe kam. Schließlich sagte er: »Ich kann damit leben … ich meine: sterben.«
»Kann ich irgendwas tun, um zu überleben, nachdem ich dich umgebracht habe?«, fragte Cosima.
John lachte. »Wir müssen nur das Feuer löschen und die Steuersysteme zum Laufen kriegen.«
»Schließ die Tore!«
»Die Verbindung ist unterbrochen, sogar das Sauerstoffsystem ist blockiert. Wir werden also elend verrecken.«
»Dummkopf! Stubenhocker!«, erwiderte Cosima. »Wir müssen da raus und die Türen per Hand schließen.«
»Und der Sauerstoff?«
»Keine Ahnung. Aber was wir gerade machen, beunruhigt mich.«
»Was?«
»Dass wir offenbar zusammenarbeiten.«
John grinste. »Mach dir keine Sorgen. Wenn wir alles gesichert haben, können wir uns immer noch die Köpfe einschlagen.«
»Klingt vielversprechend«, sagte Cosima und strich sich das lange Haar zurück.
John lächelte. »Ich habe eine Idee.«
»Hoffentlich mal zur Abwechslung eine gute.«
John drohte Cosima mit dem Finger. »Du weißt nicht, wann du den Mund halten musst!«
»Deine Idee, bitte!«
»Die Sauerstoffanlage kann so eingestellt werden, dass sie nur die Räume versorgt, die ans System angrenzen. Wir können dann Räume und Gänge benutzen, um den Sauerstoff zu leiten.«
Cosima nickte. »Klingt gut. Und die Wasserversorgung?«
»Das System ist hinüber. Es gibt aber ein Alternativsystem, allerdings kriege ich keine Verbindung. Wir müssen tatsächlich da runter und es per Hand starten. Und das alte müssen wir dann ausschalten.«
»Ich den Sauerstoff? Du das Wasser?«
John nickte nur.
Sie verließen das Kontrollzentrum, musterten einander schweigend und trennten sich. Unterwegs plagten sie ähnliche Gedanken. Sie fragten sich beide, wie es so weit hatte kommen können. Cosima erinnerte sich an die Zeit in den Clubs von Pandaros-3, als sie Teenager gewesen waren und alles anders hatten machen wollen als die Alteingesessenen. Cosima wollte als letzte Erbin der Ambersons, dass endlich wieder ein Familienmitglied die Geschicke des Schattenkonzerns lenkte, während John ihr damals offenbart hatte, dass er gerne an seines Onkels Stelle der Grande von Glennscaul Unlimited gewesen wäre, um den Dingen eine andere Richtung zu geben.
John dachte auf seinem Weg durch die Gänge an die Zeit, als sie tatsächlich die Gelegenheit gehabt hatten, ihre Träume wahr zu machen. Damals hatten er und Cosima den Krieg zwischen ihren Schattenkonzernen für ihren Aufstieg genutzt. Sie schalteten Widersacher und Rivalen in den eigenen Reihen dadurch aus, dass sie die Gegenseite auf sie ansetzten. Wenn Cosima ihre Rivalen nicht loswurde, sorgte John dafür, dass diese ihr fortan nicht mehr im Wege standen. Eine Demütigung, eine schmachvolle Niederlage oder das Offenlegen eines Geheimnisses reichte manchmal bereits aus. Oft konstruierten sie aber etwas, das denjenigen, der ihrem Aufstieg im Wege stand, ins Gefängnis oder in eine andere Art der Bedrängnis brachte. In seltenen Fällen war Gewalt im Spiel. Cosima tat das Gleiche für John. Und wenn einmal die Spuren verfolgt wurden, wiesen sie nur auf die Seite des Feindes.
Damals hatten sie einander aus Schwierigkeiten herausgeholfen, und als Cosima endlich an die Spitze von Amberson Unbound gelangt war, wollte John, dass sie seinen Onkel Ward aus dem Weg schaffte, damit er seinerseits zum Granden aufstieg und sie den Schattenkrieg nach einer letzten Eskalation beendeten. John hatte Ward gehasst. Er hatte vermutet, dass er hinter dem Bombenanschlag steckte, der unter anderem seinen Vater aus dem Leben gerissen hatte. Wie sich erst nach Wards Tod herausstellte, war das ein Irrtum gewesen.
Während John auf dem Weg zum Wassersystem dem Feuer die Türen verschloss und in den Bereich vordrang, in dem keine Gravitationspanels verbaut waren und so die Schwerelosigkeit herrschte, erinnerte er sich, wie frustriert er gewesen war, als Cosima seine Bitte, seinen Onkel auszuschalten, abgelehnt hatte. Sie wollte den Krieg nicht weiter anstacheln und hatte Zweifel, ob er sich beenden ließe, falls sie seinen Onkel aus dem Weg schaffte. Zuerst wollte sie mit Ward verhandeln und alle Möglichkeiten ausschöpfen, ehe sie gegen ihn vorging. John hatte in der Gewissheit zugestimmt, dass sein Onkel sich niemals auf Verhandlungen einlassen würde.
Zu seiner Überraschung war Ward zu Gesprächen bereit gewesen. Was dann geschehen war, hatte vielversprechend begonnen, verwandelte sich dann aber in einen Albtraum. Sein Onkel hatte sein wahres Gesicht gezeigt. Er hatte Nerina Bohlig mit seinen Leibwächtern und seinen engsten Vertrauten entführt, vergewaltigt und getötet.
Die Nacht, in der es geschehen war, würde John nie vergessen. Er war zu spät vor Ort gewesen, um den Albtraum zu verhindern. Er konnte nur noch seiner Verzweiflung und seiner Wut freien Lauf lassen. Er hatte sie alle getötet – bis auf seinen Onkel. Noch heute wusste John nicht, warum er Ward nicht einfach erschossen hatte. Er konnte sich nicht erklären, wie er Nerina in die toten Augen hatte schauen können, ohne dann vom Schmerz überwältigt seinem Onkel ein Loch in den Kopf zu brennen. Stattdessen hatte er Cosima angerufen und Ward mit einem Medi-Patch am Leben gehalten, bis sie da war. Die Trauer hatte Cosima erst niedergeworfen. Sie hatte über Nerinas Leiche geweint und sie schluchzend an sich gedrückt. Schließlich aber hatte sie sich voller Hass erhoben und war über Ward hergefallen wie eine Tigerin über ihre Beute. Als sie sich mit blutigen Händen von Wards Leiche abgewandt hatte, war sie an John herangetreten, hatte ihn mit verzweifelter Miene angeschaut und mit zitternder Stimme gedankt.
Die Verantwortung für die Toten hatten sie unter sich aufgeteilt, indem sie im Untergrund verbreitet hatten, dass Johns Onkel Nerinas Mörder war und Cosima ihn und seine Vertrauten daraufhin aus Rache getötet hatte.
So war John damals an die Spitze von Glennscaul Unlimited gelangt, und Cosima und er hatten, um den eigenen Leuten das zu geben, wonach sie verlangten, den Schattenkrieg fortgeführt. Was ein Schaukampf mit einem inszenierten Ende hätte sein sollen, hatte sich Schritt für Schritt zu einer echten Feindschaft entwickelt. Mit jedem Toten und durch den Rat der Alteingesessenen auf beiden Seiten geschürt, konnte der Hass zwischen ihnen wuchern und hatte hier auf der VANYA-17 seinen Höhepunkt gefunden.
Johns Schwebeflug durch die Korridore kam zu einem Ende. Die künstlich erzeugte Gravitation nahm mit der Annäherung an die Tür zu. Das sollte den Übergang erleichtern. Dennoch geriet John aus dem Gleichgewicht; fluchend stützte er sich an der Wand ab und öffnete die Tür zum Kontrollbereich der Wasseranlage. Auf der weiten Konfigurationsfläche waren das Standardsystem und das Notsystem in einer Übersicht angeordnet. Die roten Flecken auf der Darstellung des Standardsystems zeigten den Schaden ebenso an wie die blinkende Verbindung zu den Hauptleitungen. Zu Johns Erleichterung schien das Notsystem unbeschädigt zu sein. Er strich mit den Fingerspitzen über das Display vor ihm, das eine kleine Reproduktion der Anzeige auf dem Hauptschirm war. Er tippte auf das Symbol des Notsystems, das sofort eine Verbindung zum Wasserleitsystem aufbaute, während die Darstellung des Standardsystems mit all dessen Verknüpfungen verblasste.
Da kam John ein Einfall. Er wollte nicht noch einmal gegen Cosima kämpfen, war sich aber sicher, dass sie auf ihn losgehen würde, sobald sich die Lage auf dem Schiff stabilisiert hatte. Vielleicht würde sie sogar versuchen, ihn zu töten, während er schlief. Deswegen brauchte er ein Druckmittel. So tippte er den Patch-Computer an, der an seiner linken Handfläche haftete, und stellte eine Verbindung zum Wassersystem her. Mit einem seiner Spezialprogramme, das er sonst zur Sabotage verwendete, brachte er die Wasseranlage unter seine Kontrolle und beschränkte den Zugang darauf. Er konfigurierte das System so um, dass die Versorgung nach einem Tag abbrach. Nur zur Demonstration. Sollten sie länger bleiben, würde er die Zeitspanne vergrößern.
John ahnte nicht, dass zur gleichen Zeit Cosima eine Bombe durch die Schwerelosigkeit schob. Sie hatte sie bei der Leiche von Elmer, einem ihrer Waffenexperten, gefunden und bei wieder ansteigender Gravitation nun beinahe fallen lassen. Sie platzierte sie vorsichtig am Sauerstoffsystem und schützte den Zugriff auf sie durch einige der Sicherheitsprogramme, die auf ihrem Patch gespeichert waren. Wenn sie die Bombe nicht innerhalb von drei Tagen entschärfte, würde sie detonieren. Und John und sie würden ersticken. Das war ihre Versicherung gegen irgendwelche Attacken von John.
Zufrieden verließ sie die Sauerstoffanlage und genoss auf dem Rückweg das Schweben durch die Schwerelosigkeit.
Als Cosima längst wieder festen Boden unter den Füßen hatte und auf die Brücke kam, war John bereits dort.
»Und?«, fragte er. »Hat’s geklappt?«
»Alles in Ordnung«, erwiderte sie.
»Die Feuer werden ersticken.« Auf den Schirm hatte John den Lageplan gelegt. Die Warnsysteme arbeiteten immer noch gut und zeigten die Ausfälle und die Feuer an. Weite Teile des Schiffes waren nicht mehr zugänglich, weil der Bordcomputer sie hatte abriegeln müssen, nachdem er die lang gezogene Bresche in der Bordwand registriert hatte. Bei Feuer schlossen sich lediglich die einfachen Zwischentüren, die man per Hand öffnen konnte, um zu entkommen. »Wir müssen sehen, was noch zu retten ist.«
»Ich habe unterwegs Raumanzüge gesehen«, sagte Cosima. »Mit allem Drum und Dran. Damit könnten wir gegen das Feuer vorgehen. Jedes Stück Ausrüstung, das überlebt, kann wichtig sein.«
»Gut«, sagte John. »Und damit es klar ist: Mit dem Töten ist es vorbei. Ich habe beschlossen, dass wir das auf später vertagen – nachdem wir gerettet worden sind.«
»Was sollte mich daran hindern, dich zu erledigen, John?«
»Auf dem Wassersystem liegt ein Code. Ohne meine Freigabe wird das Wasser morgen abgestellt, und wir sind erledigt.«
»Glaubst du nicht, dass hier irgendwo ein paar Getränke gelagert werden?«
John lachte. »Ich dachte nicht daran, dass du zugrunde gehst, weil es keine Cocktails mehr gibt, Cosima. Das Sauerstoffsystem braucht unter anderem Wasser, damit es läuft. Und das Modul ist nicht unabhängig. Ohne das Wassersystem kein Sauerstoff.«
»Das trifft sich gut, John. Denn ich habe das Sauerstoffsystem mit einer Bombe versehen. Entschärfe ich die nicht, ersticken wir. Oder anders gesagt: Sollte ich tot sein, wird es auch dein Tod, mein lieber Mr. Glennscaul.«
***
Nachdem Cosima und John sich Medi-Patches auf ihre Wunden geheftet hatten, machten sie sich an die Arbeit. In den Raumanzügen, die Cosima entdeckt hatte, löschten sie schwitzend über Stunden hinweg Brände. Als sie der Erschöpfung nahe waren, zogen sie sich zurück, und keiner von beiden hätte sagen können, wer dabei die Initiative ergriffen hatte. Aber sie waren beide froh, dass sie nun endlich eine Pause bekamen. Nicht mehr in den Anzügen mit ihren haftenden Stiefeln in der Schwerelosigkeit zu operieren, sondern sich hier im Wohnbereich bei gewohnter Gravitation niederzulassen und frische Luft zu atmen, ließ sie hoffen, dass sie die Zeit an Bord der VANYA-17 unbeschadet überstehen würden.
Sie wussten zwar, dass nun die Bereiche, in denen sie nicht gelöscht hatten, vermutlich verloren waren – mit allem, was sich darin befand. Aber sie hatten den größten Teil der Frachtcontainer gerettet.
Wie die meisten automatisierten Frachter war auch die VANYA-17 zusätzlich für eine Besatzung ausgelegt. Der Wohnbereich war jedoch unberührt; es hatte auf diesem Flug keine Crew gegeben. Das Schiff war auf Autopilot unterwegs und wäre an seinem Bestimmungsort, dem Mars, von dem Leitsystem oder einer Künstlichen Intelligenz übernommen worden, um sicher dort zu landen.
Cosima wäre gerne im Kapitänsquartier untergekommen, aber dieses befand sich ebenso wie die Passagierquartiere in einem Bereich unterhalb der Brücke, der den Flammen erlegen war. Die Einrichtung war zerstört, allem voran die Gravitationspanels.
Das Wohnquartier, in dem sie sich befanden, war für das Arbeitspersonal gedacht. Die Zimmer waren schmale Schlafräume, und der Wohnbereich im Zentrum machte klar, dass hier eine Crew leben sollte, die eine unzertrennliche Gemeinschaft bildete. Dass mit ihnen hier nun zwei unzertrennliche Feinde einkehrten, brachte Cosima zum Grinsen und John zum Kopfschütteln.
Sie fanden Kleidung, von der die adaptive Unterwäsche noch die modischste war. Graue Overalls, Hosen, hellgraue Shirts, schwere Gürtel und schwere Schuhe. Dass es Arbeitskleidung war, störte sie nicht.
Cosima entdeckte die Großraumdusche und nutzte sie sofort. Sie löste die Medi-Patches bereits wieder von ihrem Körper, weil sie ihr lästig waren und sie lieber mit einigen roten und blauen Flecken zurechtkam.
Inzwischen prüfte John die Vorräte auf dem Schirm im Essbereich. Sie verfügten über genug Nahrung, und die Kochmodule waren einsatzbereit.
Als Cosima zurückkehrte und John anstarrte, während sie sich das Haar mit einem Handtuch abtrocknete, starrte er zurück, aber keiner von beiden sprach ein Wort. Sie dachten an ihre Vergangenheit und fragten sich ein weiteres Mal, wie es so weit hatte kommen können.
Nachdem John seinerseits geduscht und sich von den Medi-Patches befreit hatte, ließen sie sich von einem der Kochmodule dicke Nudeln mit süßsaurer Soße zubereiten und ruhten sich nach dem Essen auf der halbrunden Couch im Wohnbereich aus.
Nach einer weiteren Weile des Schweigens rief John den Lageplan auf dem Schirm an der Wand auf. Schließlich sagte Cosima: »Die Langstrecken-Kommunikation ist beschädigt.«
»Vielleicht kriegen wir das hin«, erwiderte John und fuhr sich über die Wange. Der Medi-Patch hatte die Schwellung abklingen lassen, aber es schmerzte noch. »Es ist ein großes Schiff, und vielleicht können wir einige Module aus den abgeriegelten Teilen verwenden, um andere Dinge zu reparieren.« Cosima zeigte mit dem Finger auf die abgebildeten Lagerbereiche des Schiffs. »Ja, vielleicht haben wir Glück, und bei der Fracht ist was dabei.«
John nickte. »Sieht vielversprechend aus.«
Cosima deutete auf eine kleine Liste am Rand des Schirms, die das Ergebnis ihrer Anfrage an das System war. »Da die meisten Steuerungssysteme ausgefallen sind, müssen wir manche Dinge auch weiterhin manuell machen. Das gilt ebenfalls für die Wartung einiger Module.«
»Wir werden vor Reparatur- und Wartungsarbeiten kaum Zeit für was anderes haben«, erklärte John. »Ich meine: um uns an die Kehle zu gehen. Am besten stellen wir uns Timer für die Versicherungen, die wir beim Wasser und beim Sauerstoff angebracht haben.«
»Habe ich schon«, erklärte Cosima grinsend. »Ich bin dir wie üblich ein paar Schritte voraus, John. Ich gehe davon aus, dass wir eine ganze Weile hier draußen sein werden. Wir sind vom Kurs abgekommen und bewegen uns in Bereichen, in die sich niemand verirren wird – oder will.«
»Du meinst, dass wir für immer hierbleiben müssen – irgendwo bei den drei Sprungtoren?«
»Falls wir in deren Nähe bleiben«, erwiderte Cosima. »Viel wahrscheinlicher ist, dass wir abdriften, und dann können wir von Glück sagen, wenn uns jemand aufgreift.« Die drei Sprungtore bildeten das sogenannte Nachtglanz-Dreieck, welches sich zwischen der Erde und der Venus befand und als eine Art Drehscheibe diente. Sie hatten die VANYA-17 auf dem Weg zwischen zwei Sprungtoren abgefangen und ein wenig abseits des Flugkorridors darum gekämpft.
»Vielleicht schaffen wir es mit Reparaturen, den Kurs zu ändern«, sagte Cosima nach einer Weile.
»Also eine unabsehbar lange Zeit mit dir, Cosima. Na toll!«
»Wir werden Regeln brauchen«, sagte Cosima mit großen Augen.
»Dass wir uns nicht an die Kehle gehen, ist eigentlich keine Regel, sondern eine Grundvoraussetzung«, entgegnete John. »Natürlich könntest du trotzdem versuchen, mich zu töten. Vielleicht reicht es dir, mich sterben zu sehen.« Ein schiefes Grinsen schob sich in sein Gesicht, auf dem von den Verletzungen nur noch rote Flecken übrig waren. »Aber vielleicht hast du auch gerade entdeckt, dass du letztlich doch ein bisschen an deinem Leben hängst«, sagte John.
Cosima schwieg, denn sie wollte ihm nicht recht geben. Ihr Lebenswille war geweckt, sie würde sich bestimmt nicht für seinen Tod opfern. »Dich zu töten, würde bedeuten, dass dein Tod mir wichtiger wäre als mein Leben. Und das – mein lieber John – glaubst du doch wohl selbst nicht.«
»Wir sind uns also einig, dass wir einander nicht töten. Wir haben die Quartiere aufgeteilt, und Vorräte scheinen erst einmal genug da zu sein.«
»Aber wir brauchen weitere Regeln, John. Darum geht es.«
»Okay. Scheiße, dass es Gemeinschaftsduschen gibt. Wir können absprechen, wer wann duscht.«
»Ich hätte dir mehr Selbstbewusstsein zugetraut«, entgegnete sie und musterte ihn anzüglich.
»Nicht jeder kann eine Nymphomanin wie du sein, Cosima.«
»Du hast noch nie zu einer solchen Crew gehört, oder? Du hast noch nie mit deinen Leuten alles geteilt. Du hattest immer deinen eigenen Bereich. Hast du jemals irgendwem vertraut?«
»Früher habe ich dir vertraut. Das war mein Fehler.«
»Und weil wir einander nicht vertrauen, brauchen wir klare Absprachen.«
»Ja, brauchen wir«, sagte John und nickte.
»Wir sind uns einig, dass wir beide überleben wollen.«
»Sind wir.«
Cosima wies um sich herum. »Und dass wir so lange kooperieren, bis wir dieses Schiff sicher verlassen haben.«
»Abgemacht«, sagte John.
»Und wir einigen uns im Rahmen dieser Kooperation auf gewisse Regeln.«
»Welche Regeln denn?«, fragte John.
»Regel Nr. 1«, sagte Cosima mit durchdringendem Blick. »Wir haben keinen Sex miteinander.«
John erstarrte, dann musste er lachen. »Das ist deine Regel Nr. 1?« Er schaute sich um. »Ich muss zugeben, mich für einen nicht ganz abstoßenden Mann zu halten. Aber ich wusste nicht, dass du auf mich stehst.«
»Ich möchte nur Klarheit haben, mein lieber Johnny. In Situationen wie dieser kommen Männer aus irgendeinem Grund auf die Idee, dass Sex zum Überleben irgendwie dazugehört. Ich möchte nur klarstellen, dass es in unserem Fall nicht dazugehört.«
»Oder du hältst dich für so unwiderstehlich, dass du fürchtest, ich könnte den Kopf verlieren?«
»Glaub mir, ich habe Männer und leider auch Frauen erlebt, die in weit weniger ernsten Situationen auf das Niveau von Steinzeitmenschen zurückgefallen sind – und das mit voller Überzeugung. Und da ich nicht zu diesen Frauen gehöre, mir bei dir aber nicht sicher bin, wann du den Drang verspürst, auf die Bäume zurückzuklettern, gibt es Regel Nr. 1.«
»Ich muss schon sagen. Das als Regel Nr. 1 zu haben, sagt viel über dich aus, Cosima.«
»Über uns, mein lieber Johnny. Über uns sagt es viel aus. Über unsere qualvolle Beziehung zueinander.«
»Meine allerliebste Cosima. Es wird mir leichtfallen, Regel Nr. 1 einzuhalten. Denn du bist die Letzte, die Allerletzte, mit der ich etwas anfangen würde.«
»Ich bin vielleicht die Einzige, Alfie.«
John verzog das Gesicht. Diesen Spitznamen hatte er seit Jahren nicht mehr gehört. Cosima hatte ihn damals so genannt, als sie die Clubs unsicher gemacht hatten, und er hatte nichts dagegen gehabt. Den Namen aber jetzt zu hören, das war für ihn wie ein Schlag ins Gesicht. »Du hast also den Spitznamen wieder ausgegraben?«
»Was dagegen?«
»Nein. Regel Nr. 2: Um nicht wahnsinnig zu werden, dürfen wir einander Spitznamen geben und einander mit Schimpfwörtern betiteln. Ist das eine gute Regel?«
»Gut gemacht, Alfie.«
»Da also Sex für uns nicht infrage kommt und ich jetzt keine Lust habe, dich mit Wörtern zu betiteln, die dir die Schamröte ins Gesicht treiben, sollten wir nach einer anderen Beschäftigung suchen.«
»Schlafen?«
»Es war immerhin ein langer Tag.«
Cosima erhob sich. »Bis morgen«, sagte sie.
»Bis morgen, meine liebste – meine allerliebste Cozy.«
Cosima blieb stehen. Sie hatte einen Fehler gemacht. Ehe sie ihn mit seinem alten Spitznamen konfrontierte, hätte sie daran denken sollen, wie er sie damals genannt hatte. Cozy! Sie schüttelte den Kopf und sagte: »Diese Runde geht an dich, John Glennscaul!«
»Schöne Träume!«, sagte er und bemühte sich um ein unschuldiges Lächeln.
»Ich werde davon träumen, dass wir bald hier rauskommen.«
»Unsere Leute werden uns schon rausfischen«, sagte John. »Ein paar Tage, vielleicht ein paar Wochen. Allein um unsere Leichen zu bergen. Zwei Wochen. Du wirst sehen.«
***
Nach zwei Tagen fanden John und Cosima die Reinigungsroboter und andere Service-Maschinen, die der Crew ein wenig von ihrer Last nehmen sollten und über die sie sich nun freuten. Und sie fanden die winzige Totenhalle und das dazugehörige Lager. Endlich konnten sie die Leichen in Särge legen, die sie mit ihren Systemen bis zu ihrer endgültigen Bestattung konservieren würden – wann immer das sein mochte.
Bislang hatten sie die Toten mit Medi-Modulen versehen, die nicht nur Wunden versorgten, sondern auch Leichen vor dem Verfall bewahrten. Zudem hatten Cosima und John die Temperatur in einem der Lagerräume heruntergeregelt und die Körper dort nebeneinander auf den Boden gelegt – Cosimas Leute auf die eine Seite, Johns auf die andere. Es war ein schmerzvoller Prozess gewesen, denn dies waren ihre Mitstreiter, für die sie die Verantwortung getragen hatten. Sie jetzt endlich in Särge zu betten, hatte etwas Versöhnendes.
Irgendwann würden die Toten auf Pandaros-3 ihre letzte Ruhe finden – in der Nekropole, die sich in der Hinterstadt erstreckte. Cosima und John wussten von den meisten, woran sie geglaubt hatten, und so tauschten sie dieses Wissen aus. Sie stellten fest, dass bei den meisten die Vorstellung prägend war, dass eines Tages die Künstlichen Intelligenzen die konservierten Toten in Maschinenkörpern wiederbelebten und für sie dann beim Erwachen nur ein Augenblick vergangen war. Es war eine tröstende Vorstellung, die Cosima und John für möglich hielten, doch sie sprachen kein weiteres Wort darüber.
***
Nach zwei Wochen hatten sie sich an das Leben an Bord und an die Abläufe gewöhnt – und auch daran, dass jeder Tag eine neue Herausforderung für sie bereithalten konnte. So nahmen sie die Meldung des Bordcomputers, wonach der Reaktor beschädigt war, mit Galgenhumor.
Sie wussten, dass sie nicht in der Lage waren, das System zu reparieren. Die Reaktortechnik lag ganz in den Händen der Künstlichen Intelligenzen und damit weit jenseits dessen, was ein Mensch im Detail hätte verstehen können.
Dennoch prüften sie die Statusdaten, die die Reaktorsoftware ihnen lieferte, und stellten fest, dass einige Leitungen zur Tiefenenergie beschädigt waren – jener Energie, die dem Kleinsten entsprang und Mitte des 21. Jahrhunderts zusammen mit weiteren Entdeckungen die Basis der technischen Singularität gebildet hatte.
Würde der Zugang des Reaktors in die Tiefe ganz ausfallen, wären sie verloren. Sie studierten die Konfigurationsmöglichkeiten und stellten fest, dass der Reaktor nicht nur Energie aus der Tiefe schöpfte, sondern dort auch Prozesse und Strukturen als Speicher und als CPU verwendete. Im Grunde saß dort in der Tiefe je eine Steuereinheit für die einzelnen Leitungen des Reaktors.
Cosima und John versuchten, die Steuereinheiten so einzustellen, dass sie die Leitungen zumindest teilweise belasten konnten.
Aber es gelang ihnen nicht, das System dazu zu bringen, die beschädigten Leitungen zu verwenden. Sie waren ein für alle Mal ausgefallen.
Es blieb ihnen nichts anderes übrig, als den Energieverbrauch zu verringern. Sie schalteten Bereiche des Schiffes ab, in denen sie sich nicht bewegten. Doch erst als sie die Schilde herabfuhren, die sich um das Schiff legten, konnten sie sicher sein, dass die Energie ausreichte, um die Systeme am Laufen zu halten.
An diesem Abend stellte John heimlich die Zeit seiner Sperre für das Wassersystem auf einen Monat um, und Cosima – ebenso heimlich – das System der Bombe an der Sauerstoffanlage auf drei Wochen.
***
Nach zwei Monaten brach ein Feuer im Recycling-System aus, und Cosima und John kümmerten sich in ihren Schutzanzügen sofort darum. Einen ganzen Tag kämpften sie sich durch den schwerelosen Bereich vor, löschten oder erstickten die Flammen und ersetzten beschädigte Module, so gut sie es vermochten. So retteten sie die Recycling-Anlage und damit ihr Leben.
Als das Ambiente-System an Bord den Abend einläutete, kehrten sie in ihren Wohnbereich zurück und duschten. Und dann betrachteten sie einander. Sie kamen sich nahe, sie liebkosten sich und vereinigten sich sogar. Kaum hatte der Sex jedoch angefangen, schreckten sie voneinander zurück, und keiner von beiden konnte sagen, wer mit dem Rückzug begonnen hatte. Entsetzt waren sie beide – sowohl voneinander als auch von sich selbst.
Am nächsten Morgen frühstückten sie gemeinsam und schwiegen einander an. Und erst nachdem John seinen Kaffee und Cosima ihren Tee getrunken hatte, sagte John: »Es wäre ein Fehler gewesen. Das weißt du.« Er war sich dessen sicher, und doch war die Versuchung groß gewesen, und er musste vor sich selbst gestehen, es zu bedauern, dass sie aufgehört hatten.
Cosima nickte. »Nach so einem Tag ist eine kleine Schwäche zu verzeihen.« Doch es war nicht nur eine kleine Schwäche gewesen. Es war das geschehen, was passieren musste. Sie hatte John immer für einen attraktiven Mann gehalten, und sie wusste, dass er sie nicht ganz unansehnlich fand. Gestern war für einen Moment all der Hass vergessen gewesen, und das erschreckte sie jetzt noch. John hatte recht: Es wäre ein Fehler gewesen. Und es war gut, dass er es auch so sah. Aber sie fragte sich, ob diese Einsicht nicht auch hinterher, nach durchlebter Lust, genauso gültig gewesen wäre. Nun hatten sie Regel Nr. 1 zumindest halb gebrochen. Und halbe Sachen mochte sie nicht. »Ab jetzt gibt es für unser Sexleben nur noch Solomissionen.« Sie starrte ihn mit großen Augen an. »Alles klar?«
»Solomissionen. Klingt verwegen – und geht in Ordnung. Klingt fast wie ein Spiel.« Da fiel ihm glücklicherweise etwas ein, denn er wollte unbedingt das Thema wechseln. »Erinnerst du dich noch an Triptyx Racing?«
Cosima nickte. »Das haben wir damals in den Clubs gespielt, als es gerade rauskam. Natürlich kenne ich das. Ich spiele es heute noch immer mal wieder.« Es war das beliebteste Rennspiel überhaupt, bei dem man eine Mischung aus Raumschiff und Schwebegleiter vom Start ins Ziel steuern musste. Die Strecke war dabei immer in drei unterschiedliche Bereiche geteilt, die den Spielern diverse Fähigkeiten abverlangen sollten.
In den letzten Jahren war Triptyx zu einem der führenden Medienereignisse geworden, sodass die KI Eleonore von der Erde aus eine Liga ins Leben gerufen hatte, bei der die Spieler die Play-Offs und die Turniere in Steuerkabinen austrugen, die den Körper massiv forderten. Es war angeblich so, als würden die Piloten tatsächlich in echten Boliden fliegen. Wenn man die erschöpften Sieger nach dem Rennen sah, wie sie ihre Pokale entgegennahmen, musste man das glauben. Viele von ihnen waren zu Stars geworden. Von manchen kannte man nicht einmal das Gesicht, weil sie stets Helme trugen und offenbar kein Interesse daran hatten, ihre Identität preiszugeben. Inzwischen war das Spiel so populär, dass es sogar Bestrebungen gab, echte Triptyx-Strecken zu bauen und echte Boliden auf ihnen fliegen zu lassen.
Cosima und John hatten das Spiel auf ihren Patch-Computern. Sie ließen die Schirme hochfahren und aus deren Basis Controller formen. Beides beruhte auf der Schildtechnik. Ursprünglich sollte diese einen Schutz um Raumschiffe legen, doch die KIs hatten sie für allerlei Zwecke weiterentwickelt, allem voran für Bildschirme. Controller aus ihnen formen zu lassen, war keine perfekte Lösung, aber eine hinreichende.
Seit damals, als Cosima und John Triptyx gemeinsam in den Clubs gespielt hatten, waren ihre Interessen zwar stark abgewandert, aber sie waren immer wieder einmal zu dem Spiel zurückgekehrt – entweder zur Ablenkung, oder aber weil gerade eine neue Version erschienen war und sie feststellen wollten, ob sie noch mithalten konnten. Sie hatten in all den Jahren zwar nie an irgendwelchen Ligen oder Turnieren teilgenommen, aber ihre Fähigkeiten waren bemerkt worden, und bald schon rankten sich Gerüchte um ihre Identität. Cosima verbarg sich hinter dem Namen Chimaira, und John war als Triptycian bekannt.
Als ihnen nun gegenseitig klar wurde, mit wem sie es zu tun hatten, konnten sie nur die Köpfe schütteln. »Ich kann nicht glauben, dass du Chimaira bist«, sagte John und erinnerte sich an spannende Rennen, die auch in die Zeit fielen, als er und Cosima bereits Feinde gewesen waren.
»Vielleicht hätten wir unsere Kämpfe im Spiel austragen sollen«, sagte Cosima und dachte an die Bewunderung, die sie für Triptycians eleganten Rennstil empfunden hatte. Sie hatte sich damals gewünscht, ihn kennenzulernen. »Weißt du eigentlich«, sagte sie, »dass ich mich an Tagen, an denen ich dich wegen irgendwas hasste, an Triptyx gesetzt habe und gegen dich gefahren bin?«
»Daran erinnerst du dich?«, fragte John.
»Ja. Weil ich mir dachte, wie toll es doch wäre, einen Feind wie dich durch einen fairen Gegner wie Triptycian zu ersetzen. Ich hatte ja keine Ahnung.«
John staunte. »Hat sich in diesen Worten gerade tatsächlich ein Kompliment eingeschlichen?«
»Sagen wir, dass wir endlich etwas gefunden haben, auf das wir gemeinsam Lust haben und in dem wir gut sind«, entgegnete sie lächelnd.
***
Nach zwei Jahren waren Cosima und John gefestigt, streitlustig wie eh und je, aber sie hatten sich nach ihrem Ausrutscher an ihre Regeln gehalten und ihre Arbeiten verrichtet. Sie glaubten jedoch kaum noch an eine Rettung. Zwar hatten sie endlich eine Notnavigation repariert, aber das System gab keine Statusinformationen nach außen, so sehr war es beschädigt. Es mochte sein, dass es sie auf irgendeinen abwegigen Kurs gebracht hatte und sie bis zu ihrem Lebensende auf diesem Schiff bleiben würden.
Sie hatten inzwischen weit weniger Wartungsarbeiten zu leisten und dadurch mehr Zeit, einfach in den Tag hineinzuleben. Dabei nutzten sie die Module aus, die sie im Frachter fanden. Neben dem Triptyx-Spiel, das sie auf ihren Patches trugen, maßen sie sich auch in anderen Spielen. Sie fanden in der Fracht Module mit riesigen Spiele-Bibliotheken, die unerschöpflich schienen. Und sie fanden Film- und Musikbibliotheken, die in Systeme integriert eine Art Basis liefern sollten und im Grunde gewaltige Archive waren. Sogar Literaturmodule gab es, die die Texte der gesamten Literaturgeschichte enthielten. Sie wählten sich Erzähler aus und ließen sich vom System Geschichten vortragen. All das hätten sie früher übers Netz abgerufen, aber hier, wo sie von allem abgeschnitten waren, entpuppten sich diese Bibliotheken als wahre Schätze.
Durch das gemeinsame Spielen und Rezipieren und den Austausch darüber fiel ihnen das Zusammenleben viel leichter, und sie reflektierten öfter und tiefgreifender über ihre Lage – jeder für sich.
John sprach in dieser Zeit ein Tagebuch in seinen Patch, Cosima zeichnete aus der Erinnerung Motive von Pandaros-3. Und gemeinsam studierten sie die Technik des Frachters und der Module, um vielleicht doch noch das eine oder andere System reparieren zu können.
Sie sprachen viel miteinander, ohne jedoch Entscheidendes preiszugeben; auch stritten sie oft und stachelten sich gerne gegenseitig auf. Eine ihrer Lieblingsbeschäftigungen war neben dem Triptyx-Spielen der Kampfsport. Das Ausmaß ihrer Feindschaft hatten sie längst ausgelotet. Ohne eine Konfrontation konnte es keine Annäherung geben, dafür hatten sie sich als Granden ihrer Schattenkonzerne zu sehr geschadet; zu viele Tote und zu viele Demütigungen standen zwischen ihnen. Aber das Ausmaß der Feindschaft zu kennen und sich ab und zu still einzugestehen, dass es eine Zeit gegeben hatte, in der sie beinahe Freunde gewesen waren, veränderte sowohl Cosima als auch John.
Eines Nachts begab sich John zur Wasseranlage und löste seine Sperre vom System, und nur wenige Wochen später war es Cosima, die ihre Bombe heimlich vom Sauerstoffsystem entfernte. Sie hatten beide ihre Druckmittel aufgegeben, ohne dass der andere davon erfuhr.
Cosima stellte sich nun die Frage, ob John wirklich noch ein Feind war, und John hatte beinahe das Gefühl, dass es immer so zwischen ihnen hätte sein sollen, wie es nun zwangsweise sein musste. Und gerade in dieser Phase, in der sie kurz davorstanden, einander mehr von sich preiszugeben, erschien die VANYA-17 am Mittag des 4. September 2316 auf den Scannern eines Schiffes – eines Schiffes namens INANNA.
Manderton
Da Captain Yuka Manderton das fremde Schiff nicht durch das Cockpitfenster sehen konnte, fuhr sie mit den Fingerspitzen über die Konsole, und mit einem Glitzern entstand ihr Hauptschirm vor ihr und zeigte einen kupferfarbenen Frachter mit zahlreichen dunkelgrauen Segmenten, an die Container und ganze Logistikmodule angedockt waren. Kein Zweifel: Dieser lang gezogene Kasten, der dort draußen im All trieb, war ein automatisierter Frachter, der offenbar außer Kontrolle geraten war.
Yuka hatte bislang erst einmal ein herrenloses Schiff gesehen. Sie war damals vor etwa einem Jahrzehnt noch eine junge Offizierin auf der Raumstation Spinning Jenny beim Neptun gewesen. Ihr Captain hatte gesagt, sie solle sich das Schiff gut anschauen, wie es sich mit den gewaltigen Sonnensegeln näherte. Es sei mehr als hundert Jahre alt und werde wahrscheinlich das einzige verschollene Schiff bleiben, das sie je zu Gesicht bekomme.
Der alte George hatte keine Ahnung gehabt, was ihnen allen bevorstand! Zwar gelangte man durch bessere Sprungportale auf Ebenen des Hyperraums, auf denen der Weg zum Ziel drastisch verkürzt war, aber einige wenige Sprungtore mussten, um günstige Verbindungen herzustellen, weit abseits der Erde und der Kolonien platziert werden. Und auf dem Weg dorthin konnte viel geschehen. Gerade jetzt, da der Aufbau neuer Verbindungen viele neue Kolonien ermöglicht und damit noch mehr Schiffe ins All gebracht hatte, war es wahrscheinlicher geworden, dass Schiffe verschwanden. Besonders hier im Nachtglanz-Dreieck, wo zwischen der Erde und der Venus drei Tore nahe beieinander platziert waren und es ermöglichten, beinahe alle Sprungtore zu erreichen, die je erbaut wurden, gingen hin und wieder Schiffe verloren. Manche tauchten, von Notsystemen gesteuert, hier in der Nähe der drei Sprungtore wieder auf. Einmal hatte es ein Schiff, das hier verschwunden war, sogar nach Jahren bis zur Venus verschlagen, und es war, zum Glück für die Crew, von den Scannern erfasst worden.
Dieser Frachter, dem sie sich nun näherten, war Yukas erster Schiffsfund als Kapitänin.
»Es gibt keine Daten, Captain«, sagte Zayda Sakamoto. Yukas Erste Offizierin strich sich durch den langen Pferdeschwanz, zu dem sie ihr schwarzes Haar gebunden hatte. »Nicht einmal ein Notsignal. Aber die Signatur am Rumpf ist zu lesen. Das ist die VANYA-17.« Zum Beweis schickte Zayda ihr das kurze Video auf ihren Schirm, das eine der Sonden von der Seite aus aufgezeichnet hatte.
Yuka wandte sich an Osred Eckert, ihren Zweiten Offizier, der über seine Konsole gebeugt saß und sich unruhig an seinem kurz geschorenen Kopf kratzte. »Irgendwas in den Datenbanken?«, fragte sie ihn.
»Ja. Die VANYA-17 ist vor zwei Jahren vom Mars aufgebrochen und irgendwo hier im Nachtglanz-Dreieck verloren gegangen. Sie gehörte der Algorithmic Idol Foundation.«
»Gehörte?«
»Ja. Sie haben ihre Besitzansprüche nach einer vergeblichen Suche aufgegeben.«
Yuka nickte zufrieden. Da hier draußen die Eigentümer eines Schiffes für den Schaden eines Wracks aufkommen mussten und gerade die automatisierten Frachter oft mit Notsystemen ausgestattet waren, die sie auf die bekannten Routen zurückführten, nutzten fast alle in solchen Unglücksfällen eine Lücke im Verkehrskodex. Sie mussten dazu lediglich die Eigentumsrechte an einem verschollenen Schiff aufgeben. Es gab sogar Piraten, die damit ein Geschäft machten. Sie ließen Frachter verschwinden und warteten, bis die Eigentümer die Ansprüche aufgaben. Dann kamen sie aus der Deckung und verkauften das Schiff und dessen Ladung völlig legal.
Zayda schaute zu ihr herüber. Auf ihren lilafarbenen Lippen formte sich ein Lächeln. »Könnte ein Glücksfall für Sie sein, Captain«, sagte sie. »Das sind eine Menge Container.«
Auch Osred wandte den Kopf und grinste wie ein kleiner Junge. »Den Daten zufolge war das Ding bei seinem Abflug vollbeladen. Hundertzwölf Container.«
Yuka tippte auf ihren Schirm. »Sieht ein bisschen gerupft aus«, murmelte sie. Es wirkte, als hätte irgendwer willkürlich zahlreiche Container herausgelöst.
»Schauen Sie sich das große Loch am Heck an«, sagte Zayda. Tatsächlich klaffte dort eine gewaltige Lücke. Der Kunststoff war gesplittert, das Metall nach außen gebogen. »Eine Explosion im Inneren. Das könnte einige der Container gelöst haben. Und da!« Ein breiter Riss zog sich an der Seite entlang. »Das Modell müsste von den Schleusen bis in die Wohnbereiche und zur Brücke Gravitationspanels haben«, erklärte Zayda. »Wenn es so ist, reden wir von einem kleinen Vermögen.«
Yuka klatschte in die Hände und erhob sich. »Also gut! Schickt die schweren Drohnen raus. Holt mir das Ding! Ich gehe runter und schau mir die Kiste an. Und schickt mir Teodor mit seinen Leuten runter. Ich möchte keine Überraschungen erleben.« Sie nahm ihre blaue Uniformjacke von der Konsole und zog sie sich über ihre cremefarbene Bluse.
»Glauben Sie, da ist jemand an Bord?«, fragte Zayda, während sie sich erhob. »Etwa Piraten?«
»Man kann nie vorsichtig genug sein«, sagte sie, während sie die Uniformjacke zuknöpfte.
Zayda nickte, und während Yuka die Brücke verließ, hörte sie noch, wie ihre Erste Offizierin Osred anwies, einige Scans des Schiffes zu machen. »Wenn es schon keine Daten sendet, können wir vielleicht auch so etwas herauskitzeln.«
Yuka folgte dem stillen Gang des Kommandobereichs hinaus auf einen der großen Ringgänge. Jeder Quadratmeter war hier ein Vermögen wert, denn die oberen Ebenen des Schiffes waren mit Gravitationspanels ausgestattet. Sie hatte sich die Platten, die in die Böden eingesetzt waren, nur durch den Kredit der Carrender-Foundation leisten können, aber sie verliehen Yukas Schiff einen ungeheuren Glanz. Ohne die Carrender-Foundation hätte sie sich den Umbau des Frachters zu einem Kongressschiff nicht leisten können. Carrender hatte ihr nicht nur Kredite gegeben, sondern auch selbst investiert, indem sie ihr einen Teil der Crew bezahlte. Und auch sonst hatte die Foundation sie in jeder Hinsicht unterstützt. Natürlich wusste sie, dass sie dadurch in der Hand der Foundation war und rechtlich gesehen das Risiko trug, während Carrender lediglich ein finanzielles Wagnis einging, was angesichts der Größe des Unternehmens nicht weiter ins Gewicht fiel.
Gänge, auf denen man niemandem begegnete, gab es selten auf Schiffen mit Gravitationspanels. Hier aber war es ein Luxus, den sie sich leisten konnte. Die Stille war ein Privileg. Erst in Kürze würde es hier von Besuchern wimmeln, von denen jeder an der großen Auktionswoche teilnehmen wollte, die sie hier auf der INANNA wieder einmal veranstaltete.
Für Yuka war es diesmal so verwunderlich wie vor drei Jahren, als die Carrender-Foundation ihr zum ersten Mal die Ehre hatte zukommen lassen, der Gastgeber der Veranstaltung zu sein. Sie hatte nicht damit gerechnet; schließlich war sie lediglich bei Carrender unter Vertrag. Die INANNA gehörte ihr, und die Foundation war stets vorsichtig gewesen, den Freien solche Privilegien zu gewähren. Für irgendwelche Kongresse war sie gut genug gewesen, aber für so etwas Prestigeträchtiges wie eine der großen Auktionswochen hatte die Foundation stets die eigenen Schiffe genommen. Offenbar war die Führung mit ihrer Arbeit zufrieden.
Yuka stieg in den Transporter. Früher einmal war es ein einfacher Aufzug gewesen, doch mit den Erweiterungen war es zu einer sehr flexiblen Transportkabine geworden, die sie rasch in jeden Bereich des Schiffes brachte. Sie bevorzugte zwar die Fahrsteige in den offenen Bereichen und den breiten Gängen, aber wenn es schnell gehen musste, gab es nichts Besseres als den Transporter.
Die Tür öffnete sich mit einem leichten Zischen, und Yuka trat hinaus auf den hellen Gang. Teodor Rowak, ihr Sicherheitsoffizier, kam ihr entgegen. Sie würde sich wohl nie daran gewöhnen, dass er sich die blonden Locken hatte abschneiden lassen, musste aber zugeben, dass der beinahe kahl geschorene Kopf seine grünen Augen zur Geltung brachte und dadurch weit bedrohlicher wirken ließ. Und das passte zu einem Sicherheitsoffizier.
»Wir haben angedockt und sind bereit zum Zugriff«, sagte er.
»Zugriff? Es geht hier nicht um Verbrecher, die sich verschanzt haben, Teodor. Wahrscheinlich ist niemand an Bord.«
»Man kann nie wissen«, entgegnete der groß gewachsene Offizier und führte sie um die Ecke auf einen Gang zu den Bordwachen, die vor der Schleusentür standen und die Waffen bereithielten.
Yuka schüttelte den Kopf. »Runter mit den Waffen!«, befahl sie. »Wer immer da drin ist, braucht vielleicht unsere Hilfe.«
»In Ordnung, Captain«, sagte Teodor. »Aber Sie halten sich zurück, ja?«
Yuka nickte, trat bis zur Wand zurück und ließ ihre Leute ihre Arbeit machen.
Sie öffneten die Schleusentür. Teodor prüfte etwas auf dem transparenten Schirm, der aus dem Patch an seinem Ärmel wuchs. Sämtliche rechteckigen Mikroschilde auf seiner Uniform schalteten sich ein. Die kleinen Flächen, die nun blau leuchteten, konnten einen leichten Beschuss abwehren. Für all die Extras, mit denen die Wachuniformen ausgestattet waren, hatte Yuka ein Vermögen bezahlt. Ihre eigene Uniform verfügte weder über Mikroschilde noch über Flächen, die für das Anheften von Modulen gedacht waren. Sie war trotz des gleichen Blautons ebenso wie die von Zayda und Osred lediglich zu Repräsentationszwecken gedacht und wirkte damit eleganter und ansehnlicher.
»Das Klimasystem läuft standardmäßig«, sagte Teodor. »Keine giftigen Gase. Alles in Ordnung.«
Das bedeutete, dass sie die Schleuse nicht benötigten, sondern gefahrlos die Tür öffnen konnten.
»Aber ich will auf Nummer sicher gehen«, fügte Teodor hinzu.
Yuka nickte nur.
Teodor schloss die Schleuse hinter sich und winkte ihr durch das Sichtfenster zu. Bei ihr waren nur noch drei Wachen, die sich nicht die Mühe machten, ihre Mikroschilde einzuschalten.
»Sie müssen ihn verstehen«, sagte Juliana Weddington, eine der jüngeren Wachfrauen, die ihr braunes Haar heute zu einem Zopf geflochten hatte. »Hier gibt es so wenige Vorfälle.«
»Ich verstehe es ja, Julie. Aber ich hoffe, er versaut den ersten Eindruck nicht.«
»Selbst wenn. Wir können immer sagen, dass er nur seinen Job macht. Nicht er wird den ersten Eindruck machen, sondern Sie – die Kapitänin.«
Yuka lächelte. »Ich werde dich vermissen, Juliana«, sagte sie. »Gibt es noch irgendeine Möglichkeit, dich zu halten?«
»Leider nicht«, sagte die junge Wachfrau mit einem verlegenen Schmunzeln. »Oder würden Sie einen Platz an der DeGarmo ausschlagen?«
»Wenn ich dein musikalisches Talent hätte, wohl kaum. Versprich mir eins: Wenn du eine berühmte Komponistin geworden bist, kommst du zurück und gibst hier ein Konzert mit deinen Stücken.«
»Ich verspreche es«, sagte Juliana. Ihre blauen Augen glänzten.
Yuka strich der jungen Frau über die Schulter.
In der Schleuse tat sich etwas. Hinter der Scheibe bewegte sich jemand. Da öffnete sich die Tür, und Teodor führte zwei Fremde vor sie – einen Mann und eine Frau.
Sie wirkten gepflegt, trugen aber Arbeiteroveralls. Im ersten Moment dachte Yuka, sie wären ein Paar, doch dann musterte die Frau den Mann von oben bis unten, als wollte sie sich von ihm distanzieren; und der Mann grinste verwegen zurück, als hätte er eine riskante Wette gewonnen. Diese beiden waren alles andere als ein Paar.
Yuka wusste nicht, wen von beiden sie anschauen sollte, und so zogen diese beiden Gestalten immer wieder ihren Blick hin und her. Es geschah nicht ruckartig, sondern fließend, als würden beide sie mit sanfter Hand zu sich locken.
Der Mann war blass und hatte dunkelbraunes Haar und mittelbraune Augen. Hatte er die Frau gerade noch wie ein frecher Junge angegrinst, lächelte er Yuka so schamlos offen entgegen, als hätte sie ihm gerade ein Kompliment gemacht. Wie er es schaffte, unrasiert dennoch gepflegt zu wirken, fragte sie sich. Und die Frau! Eine beeindruckende Gestalt. Jede Geste war zielsicher. Diese Frau war das Befehlen gewohnt. In respektabler Kleidung hätte man sie für eine Kapitänin oder die Chefin eines Unternehmens halten können. Sie hatte schulterlanges schwarzes Haar. Ihre braune Haut war gerade dunkel genug, um die rosigen Wangen nicht ganz zu überdecken. Sie war ungeschminkt und durch nichts an irgendeinen Trend angepasst. So schaute Yuka zu dem Mann zurück. Neben der Frau hätte jeder unterlegen wirken müssen, doch dieser Mann strahlte ein Selbstvertrauen aus, das einfach umwerfend war.
Egal, wer diese beiden waren, Yuka wollte sie kennenlernen. Sie hoffte, dass sie den ersten Eindruck nicht zunichtemachten, sobald sie den Mund öffneten. Und umgekehrt fürchtete sie, sich lächerlich zu machen, wenn sie zu ihnen sprach.
»Ich bin Yuka Manderton, Kapitänin dieses Schiffes – der INANNA«, sagte sie und war zufrieden mit ihrer Stimme und ihrer Haltung. Sie reichte der Frau die Hand.
»Cosima Amberson«, sagte diese, und Yuka erkannte den Namen. Diese Frau war berüchtigt – die Grande des Schattenkonzerns Amberson Unbound, die in der Grauzone der Kolonien operierte. Sie hatte sogar einmal ein Video von ihr gesehen. Aber der Unterschied zwischen der Frau in dem Abendkleid, die perfekt gestylt den roten Teppich irgendeiner Gala entlangging, und der ungeschminkten Frau, die hier mit einem Arbeitsoverall vor ihr stand, war einfach zu groß, als dass sie sie erkannt hätte. Dass sie eine Grande war, der Kopf eines Schattenkonzerns, passte allerdings zu diesem scheinbaren Widerspruch – eine Frau, die im Verborgenen Verbrechen beging und am Abend wie die personifizierte Unschuld auf Partys erschien. Was sie hier zu suchen hatte, konnte Yuka sich jedoch nicht erklären.
»John Glennscaul«, sagte der Mann und drückte Yuka die Hand.
Sie stutzte und schaute dann zwischen ihren beiden Gästen hin und her. »Ihr wollt mich verarschen«, sagte sie. Natürlich kannte sie den Namen John Glennscaul und hatte auch von dem Schattenkonzern Glennscaul Unlimited gehört. Aber diesen Mann hatte sie noch nie gesehen. Es hieß, er meide die Öffentlichkeit und bewege sich in ihr unerkannt. »Wer seid ihr wirklich?«, fragte sie. Denn die beiden Granden, deren Feindschaft bekannt war, an einem Ort vereint – das war unmöglich.
Die Geretteten tauschten einen Blick, dann sagte die Frau: »Wir verarschen Sie nicht. Wir sind Cosima Amberson und John Alfred Glennscaul.«
»Aber ihr seid Feinde. Eure Fehden sind legendär.«
»Sie sagen die Wahrheit«, erklärte Teodor und zeigte auf dem Schirm über seinem Ärmel die Identifizierung. »Sofern sie nichts haben machen lassen, sind sie es.«
Yuka lächelte schief. »Irgendwelche Straftaten?«
»Es ist nichts im System.«
Sie schaute zwischen Amberson und Glennscaul hin und her. »Dann heiße ich Sie im Namen der Carrender-Foundation herzlich auf der INANNA willkommen.« Sie musste ihnen nicht erklären, dass sie in Schwierigkeiten geraten würden, falls sie hier irgendetwas Zwielichtiges durchführten. Die Erwähnung der Carrender-Foundation musste selbst den Dümmsten klarmachen, dass dies kein Ort für irgendwelche Straftaten war.
»Kommen Sie«, sagte Yuka und führte die beiden Granden den Gang entlang. Teodor signalisierte ihr, dass er sich die VANYA-17 ansehen wolle. Yuka nickte.
»Sie trauen uns nicht?«, fragte Cosima Amberson.
»In manchen Dingen traue ich Ihnen, in anderen überhaupt nicht.«
»Das ist mehr, als man uns sonst zugesteht«, sagte John Glennscaul. »Wie kommen wir zu der Ehre?«
»Nun, das will ich Ihnen nicht vorenthalten: Sie sind Granden von Schattenkonzernen. Sie sind nicht dumm. Sie wissen, dass Sie ein Schiff wie die INANNA nicht überfallen können, ohne dass die Carrender-Foundation über Sie kommt wie eine Supernova. Sie wissen genau, gegen wen Sie vorgehen können und von wem Sie lieber die Finger lassen. Deshalb haben Sie so lange überlebt. Also kann ich Ihnen insofern vertrauen. Aber was Gesetzeslücken und Grauzonen angeht, vertraue ich Ihnen überhaupt nicht. Ich frage mich nur eins: Wie kommt es, dass Sie zusammen hier sind? Es heißt doch, Sie würden sich bis aufs Blut bekämpfen.«
»Das haben wir auch«, sagte Cosima. »Und das werden wir auch wieder. Aber wenn man auf einem Wrack gefangen ist, muss man halt manchmal Kompromisse schließen, um zu überleben.«
»Also haben wir die Feindschaft ruhen lassen, um sie bald wieder aufzunehmen«, erklärte John.
Yuka blieb stehen. »Bald ist gut. Bald – das heißt, wenn wir auf der Erde angekommen sind. Solange Sie hier sind, werden Sie sich zurückhalten. Ich meine: Wie lange waren Sie auf dem Schiff?«
John setzte zum Sprechen an: »Zw…«
»Anderthalb Jahre«, sagte Cosima.
»Also zwei Jahre«, erwiderte Yuka. »Und vor zwei Jahren ist der Frachter verschwunden. Ganz ehrlich: Es ist mir egal, wie Sie auf den Frachter gekommen sind – ob Sie für das Verschwinden verantwortlich sind. Vielleicht könnten wir sogar ins Geschäft kommen.«
Cosima grinste. »Nun, wir sind Geschäftsleute. Das ist unser Job.«
»Es geht um den Frachter?«, fragte John.
Yuka nickte. »Meine Leute werden ihn genauer in Augenschein nehmen, und dann mache ich Ihnen vielleicht ein Angebot. In drei Tagen beginnt hier an Bord eine Auktionswoche. Da könnten Sie sich von dem Erlös etwas kaufen. Sogar Schiffe werden angeboten.«
»Sie fliegen nicht zufällig nach Pandaros-3?«, fragte Glennscaul.
»Nein. Unsere Reise endet auf der Erde. Aber wenn Sie wollen, könnte ich schauen, welche Schiffe, die hier anlegen, den Weg zum Jupiter nehmen.«
»Und das Wrack wollen Sie an die Carrender-Foundation übergeben?«, fragte John.
Yuka lachte leise. »Natürlich.«
Cosima spitzte die Lippen. »Die Carrender-Foundation hält sich an die KI-Konventionen. Also wären wir bereit, die Summe, die die KI-Analyse ermittelt, zu akzeptieren, wenn Sie es uns hier sehr gemütlich machen.«
»Sie werden mit Ihren Quartieren und dem Service mehr als zufrieden sein«, entgegnete Yuka.
»Bei dem Schaden auf dem Schiff ist unsere Crew ums Leben gekommen«, sagte John und wich erstmals ihrem Blick aus. »Wir haben sie in Särgen bestattet. Würden Sie dafür sorgen, dass man sie nach Pandaros-3 bringt?«
»Wenn Sie mir garantieren, dass bei dem Schaden keine Unbeteiligten umgekommen sind, kann ich das machen«, erwiderte Yuka. Wegen zahlreicher Gesetzeslücken gab es hier draußen keine zielführende Handhabe gegen Schattenkonzerne, die sich auf einem herrenlosen Frachter eine Schlacht lieferten. In dem Augenblick, als der alte Eigentümer der VANYA-17 seine Besitzansprüche aufgegeben hatte, war aus dem Frachter ein gesetzloser Ort geworden. Und solange die beiden Granden schwiegen und keine Beschuldigungen gegeneinander erhoben, konnten die Behörden nichts unternehmen. Yuka musterte die beiden Granden und fragte sich, wie sie nach einem Kampf, der auf beiden Seiten Tote gefordert hatte, hier so ruhig nebeneinanderstehen konnten.
»Außer unseren Leuten war niemand an Bord«, sagte John.
»Und sind die Zieldaten in den Särgen gespeichert?«, fragte Yuka.