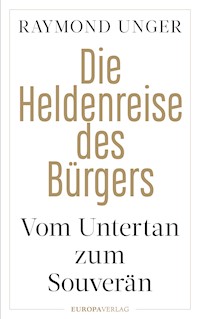Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Europa Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Eine Familienchronik und Autobiografie von großer emotionaler Wucht. Die Auswirkungen von verdrängten traumatischen Erfahrungen sind vielen Menschen nicht bewusst, doch sie vererben sich auf die nächste Generation und üben bis in die Gegenwart einen starken Einfluss auf die persönliche Biografie aus. Sehr oft sind sie der Schlüssel, um das eigene Leben besser zu verstehen. Raymond Unger legt in Die Heimat der Wölfe offen, worüber in den meisten Familien nicht gesprochen wurde und wonach man heute kaum noch fragen kann, da es bald niemanden mehr gibt, der die Schrecken des Zweiten Weltkriegs, Flucht und Vertreibung selbst erlebt hat. Eindringlich schildert er anhand seiner eigenen Familiengeschichte, wie die Generation der Kriegskinder traumatisiert wurde und dadurch ihren eigenen Kindern – die heute zwischen 40 und 65 Jahre alt sind – häufig nur verschlossen, körperlich/seelisch unnahbar und wenig empathisch begegnen konnte. "Wenn du hervorbringst, was in dir ist, wird dich, was du hervorbringst, erretten. Bringst du nicht hervor, was in dir ist, wird dich, was du nicht hervorbringst, zerstören. " Aus dem gnostischen Thomas-Evangelium Erste literarische Auseinandersetzung mit der Thematik Kriegsenkel Haben die traumatischen Erlebnisse von Eltern und Großeltern Einfluss auf die nachfolgende Generation? Gibt es ein transgenerationales Erbe? Raymond Unger, angesehener Berliner Künstler und Therapeut, hat sich anhand von persönlichen Erinnerungen, Tagebüchern und Tonbandaufzeichnungen intensiv mit der Chronik seiner Familie und den Kriegstraumata seiner Eltern auseinandergesetzt. Es ist ihm gelungen, das Schicksal der Kriegsenkel in literarischer Form zu verarbeiten und seinen Lesern damit einen Spiegel für die eigene Reflexion anzubieten. Seine glänzend erzählte Familienchronik verdichtet er zu einem Gesamtbild großer Themen des 20. Jahrhunderts.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 289
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hinweis: Abgesehen vom Klarnamen des Autors wurden alle Familiennamen im Buch geändert.
1. eBook-Ausgabe 2016
© 2016 Europa Verlag GmbH & Co. KG, Berlin • MünchenUmschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich, unter Verwendung eines Fotos von © Privatarchiv Raymond UngerLayout und Satz: BuchHaus Robert Gigler, MünchenKonvertierung: Brockhaus/CommissionePub-ISBN: 978-3-95890-039-4
Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Alle Rechte vorbehalten.
www.europa-verlag.com
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]
Für meine Familie
INHALT
PROLOG
WOLFSWINTER | 1924 | Fürstenfeld, Bessarabien
NEUE HEIMAT| 1969 | Neu Wulmstorf
DAS BOOT | 1916 | Jütland, Nordsee
GROSSADMIRAL DÖNITZ | 1976 | Hamburg-Blankenese
DIE ZEITUNG | 1975 | Stelle
HEIM INS REICH | 1940 | Fürstenfeld, Bessarabien
BARACKENKINDER | 1948 | Wangersen (Ahlerstedt)
MASTER UND BLASTER | 1976 | Winsen (Luhe)
DER KELLER | 1978 | Stelle
OPERATION GOMORRHA | 1943 | Hamburg | Grafenau
UKRAINISCHE TÜCHER | 1984 | Stelle
LA DOLCE VITA | 1986 | Imperia, Italien
BUNDESMARINE | 1985 | List auf Sylt
SCHWARZER PETER | 1983 | Neu Wulmstorf
NACHTLEBEN | 1987 | Hamburg-Eppendorf
MARILYNS ENDE | 1999 | Hamburg-Eppendorf
TRAURIGER KÜNSTLER | 2005 | Friedrichstadt
DREI FRAUEN IM SAND | 2009 | Lemvig, Dänemark
HAUS SONNENSCHEIN | 2011 | Norderstapel
DAS DRAKE | 1958 | Chicago, Illinois, USA
MARSCHLAND | 1963 | Buxtehude
GOTT UND APOLLO 11 | 1969 | Neu Wulmstorf
DER TAUBENSCHLAG | 1975 | Stelle
SCHLAUE SABINE | 1979 | Hamburg-Grindelberg
CORNED BEEF | 1945 | Hamburg-Altona
ZWEITES GLÜCK | 1996 | Stelle
BETONKOPF | 1971 | Neu Wulmstorf
LETZTE MARLBORO | 2013 | Buchholz in der Nordheide
FARBEN DER GEWALT | 2011 | Berlin
ZUCKERBROT UND PEITSCHE | 1977 | Neu Wulmstorf
EPILOG
STAMMBAUM
ZUM AUTOR
ENDNOTEN
»Wenn du hervorbringst, was in dir ist,wird dich, was du hervorbringst, erretten.
Bringst du nicht hervor, was in dir ist,wird dich, was du nicht hervorbringst, zerstören.«
Aus dem gnostischen Thomas-Evangelium
PROLOG
Auf einer Vernissage stand ein Ehepaar vor einem meiner Gemälde. Die Ehefrau hielt betroffen ihre Hand vor den Mund und sagte zu ihrem Mann: »Dieser Künstler muss eine sehr schwere Kindheit gehabt haben.« Eine andere Frau, kaum zwei Meter von dem Paar entfernt, hatte die Bemerkung gehört. Sie kommentierte: »Ja, das mag sein. Der Künstler ist mein Sohn.«
Diese wahre Begebenheit aus dem Jahr 2008 zeigt dreierlei: Meine Ölbilder werden als Bearbeitung einer schwierigen Kindheit verstanden. Meine Mutter erkannte meine schwierige Kindheit an. Was daran lag, dass sie selbst eine schwierige Kindheit hatte. In diesem Buch geht es um das Weiterreichen von »Schwierigkeiten«. Als Kriegsgeneration hatten die Eltern meiner Mutter eine Menge Schwierigkeiten. Davon bekamen auch meine Eltern noch welche ab – und später ich.
Die Schwierigkeiten Deutschlands reichten für drei Generationen. Doch kinderlos, wie ich bin, beendete ich den Reigen der Weitergabe und behielt alles Schwierige in mir. Schweigen und Scham ließen es kumulieren und giftige Blasen werfen. Mit diesem Buch steche ich sie endgültig auf.
Als Künstler ringe ich um maximale Authentizität und Kreativität. Ich will wissen, woher ich komme und wer ich bin. In meinem Sachbuch Die Heldenreise des Künstlers komme ich zu dem Schluss, dass meine Wahrnehmung der Wirklichkeit geprägt wurde durch meine Herkunftsfamilie und die Generation, der ich angehöre. Ich bin ein Künstler der sogenannten Babyboomer-Generation, das sind die Jahrgänge zwischen 1960 und 1975. Und wie viele Künstler meiner Generation neige ich dazu, mich selbst infrage zu stellen. Doch was für Künstler gilt, gilt vermutlich auch allgemein: Meiner Generation wird häufig Indifferenz, Orientierungslosigkeit und bisweilen sogar Larmoyanz unterstellt. Als Antwort auf diese Zuschreibungen war ich zunächst versucht, ein weiteres Sachbuch zu schreiben. Doch ich habe mich dagegen entschieden. Zum einen gibt es bereits hervorragende Sachbücher zum Thema, zum anderen glaube ich, dass ich mit einer anekdotischen Erzählweise die Materie prägnanter und vermutlich auch unterhaltsamer darstellen kann. So ist aus dem Vorhaben ein autobiografischer Roman geworden. Ausgehend vom familiären Universum meiner Kindheit, widme ich jedem Familienmitglied eine oder zwei Anekdoten. Obgleich ich nicht streng chronologisch erzähle, vertraue ich darauf, dass sich durch die Zeit- und Ortsangaben die Zusammenhänge und die zeitgeschichtlichen Hintergründe erschließen.
Meine Familienchronik reicht vom Jahr 1924, der »Heimat der Wölfe« Bessarabiens, über die Hamburger Bombennächte von 1943 und die Erfahrungen meines Vaters als USA-Auswanderer 1958 bis zur Suche nach etwas Glück in der Eigenheimsiedlung einer Hamburger Vorstadt der 1970er-Jahre. Je näher meine Erzählungen der Gegenwart kommen, desto deutlicher zeigen sich Dekompensationen und Auflösungserscheinungen des westdeutschen Wirtschaftswunders. Viele Selbst-Reparationsversuche psychischer Schräglagen führten zum tragisch-verfrühten Tod von Familienmitgliedern. Da hierbei Suchtverhalten im Vordergrund stand, vermutete ich dort lange Zeit den Schlüssel für die Probleme meines Familiensystems. Erst um das Jahr 2008 erkannte ich die tieferen Hintergründe: Verdrängung der Kriegserlebnisse meiner Eltern und Großeltern und damit unbewusste »transgenerationale Weitergabe des Kriegstraumas« an mich und meine Schwester.
Auf Dauer konnten die Dämonen der 1940er-Jahre weder mit Alkohol noch durch exzessive Hobbys gebändigt werden. Seither bezeichne ich mich selbst als »Kriegsenkel«, damit ist die Generation nach den »Kriegskindern« gemeint. Meine Eltern sind klassische Vertreter der Kriegskindgeneration, erlitt doch jedes Elternteil eines der beiden Ur-Traumen der Nachkriegsdeutschen: Flüchtlingsschicksal mit Vertreibung aus dem Osten (meine Mutter) und Obdachlosigkeit durch Verlust der Hamburger Wohnung aufgrund der Operation Gomorrha (mein Vater).
Unbewusst wurde meine frühkindliche Weltsicht geprägt von der Trauer über den »Verlust der Heimat« und von unbewältigten Kriegsängsten. Hinzu kamen die emotionale Kälte und mangelnde Empathie meiner Eltern, die für Kriegskinder typisch sind.
Bevor es losgeht, möchte ich kurz die wichtigsten Protagonisten vorstellen – wen zähle ich zu meiner engeren Familie? Für mich waren dies in erster Linie die Personen, die mein unmittelbares Erleben als Kind prägten (siehe dazu auch den Stammbaum im Anhang). Mein familiäres Universum bestand aus neun Personen (mit mir zehn), die alle zusammen auf einem Grundstück in Neu Wulmstorf bei Hamburg lebten. Den Kern bildeten meine Großeltern mütterlicherseits: Wilhelmine und Jakob Müller, »bessarabiendeutsche1« Schwaben und Kriegsflüchtlinge aus dem heutigen Moldawien. Meine 1940 nach dem Hitler-Stalin-Pakt aus Bessarabien über Polen geflohene Kernfamilie war streng religiös und gehörte einer Freikirche an. Die Kinder meiner Großeltern, meine Mutter Katja und mein Onkel Ewald, bildeten die nächste Generation des Hofes. Die Geschwister Ewald mit Ehefrau Helga und meine Mutter Katja mit Ehemann Andreas standen lebenslang in Konkurrenz. Beide buhlten um die Gunst der streng religiösen Eltern, wobei der ältere Sohn Ewald die klare Dominanzposition innehatte. Beide Ehepaare auf dem Hof hatten jeweils zwei Kinder. Ewald und Helga bekamen 1960 Tochter Ina und 1965 Sohn Peter. Meine Eltern bekamen 1960 meine Schwester Sabine und 1963 mich. Ich möchte noch erwähnen, dass das Verhältnis beider Familien eng und unabgegrenzt war. Ina und Peter waren deshalb für mich wie Geschwister. Ebenso waren mein Onkel Ewald und meine Tante Helga ein zweites »Elternpaar«.
Darüber hinaus schildere ich das Schicksal meiner Großeltern väterlicherseits, Amalie und Otto Unger, die gleich zwei Weltkriege zu überstehen hatten. Der jüngste ihrer vier Söhne ist mein Vater Andreas.
Berlin, August 2015
WOLFSWINTER| 1924 | Fürstenfeld, Bessarabien
An die Wölfe Bessarabiens hatten sich die deutschen Kolonisten längst gewöhnt. Es waren ohnehin nicht mehr viele. Seit fast zwei Jahrhunderten wurden Wölfe getötet, wo immer man auf sie traf. Sie wurden in Wolfsgruben gefangen und mit Mistgabeln erstochen oder einfach mit Knüppeln erschlagen. Gewehre waren nicht verbreitet unter den Bauern. Wer aber ein Gewehr besaß, nutzte es vor allem für die Wolfsjagd.
In einem Wolfswinter jedoch war es anders. In diesem besonders harten Winter fror der Dnister zu. Damit dieser schnell fließende Grenzfluss zu Russland zufrieren konnte, mussten die Temperaturen über Wochen unter minus 20 Grad fallen. Dies geschah immerhin alle drei bis vier Jahre, und dann kamen sie aus Russland über den Fluss: große, ausgehungerte Wolfsrudel, manchmal zwanzig Tiere auf einmal.
Wilhelmines Mutter sollte Recht behalten, dieser Winter war ein Wolfswinter. Schon im Herbst hatte die Mutter prophezeit, dass der Winter hart werden würde. Eben hatte Wilhelmine die Kuh versorgt und die große Schneeschaufel vorsichtshalber gleich mit ins Haus genommen. Rasch tropfte jetzt der Schnee von der Schaufel, denn sie lehnte an der heißen Ofenwand.
Jedes deutsche Haus in Bessarabien hatte so eine Wand, hinter der sich ein besonderer Ofen verbarg. Niemand wusste, wer zuerst angefangen hatte, solche Öfen zu bauen. Aber ohne diese trickreichen Öfen wäre das Überleben im Winter wohl nur schwer möglich gewesen. Die zentrale Stützwand deutsch-bessarabischer Häuser war hohl beziehungsweise eine Doppelwand. An der Stirnseite gab es mächtige Eisenbeschläge mit einer schweren Feuertür. Diese Brennstelle fasste große Mengen Holz. Doch dieses Holz brannte nicht einfach schnell ab. In der Wand schlang sich ein ausgeklügeltes Schornstein-Labyrinth bis nach oben zum Dach. Der Rauch wurde dabei mehrfach innerhalb der Wand umgeleitet, bis er seinen Weg ins Freie fand. Bereits eine Holzladung reichte aus, dass das Mauerwerk die Hitze die ganze Nacht hindurch speicherte und es dadurch bis zum nächsten Morgen behaglich warm blieb.
In den letzten zwei Wochen hatte es so viel geschneit, dass die Wege über den Hof an Schützengräben erinnerten. Ein schmaler Gang führte quer über den Hof zur Scheune, ein anderer am Haus entlang zu den Ställen. Jeden Tag aufs Neue mussten Wilhelmines Brüder die Zugänge freihalten. Nur den Weg zur Sommerküche, schräg gegenüber, sparten sie sich. Schon im Herbst wurde die Großküche aufgegeben, bis zum April würde sie Winterschlaf halten. Mitunter verwehten die Wege in der Nacht so stark, dass die Brüder morgens ganz schön schuften mussten, damit Wilhelmine überhaupt die Kuh melken konnte. Doch in den letzten zwei Tagen hatten sie überraschend wenig zu tun, denn es war für wenige Stunden so warm geworden, dass der Schnee kurz antaute. Dadurch hatte sich eine feste Harschschicht gebildet, und nun lagen die enormen Schneemassen wie versiegelt da. Umso besser, dachten sich die Brüder, denn verwehen konnte der Schnee nun nicht mehr. Aber auch diese Besonderheit hatte einen Nachteil, wie sich bald herausstellen würde.
In dieser Nacht wurde es kälter als jemals zuvor. Die schwache Sonne war soeben untergegangen; der Himmel erschien kristallklar. Das helle Mondlicht fiel auf den Schnee und war kaum von der fahlen Tagessonne zu unterscheiden. Wäre jetzt einer der Dorfbewohner draußen gewesen, er hätte ein merkwürdiges Schauspiel beobachten können: Ohne dass es einer mitbekommen hatte, befand sich das Dorf bereits seit Tagen in einem Belagerungszustand. Auf dem kleinen Hügel jenseits des Ortes hatte sich eine Reihe dunkler Gestalten versammelt. Selbstsicher und ohne die geringsten Anzeichen von Unruhe saßen sie im Schnee, den Blick starr auf das Dorf gerichtet. Die Ohren steil nach vorn gestellt, nahmen sie jedes Geräusch von dort auf. Nichts entging dem Rudel. Das Geklapper aus den Küchen, die Stimmen der Menschen, die Ketten der Tiere in den Ställen. Keiner aus der Gruppe schien es eilig zu haben. Und keiner schien sich verstecken zu wollen. Warum auch? Bislang jedenfalls hatte sie noch niemand gestört auf ihrem Horchposten, dem kleinen Hügel hinter dem Weinberg. Hunderte Kilometer hatte das Wolfsrudel bereits hinter sich gebracht. Die Tiere waren von der langen Wanderung abgemagert, aber immer noch kraftvoll. In diesem kleinen Ort gab es etwas, dass ihren Wandertrieb unvermittelt gestoppt hatte. Wie ein unsichtbarer Magnet zog der unwiderstehliche Geruch von Schafdung das ausgehungerte Rudel an den Hügel. Langsam wurde es ruhig im Dorf. Mit den fallenden Temperaturen schienen auch die Geräusche des Ortes zu verstummen. Plötzlich, gegen Mitternacht, lief der Leitwolf den Hügel hinab, ganz so, als hätte er eine Entscheidung getroffen. Leichtfüßig und im Trab folgten die anderen Wölfe nach. Nur ab und zu brach mal eine Pfote durch die Eisschicht auf dem Schnee, wovon die Tiere sich jedoch nicht aufhalten ließen.
Wilhelmine schlief noch nicht. Jetzt im Winter genoss sie es, lange wach zu liegen und ihren Gedanken nachzuhängen. Im Sommer war das undenkbar. Da war sie gerade mal eingeschlafen, schon hörte sie um halb vier Uhr morgens den Vater vor ihrer Kammer: »Steh uff! S’isch hell Dag!« Nach dem ersten Weckruf hatte sie höchstens drei Minuten Zeit zum Aufstehen, sonst kam die Steigerung: »Steh uff, sag ich! Der Kühhirt knallt scho!« Und sosehr Wilhelmines Muskeln auch schmerzten und brannten von der Feldarbeit, sosehr der junge Körper auch nach Ruhe schrie – es gab keinen Aufschub. Die Lider noch fast geschlossen, taumelte sie in den Stall, lehnte den Kopf an das warme Fell und füllte den Milcheimer. Alles andere wäre eine große Schande gewesen. Wollte sie etwa ein »faules Mädchen« sein? Eine, die die Kuh durch den ganzen Ort auf die Weide »nachtreiben« musste? Sicher nicht. Das ganze Dorf hätte über sie gespottet. Junge Mädchen, die es nicht mal schafften, die Kuh rechtzeitig zu melken, damit der Sammelhirte sie auf die Kuhweide mitnehmen konnte, waren gewiss keine gute Partie … Wilhelmine schaffte es immer. Nicht ein einziges Mal in ihrem Leben hatte sie die Kuh auf die Weide nachtreiben müssen, und darauf war sie sehr stolz.
Doch jetzt im Winter war alles anders. Man hatte Zeit. Die Kuh blieb ohnehin im Stall, und die Nacht war lang. Wilhelmine dachte nach. Die aufregende Veranstaltung der »Sabbatianer« ging ihr nicht mehr aus dem Kopf. Gegen den Willen ihrer Mutter hatte sie daran teilgenommen. Die Versammlung wurde von einem großen, gut aussehenden Mann mit stahlblauen Augen geleitet. Dieser Mann kam extra aus Amerika ins abgelegene Bessarabien angereist, um die Wahrheit zu verkünden. Und was er zu sagen hatte, war für Wilhelmine neu und überaus spannend gewesen. So hatte er erklärt, dass der Sonntag der falsche heilige Tag sei. Gott hatte dafür eigentlich den Samstag bestimmt, und so würde es auch in der Bibel stehen. Konnte das wirklich wahr sein? Wilhelmine ließ das keine Ruhe. Und wenn das wirklich stimmte, wäre dann auch alles andere wahr? Dass in der Bibel stand, Gott wollte nicht, dass die Menschen Schweinefleisch essen? Wilhelmine hatte direkt nach der Veranstaltung die einzige Autorität gefragt, die es im Ort gab: den Pfarrer, der zugleich ihr Schullehrer war. Der sollte es wohl wissen. Der Pfarrer hatte laut aufgelacht und gesagt, das mit dem Samstag sei großer Blödsinn. Und das würde er jetzt und hier sogleich beweisen. Dann hatte er sich seine Nickelbrille aufgesetzt, die Bibel zur Hand genommen, seinen Zeigefinger angeleckt und die zehn Gebote aufgeschlagen. Mit kräftiger Stimme begann er vorzulesen: »Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebenten Tage ist der …«, plötzlich murmelte der Pfarrer nur noch. Wilhelmine konnte ihn kaum verstehen. Unvermittelt schlug er die Bibel zu, warf den Kopf nach hinten und schritt wortlos von dannen. Seit dieser Geschichte wusste Wilhelmine, dass der Pfarrer gelogen hatte. Und dass der Mann mit den schönen blauen Augen die Wahrheit gesagt hatte.
Dann passierte es. Ein furchtbarer Schrei riss Wilhelmine aus ihren Gedanken. Dieser Schrei war das Schrecklichste, was Wilhelmine jemals gehört hatte. Er klang tierisch menschlich. Verzweifelt und – endgültig. Kurz darauf ein lautes Gepolter, so als würden Sachen umgestoßen. Erstarrt lag Wilhelmine in ihrem Bett und lauschte in die Nacht. Jetzt muhte die Kuh ohne Unterlass, dann war lautes Kettenrasseln zu hören, dann wieder Gepolter; offenbar spielten die Pferde in ihren Boxen verrückt. »Johan! Das ist der Wolf!«, hörte sie die Mutter schreien. Der Vater rannte zur Tür, griff nach der Schaufel, die noch an der Ofenwand lehnte, und wollte hinaus. Kaum hatte er die Haustür geöffnet, da zwängte sich eine zottelige graue Gestalt an ihm vorbei, rannte in die Küche und kauerte sich unter den Küchentisch. Voller Entsetzen war Wilhelmine, die es nun auch nicht mehr in ihrem Bett ausgehalten hatte, jetzt davon überzeugt, dass ein Wolf unter dem Küchentisch saß. Doch die Mutter erkannte sofort, dass es der eigene Hofhund war. Mit eingeklemmtem Schwanz und fiepend vor Angst hatte er sich unter den Tisch verkrochen. Wilhelmine sah jetzt die abgerissene Hofleine darunter hervorlugen, und ein Wolf hätte bestimmt keine Leine gehabt.
Der echte Wolf war im Stall gefangen. Er roch die Menschen. Voller Panik sprang er so hoch er konnte, doch den Weg, den er gekommen war, konnte er nicht mehr zurück. Sein Einbruch in den Stall war leicht gewesen. Draußen an der Giebelwand stand ein alter Leiterwagen. Er war so hoch eingeschneit, dass sich eine Rampe gebildet hatte, die bis unter die Giebelluke des Stalls reichte. Durch die Eisschicht war der Schnee fest, und der Wolf konnte bis zur Giebeltür laufen, dort etwas rütteln, und schon war er in den Stall hinabgefallen. Aber was jetzt? Zurück ging es so nicht, schon gar nicht mit seiner Beute, dem Schaf. Blutig vom Kehlbiss – das Schaf war jedoch noch nicht ganz tot – sprang der Wolf verzweifelt die Stallwand hoch. Der Vater und Wilhelmines Brüder standen vor der Stall tür. »Warte!«, schrie der Vater, »noch nicht aufmachen! Fritz soll die Mistgabel holen!« Eine endlose Zeit verging. Im Stall lautes Gepolter, das unaufhörliche Muhen der Kuh, dazu das Getrampel der Pferde in ihren Boxen und ein zunehmend atemloser, panischer Wolf, der weiterhin gegen die Stallwand sprang. Endlich kehrte Fritz mit einer Mistforke und einem Dreschschlegel zurück. Sofort griff sich der Vater die Forke, holte tief Luft und rief: »Aufmachen!« Kaum war die Stalltür offen, rannte der Leitwolf aus dem Stall. Fast hatte er es geschafft. Doch in einer letzten Drehbewegung erwischte ihn das kalte Metall der Mistgabel im Unterbauch. Mit ganzer Kraft drückte der Vater den Wolf auf den gefrorenen Boden, als wollte er ihn festnageln. Heulend vor Schmerz drehte sich der Leitwolf wie ein wütender Lindwurm und kämpfte um sein Leben. »So erschlagt ihn doch!«, schrie der Vater. Laut klappernd knallte der Dreschschlägel auf den betonharten Boden, denn Fritz schlug wiederholt daneben. Fast dasselbe Geräusch machten auch die Zähne des Wolfs; auch er schnappte laut und bedrohlich ins Leere, bis plötzlich ein kräftiger Schlag alles beendete. Endlich. Der Wolf war tot. Regungslos lag er auf der Seite, die lange Zunge fiel aus dem Maul und fror augenblicklich am Boden fest.
NEUE HEIMAT| 1969 | Neu Wulmstorf
Auch dieses Mal hockte ich wie stets am Ende einer Wolfsgeschichte unter dem Couchtisch. Das stellte kein Problem dar, denn ich war erst sechs Jahre alt. Das Wohnzimmer meiner Großeltern war für Stunden unwirklich geworden. Ich war dort! Im kältesten Winter aller Zeiten. Ich konnte alles sehen: den Wolf, den Schnee, den Hund. Ich konnte alles riechen: den Stall, das Blut, das Schaf. Ich konnte alles hören: den schnappenden Wolf, das Muhen der Kuh.
Wie betäubt tauchte ich langsam unter dem Couchtisch mit der bunten Marmorplatte hervor. Ich hörte das Ticken der mächtigen Wanduhr, die meine Oma Wilhelmine jeden Abend weihevoll aufzog. Es roch nach Rosenöl. Obwohl es im Deutschland der 1960er-Jahre natürlich immer Strom gab, hatte meine Oma grundsätzlich eine frisch gefüllte Öllampe auf dem Schrank parat stehen – man konnte ja nie wissen. Ich schaute mich um: Neben mir lagen Erdnussschalen verstreut. Im Verlauf der spannenden Wolfsgeschichte hatte ich die kleine Tonschüssel nicht mehr getroffen, die für die Schalen bestimmt war.
Draußen herrschte tatsächlich Winter, auch hier in Deutschland. Doch war dies alles nichts. Nichts war hier überhaupt irgendetwas. Der Schnee nicht, der Winter nicht, die Tiere nicht und die Menschen schon gar nicht. Hier war alles nur – Abklatsch.
Das wahre Leben war ein für alle Mal verloren. Die Wirklichkeit war verloren. Die wirklich heißen Sommer, die wirklich kalten Winter, die wirklich ehrlichen Leute, die wirkliche Gemeinschaft, die wirklich harte Arbeit, das wirklich gute Essen, der wirklich wahre Glaube. Von einem Tag auf den anderen musste alles Wirkliche zurückgelassen werden, in der Heimat, in Bessarabien. Was blieb, waren Erinnerungen. An das schöne Leben, früher. Und was noch blieb, waren Hoffnungen. Auf ein Paradies im Jenseits. Und in der Zwischenzeit gab es nicht allzu viel von Wert.
Ich war erst sechs, doch ich wusste bereits – dieses Leben war nicht von Belang. Ohnehin konnte es nicht mehr allzu lange dauern. Der Weltuntergang war nah! Das wussten meine Großeltern ganz genau. Ich war täglich hier, denn ich wohnte mit meinen Eltern auf demselben Hof. Und es hatte den Anschein, dass meine Mutter Katja ganz froh darüber war, wenn ich bei meiner Oma Wilhelmine steckte, denn meine Mutter hatte schon genug Sorgen. Immerzu musste sie mit meinem Vater Andreas streiten, den ich so gut wie nie zu sehen bekam. Entweder war er in Hamburg, um zu arbeiten, oder er war auf seinem Taubenschlag, auf dem ich nur störte.
In den Geschichten meiner Oma ging es fast nur um früher. Stundenlang lag ich unter dem Couchtisch und aß Erdnüsse oder selbst gebackene Kekse. Oder ich saß in der Küche und schaute Oma fasziniert beim Kochen zu. Ich sah zu, wie sie Hühner ausnahm und mit Spiritus absengelte. Ich schaute mir dann die Innereien ganz genau an. Das Herz. Die Leber. Ich schaute zu, wie sie Fleisch durch den Fleischwolf drehte, um Leberwurst zu machen. Das klapprige Gerät war ihr ein und alles, es hatte sogar die Flucht überstanden. Es quietschte entsetzlich, wenn Oma die Handkurbel drehte, und am Ende des Tages tat ihr das Handgelenk schrecklich weh, aber diese Prozedur war unverzichtbar. Zwar hätte meine Oma überall Leberwurst kaufen können, aber da wäre dann sicherlich Schweinefleisch drin gewesen. Oder der Schlachter hatte vorher Schweinefleisch verwurstet und danach das Gerät nicht richtig sauber gemacht. »Nee, nee, des kansch net mache«, sagte Oma. Besser, man machte das selbst. Da wusste man, was man hatte. Oder ich schaute erstaunt zu, wie Oma Maiskörner in »Bobsche« (Popcorn) verwandelte. Toll, wie laut es in dem schwarzen Eisentopf knallte, wenn die Körner an den Deckel sprangen.
Währenddessen entführte mich Oma in eine fremde Welt voller Wölfe, mit Schneebergen, wehrhaften Männern mit Mistgabeln, heißen Sommern, Wassermelonen, prachtvollen Maisfeldern, frischer Milch, gutem Fleisch, selbst gemachtem Käse, starken Pferden und Gedärm im Weinberg. Gedärm im – was? Ja, das war nämlich so: Wölfe suchen sich ein möglichst kleines Schaf aus und zerren es in den Weinberg, denn dort kann sie keiner sehen. Im Weinberg beißen sie dem Schaf dann in den Bauch, und zwar so, dass er aufreißt und die Gedärme rauskommen. Dann nehmen die Wölfe das Schaf mit in den Wald, um es dort in Ruhe aufzufressen, aber die Gedärme bleiben im Weinberg liegen. Und wie Gedärme aussehen, das wusste ich ganz genau von den Hühnern.
Manchmal ging es in den Geschichten meiner Großeltern auch nicht um früher. Dann wollten sie mir erklären, was bald passieren würde. Offenbar verheimlichten mir meine Eltern die Wahrheit: Schon bald, so in zwei oder drei Jahren, würde es wieder Krieg geben. Doch diesmal würde alles noch viel, viel schlimmer werden als das, was meine Großeltern zuvor in zwei Weltkriegen erlebt hatten. Und sie hatten ja einiges erlebt. Bomben, Flucht, Vertreibung, Schmerz, Tod und Vergewaltigung – alles Pipifax gegen das, was bald kommen würde.
Im dritten Weltkrieg würde zunächst ein Drittel aller Menschen einander auf bestialische Weise massakrieren. Dann, auf dem Gipfel des Chaos, würde es tagsüber ganz dunkel und ganz still, so wie in der Nacht. Überall gingen dann die Gräber auf, die Toten kämen heraus und würden sich verschlafen umsehen. Dann würde ein Fleck im Himmel gleißend hell werden, so hell, dass man kaum hinsehen kann. Aber wenn man die Augen etwas zukniff, kann man irgendwie doch Jesus erkennen, der als mächtiger König auf einer Wolke zur Erde schwebt. Jesus, der dann endgültig die Nase vollhat von den bösen Menschen, würde alle guten und gerechten Menschen mit sich in den Himmel nehmen, in Sicherheit. Jesus kann die Auserwählten für das Himmelreich ganz leicht erkennen, denn es sind diejenigen, die das »Zeichen« haben. Und nur Siebenten-Tags-Adventisten haben dieses Zeichen.
Als Sechsjähriger stellte ich es mir immer als eine Art Brandzeichen vor. Vermutlich war es ein großes »Z« auf der Stirn. Aber nur Adventisten, die sich wirklich an alle Regeln der Bibel gehalten hatten, bekamen von Gott ein großes Z auf die Stirn gebrannt. Also nur die, die den Sabbat heiligten und nicht den Sonntag. Und nur die, die nicht rauchten. Und nur die, die kein Schweinefleisch aßen. Zu Rauchern und Schweinefleischessern würde Jesus sagen: »Hinweg! Ich kenne euch nicht!«
Dann wird sein ein Heulen und Zähneklappern, denn wehe dem, der danach noch auf der Erde bleiben muss. Dann geht der Horror erst richtig los … Unter der Herrschaft des Teufels, der nun ungezügelte Macht auf Erden bekommt, werden sich alle bösen Menschen, also Katholiken, Evangelische, Raucher, Schweinefleischesser, Alkoholtrinker, Kartenspieler und Musikhörer nach Herzenslust umbringen, quälen und massakrieren. Tausend Jahre lang.
Und tausend Jahre kamen mir schon damals, als Sechsjähriger, ziemlich lang vor. Dann, nach tausend Jahren Quälerei, kommt Jesus abermals auf die Erde. Aber nur, um endgültig Schluss zu machen mit der verbliebenen Brut. Dann verbrennt er alle bei lebendigem Leib, schmeißt den Teufel in ein Höllenloch und reinigt die Erde. Danach baut er ein neues, goldenes Jerusalem und alle guten Menschen (also, die Siebenten-Tags-Adventisten) dürften fortan in Frieden auf Erden leben.
Meine Oma hat mir Bilder gezeigt, wie schön das wird. Wir werden dann alle auf grünen Wiesen sitzen, die Bäume prahlen mit ihren Früchten, und mit den Wölfen kann man schmusen. Denn sie fressen dann keine kleinen Schafe mehr, sondern nur noch Gras. Und bis dahin?
Bis zum nahen Weltuntergang sollte ich nach außen hin das tun, was alle Mitglieder meiner Familie machten: »so tun als ob«. Doch bevor ich im Paradies die Wölfe kraulen durfte, musste ich erst mal zur Schule. Der Weg dorthin war eine Tortur. Nicht, dass er lang oder mühsam gewesen wäre, ganz im Gegenteil, er war viel zu kurz.
Hier in Neu Wulmstorf, in die Siedlung »Neue Heimat«, hatte es unsere Enklave ehemaliger Bessarabiendeutscher verschlagen. Nach kurzfristiger Zwangsumsiedlung 1940 vom heutigen Moldawien nach Polen ging es 1945 von Polen ein zweites Mal auf die Flucht, diesmal nach Westdeutschland. Zweimal Flucht, zweimal Hals über Kopf, zweimal unter Lebensgefahr. Als ich 1963 geboren wurde, lag die letzte Flucht schon 18 Jahre zurück. Doch in den Köpfen meiner Mutter und meiner Großeltern Müller war es erst gestern.
Hier in der »Neuen Heimat« waren es tatsächlich nur 300 Meter bis zu meiner Schule, schnurgerade die Straße hoch. Jeden Morgen ging ich diesen viel zu kurzen Weg so langsam wie nur irgend möglich. Und manchmal kam ich auch gar nicht in der Schule an.
»Wie kannst du dich auf diesem kurzen Weg nur verlaufen? Wie ist das möglich?« Meine Mutter konnte das nicht begreifen. In Wahrheit entpuppte sich mein Leben seit meiner Einschulung als einziger Horrortrip. Nie fühlte ich mich fremder als zur Zeit meines ersten Kontakts mit der »normalen« Welt, denn in dieser Welt war alles falsch, alles gelogen, alles verloren und alles Surrogat.
Mit meiner Einschulung wurde mir augenblicklich bewusst, wie anders ich war. Was ist das, wofür sich die anderen da begeistern? Und wozu? Rechtschreibung oder Mengenlehre? Schwimmen und Noten lernen? Was sollte ich zu Hause darüber erzählen? Zu Hause konnte keiner Noten lesen. Zu Hause konnte keiner schwimmen. Zu Hause konnte keiner Mengenlehre. Und lesen konnten meine Großeltern nur die Bibel. Und auch das nur mit dem Finger die Buchstaben entlang. Wort für Wort.
Konnte ich wirklich so kolossal anders sein, so fremd? Noch anders als die anderen Aussiedler, die doch schon so anders waren? Und noch anders als die Christen, die ihren Glauben wirklich ernst nahmen, obwohl diese ja schon so anders waren? Ja, konnte ich. Aussiedler kamen normalerweise aus West- oder Ostpreußen. Doch die Familie meiner Mutter kam aus Bessarabien.
»Aus … Was? Arabien? Du siehst gar nicht so arabisch aus.«
»Nein, aus Bessarabien. Das ist nicht in Afrika.«
»Aha …«
»Nein, ich esse kein Schweinefleisch.«
»Hä? Kein Schweinefleisch? Wieso das denn? Jude oder was?«
»Nein, ich bin kein Jude.«
»Aber du gehst auch samstags nicht zur Schule!«
»Nein, ich gehe samstags nicht zur Schule. Das liegt daran, dass der Sonntag der falsche heilige Tag ist. Am Sonntag soll man eigentlich arbeiten. Aber am Sabbat darf man dafür gar nix machen.«
»Wo gibt’s denn so was? Am Sabbat … Du bist also doch ein Jude!«
»Nein, ich bin kein Jude.«
Mein Anderssein zu erklären war mühsam. Wenn überhaupt, so fühlte ich mich eher wie ein kleiner Russe. Immerhin hieß meine Mutter Katja, und ihr Vater, mein Opa Jakob, sah aus wie der Zwillingsbruder von Leonid Breschnew. Samstags trug er schwarze Anzüge und eine glänzende, pechschwarze Schaffellmütze, eine echte Karakulmütze, die allerdings hervorragend zu seinen monströsen und ebenfalls pechschwarzen Augenbrauen passte. Dass mein Opa eigentlich aussah wie ein Bilderbuchrusse, konnte ich mir erst sehr viel später eingestehen.
Meine Oma wurde nie müde zu betonen, dass unsere Familie immer »arisch« geblieben sei. Unter keinen Umständen hätte sich ein Deutscher mit einem Russen, Rumänen, Moldowaner oder Juden »eingelassen«. Wir sind immer deutsch geblieben! Garantiert. Bei dem Wort »Moldowaner« verzog meine Oma noch verächtlicher das Gesicht als bei »Jude«.
Moldowaner … Bis heute weiß ich nicht so genau, wen sie damit eigentlich meinte. Als Kind stellte ich mir irgendwelche wilden Ureinwohner vor. Ja, diese Moldowaner oder Juden hätte es zwar gegeben, aber die wohnten niemals mit »echten Deutschen« zusammen. Die kamen höchstens mal vorbei als fliegende Händler oder Kesselflicker. Auf jeden Fall mussten das sehr finstere Gestalten sein, da war ich mir sicher. Wie auch immer, Bessarabiendeutsche blieben jedenfalls »reine Deutsche«. Um jeden Preis. Selbst wenn irgendwann jeder mit jedem verwandt war.
Nur 9000 fleißige Schwaben waren 1814 in das fruchtbare Land zwischen Rumänien und der Ukraine aufgebrochen. Doch als sie 1940 wieder gingen, waren es fast 100000. 130 Jahre lang heirateten und mehrten sich die Schwaben nur unter ihresgleichen. Aber – der eine oder andere kulturelle Übersprung schien trotzdem stattgefunden zu haben. Das merkte man am guten Joghurt. Und an den leckeren Maisspeisen. Und am Schafskäse. Und – an den monströsen Augenbrauen meines Großvaters … Auf jeden Fall aber merkte man es an den Schaffell-Karakulmützen! Der letzte Schrei für echte Männer Bessarabiens. Ebenso wie rotes Zaumzeug für die Pferde oder lange geflochtene Pferdepeitschen aus weichem Leder.
Im Neu Wulmstorf der 1960er-Jahre kamen Zaumzeug und Peitschen weniger gut an, deshalb ließ mein Opa Jakob sie vermutlich weg. Doch seine Karakulmütze ließ er sich zeit seines Lebens nicht nehmen.
Der kleine Russe in mir hatte allerdings einen starken Gegenpol. So fühlte ich mich auf der anderen Seite immer ein bisschen wie ein kleiner Amerikaner. Immerhin heiße ich Raymond, Kurzform Ray, original amerikanisch geschrieben. Darauf legte mein Vater großen Wert, denn ein deutscher Raymond schreibt sich Reimund oder Raimund oder Raimond. Tatsächlich wurde ich aber benannt nach Raymond, dem amerikanischen Unteroffizier, mit dem mein Vater seinen Dienst in der U.S. Army geleistet hatte.
Mein Vater wollte unbedingt Amerikaner sein. So sehr, dass er als junger Deutscher nach Amerika ging und dort in die U.S. Army eintrat, um später als »Besatzer« nach Deutschland zurückzukehren. Als Sieger! Endlich … Das war schon was. Mit dickem Cadillac im kleinen Neu Wulmstorf Ende der 1950er-Jahre.
»Da hat die Familie deiner Mutter, diese Hinterwäldler aus Bessarabien, ganz schön geguckt! Die hatten nämlich nur Fahrräder oder Mopeds. Oder, wenn es hochkam, eine BMW Isetta …«, sagte mein Vater manchmal, wenn er genug Bier getrunken hatte. Und wenn mein Vater damals meine Mutter besuchte, kam an seinem Cadillac aus Chicago keiner mehr vorbei, so breit war der. Oder anders gesagt, so schmal war unsere Gasse in der »Neuen Heimat«. Zur Strafe wurde meine Mutter, die meinen Vater auch noch in voller U.S.-Army-Uniform heiratete, als »Ami-Flittchen« beschimpft. Zu Unrecht. Denn trotz seiner Mimikry blieb mein Vater immer Deutscher. Man kann nicht alles haben.
DAS BOOT| 1916 | Jütland, Nordsee
Der »Alte« war nervös. Irgendwas wusste er, was Otto Unger, der Vater meines Vaters, und die anderen aus der Mannschaft nicht wussten. In aller Eile wurde das Boot beladen. Für die langen Patrouillenfahrten im Kanal wurde sonst eindeutig mehr Essen gebunkert. Offenbar ging es diesmal woanders hin. Doch was war das Ziel? Auf jeden Fall würde die Fahrt kürzer ausfallen, zumindest ließ das Wenige an Proviant darauf schließen. Stattdessen wurden in der letzten Nacht Torpedos neuester Bauart verladen, solche, die »ihr Ziel fast von allein finden«, sagte der Alte. Das war natürlich Quatsch, denn eigentlich rauschten viele Torpedos am Ziel vorbei. Er sagte so was trotzdem, wohl um die Mannschaft zu beruhigen. Das war so seine Art.
Mein Großvater Otto war ein lustiger Geselle und fühlte sich bei der Kaiserlichen Marine pudelwohl. Gern spielte er Karten, und dem einen oder anderen Bierchen war er auch nicht abgeneigt. Ein Foto aus dieser Zeit zeigt ihn in Marineuniform: Er sitzt an einem Tisch mit drei Kameraden und spielt Karten. Einer hat sich die Schuhe ausgezogen und hält die Spielkarten mit den Zehen.
Otto hatte inzwischen mitbekommen, dass die Kaiserliche Marine ein ganz besonderer Truppenteil war. Er konnte das beurteilen, schließlich war er, bevor er zur U-Boot-Waffe wechselte, Infanterist gewesen. Nun kam ihm der furchtbare Grabenkrieg schon vor wie aus einem anderen Leben, und doch lag er erst knapp ein Jahr zurück.
Für Otto war der dunkle und nach Dieselöl stinkende Bauch eines U-Bootes ein nahezu freundlicher Ort im Vergleich zu den Gräben an der Westfront. Dort hatte es oft wochenlang geregnet. Schnell sammelte sich in den schmalen Gräben eine dunkle Brühe aus Wasser, Schlamm und Fäkalien. Das Kot-, Urin- und Sandgemisch drang überall ein, zuerst in die Stiefel. Die rauen, nassen Wollsocken und der kalte Sand ließen die Füße in kürzester Zeit zu entzündeten Klumpen anschwellen. Einige Fußgeschwüre wurden dunkel und stanken bestialisch.
Natürlich wussten die Kommandeure, dass diese Hölle nur wenige Tage durchzuhalten war, auch ohne jegliche Kampfhandlung. In der Regel wurden die Soldaten im vordersten Schützengraben nach maximal zwei Wochen abgelöst. Doch für viele Kameraden war dies bereits zu lang. Schlaf- und Wassermangel taten ihr Übriges, der ganze Körper war nach wenigen Tagen eine einzige Wunde.
Über die Köpfe flogen Granaten, zudem lauerten auf beiden Seiten Scharfschützen, die nur darauf warteten, dass tagsüber mal einer zu sehen war. Wer seinen Kopf hob, starb. Wer nach vorn angriff, starb. Wer nach hinten floh, starb. Schon nach wenigen Tagen waren die meisten Kameraden mental am Ende. Einige beteten ohne Unterlass. Viele saßen auch einfach nur da und starrten in den Matsch, als gäbe es dort etwas Interessantes zu sehen. Die häufigsten Verletzungen waren Kopf- oder Splitterverletzungen, und auch Otto erwischte es schwer. Ein Hartkerngeschoss durchdrang ein Grabenschild, das eigentlich Schutz bieten sollte. Es durchschlug Ottos Scheitelbein, durchtrennte einige Blutgefäße und nahm beim Wiederaustritt etwas Hirnmasse mit. Schwer verletzt wurde Otto in ein Lazarett eingeliefert. Der Kopfschuss sollte sein Leben für immer verändern.