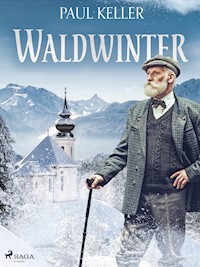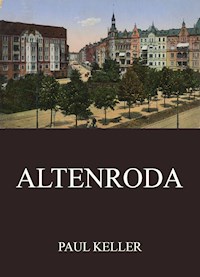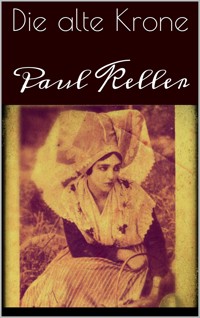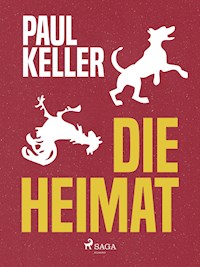
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Im Buchenhofe war ein Hühnchen ermordet worden. Der Verdacht lenkte sich auf Waldmann, den Dachshund, der nach der Tat flüchtig geworden war. Es war auch dem Schaffersohne Hannes, der sich sofort aufgemacht hatte, die Spuren des Mörders zu verfolgen, nicht gelungen, des Attentäters habhaft zu werden." Mit diesen Worten beginnt Paul Kellers berühmter schlesischer Heimatroman, der das Wort "Heimat" ja schon im Titel trägt. Zu den kleinen Katastrophen, wie der Sache mit dem Huhn, gesellen sich freilich bald auch die großen, und so gestaltet sich das Buch zu einer packend erzählten Tragödie menschlicher Irrungen und Fehden und singt darüber hinaus das Hohelied der Treue und Liebe zur Heimat. Im Zentrum der Handlung um Heim und Hof, Familie, Feindschaft, Treue und Liebe stehen packende Gestalten wie der Hannes und die Lene und vor allem der Sohn seines Herrn, Heinrich Raschdorf, sowie dessen Familie und, nicht zu vergessen, Heinrichs geliebte Lotte. Ein Buch, das man nicht nur gerne liest, sondern das auch eine Palette wunderbar fein gezeichneter Charaktere entfaltet, die den Leser auch nach Ende der Lektüre noch lange begleiten. "Die Heimat" – von Felix Dahn als "echte Heimatkunst" gelobt – gehört zu den erfolgreichsten Büchern des großen Unterhaltungsautors Paul Keller, dessen Werke in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts Millionenauflagen erzielten und die teils bis heute immer wieder aufgelegt werden.Paul Keller (1873–1932) wurde als Sohn eines Maurers und Schnittwarenhändlers geboren. Zwischen 1887 und 1890 besuchte er die Präparandenanstalt in Bad Landeck und anschließend von 1890 bis 1893 das Lehrerseminar in Breslau. Nachdem er acht Monate als Lehrer im niederschlesischen Jauer tätig war, wechselte er 1894 als Hilfslehrer an die Präparandenanstalt in Schweidnitz. Zwischen 1896 und 1908 war er Volksschullehrer in Breslau. Keller gründete die Zeitschrift "Die Bergstadt" (1912–1931) und schrieb schlesische Heimatromane sowie "Das letzte Märchen", eine Geschichte, in der ein Journalist in ein unterirdisches Märchenreich eingeladen wird, um dort eine Zeitung aufzubauen, und dabei in Intrigen innerhalb des Königshauses hineingerät. Die Namen wie "König Heredidasufoturu LXXV.", "Stimpekrex", "Doktor Nein" (der Oppositionsführer) haben wahrscheinlich Michael Ende zu seinem Roman "Die unendliche Geschichte" angeregt. Zusammen mit dem schlesischen Lyriker und Erzähler Paul Barsch unternahm Keller zwischen 1903 und 1927 zahlreiche Reisen durch Europa und Nordafrika. Zudem führten ihn etliche Lese- und Vortragstourneen durch Deutschland, Österreich, die Schweiz und die Tschechoslowakei. Er war 1910 Mitglied der Jury eines Preisausschreibens des Kölner Schokoladeproduzenten Ludwig Stollwerck für Sammelbilder des Stollwerck-Sammelalbums Nr. 12 "Humor in Bild und Wort". Keller starb am 20. August 1932 in Breslau und wurde auf dem dortigen Laurentiusfriedhof bestattet. – Paul Keller gehörte zu den meistgelesenen Autoren in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, was sich in einer 1931 bei fünf Millionen liegenden Gesamtauflage seiner Bücher widerspiegelt, und wurde in 17 Sprachen übersetzt. Schriftsteller wie der alte Wilhelm Raabe oder Peter Rosegger schätzten den Autor sehr. Gerade die früheren Werke wie "Waldwinter", "Ferien vom Ich" oder "Der Sohn der Hagar" zeichnen sich durch künstlerische Kraft und Meisterschaft aus. Seinen Roman "Die Heimat" (1903) nannte Felix Dahn "echte Heimatkunst". Seine bekanntesten Werke wurden zum Teil auch verfilmt.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 341
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Keller
Die Heimat
Roman
Saga
Die Heimat
© 1912 Paul Keller
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711517345
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Im Buchenhofe war ein Hühnchen ermordet worden. Der Verdacht lenkte sich auf Waldmann, den Dachshund, der nach der Tat flüchtig geworden war. Es war auch dem Schaffersohne Hannes, der sich sofort aufgemacht hatte, die Spuren des Mörders zu verfolgen, nicht gelungen, des Attentäters habhaft zu werden. „Der Gauner is ausgerückt“, meldete er niedergeschlagen dem Sohne seines Herrn, dem vierzehnjährigen Heinrich Raschdorf, der zu den Ferien daheim war. „Ich sag’ dir, a muss in a Fuchsloch gekrochen sein, sonst hätt’ ich ’n erwischt. Ich hab’ gesucht wie verrückt!“
„Wenn er Hunger haben wird, kommt er von selber nach Hause“, sagte voll Überlegung Heinrich, der Quartaner.
„Ja, und weisste was? Dann machen wir ’n Heidenulk! Wir machen Gericht! Du bist der Richter, und ich bin der Poliziste, und du verurteilst a Dackel, dass ihm der Poliziste fünfe aufs Leder haut, und dass a ihn mit der Schnauze a paarmal aufs tote Hühndel stampt, und dass a ihn ’ne Stunde in a Kohlschuppen sperrt. Gelt, Heinrich, das machste?“
„Ich werd’ mir’s überlegen“, antwortete in vornehmer Ruhe der Quartaner.
Diese Zurückhaltung schien dem lebhaften Bauernburschen nicht zu gefallen. Er sann über etwas anderes nach.
Nicht lange, so hatte er’s.
„Ja, und weisste was, Heinrich? Das Hühndel werden wir begraben. So ’n Begräbnis macht auch ’n riesigen Spass! Du machst a Pfarrer ...“
„Das ist mir schon zu kindisch, das hab’ ich früher gemacht“, erwiderte Heinrich.
„Na, hör mal, wenn du auch Quartaner bist, kannste doch noch ’n Pfarrer machen. Siehste, ich bin der Totengräber. Wir machen ’n Leichenzug, und ich setz’ mir Vaters Zylinder auf und geh so wackelig vorm Zug her, gerade wie der alte Lempert. Was Ulkigeres wie ’n Totengräber gibt’s nich. Na, und die Mädel sind doch och dabei, die Lene und die Lotte und die Liese. Die müssen flennen. Und wenn du die Rede hältst, müssen sie immer mehr flennen, und nachher lassen wir das Hühndel ins Grab, und die Mädel singen: ‚In der Blüte deiner Jahre‘. Na, wenn das nischt is ...!“
Der Quartaner überlegte. Die Beredsamkeit seines ländlichen Freundes beeinflusste ihn. Skrupel hatte er ja freilich. Seine „Kollegen“ in der Quarta würden so etwas „einfach dämlich“ gefunden haben. Also sagte er langsam und bedächtig.
„Eigentlich ist es kindisch! Aber dir zu Gefallen können wir’s ja noch einmal machen. Doch es ist das letzte Mal, Hannes, das sag ich dir. Und Vater und Mutter dürfen nichts wissen.“
„Die wissen sowieso nischt“, sagte Hannes. „Der ‚Herr‘ sitzt drüben beim Schräger, und die ‚Frau‘ hat ’n Kopfkrampf und liegt im Bette. Besser kann sich’s nich treffen.“
„Na, denn meinetwegen, Hannes!“
Hannes war von diesem Zugeständnis freudig berührt. Er hob einen dürren Stecken aus dem Garten auf, rannte ans Fenster des stattlichen Bauernhauses und klopfte dreimal feierlich an.
Der Kopf eines dunkeläugigen, bildhübschen Mädchens von etwa zwölf Jahren wurde sichtbar.
„Was is ’n los!“
Hannes senkte geheimnisvoll das Haupt und sagte mit der düsteren Stimme eines „Grabebitters“:
„Der Herr Raschdorf lässt schön grüssen, und a lässt bitten, dass die Jungfer Magdalene so freundlich sein täte und ’m toten Hühndel ’s letzte Ehrengeleite geben. Der Pfarr’ und die Schule gehn mit!“
„Macht ihr wirklich Begräbnis?“ fragte sie, nicht ohne Begeisterung.
„Natürlich, Lene“, antwortete der Leichenbitter und fiel aus der Rolle. „Es wird riesig ulkig. Heinrich is Pfarrer und ich Totengräber, und du musst das Hühndel in a Sarg legen. Auf ’m Kleiderschranke sind ja die Zigarrenkisten; da nimmste eine, und da haste die Leiche!“
Damit warf er dem Mädchen das tote Hühnchen, das er bisher in der Hand getragen hatte, aufs Fensterbrett, schlug sich selber mit dem „Grabebitterstöckel“ ein paarmal auf die Waden und rannte davon.
Der „Buchenkretscham“ war vom „Buchenhofe“, auf dem Heinrich und Magdalene die Kinder der Herrschaft waren, Hannes aber als Sohn des „Schaffers“ lebte, nur durch die Strasse getrennt, die von der Stadt her nach dem schlesischen Gebirgsdorfe führte. Früher waren beide Höfe zu einer grossen „Herrschaft“ vereinigt gewesen. Der letzte Besitzer war bankerott geworden, das Gut wurde zerstückt, einzelne Teile des Ackers wurden an Bauern des Dorfes verkauft; aus dem Rest der Felder und den Gebäuden aber entstanden zwei neue Besitztümer, immer noch sehr stattlichen Umfanges: der Buchenhof Hermann Raschdorfs und der Buchenkretscham des Julius Schräger.
Vor dem Kretscham machte Hannes vorsichtig halt. Er schlich an ein Fenster der Gaststube und lugte vorsichtig durch die Scheiben. Die Ausschau befriedigte ihn. Sein „Herr“ und Schräger, der Gastwirt, sassen beisammen und sprachen eifrig miteinander. Diese beiden würden voraussichtlich die Trauerfeierlichkeit nicht stören. Also begab sich Hannes Reichel nach dem Hausflur. Er hatte Glück und traf die Schräger-Lotte, die er suchte.
Das etwas blasse Kind erschrak ein wenig, als es Hannes dreimal mit seinem Stecken auf den Arm klopfte und sagte: „Der Herr Raschdorf lässt schön grüssen, und ob die Jungfer Lotte vielleichte so freundlich sein täte und ’m toten Hühndel ’s letzte Ehrengeleite geben. Der Pfarr’ und die Schule gehn mit!“
„Was? Der Herr Raschdorf sitzt ja drin in unserer Stube. Und warum hauste mich denn so auf den Arm?“
Der Grabebitter fiel abermals aus der Rolle.
„Tumme Gans, der Herr Raschdorf is der Heinrich, und wenn du nich in ’ner halben Stunde drüben bist und mitmachst, da – da sollst du mal sehen!“
Das Mädchen wollte noch etwas fragen, aber Hannes „schmitzte“ bereits seine Waden und „sockte“ ab.
„Mit der Lotte is nischt los“, sagte er zu sich selbst.
„Sie is ’ne Tunte! Aber die Lene, die Lene!“
Und das Bürschlein blieb einen Moment stehen und verdrehte verliebt die Augen. Dann setzte es sich schnell wieder in Bewegung.
Im grellhellen Lichte des Julitags lag das Dorf langgestreckt drunten im Tal. Die Nordseite war durch einen waldigen Hügelzug abgeschlossen, an dessen Abhang, etwas abgesondert vom Dorfe, die Buchenhöfe lagen. Drüben die südliche Einrandung der Talmulde war viel niedriger, ganz mit gelben Saaten bestanden, über denen schwer und schwül die Sommersonne lag. Und all die vollen Ähren standen wie im heissen Fieber, in einem Fieber, welches das Leben zur Gluthitze bringt und doch die besten Säfte und Kräfte verkalkt, verzuckert und vermehlt, so dass nach dem heissen Rausch das Sterben kommt. Hannes rannte hinab ins Dorf. An ein paar Bauernhöfen lief er vorbei, dann kam eine grüne Aue, auf der ein kleines, nettes Haus stand.
Hannes reckte sich und klopfte mit seinem Stecken ans Fenster. Ein schmächtiges, blasses Mädel erschien.
„Der Herr Heinrich Raschdorf lässt schön grüssen, und ob die Jungfer Liese nicht so freundlich sein wollen mögen täte, ’m toten Hühndel ’s letzte Ehrengeleite zu geben. Der Pfarr’ und die Schule gehn mit!“
„Wenn is es denn? Wenn is es denn?“ fragte das Kind mit vielem Interesse. „Macht der Heinrich a Pfarrer?“
„Natürlich, Liese, macht a ’n Pfarrer.“
„Gelt, du, Hannes, der is aber gar nich ’n bissel stolz geworden, und a is doch schon Quartaner, hat doch jetzt immer Gamaschen an“, sagte das Mädchen bewundernd.
„Nu eben“, pflichtete Hannes bei. „Komm och balde nach, Liese; ’s geht gleich los! Ich muss bloss schnell ’s Grab graben und ’n Zylinder suchen. Wenn kommt ’n dein Vater heim?“
„Nu, a kommt balde! Ich müsste eigentlich ...“
„Gar nischt musste! Bloss kommen! Kannste ‚In der Blüte deiner Jahre‘ auswendig, Liese?“
„Bloss drei Verse.“
„Das langt! Bloss balde kommen! In einer reichlichen halben Stunde geht der Rummel los. – Nanu, wer is ’n das?“
Zehn Meter von Hannes entfernt lag auf der Aue Waldmann, der Dackel. Er lag mit der Schnauze auf der Erde, so dass seine langen Ohren den Boden berührten, und schielte mit höchst durchtriebenem Gesicht den Hannes an. „A is schon a paar Stunden hier“, berichtete Liese. „Ich hab’ ihm Milchsuppe gegeben.“
„Machste recht, Liese! So ein’m Lump, der ’s Hühndel totgebissen hat, Milchsuppe!“
„Ja, das wusst ich doch nicht, Hannes. Und ich denke, du bist froh, dass wir Begräbnis machen können.“
„Natürlich, Liese, bin ich froh. Wenn der Dackel ’s Hühndel nicht erbissen hätte, wer’s sehr schade; aber weil a ’s erbissen hat, kriegt a Hiebe. Das is nich mehr wie recht und billig. – Dackel, nu Dackerle, nu Waldmänndel, nu komm doch; siehste nich, dass ich Zucker hab’? Zucker, Waldmänndel! Na, da komm her, Dackel!“
Der Junge näherte sich Schritt für Schritt dem Hunde. Der lag lauernd auf der Erde und schnitt ein über die Massen schlaues Gesicht. Er lachte geradezu. Und als der Hannes auf drei Schritte herangekommen war, sprang der Dackel auf und lief davon, dass der Boden hinter ihm aufflog. In dreissig Meter Entfernung legte er sich wieder nieder und grinste seinen Verfolger mit überlegener Schadenfreude an. Der verbiss seinen Ärger und beschloss zunächst, seinen Stecken wegzuwerfen und beide Hände in die Taschen zu stecken, damit ersichtlich sei, dass er gar nichts Übles im Sinne führe. Dabei verdoppelte er die Kosenamen und führte alle Schätze der heimischen Speisekammer namentlich auf. Doch als er sich dem Verfolgten wieder auf drei Schritte genähert hatte, brachte dieser sein Leibliches abermals durch eine fabelhaft beschleunigte Flucht in Sicherheit.
Ein paar Knaben schleuderten müssig die Dorfstrasse herab. Als Hannes sie gewahrte, gab er die Verfolgung des Hundes auf und wandte sich den Jungen zu in der Absicht, neue Teilnehmer an dem Begräbnis zu werben. Seine ganze blühende Redekunst wandte er zu diesem Zweck auf.
Ohne Erfolg!
„Mit ’m Heinrich Raschdorf spiel’ ich nich“, sagte Ernst Riedel, „der is a stolzer Affe!“
„Ich geb’ mich auch nich mit ’m ab“, sagte ein zweiter.
„Und ich tät’ überhaupt von mein’m Vater Wichse kriegen, wenn ich uff a Buchenhof ging“, sagte der dritte.
Hannes war wütend.
„Das werd’ ich ’m Herrn Lehrer sagen, der is Heinrichs Grossvater“, sagte er, nachdem er sich kurz die Unmöglichkeit zu Gemüte geführt hatte, selbst die drei starken Bengel durchzuprügeln.
„Wenn a mir was tut“, sagte Ernst Riedel, „geht mein Vater zum Schulinspektor.“
„Und meiner och!“
Sie gingen. Hannes schaute ihnen eine Weile nach.
Dann spuckte er aus und schrie ihnen nach:
„Ochsen, Ochsen, Dorfochsen!“
*
In der Gaststube des Buchenkretschams war es ganz still. Nur zwei Männer sassen drin: Hermann Raschdorf, der Buchenbauer, und Julius Schräger, der Wirt. Man hörte, wie am Leimstengel auf dem Fensterbrett die gefangenen Fliegen zitterten. Die Sonne aber, die bei aller vielen Arbeit immer noch Zeit findet, ein wenig Spass zu treiben, wie alle grossen Leute, gestattete sich ein wunderliches Spiel. Sie beleuchtete die grossen Schnapsflaschen, die im Schanksims standen, und entlockte ihnen wunderbare Lichter; und wer da genau hinsah auf die flimmernden Flaschenleiber, konnte denken, er sähe lauter grosse Edelsteine. Da war der Benediktiner, dunkel wie ein Orthoklas, und daneben glänzte die Kirschflasche wie ein riesiger Rubin; der grüne Magenbitter kam sich sicherlich selber vor wie ein märchenhafter Smaragd, und der Eierkognak war so milchig hell und hatte so sanfte Mondscheinreflexe wie ein echter Opal. Der Branntwein aber, von echtem „Wasser und Feuer“, hielt sich ohne übermässige Bescheidenheit für einen Diamanten. Schade, dass so viele Menschen nicht darauf achten, wenn die Sonne einmal witzig ist. Auch die beiden Männer nicht.
„Die Hauptsache is, Hermann, dass du mir keine Schuld gibst“, sagte der Wirt.
„Aber du hast mir doch am meisten zugeredet, dass ich die verfluchten Aktien gekauft hab’!“ entgegnete der Buchenbauer.
„Zugeredet, was heisst zugeredet? Hätt’ ich dir zugeredet, wenn ich nich gedacht hätte, die Sache wär’ gut, was? Hätt’ ich das? Was? Selber hätt’ ich welche gekauft, wenn ich damals Geld liegen gehabt hätte.“
„Und ich? Hatt’ ich welches liegen? Hatt’ ich’s? Hab’ ich nich ’ne neue Hypothek aufgenommen? Fünftausend Taler, Mensch! Fünftausend Taler! Was das heissen will bei mir!“
Der Gastwirt sprang ärgerlich auf, steckte die Hände in die Hosentaschen und trat ans Fenster.
„So is ’s! Wenn die Leute Pech haben, schieben sie’s immer auf andere.“
Er drehte sich rasch wieder um.
„Nu, Mensch, siehste das nich ein, dass ich’s bloss gut gemeint hab’? Dass ich bloss dein Bestes wollte? Was? Wenn die Sache richtig gegangen wär’ ...“
„Wenn! Man soll sich mit solchen Lausekerlen nicht einlassen. Herrgott, wenn wirklich, Schräger – es is ja – es is ja gar nich zum Ausdenken ...“
Der kleine, dicke Gastwirt legte dem grossen, stattlichen Bauern beschwichtigend die Hand auf die Schulter.
„Hermann! Was nutzt ’n das alles! Abwarten! Ruhig abwarten!“
„Abwarten! Du hast gut reden. Abwarten! Ich – ich – mir wird die Zeit zur Ewigkeit; drüben liegt mein Weib krank, sie weiss nichts von all dem, die Zinsen bin ich noch schuldig von Johanni – ich – ich ...“
„Weisste, Hermann, trink’n wir ’n Kirsch!“
„Ich mag nich, ich will nich, ich hab’ schon genug!“
„Trink’n wir halt ’n Kirsch! Das wirste mir doch nich abschlagen, Hermann!“
Der Wirt geht nach dem Schanksims, und der Rubin tauchte unter.
„Na also!“ sagte Schräger, indem er langsam mit den gefüllten Gläsern zurückkam. „Nur nich ’n Kopp verlieren! Wird ja noch alles werden. So da! Na, trink mal, Hermann! Auf dein Wohl!“
Da tönten Schritte draussen im Hausflur.
„Der Briefträger“, keuchte Raschdorf und stiess das gefüllte Glas um. Er stand auf und stützte sich schwer auf den Tisch. Ein Landbriefträger trat über die Schwelle, erhitzt und bestaubt.
„Guten Tag!“ sagte er; „’n Korn und a Glas Einfach ...“
„Is was an mich?“ fragte Raschdorf schwer beklommen. Auch der Wirt blickte aufs höchste gespannt nach der schwarzen Ledertasche. „Jawohl, Herr Raschdorf, da ist ein Brief!“
„Vom Rechtsanwalt“, sagte Raschdorf leise und langte über den Tisch.
„Komm mit ins Stübel, Hermann!“ riet der Wirt. Die beiden Männer gingen ins Wohnzimmer des Wirtes. Mit zitternden Fingern löste Hermann Raschdorf den Umschlag des Briefes.
„Setz dich, Hermann, setz dich!“ Der Wirt zwang ihn aufs Sofa.
Und Raschdorf las. Da wurde das Gesicht blass, die Mundwinkel verzogen sich, der Unterkiefer zitterte, und auf der Stirn brannte ein roter Fleck wie eine Wunde.
„Verflucht! Oh – oh – verflucht!“
Das Papier entsank dem starken Mann, und er selbst fiel mit dem Gesicht auf das Sofa und krallte seine Finger in die Polster.
„Was is denn, Hermann, um Gottes willen, was is denn?“
Keine Antwort. Der hünenhafte Körper nur zuckte krampfhaft auf und nieder, die Hände fuhren wie irre hin und her, und der Kopf bohrte sich in den Sofasitz. Der Wirt bückte sich, hob den Brief auf und las.
Eine lange Pause entstand.
„Fünfzehn Prozent, nur fünfzehn Prozent!“
Schräger setzte sich auf einen Stuhl. Schweigend betrachtete er den Unglücklichen, der in dumpfes Schluchzen ausbrach. In den grauen Augen des Wirtes zuckte es sonderbar. Ein Weilchen blieb er so ganz still, dann schlich er auf den Zehen hinaus und verkaufte drüben dem wartenden Briefträger Schnaps und Bier.
„Sagen Sie einstweilen von dem Briefe nichts im Dorfe“, sagte er zu dem Briefträger und kassierte die Zeche ein. Dann ging er zurück nach der Wohnstube. Behutsam öffnete er die Tür. Raschdorf lehnte auf dem Sofa, die Füsse weit von sich gestreckt. „Hermann!“
„Na, was sagste? Haste gelesen? Fünfzehn Prozent! Was? Das macht sich! Diese Schweinebande!“
„Aber ’s muss doch ’n Gesetz geben, Hermann!“
„Gesetz geben! Schafkopp! Gesetz! Wenn du ’n Hund ohne Maulkorb ’rumlaufen lässt, oder wenn du die Wagentafel zu Hause vergessen hast, da gibt’s ’n Gesetz, da werden sie dich schon fassen; aber wenn kleine Leute von Spekulanten um ihr Geld begaunert werden, um Tausende, um viele Tausende, um alles – da gibt’s kein Gesetz, da kräht kein Hahn darüber, da kümmert sich kein Teufel drum – Schweinebande!“
Schräger trat nahe an den Sofatisch.
„Es ist schrecklich, Hermann! Und das schlimmste: nu werd’ ich die Schuld kriegen.“
Raschdorf blickte auf.
„Die Schuld kriegen! Du? Hä! Natürlich bist du schuld!“
„Hermann, das verbitt’ ich ...“
„Ach, halt’s Maul! Was hat’s denn für ’n Zweck, wenn ich dir die Schuld geb’? Krieg ich mein Geld wieder? Was? Nee! Hin ist hin! Aber, dass du mir zugeraten hast, dass du mir in a Ohren gelegen hast Tag und Nacht, das steht auf ein’m andern Brette, Schräger!“
„Na, is gut, Hermann! Gut is! Ich werd’ dir ja nich mehr raten! Ich sag’ ja kein Sterbenswort mehr, und wenn du ...“
„Und wenn ich gleich pleite geh’! Weiss ich, Schräger, weiss ich! Is auch ganz gut so.“
„Na, das is ja richtig! Das habe ich mir ja gerade um dich verdient!“
Schräger trat ans Fenster und blickte hinaus auf die staubige Strasse. Raschdorf erhob sich und dehnte die Arme.
„So! Nu werd’ ich’s meinem kranken Weibe sagen, nachher könn’n wir ja die Klappe zumachen und fechten gehen.“
Schräger drehte sich langsam um.
„Hermann“, sagte er, und seine Stimme klang warm, „Hermann, wenn du ’n Freund brauchst!“
Raschdorf sah ihn mit herbem Lächeln an.
„Wenn ich ’n Freund brauch’, komm ich zu dir. Verlass dich darauf, Schräger!“
Sie sahen sich einige Sekunden in die Augen.
„Leb wohl, Schräger!“ – –
Über die Strasse ging Raschdorf und über seinen Hof. Er sah und hörte nicht. Als er in den Hausflur kam, blieb er stehen, als ob er Mut fassen müsse. Von oben herab klang ein hohles Husten. Da raffte sich der Mann auf. Langsam stieg er die Treppe hinauf und öffnete eine Tür.
„Wie geht dir’s, Anna?“
Die sanfte, zarte Frau, die im Bette lag, sah ihn erstaunt an und fragte furchtsam:
„Was ist dir, Hermann?“
„Mir? – Was soll mir sein?“
Die Kranke richtete sich auf.
„Hermann, es ist was passiert! Dir ist was; Hermann, was ist dir?“
Er sank auf den Stuhl neben ihrem Bette und lehnte den Kopf an das kühle Kissen. Und wie sich ein Schuldbekenntnis von Männerlippen immer schwer und schmerzhaft losringt, so auch jetzt.
„Anna, ich – hab’ spekuliert – und ich hab’ verloren.“ Eine heisse Röte zog über das weisse Frauengesicht. Sie sagte nicht gleich etwas, aber dann fragte sie:
„Ist es viel, Hermann?“
„Viel, Anna! Sehr viel! Über – über viertausend Taler.“
Die Kranke sank in die Kissen zurück und legte den rechten Arm über die Stirn und die Augen. Und der Mann sass in finsterem Schweigen an ihrem Bette. Kein Laut. Nur die Frau hustete ein paarmal. Und die Sonne schien schwül in die Stube.
Da klang ein seltsam Tönen in diese Todestraurigkeit. Vom Garten unten drang schwaches Kindersingen: „In der Blüte deiner Jahre.“
Müde erhob sich Raschdorf. Er hatte nicht den Mut, seiner blassen Frau in die Augen zu sehen. So trat er sachte ans Fenster und lehnte sich gegen die Mauer. Ein wunderliches Bild bot sich ihm unten im Garten. Er sah nicht alles, nicht den Hannes, der possenhaft aufgeputzt da unten stand, nicht die fremden Kinder; er sah ein totes Hühnchen, das mit Myrtenzweigen und blauen Bändern geschmückt über einer Grube stand, er sah sein schönes Kind, die Magdalena, und er sah seinen einzigen Sohn, der wie ein Geistlicher angezogen unten stand und vernehmlich sagte:
„Vita brevis! Vita difficilis!“
„Das Leben ist kurz! Das Leben ist schwer!“
Das Wort traf den Mann ins Herz. Er ging zurück zum Bette der Frau und bedeckte sein Gesicht mit den Händen. –
Drüben im Buchenkretscham durchmass der Wirt die einsame Gaststube. Er war wohl in schwerer Erregung. An allen Tischen blieb er stehen und trommelte mit den dicken, kurzen Fingern darauf. Immer lockte es ihn ans Fenster, und er hatte doch nicht den Mut, ganz nahe hinzutreten. Die Augen aber richteten sich immer aufs neue nach dem Buchenhofe. So vertieft war er in seine Gedanken und in das Anschauen des stattlichen Gehöftes, dass er nicht einmal bemerkte, wie sich die Tür öffnete und ein Mann erschien, der ihn sekundenlang beobachtete.
„Eine wunderschöne Besitzung, der Buchenhof, was, Schräger?“
„Ah – ah – ja – ja – natürlich – natürlich; ach, du bist’s, Berger, du hast mich ja ...“
„So, erschreckt, gelt ja? Hähä! Is kaum zu glauben, dass ’n Gastwirt erschrickt, wenn a Gast kommt.“
„Ich – ich dachte gerade nur ...“
„Du dachtest gerade nur darüber nach, was doch der Buchenhof für ’ne riesig hübsche Wirtschaft wär’, und da kam ich dummerweise und störte dich in deiner Andacht.“
„Bist doch halt a gespassiger Mensch, Berger. Immer weisste ’n Witz. Was kann ich dir denn einschenken?“
„Gar nischt! Ich will dich bloss was fragen, Schräger. – – Weiss er’s schon?“ und er zeigte mit dem Daumen nach dem Buchenhofe.
„Was – was soll er denn wissen?“
„Von der Pleite und den fünfzehn Prozent!“
„Berger, woher weisst denn du das schon wieder? Das is ja gar nicht möglich!“
Der andere lachte.
„Ja, weisste, wenn man Lumpenmann is wie ich und so mit einer Kurier-Hunde-Post im ganzen Lande ’rumfuhrwerkt, da hört man vieles. Was a richtiger Lumpenmann is, der weiss alles.“
Der Wirt sah Berger mit unruhig flackernden Augen an.
„Na, meinetwegen! A weiss schon. A hat halt Pech!
Mich geht’s ja nischt an, Berger. Was?“
„Nu je! O ja! Doch, doch!“
Der Lumpenmann lachte bei dieser Rede. Schräger fuhr auf.
„Mich soll’s angehen? Mich? Was denn? Was denn zum Beispiel? Möcht’ ich wissen. Was denn, Berger?“
Der lehnte sich gegen das Schanksims, kniff seine Äuglein ein wenig zusammen und sagte ganz ruhig: „Ich werd’ dir mal was sagen, Schräger. Siehste, es könnte einer auf den Gedanken kommen, es wär’ eigentlich ganz hübsch, wenn die beiden Buchenhöfe wieder zusammenkämen. – Lass mich reden, Schräger, reg dich nich uff! Also, wenn alles wieder eine Herrschaft wär’! Das könnte schon einer denken. Nich? Na, aber ’s wär’ ’n sehr dummer Gedanke, Schräger; denn die Raschdorfs gehen da drüben nich ’raus!“
„Ich weiss nich, was du hast, Berger. Ich denk’ doch im Traume nich an so was. Der Raschdorf is mein Freund.“
„Is dein Freund, Schräger. Das ist hübsch von dir! Und weil du nu deinen Freund mit den Aktien so in die Tinte geritten hast ...“
„Berger, das lass ich mir nich gefallen!“
„Weil du ihn so in die Tinte ’reingeritten hast, sag’ ich, wirste ihn wohl jetzt wieder ’rausreiten müssen.“
„Das is ’ne Frechheit von dir, Berger! Wie kommste denn dazu? Das geht dich doch gar nischt an!“
„Geht mich gar nischt an, Schräger, da haste recht! Aber gerade das, was mich nischt angeht, um das kümmer ich mich. Schräger, ich will dir mal in aller Gemütlichkeit was sagen: Wenn du etwa am Raschdorf schuftig handelst, da mach ich dich schlecht im ganzen Vaterlande und im ganzen Waldenburger Kreise. Verstehste? Ich verkauf dich als Lumpen in jedem Hause.“
„Nu is aber genug, Berger! Das sagste mir in meinem Hause? Ich verklag dich, und wenn du noch ’n einziges Wort sagst, dann ...“
„Da schmeisste mich ’raus. Wachste recht, Schräger, tät’ ich auch machen! Aber ich geh’ schon alleine. Meine Meinung weisste! Leb gesund, Schräger!“
Berger hörte nur noch, dass ihm der Wirt etwas nachzischelte, aber er kümmerte sich nicht darum. Aus der sauersüss riechenden Wirtsstube trat er wieder hinaus auf die sonnenbeglänzte, freie Strasse. Ein kleiner Planwagen stand da, vor den ein grosser schwarz- und weisshaariger Hund gespannt war. Der schielte seinen Herrn mit einem verliebten Seitenblick an und klopfte in drei gleichmässigen Zwischenräumen mit seinem mächtigen Schweife an die Wagendeichsel. Der Lumpenmann stutzte und betrachtete aufmerksam sein Gefährt, in dem sich leise etwas regte.
„Haste etwa a Raschdorf Heinrich gesehen, Pluto?“
Der Hund bellte freudig.
„Oder vielleicht gar a Schaffer-Hannes?“
Der Hund bellte noch lauter.
„Haste sie wirklich gesehen, Pluto? Möcht’ ich wissen, wo sie stecken.“
Der Hund bellte wie toll und zerrte und riss an seinem Geschirr. Der Lumpenmann bückte sich und machte ihn frei.
„Na, da such, Pluto, da such!“
Ein Satz, und der mächtige Hund war unter der Plane verschwunden. Ein Zeter- und Mordgeschrei erhob sich in dem kleinen Wagen, dazwischen ertönte ein ganz rasendes Hundegebell. Der Lumpenmann stand da und lachte, und die Tränen liefen ihm über das runzlige, bestaubte Gesicht. Ein Paar Gamaschen wurden auf der Deichsel sichtbar, in denen steckten zwei Quartanerfüsse, und nach und nach kam der ganze junge Akademiker zum Vorschein. Unterdessen war ein wüstes Gebrülle und Gebelle im Wagen.
„Du bist verrückt, Pluto! Mein Gesicht, au, mein Gesicht!“
Der kleine Wagen wankte und bebte von dem gewaltigen Kampfe, der sich in ihm abspielte, und dann wurde in seiner dunklen Össnung ein animalischer Knäuel sichtbar, und rechts von der Deichsel fiel ein Hund auf die Strasse, und links von der Deichsel ein Junge.
Hannes erhob sich mit zerkratztem Gesicht.
„Wir kommen vom Begräbnis“, sagte er kläglich und betrachtete zerknirscht den demolierten Paradehut seines Vaters. „Da macht man sich ’n kleinen Spass und kriecht mal in den Lumpenwagen, und gleich hetzt a mit Hunden. Was bloss mein Vater zu seinem Zylinder sagen wird! Pfui, Mathias, das werd’ ich mir merken! Das ist ruppig von Ihn’n!“
Der Lumpenmann lachte, dass er sich schüttelte.
„Ihr Halunken! Gelt, das wär’ a Spass gewesen, wenn euch der Mathias Berger ins Dorf gezogen hätte! Na, heul nich etwa, Hannes! Sagen wird dein Vater zum kaputten Zylinder nischt; a sagt ja nie was; höchstens durchhauen wird a dich.“
In diesen Worten vermochte Hannes einen erheblichen Trost nicht zu erblicken, und so versprach ihm Mathias Berger einen neuen Zylinderhut. Er habe zwei Stück. Einer rühre von seiner Hochzeit her, den anderen habe er geerbt. Der Hannes solle sich den schönsten gleich abholen, ehe der Vater vom Felde heimkehre und gewahr werde, was mit seiner „Trauertonne“ passiert sei.
Da war die Not des Buben behoben. Und nachdem Hannes durch einige kritische Fragen, die das Erbstück betrafen, die tröstliche Versicherung erhalten hatte, dass die beiden Hüte Bergers wirklich Prachtexemplare ihrer Art seien, spannte er sich selbst neben den von ihm sonst heissgeliebten Pluto und zog mit ihm das Wägelchen die Strasse hinab dem Dorfe zu.
Mathias Berger und Heinrich Raschdorf folgten in einiger Entfernung. Es war Abend geworden. Einzelne Schnitter kamen heim vom Felde. Irgendwo draussen waren die ersten Halme gefallen. Wie die Leute am Anfang der Ernte so stolz daherschreiten! In ihren Muskeln ist aufgespeicherte Kraft, und die Gewissheit wohnt in ihren Herzen, dass ihr Körper kräftig und tüchtig ist. Diese Menschen sind die glücklichsten Leute der Erde. Sicher aber die leidlosesten, die ruhigsten, die ungeängstigtsten. Was ihnen fehlt, wissen sie nicht, und was sie haben, steht über aller Wertung nach Geld. Die anderen haben viel, was Plunder ist, und das Schlimmere: sie wissen, was ihnen fehlt, grübeln darüber nach und sehnen sich müde. Es ist kein Wunder, dass ein wortkarger Stolz im Bauern wohnt. Lächelt der Städter über den Landmann, wenn er ihn unbeholfen über seine Strassen trotten sieht, der Bauer lacht unendlich verächtlicher über den Städter, wenn der neben seinen Erdfurchen und strotzenden Saaten so vorsichtig und blass und müde daherwandelt.
Mathias Berger sah seinen jungen Begleiter an, der einen grauen Anzug mit kurzen Hosen, einen weissen Strohhut und Gamaschen trug. „Eigentlich siehst du dich komisch an hier auf der Dorfstrasse“, sagte er.
„Ja, Mathias, wissen Sie, und ich wär’ auch viel lieber wieder zu Hause.“
„Gefällt dir’s nicht auf der Schule in Breslau?“
„O ja, wenn man der Siebente ist von achtunddreissig, das ist schon ganz anständig. Im Französischen hab’ ich bloss ‚genügend‘, sonst steh’ ich ganz gut. Aber wissen Sie, Mathias, das Schlimme ist, dass mir immer so bange ist.“
„Du hast wohl manchmal das Heimweh, Heinrich?“
Der Knabe mässigte seine Stimme.
„Ja, aber das sag’ ich bloss Ihnen, Mathias! Sonst müsst’ ich mich ja zu sehr schämen. Und meine Kameraden würden sagen, ich sei eine Memme, und ich kriegte Klassenkeile. Aber mir ist halt immer so bange. Ich kann nicht dafür, Überhaupt nach den Ferien! Einmal hab’ ich nach den Ferien meine Wochentagsschuhe vier Wochen lang nicht angehabt. Ich mochte sie nicht abbürsten, weil – weil Boden von zu Hause dran war.“
Der Lumpenmann wandte sich ab und sagte mit verstellter, etwas heiserer Stimme:
„Das wirste schon noch überwinden lernen, Heinrich! Oder willste nicht gern Doktor werden oder Pfarrer oder sowas?“
„Nein, Mathias, ich will nicht! Ich will wieder zu Hause sein, wo ihr alle seid.“
„Willste denn Bauer werden, Heinrich?“
„Ja. Sehn Sie mal, Mathias, es wär’ doch schade um unser schönes Gut. Sehn Sie, hier gerade an dem wilden Kirschbaum kann man unsere ganzen Felder übersehen. Das sind doch viel! Nicht, Mathias? Eigentlich sind wir doch reich. Aber das sag’ ich gar nicht in Breslau. Ich denk’ bloss immer dran, dass wir so ein schönes Gut haben.“
Der Lumpenmann bückte sich hastig nach dem Wegrande, riss einen Stengel Sauerampfer ab, biss darauf herum und spuckte dann alles weit von sich.
„Was macht denn deine Mutter?“ fragte er.
„Die ist wieder ganz krank. Am Mittwoch, wie Wochenmarkt in Waldenburg war, war sie mit beim Doktor.“
„Und was hat der gesagt?“
„Das weiss ich nicht. Sie hat geweint, als sie heimkam. Das ist es auch, was mir immer so bange macht, dass die Mutter nicht gesund ist.“
Sie gingen eine Weile schweigend weiter.
„Sieh nur, dass du weiter auf der Schule fortkommst, Heinrich! Gelt, bis in die Prima musst du, eh’ du den Einjährigen hast?“
„Bloss bis Obersekunda!“
„Das wär’n also reichlich noch drei Jahre. Sieh och, Heinrich, ’s is schon gutt, wenn du was lernst. Auf alle Fälle is gutt. ’s is ja ganz erbärmlich, wenn einer so tumm is wie zum Beispiel ich. Kannste denn eine Stellung kriegen, wenn du einjährig bist, Heinrich?“
„O ja, es war einer mit auf unserer Bude, der ist nach ’m Einjährigen abgegangen, und jetzt ist er Schreiber auf einem Landratsamte, und dann wird er Kreissekretär oder so ähnlich. Aber ich mag nicht Kreissekretär werden. Ich will Bauer werden.“
„Schon, schon, Heinrich! Aber sieh mal, am Ende könnt’st du dich doch später anders besinnen.“
„Nie, Mathias, nie! Ich übernehm’ das Gut. Das ist tausendmal besser, als wenn ich so in einer Schreibstube sitzen muss.“
Ein Blick des Lumpenmannes glitt über die goldenen Fluren, die sich rechts und links von ihm ausdehnten und die alle jetzt noch den Raschdorfs gehörten.
„Wir werden schon sehen, dass du ein Bauer werden kannst. Wir werden schon sehen!“ sagte er. – –
Hannes hielt mit der Hundefuhre mitten auf dem Wege an. Aus einem Feldraine bog ein Trupp Schnitter ein, und an ihrer Spitze schritt schwer und gewichtig August Reichel, der Vater des Hannes.
„Na, da komm mal schnell, Heinrich, sonst passiert da unten ein Unglück!“ sagte der Lumpenmann und schritt mit seinem Begleiter rüstig aus.
Sie kamen ziemlich gleichzeitig mit den Schnittern an den Wagen an. August Reichel, ein Riese von Gestalt, blieb stehen und betrachtete höchst beängstigenden Blikkes seinen Sprössling, der da beklommen vor ihm stand und mit der einen Hand krampfhaft hinter dem Rücken etwas versteckte. Der Riese reckte ein wenig den Hals und konnte so ganz bequem auch aus einiger Entfernung die Rückseite seines Nachkömmlings einer genauen Musterung unterziehen. Ein Zucken ging über das Gesicht des Goliath.
„Her!“ sagte er lakonisch und streckte die Hand aus.
Hannes reichte ihm die ruinierte „Trauertonne“ und schielte halb ängstlich, halb abwartend durch die Haare, die ihm in die Stirn hingen, zu seinem muskulösen Vater hinauf.
Der betrachtete den Zylinder, nahm den Strohhut vom Kopfe, probierte den Zylinder auf, fand, dass er ihm passe, prüfte dann das Schweissleder und hieb plötzlich dem Knirps vor ihm den Hut mit solcher Wucht auf den Kopf, dass dieser bis übers Kinn darin versank und mit beiden Beinen zugleich auf der Strasse kniete.
„August, halb und halb bin ich schuld“, sagte der Lumpenmann beschwichtigend, „ich hab’ zwei Zylinderhüte zu Hause; ich schick dir einen.“
Über das breite Gesicht des Riesen ging ein Lächeln.
„Ich brauch’ keinen!“ sagte er und nickte dem Lumpenmann freundlich zu. Darauf setzte er sich wieder an die Spitze seiner Schnitterschar und schritt in breitbeiniger Majestät die Anhöhe hinauf dem Buchenhofe zu.
Hannes arbeitete sich ans Tageslicht. Er sah seinem Vater halb ärgerlich, halb schadenfroh nach und sagte, indem er sich die Stirn rieb und dem Vater mit dem Finger nachdrohte: „Na wart nur! Wenn ich heute abend Kopfschmerzen hab’, da wirste mir ja Tee kochen müssen!“
Mathias Berger lachte, Pluto bellte einen kleinen Jubelhymnus, Hannes fasste ihn um den Hals, und die kleine Karawane zog weiter.
So kamen sie bei dem kleinen Hause des Lumpenmannes an. Die Liese kam ihnen entgegen. Eine ganze Woche lang hatte sie den Vater wieder nicht gesehen. Nun schmiegte sie sich zärtlich an ihn. Er aber schlang den Arm um sie und fuhr mit der Hand über ihren flachsblonden Kopf.
„Liese! Nu, Liese! Nu, mei Madel du!“
Ein ganzer Strom von Liebe ging durch diese paar Worte. Dann kam auch die Schwester Bergers, die ihm seit dem frühen Tode seiner Frau die Hauswirtschaft besorgte. Unterdessen spannten die Knaben den Hund aus und schoben den Wagen in einen kleinen Schuppen. Mathias Berger folgte ihnen. Er hob einen riesigen Sack aus dem Wagen, der prall mit Lumpen gefüllt war, und schüttelte ihn aus.
„Na, da seht mal! Wenn ich die sortieren werd’, das ist ganz int’ressant. Da ist alles dabei. Wollflecke von Grossmutterkleidern und Kattun von Kinderschürzen, Übrigbleibsel vom Brautstaate und Leinwand von einem Totenhemde. A Lumpenmann kann alles sehen. Es kommt von allem was in seinen Sack.“
Heinrich folgte gedankenvoll diesen Worten; aber Hannes hörte nicht darauf und machte sich mit einem kleinen Holzkasten zu schaffen.
In der Stube wurde dieses Schatzkästlein geöffnet. Ein Kinderherz konnte bei solchem Anblick selig sein. Es gab ja auch einige langweilige Dinge in dem Kasten, wie: Fingerhüte, Nähnadeln, Zwirn, Jerusalemer Balsam und Federhalter. Aber sonst? Soldatenbilder, allerhand andere Bilder mit schönen Versen von Gustav Kühn aus Neuruppin, Peitschenschnüre, Pfeifen, Kreisel, Spielmarken, Papierorden, kleine Pistolen, Vogelpfeifen, „goldene und silberne“ Uhren und Fingerringe die schwere Masse mit den prachtvollsten Steinen.
„Ich möchte gerne a Fingerringel für die Raschdorf-Lene“, sagte Hannes, „weil die mir ofte manchmal a Stückel Wurstschnitte gibt.“
„Such dir einen aus, Hannes“, sagte der Lumpenmann.
Der Knabe wühlte mit zitternden Fingern in den Schätzen.
So mag den Märchenprinzen zumute gewesen sein, die nach dem Wunderring suchten.
Heinrich stand etwas abseits. Er hielt es wohl mit seiner Gymnasiastenwürde unvereinbar, sich noch für solche Dinge zu interessieren, aber er wandte doch kein Auge von dem Kasten. Schliesslich trat er mit gewaltsam erzwungener Gleichgültigkeit näher.
„Was ist denn da eigentlich alles?“ fragte er mit ungeheurem Gleichmut.
„Wenn dir was gefällt, Heinrich, such’ dir nur aus“, sagte Berger freundlich.
Heinrich tat so, als ob er das durchaus nicht beabsichtige; aber schliesslich prüfte er doch eine kleine Zündblattpistole und liess sich durch einiges Zureden Bergers bewegen, sie nebst einer Schachtel Munition zu behalten. Auch einen silbernen Ordensstern nahm er noch an sich. Dann aber fühlte er das Bedürfnis, wieder ernsthafter aufzutreten.
„Wissen Sie, Mathias, wer die Lumpenmänner eigentlich in Schlesien eingeführt hat?“
„Nein“, sagte Mathias, „das weiss ich nicht.“
„Das hat der Alte Fritz getan“, belehrte ihn Heinrich.
„Vor der Zeit des Alten Fritz gab’s keine Lumpenmänner in Schlesien.“
„Da hat der Alte Fritz was sehr Kluges gemacht“, entgegnete Berger.
„Is überhaupt sehr tüchtig gewesen“, sagte Hannes wohlwollend, um damit zu zeigen, dass er auch in der Geschichte bewandert sei. Dabei stellte er drei Ringe in die engere Wahl: einen Diamantring, einen Rubinring und einen einfachen Silberreif, auf dem das Wort „Liebe“ eingeprägt war.
„Ja“, nahm Heinrich wieder das Wort, „der Alte Fritz war sehr sparsam, und er wollte nicht, dass die Leute was wegwarfen: Lumpen, Knochen, altes Eisen und so ähnlich. Da setzte er die Lumpenmänner im Lande ein. Und die mussten solche Dinge im Kasten haben wie Sie, Mathias. Und das nennt man Tauschhandel. Wobei es auch auf die neuen Papierfabriken ankam.“
Bergers Augen leuchteten. „Sieh mal, Heinrich, das is doch hübsch, wenn einer das alles weiss. Ich bin nu schon so lange Lumpenmann, und ich bin es auch gerne; aber ich hab’ noch nie gewusst, wer uns eigentlich erfunden hat. Es wär’ doch hübsch, wenn du weiter studiertest und ein Gelehrter würdest. Nich, Heinrich? Sieh mal, Bauern gibt’s doch massenhaft auf der Welt?“
Der Knabe fühlte sich geschmeichelt, aber er schüttelte doch den Kopf.
„Nein, ich will Bauer sein. Ich will den Hof übernehmen. Ich will immer hier sein.“
„Das is richtig“, stimmte Hannes bei; „wenn du nich da bist, is nischt los zu Hause. Sieh mal, Heinrich, welchen nehm’ ich nu: den mit dem weissen oder den mit dem roten Stein? Den silbernen mit ‚Liebe‘ mag ich nich; da gäb’ mir die Lene am Ende ’ne Backpfeife. Ich denke, ich nehm’ den roten.“
„Nimm sie beide, Hannes“, sagte der Lumpenmann.
„Wer die Wahl hat, hat die Qual.“
„Aber der silberne ist auch niedlich – sehr hübsch ist er“, sagte Heinrich.
„So behalt ihn“, sagte Berger.
„Den mit ‚Liebe‘?“ fragte Hannes erstaunt. „Wem willste denn den mit ‚Liebe‘ schenken, Heinrich?“
Der Quartaner wurde blutrot.
„Ach, niemand“, stotterte er, „niemand, vielleicht der Liese.“
Und er gab das unechte kleine Ringlein der Liese, der Tochter Bergers, die schon lange mit roten Wangen hinter ihm gestanden hatte.
*
Am Abend noch, als die Sonne im Verlöschen war, ging Mathias Berger die Dorfstrasse hinab nach der Schule. Die beiden Knaben waren längst zu Hause; die kleine Liese lag im Bett und schlief und hatte das silberne Ringlein am Finger.
Der alte Dorfkantor Johannes Henschel sass an einem Harmonium und spielte aus einer Orgelpartitur.
„Es ist eine schwere Sache, eine sehr schwere Sache, Herr Kantor, wegen der ich komme“, sagte Berger.
„Was ist denn?“
„Herr Kantor, eh’ ’s Ihnen die anderen sagen: Ihr Schwiegersohn, der Herr Raschdorf, verliert bei der Fabrik sein Geld.“
Das blasse Gesicht des alten Lehrers wurde noch um einen Schein fahler, und die welke Rechte fuhr nach der Brust. „Bei den Aktien?! Ist das möglich, Berger? Ist das möglich?“
Mathias Berger sah den Alten mitleidig an.
„Es ist so, Herr Kantor. In Altwasser drüben der Teichmann verliert auch dreitausend. Von dem weiss ich’s. Fünfzehn Prozent kriegen die Aktionäre ’raus, das ist alles.“
Ein Zittern ging über das Antlitz des alten Mannes. Dann stützte er den Kopf schwer auf die Hand.
„O mein Gott!“
Es war ganz still in der Stube, nur die Uhr tickte leise. Draussen erhob sich ein matter Nachtwind und fuhr müde durch die alten Bäume des Schulgartens.
Mathias Berger nahm wieder das Wort.
„Sehn Sie, Herr Kantor, das ist ja eigentlich nicht meine Sache. Es geht mich gar nischt an. Aber Sie wissen ja, ich bin Ihn’n viel Dank schuldig. Wie ich a blutarmer Junge war, ohne Vater und Mutter, da haben Sie mich aufgenommen und mich grossgefüttert. Das vergess’ ich nich, und wenn ich hundert Jahr werd’. Was mir das jetzt leid tut, kann ich gar nicht sagen. Aber, Herr Kantor, der Herr Raschdorf sollte sich nich mit ’m Schräger einlassen. Das is a grundschlechter Kerl!“
„Der Gastwirt? Ach nein, Berger! Der hat ja meinem Schwiegersohn immer noch ausgeholfen, wenn’s einmal fehlte.“
„Ausgeholfen, Herr Kantor! Warum denn? Warum denn? Weil a ihn nach und nach ganz in seine Gewalt kriegen will. Bloss darum! Ich sag Ihnen, dem dicken Kerle wird erst ganz wohl sein, wenn a beide Höfe hat. Darauf spekuliert a, darauf hat a’s abgesehn! Schräger is Raschdorfs grösster Feind!“
Der alte Kantor schüttelte unwillig den Kopf.
„Das müssen Sie nicht sagen, Berger, das ist unrecht! Schräger hat sein Geld auf die letzte Hypothek gegeben. Der ist ein Freund von meinem Schwiegersohn.“
Mathias Berger erhob sich.
„Na, da – da tut mir’s leid, dass ich was gesagt hab’.“
„Setzen Sie sich, Berger, setzen Sie sich doch wieder! Sie sehen zu schwarz. Der Schräger und mein Schwiegersohn sind Freunde. Sie sind zusammen in die Schule gegangen, sie sind zusammen aufgewachsen. Schräger ist nicht schuld. Das ist halt Unglück, Berger, schreckliches Unglück! O Gott, ich weiss ja nicht, was werden soll! Fünftausend Taler! Und mir hat er immer nichts gesagt, wie’s steht, nichts!“
Eine Pause entstand. Beide Männer starrten vor sich hin.
„Um Ihre Tochter tut mir’s leid“, sagte Berger endlich leise.
Der alte Lehrer wandte sich ab.
„Und um den Jungen, um den Heinrich! Heute sagt a mir, a will nich studieren; a will Bauer werden – übernehmen die Wirtschaft –, das is ja a Jammer.“
Ernst und gross wandte der Alte die Augen dem schlichten Manne gegenüber zu.
„Ich hab’ ein Unrecht begangen, Mathias – ich, nicht der Schräger. Ich musste dem Raschdorf die Anna nicht geben. In so einem Gut muss Geld sein! Was waren da die paar Pfennige, die ich ihr mitgeben konnte? Gar nichts! Gar nichts! – Und nun ist das Elend da. Ich bin schuld daran, Mathias, – ich!“
Berger richtete sich auf.
„Herr Kantor, nehmen Sie’s nich übel, aber das is – das is Unsinn, was Sie da sagen! Sie sind nich schuld! Der Raschdorf stand sehr gut da. Der brauchte keine reiche Frau. Bei dem ging’s ohne Mitgift. Aber wie hat a gelebt? Wie a gnädiger Herr! Immer oben ’raus! Und das Schlimmste: a hat sich mit dem Schräger eingelassen, und das is und bleibt a Malefizlump, und wenn a noch so scheinheilig tut, und wenn Sie noch so für ihn reden.“
Der Kantor schüttelte den Kopf.
„Es wäre schlecht, Mathias, einem zweiten die Schuld zu geben, wenn uns ein Unglück trifft. Und selbst, wenn er ihm zugeredet hat, wer konnte das ahnen? Den Ausgang konnte niemand wissen. Es ist eine bittere Sache, Mathias, wenn man alt ist und ein einziges Kind hat, und dem geht’s so!“
Als der Lumpenmann heimging, lag die Sommernacht über dem schlummernden Dorfe. Ernte! In schweren, schwülen Zügen atmete draussen das todgeweihte Feld.