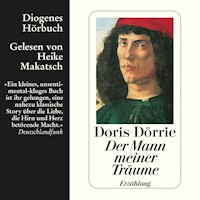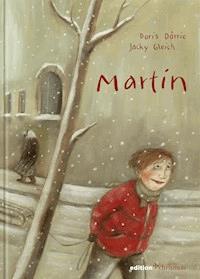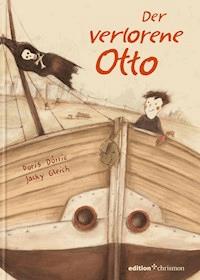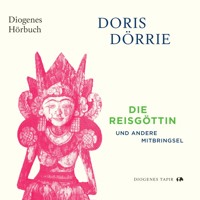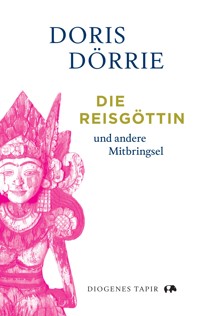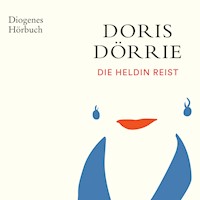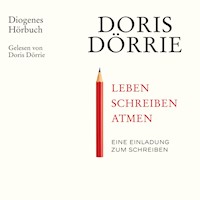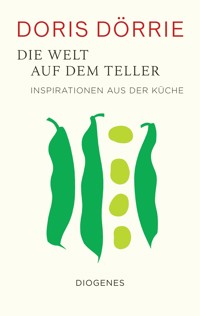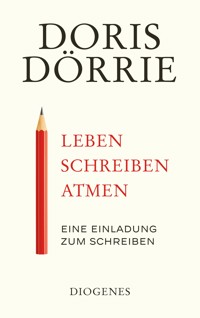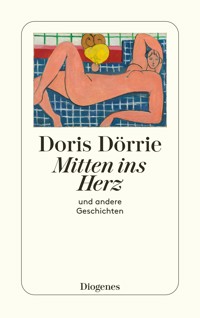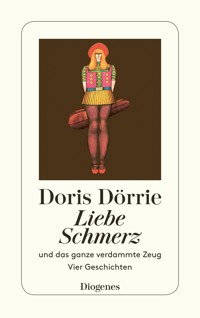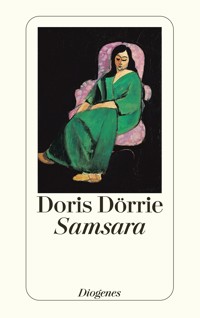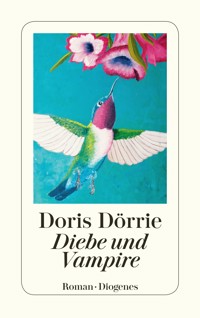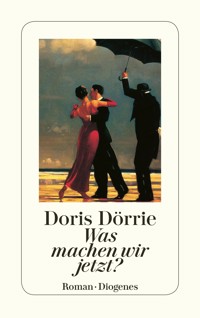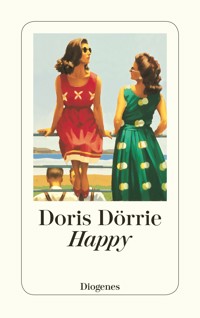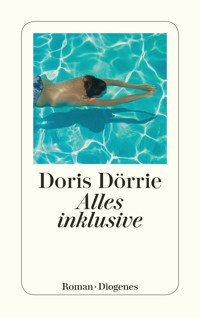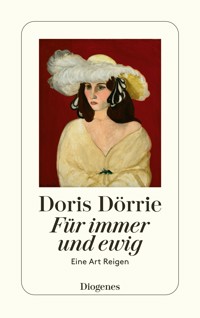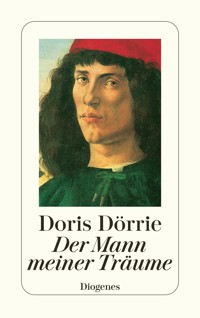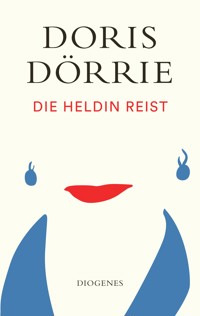
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der Held muss in die weite Welt hinaus und Abenteuer erleben, um ein Held zu werden – und eine Geschichte zu haben. Und was ist mit der Heldin? Doris Dörrie erzählt von drei Reisen – nach San Francisco, nach Japan und nach Marokko – und davon, als Frau in der Welt unterwegs zu sein. Sich dem Ungewissen, Fremden auszusetzen heißt immer auch, den eigenen Ängsten, Abhängigkeiten, Verlusten ins Auge zu sehen. Und dabei zur Heldin der eigenen Geschichte zu werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Doris Dörrie
Die Heldin reist
Diogenes
I
San Francisco
Im Jahr 2019 bin ich in die USA, nach Japan und Marokko gereist. Niemals hätte ich mir vorstellen können, dass es für längere Zeit die letzten Reisen gewesen sein sollten. Noch hatte niemand vom Coronavirus gehört. Noch war George Floyd am Leben. Noch schien mein Leben ganz so zu sein wie in all den Jahren zuvor: fast immer unterwegs, selten mehr als drei Monate zu Hause.
Ich flog nach San Francisco zu einem Filmfestival und freute mich auf diese kurze Reise, ein kleines Abenteuer. Unterwegs zu sein war mein Idealzustand, unterwegs fühlte ich mich von mir selbst befreit, und gleichzeitig träumte ich unbeirrt weiter davon, in der Fremde eine andere, bessere Version meiner selbst zu werden. Der deutsche Traum der Bildungsreise. Meine Eltern waren schon reisesüchtig, was eng mit ihren Erfahrungen in Nazideutschland verknüpft war. Uns wurde früh beigebracht, dass Reisen nicht nur Spaß macht, sondern fast eine Verpflichtung ist, um den eigenen Horizont zu erweitern. Als Kinder waren wir dazu nur bedingt bereit. Meine Schwestern und ich fürchteten die endlosen Autofahrten zu viert auf dem Rücksitz, bei denen wir zum Schutz vor der brennenden Sonne Tücher vor die Scheiben hängten und rein gar nichts von der Umgebung sahen. Meine Mutter rief immer wieder: Schaut doch mal aus dem Fenster, wie schön es hier ist! Aber wir starrten lieber auf unsere nackten Knie, während wir uns in engen Serpentinen über die Alpenpässe quälten. Regelmäßig wurde uns schlecht, und meine Mutter reichte uns Plastikbeutel nach hinten, in die wir den blassrosa, lauwarmen Malventee spien, den es nur auf diesen Autoreisen gab. Wenn wir stritten, schüttelte mein Vater eine Flasche Selterswasser und hielt sie, ohne den Blick von der Straße zu wenden, nach hinten, um unsere Mütchen zu kühlen. Dass wir endlich Italien erreicht hatten, merkten wir daran, dass es heiß wurde und unsere Schenkel unangenehm aneinanderklebten. Wir stritten nun absichtlich, um eine kleine Seltersdusche abzubekommen, aber da gab es meist keinen Nachschub mehr. Wenn wir Glück hatten, hielten wir an einer Tankstelle mit dem Logo eines sechsbeinigen Hundes, der Feuer spuckte, und taumelten in einen Traum von Raststätte, in der es frische Pizza gab und rabenschwarzen Espresso für die Eltern, die auf einmal ganz verwandelt schienen, leichtfüßiger, lustiger, fast schon verwegen – und mit einem Schlag waren alle Reisequalen vergessen, und unser Horizont fühlte sich bereits enorm weit an. Wie konnte man nur darauf verzichten? Wer nicht reiste, galt als engstirnig und wunderlich – denn wer wollte nicht so oft wie möglich aus Hannover herauskommen?
Mein Wunsch, in den USA zu studieren, wurde wahrscheinlich auch deshalb von den Eltern unterstützt, und so brach ich vor fast einem halben Jahrhundert allein nach San Francisco auf. Ich sprach schlecht Englisch und kannte dort niemanden, aber wie in dem Märchen von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen, hatte ich vor nichts Angst. Die ganze Welt schien mir ein aufregender, aber prinzipiell freundlich zugewandter Ort zu sein, den ich nun zu durchwandern hatte, um zu lernen und zu wachsen. Die Vorstellung von Wanderschaft und Wanderjahren kannte ich aus der Literatur, aus Liedern und Gedichten. Mich faszinierten die Wandergesellen, die mindestens drei Jahre lang fern der Heimat unterwegs waren und als Fremdgeschriebene bezeichnet wurden, wildromantische Gestalten in ihrer schwarzen Kluft, den Hosen mit Schlag, manche trugen einen Ohrring und als Zeichen des freien Mannes – natürlich waren es immer nur Männer – Zylinder, Schlapphut oder Melone, was zuvor nur dem Adel vorbehalten gewesen war. Sie wirkten wie eine Mischung aus Rockstar und Hippie, ultracool. Meine Reise nach Kalifornien fühlte sich auch ein wenig an, als würde ich auf die Walz gehen. Nur eben als junge Frau, ganz allein, was in meiner direkten Umgebung damals doch etwas ungewöhnlich war. Warum hatte ich überhaupt keine Angst? Meine Neugier auf neue Erfahrungen war so groß, dass ich dafür keine Zeit hatte, vielleicht fehlte mir auch einfach die Fantasie. Außerdem war ich in dem Glauben erzogen worden, Männern vollkommen gleichgestellt zu sein, was ich lange nicht im Geringsten anzweifelte.
In vielen Geschichten ist Angst der Treibstoff, der Motor, und wir wissen ganz genau, dass der Protagonist am Ende lernen wird, seine Angst zu überwinden. Der Held muss sich dem Drachen stellen, den Kampf mit ihm wagen, den eigenen Tod riskieren, eine tiefe Verwandlung erfahren, um siegreich und belohnt nach Hause zurückzukehren. In San Francisco gründete George Lucas in den Sechzigerjahren seine Firma Industrial Light & Magic und brachte mit dem Star-Wars-Epos die Dramaturgie der sogenannten »Heldenreise« in die Welt, die seitdem als Blaupause jedem Blockbuster zugrunde liegt. Wir lieben dieses Muster offenbar, denn sonst wäre es nicht so erfolgreich. Der (zukünftige) Held, oft schwach und blass, ein Schisser, Muttersöhnchen, Versager, muss aus dem Haus, raus aus der gemütlich miefigen Wohnküche, rein ins Abenteuer. Das kann auf vielfältigste Art und Weise geschehen: durch ein Missgeschick, etwa von einer radioaktiven Spinne gebissen zu werden, durch Eltern, die einen im Wald aussetzen, durch eine miese Prophezeiung, die man mit sich herumschleppt, durch eine Kündigung, eine Hausräumung, einen Umzug oder durch schiere Wanderlust. Egal wie, der Held muss aufbrechen, denn wenn er diesen Aufruf zum Abenteuer ausschlägt, bleibt er für immer ein Waschlappen, Trottel und Weichei – und es gibt keine Geschichte. Wer sich nicht fürchtet, hat einfach bisher noch nichts kennengelernt, vor dem er sich fürchten müsste, er stolpert ungeschützt ins Abenteuer. Der Furchtsame aber legt seine teure, tolle Funktionsrüstung an, die jedoch später garantiert eine Schwachstelle aufweisen wird (wie das Lindenblatt zwischen Siegfrieds Schulterblättern, der doch extra in Drachenblut gebadet hatte). Gerüstet oder nicht, auf dem Weg ins Abenteuer muss der Held die Schwelle in ein fremdes und gefährliches Land überschreiten, vorbei an strengen Schwellenwärtern, die manchmal aussehen wie der Türsteher vom Berghain, manchmal aber auch klein, dünn und unerbittlich wie die Dame hinter einem Lufthansa-Schalter. Wenn der Held die Schwelle überschritten hat, gibt es kein Zurück mehr. Im fremden Land gelten die ihm bekannten Regeln nicht mehr, er versteht kein Wort, man isst eklige Dinge, es ist entweder zu heiß oder zu kalt, der Boden unter seinen Füßen beginnt zu schwanken. Dubiose Gestalten bieten ihre Hilfe an, Widersacher belästigen ihn, manchmal findet er Rat bei einer weisen Frau, manchmal sogar treue Begleiter, die aber ihre eigenen Probleme mit sich bringen, er übersteht eine Prüfung nach der anderen, bis er auf dem Höhepunkt dem Drachen gegenübersteht, seinem schlimmsten Feind und seiner größten Angst. Es wird dunkel um ihn, er stürzt in die tiefe Nacht der Seele, aber er darf jetzt nicht umkehren, nicht davonlaufen. Natürlich gewinnt er den Kampf, weil er muss – sonst wäre er kein Held. Lädiert, aber triumphierend kehrt er heim, bekommt die Frau, das Haus und das Auto und befreit auch noch gleich die daheimgebliebenen Jammerlappen. So ähnlich läuft es in allen erfolgreichen Geschichten der Welt ab, analysierte der amerikanische Mythenforscher Joseph Campbell in den Sechzigerjahren und nannte das den Monomythos des Helden. Selbst Buddha und Jesus folgen diesem Muster, minus Haus, Auto und Frau.
Der Held muss also aus dem Haus, um ein Held zu werden. Und die Heldin? Sie ist gar keine Heldin, sondern die Frau des Helden, sie bleibt, wo sie ist, und beschützt das Haus. Sie ist die Hausfrau, die Frau im Haus. Sie muss auch deshalb dableiben, damit jemand zu Hause ist, wenn der siegreiche Held zurückkehrt. Sie darf nicht ausziehen, um das Fürchten zu lernen, aber das muss sie auch gar nicht, denn sie hat ja sowieso permanent Angst. Sie macht sich ständig Sorgen, am meisten um den Helden. Der Held wiederum macht sich keine um sie, denn er kann sich darauf verlassen, dass sie geduldig auf seine Rückkehr wartet und in seiner Abwesenheit kratzige Pullover webt. Den dramatischen Monomythos gibt es für die Heldin historisch betrachtet nicht (es sei denn, man steckt sie als männliche Fantasie in ein hautenges Lederkorsett und lässt sie mit riesigen Waffen hantieren). Die Geschichte der Heldin besteht eher aus einer Abfolge von Episoden ohne vorhersehbare Dramaturgie, ohne Action und Geballere, ohne Rettungsfantasie und Showdown. Aber ist es dann überhaupt eine Geschichte? Oder muss sie dafür das Haus verlassen? Die Theorie besagt, dass jede Reise unweigerlich den Stationen der Heldenreise folgt und Konflikte deshalb unausweichlich sind. Das heißt, wenn die Heldin das Haus verlässt und reist, bekommt sie auf jeden Fall Ärger – und damit eine Geschichte.
Da ich keinen Ärger haben möchte, schreibe ich auf das Einreiseformular für die USA unter Berufsbezeichnung immer: Hausfrau. Das wirkt auf die meist schlecht gelaunten immigration officers ungemein beruhigend. Eine Hausfrau wird aller Voraussicht nach nicht ihr Rückreiseticket gegen Drogen eintauschen oder illegal einen Alligator erlegen und im Koffer zurückschmuggeln – was vielleicht eine gute Geschichte wäre –, nein, eine Hausfrau macht keine Geschichten. Mit meiner falschen Angabe verrate ich zwar alle Hausfrauen dieser Welt, und mich selbst obendrein, dennoch klopft mein Herz an der mythischen Schwelle mit ihren schwarz uniformierten Schwellenwärtern.
Damals, bei meiner ersten Reise in die USA in den Siebzigern, sollte ich auf dem Einreiseformular meine race angeben. Ich war empört und verstand das Wort caucasian auch gar nicht. Hatten wir nicht in Deutschland gerade mühsam gelernt, dass es keine Rassen gibt, und Farbenblindheit eingeübt, um nicht als rassistisch zu gelten (was wir natürlich weiterhin waren)? Mehr als fünfundvierzig Jahre später wird race auf dem Einreiseformular nicht mehr abgefragt. Wenigstens das. Welcome to America, lächelt die Immigrationsbeamtin und stempelt den Pass der reisenden Hausfrau ab. Auf mein Formular schaut sie gar nicht, anscheinend interessiert sie noch nicht mal, ob die Hausfrau angekreuzt hat, dass sie mit einem Maschinengewehr einreist.
Meine Abholung wartet bereits auf mich, Vince, ein magerer Mann in schlottrigen Jeans, der als Freiwilliger für das Festival arbeitet, seit er in Rente ist. Er packt mich in seinen zerbeulten Honda und schimpft gleich mal auf die Europäer, diese Waschlappen, die ohne die USA gar nicht imstande wären zu überleben. Zu feige für jeden Krieg, in Bosnien habt ihr zugeschaut, wie die Menschen abgeschlachtet wurden. In der Ukraine zieht ihr den Schwanz ein, andere sollen ständig für euch die Waffel aus dem Feuer holen. Die Waffel?, frage ich. Auf Deutsch sind es die Kastanien, die man aus dem Feuer holt.
Und dann auch noch immer recht haben wollen, grantelt Vince.
Die Sonne geht eilig in einem Farbfeuerwerk unter, wie sie das hier so macht. Ich erinnere mich an das Licht, dieses kristallklare Licht, das alles erscheinen lässt wie ausgeschnitten. Wie sehr habe ich, als ich zum ersten Mal hierherkam, über das Licht gestaunt, das dieses ganze Amerika aussehen ließ wie ein Plattencover. Was für ein himmelweiter Unterschied zum grau verhangenen Hannover, wo man die meiste Zeit des Jahres wie hinter einer Milchglasscheibe verbrachte. Unablässig rieb ich mir hier die Augen. Selbst auf meinen Schecks der Bank of America prangte ein glühender Sonnenuntergang.
Mit vierzehn ist Vince ganz allein aus Sizilien eingewandert, erzählt er. Ich sage nicht, dass er doch eigentlich auch Europäer ist. Hat sich mit Jobs durchgeschlagen, dann vierzig Jahre lang beim Finanzamt als Steuerprüfer gearbeitet. Es ödet ihn an, dass die großen Firmen keine Steuern zahlen und die jungen Techies mit ihren gigantischen Einkommen San Francisco übernommen haben.
Sie nehmen mir die Stadt weg. Nichts kann man sich mehr leisten. Mit 80000 Dollar Jahreseinkommen giltst du jetzt offiziell als arm. Ich habe nie mehr als 72000 verdient. Ist doch scheiße, oder? Was sagen Sie? Ja, murmele ich, ist scheiße.
Und die ganzen Obdachlosen in der Stadt, überall nur noch Obdachlose. Am Wochenende fahre ich an den Strand und hole große Steine, die lege ich auf den Bürgersteig vor meiner Wohnung, damit sie dort nicht mehr rumsitzen können. Im Januar muss ich raus aus meiner Zweizimmerwohnung, die hat so ein Silicon-Valley-Affe für 1,8 Millionen Dollar gekauft, der ist erst 25 Jahre alt. Jetzt sitze ich selbst bald auf der Straße, vor meiner eigenen Wohnung, aber nirgendwo kann ich mich hinsetzen, denn shit, da sind ja die Steine!
Er lacht röhrend. Seine Zähne sind nicht in bestem Zustand. Auf der klassischen Heldenreise wäre Vince die ideale Besetzung für den lustigen, aber nicht ganz zuverlässigen Begleiter im fremden Land, der im entscheidenden Augenblick vielleicht doch die Beine in die Hand nimmt. Die Dunkelheit fällt dramatisch wie ein Vorhang nach einer kurzen Dämmerung. Die Dinge verändern sich rasant und ohne lange Vorankündigung. Auch daran musste ich mich damals gewöhnen. Ich war so langsam, so umständlich, so deutsch.
Wir fahren über die Golden Gate Bridge, die jetzt sieben Dollar Maut kostet. Vince setzt mich vor einem Motel direkt am Highway ab. Keine Kneipe, kein Restaurant in Sicht.
Wo bekomme ich jetzt noch was zu essen?
Tja, sagt Vince, am besten im Traum, da können Sie bestellen, was Sie wollen und es ist auch noch günstig.
Er lacht röhrend und düst davon. Ein Rücklicht ist kaputt. Natürlich. Das leicht Verlotterte, Kaputte gehört zu seinem Archetypus unbedingt dazu, im Film würde die Requisite dafür extra und kunstvoll sein Rücklicht zerstören.
Die verschlafene Rezeptionistin findet meinen Namen in den Reservierungen nicht. Auch das sollte mich nicht weiter überraschen. Gehört zum Standardprogramm der Heldenreise: Hat der Held die Schwelle überschritten, lauern überall Unbill, Ärger und Gefahren, er ist ein Fremder und wird nicht mehr erkannt. Nicht mehr gesehen. Gehört nicht mehr dazu. Erst als ich meinen Namen auf die falscheste Art, die mir einfällt, buchstabiere, tauche ich im System auf. Sie gibt mir die Zimmerkarte und informiert mich gähnend, dass das WLAN wegen der Waldbrände nicht funktioniert, sorry, die Telefongesellschaft hat das Netz vorsichtshalber gekappt. Ja klar, Waldbrand. Abgeschnitten von der Welt. Wenn man das heldische Erzählprogramm begriffen hat, ergibt alles einen Sinn. Die Prüfungen beginnen. Ich ziehe meinen Koffer durch endlose Flure, mein Zimmer liegt am hintersten Ende, es riecht nach Desinfektionsmittel, ein Geruch, der für mich immer mit den USA verbunden war, bevor wir dann in der Pandemie alle anfingen, uns ständig die Hände zu desinfizieren. Das Zimmer riecht muffig, ich reiße die doppelt gesicherten Fenster zu einem riesigen, leeren Parkplatz auf, falle ins Bett, zerre die festgesteckte Decke von meinen Füßen. Nie habe ich verstanden, wie man so schlafen kann, ohne sich die Füße zu brechen. Im Halbschlaf fällt mir ein, dass ich Angst haben sollte, weil ich in den USA bin. Ich wühle mich aus dem Bett, schließe die Fenster wieder.
Meine deutsche Furchtlosigkeit oder grenzenlose Naivität erstaunte und bestürzte meine Mitstudierenden damals, sie bemühten sich, mir Angst beizubringen wie eine neue Sprache: Sieh dich immer um, ob dir jemand folgt. Auch im Supermarkt. Hab besonders Angst vor jungen Schwarzen Männern. Halte nie allein im Auto auf einem Parkplatz. Schließ die Tür mehrmals hinter dir ab. Geh nie allein in ein fremdes Haus, durch unbekannte Stadtviertel, am besten gar nicht zu Fuß, dein Auto ist der sicherste Ort. (Ich hatte gar kein Auto.) Verriegele immer dein Auto von innen. Schau an einer roten Ampel nicht zum Fahrer im Nachbarauto, er könnte es für eine Aufforderung halten.
Fürchte dich! Immer und überall!
Ich kann nicht mehr schlafen. Fühle mich allein. Im Film ist ein Mann allein in einem Hotelzimmer immer romantisch. Eine Frau nie. Dem Mann fehlt nichts, der Frau alles. Der Mann ruht sich nur kurz aus vom Abenteuer, bevor er wieder loszieht, der Frau droht tiefe Einsamkeit wie eine Strafe. Im Fernseher wird auf allen Kanälen geschossen, ich zähle achtundzwanzig Leichen in zwölf Minuten.
Am nächsten Morgen sitze ich an einem türkisblauen Swimmingpool inmitten von Beton, umgeben von hohen Maschendrahtzäunen wie in einem Gefängnis, aber da ist es wieder, das gleißende Licht Kaliforniens, wie eine ständige Erpressung: Cheer up! Lächle, lächle, denk positiv, und fürchte nichts! Das ist die Rüstung, die hier jeder trägt. Jeden Tag wieder zieht man damit in die Schlacht und zeigt sich lächelnd und tapfer. Ich habe damals schnell gelernt, die amerikanische Rüstung anzulegen, aber ich fühlte mich durch sie erdrückt und kam mir oft verlogen vor. Warum sollte ich so tun, als wäre alles just great, wenn es doch gar nicht stimmte? Warum behaupten, es ginge mir fine, just fine, wenn mir hundsmiserabel zumute war? Manchmal jedoch half die Zwangslüge, die gegenseitige Verpflichtung, so gut es geht, glücklich zu erscheinen, denn da nicht nur das Sein, sondern auch der Schein das Bewusstsein bestimmt, fühlte ich mich manchmal tatsächlich besser, wenn ich nur oft genug gelächelt hatte und angelächelt worden war und immer wieder laut gerufen hatte: I am fine, just fine! Man konnte anscheinend beschließen, happy zu sein. Kein besonders deutsches Konzept.
Der klassische amerikanische Held ist Optimist. Er lässt sich nicht unterkriegen, er gibt nie auf, unbeirrt folgt er seinem Traum. Während er durchs Unterholz stapft auf der Suche nach dem Drachen, bangt die Frau daheim. Sie hat keinen Traum, den sie von sich aus und allein verfolgen könnte, sie wartet auf die Rückkehr des Helden und ist, bei den vielen Sorgen, die sie sich macht, eher Pessimistin. Die Hüterin des Konjunktivs. Hätte, würde, könnte. Er könnte sich das Bein brechen, vergessen, dass er auf Erdnüsse allergisch ist, die falsche Waffe mitnehmen, die Rüstung verkehrt herum anziehen – es gibt so vieles, was schiefgehen könnte. Aber nur, wenn ordentlich viel schiefgeht, sind wir, die dem Helden dabei zuschauen, wie er zum Helden wird, zufrieden und fühlen uns unterhalten. Sein Schlamassel ist unser Vergnügen. Würde bei einer Heldin ähnlich viel schiefgehen, oder wäre sie umsichtiger, vorsichtiger, klüger – und damit automatisch weniger unterhaltsam? Oder ist einfach mehr Fantasie gefragt, um die Heldin in Schwierigkeiten zu bringen, weil sie so gut vorgesorgt und die Zeckenkarte, den Verbandskasten, Proviant und ein Solaraufladegerät fürs Handy eingesteckt und die App für giftige Pflanzen und gefährliche Tiere geladen hat, bevor sie in den Dschungel gezogen ist? Und dann doch vernünftigerweise umkehrt, wenn es ihr idiotisch gefährlich erscheint? Oder ist das nur ein weiteres Klischee von Weiblichkeit?
Als ich vor die Tür trete, steht dort schon Vince und pflaumt mich an, ich sei doch schließlich Deutsche, warum also, verdammt noch mal, nicht auf die Minute pünktlich? Er fährt mich zum Kino des Festivals, ich lade ihn zur Vorstellung meines Films Kirschblüten und Dämonen ein.
Ich weiß nicht, sagt er, so’n europäischer Film, da passiert immer nix, und alle reden so viel.
Doch, doch, da passiert viel, verspreche ich.
Dämonen hab ich selbst genug, grummelt er, willigt aber ein zu kommen.
Den Film haben wir in Bayern und Japan gedreht. Er ist die Fortsetzung von Kirschblüten Hanami, der die Geschichte von Rudi Angermeier erzählte, der kurz vor seiner Pensionierung seine Frau verliert. In seiner Trauer flieht er zu seinem Sohn Karl nach Tokio, der ebenfalls tief getroffen ist vom Verlust der Mutter, aber keine Zeit für den Vater hat. Es ist die Zeit der Kirschblüte, und in einem Park lernt Rudi eine junge Tänzerin kennen, die seinen Schmerz erkennt und sich um ihn kümmert wie keines seiner Kinder. Sie bringt Rudi dazu, sich auf die Spurensuche nach seiner Frau zu begeben, die selbst einmal Tänzerin werden wollte, aber ihren Traum für ihre Familie begraben hatte. Rudi wird zum Helden, weil er nicht nur seinen Blick auf seine Frau verändert, sondern auch sich selbst. Ein grantiger, festgefahrener, konservativer Bayer öffnet sich zusehends, wird verletzlich und weich und tanzt sogar am Ende unbeholfen, aber dafür rührend vor dem Berg Fuji für seine verstorbene Frau. Ganz gleich, wo der Film auf der Welt gezeigt wurde, überall ging an dieser Stelle ein Seufzen durchs Kino, und die Taschentücher wurden gezückt. Es ist ein Augenblick, der die ganzen Mühen des Filmemachens lohnt, denn es gibt in ihm eine tiefe Verbindung zwischen Rudi Angermeier, dem Publikum und unserem miesen kleinen Schicksal.
Diese seltsame Kraft, die sich aller Kontrolle entzieht, war schon beim Drehen der Szene zu spüren. Der Fuji strahlte überirdisch, es war noch kalt am frühen Morgen, die Luft kristallklar, und als Elmar Wepper als Rudi tanzte, fing das japanische Team an zu weinen.
Die Fortsetzung Kirschblüten und Dämonen nun dreht sich um den Sohn Karl. Er hat den Verlust der Mutter nicht verkraftet, der er besonders nahestand und die seine Empfindsamkeit geschätzt hat, ganz anders als der Vater. Selbst als Tote ist sie noch ganz bei ihm, er kann sie nicht gehen lassen. Verzweifelt ringt er mit seiner Identität, auch seiner sexuellen. Im Lauf der Geschichte wird auch Karl zum Helden – sonst wäre es keine Geschichte und er nicht ihr Protagonist. Zögerlich begibt er sich immer mehr in eine offene, weniger festgelegte Identität, macht sich ebenfalls verletzlich, was für eine männliche Hauptfigur fast immer eine tiefgreifende Veränderung bedeutet. Für eine weibliche eher nicht, da das Genderklischee sie meist sowieso als verletzlich und ständig verletzt erzählt. Müssen wir also, um zu Heldinnen zu werden, den umgekehrten Weg gehen? Von Penelope zu Lara Croft, zu Superwoman und Black Widow? Dafür gibt es inzwischen reichlich Beispiele. Aber ist das wirklich erstrebenswert? Oder sollten wir lieber ganz aus dem Monomythos der Heldenreise aussteigen? Aber wie erzählen wir dann noch eine Geschichte?
Ich sehe meinem Hauptdarsteller Golo Euler in der Rolle von Karl zu, wie ihm in der letzten Einstellung des Films Tränen in die Augen steigen und er ganz durchsichtig, ganz zart erscheint, und jedes Mal muss ich schlucken, weil ich mit ihm fühle, obwohl ich doch selbst die Szene geschrieben habe und weiß, dass er spielt. Aber wie dankbar unser Hirn auf die Illusion reagiert und sie für bare Münze halten möchte. Wir scheinen programmiert zu sein auf Geschichten. Ich erinnere mich, wie ich für meine kleine Tochter als TV-Ersatz ein Schattentheater aus einer Obstkiste und Pergamentpapier bastelte, mit ihr zusammen einen Wal ausschnitt, der auf ihren Wunsch alles verschlingen sollte, aber kaum trat er als Schatten hinter dem Pergamentpapier auf, wurde er so real, dass sie in Tränen ausbrach. Und dennoch wollte sie ihm unbedingt weiter zuschauen. Wir sind süchtig nach der Story, der Erzählung, dem Narrativ und ziehen sie nicht nur der realen Welt vor, sondern verwandeln diese, wann immer es geht, in Fiktion.
Die Schlusstitel laufen, noch ist unklar, wie der Film angekommen ist, mein Herz schlägt schneller, wie immer meldet sich die Angst, abgelehnt, ausgebuht, sogar gehasst zu werden. Die Verletzungsgefahr ist hoch. Miese Kritiken, ausbleibendes Publikum, negative Reaktionen verkrafte ich nur schwer und leide lange. Jedes Mal wieder der freie Fall – warum eigentlich? Als ich mit zwanzig meinem Vater meinen Berufswunsch mitteilte, schüttelte er mitleidig den Kopf und fragte: Warum willst du dich ein Leben lang von der Meinung anderer abhängig machen?
An diesem Abend kommt der Film gut an, aber in der anschließenden Diskussion beklagt sich eine Zuschauerin, deren Hautfarbe ich nicht erkennen kann, dass der Film sehr weiß besetzt sei, bis auf die eher kleine Rolle der Frau vom Jugendamt.
Bayern ist auf dem Land einfach sehr weiß, wende ich ein. Wenn ich dort Diversität behaupte, entspricht das nicht der Wahrheit.
Aber müsse man nicht im Film gerade deshalb divers erzählen, fragt die Zuschauerin, um so die Realität zu zwingen, sich zu verändern?
Unbedingt, stimme ich zu, aber in manchen Geschichten wirkt das unglaubwürdig.
Aber ist nicht sowieso alles Fiktion?, fragt sie.
Höflich werden wir von einer jungen afroamerikanischen Platzanweiserin aus dem Saal gescheucht. Bald soll der nächste Film beginnen, und wir haben bereits zehn Minuten überzogen. Ich bedanke mich bei ihr für ihre Geduld und lege ihr dabei die Hand auf die Schulter, die sie ruhig liegen lässt und betrachtet, bis ich sie wieder wegnehme. Meine Freundin Lille, die neben mir gestanden hat, sagt danach zu mir: Du weißt schon, dass dein Schultertätscheln eben rassistisch war und du damit ein Machtverhältnis ausgedrückt hast, oder?
Wieso?
Ganz einfach: Der, der die Macht hat, fasst den an, der sie nicht hat.
Quatsch, sage ich, so war das doch nicht gemeint.
Vielleicht nicht so gemeint, es ist aber einfach so, sagt Lille. Es verletzt.
Aber das war doch nicht absichtlich. Ist die Absicht nicht entscheidend?
Was ändert die Absicht denn an der Verletzung?
Es macht doch einen Unterschied, ob mich jemand mit Vorsatz verletzt oder aus Versehen, rege ich mich auf.
Und sie soll jetzt unterscheiden zwischen deiner guten oder vielleicht bösen Absicht?
Ich hab ihr doch nur die Hand auf die Schulter gelegt!
Das »nur« bestimmst aber du!
Rettet den Kontext!, murmele ich.
Jetzt willst du auch noch die Deutungshoheit über den Kontext? Der ist für dich doch ein komplett anderer als für sie. Fang mal lieber an, von vornherein dein weißes Privileg mitzudenken!
Ich denke also ein bisschen nach und stelle fest, dass ich mich durchweg als freies Individuum betrachte, das in keinerlei historischem Zusammenhang agiert und sein Privileg nicht im Geringsten mitdenkt.
Ich laufe also zurück, entschuldige mich bei der Platzanweiserin. Sie zuckt die Schultern, winkt ab. Ich füge hinzu, ich käme aus Europa, als erkläre das irgendetwas. Fast mitleidig schaut sie mich an, und ich meine, in ihrem Blick zu erkennen, wie satt sie die Erklärungen von Weißen hat, die vielleicht sogar ihr Privileg erkennen, aber im Kern nichts verändern.
Aus dem alten, zerbeulten Honda steige ich um in den neuen roten Porsche Cabrio von Lille, verabschiede mich von Vince. Er beklagt sich über meinen Film, er sei ihm zu ernst gewesen. So eine traurige Familiengeschichte, alle machen sich fertig, wie in seiner Familie, und niemand habe am Ende gewonnen.
Es ist halt ein realistischer Film, sage ich.
Ist doch scheiße, sagt Vince. Ich ziehe die Fiktion vor.
Lille ist studierte Ökonomin, frisch in Rente. In einer Start-up-Firma von jungen Techies hat sie viel Geld verdient und eine Zweizimmerwohnung in San Francisco gekauft. Ich frage nicht, was sie gekostet hat. Sie lebt allein und ist sehr guter Dinge. Sie ist eigentlich immer sehr guter Dinge. Ursprünglich kommt sie aus Deutschland, lebt aber seit Jahrzehnten in den USA. In der Dramaturgie der Heldenreise gäbe sie, weil sie sich in beiden Ländern auskennt, eine gute Mentorin ab, Archetyp »weise Frau« mit grauen Haaren. Die Mentorin führt den Helden ein in die fremde Welt und beschützt ihn, so gut es geht.
Lille hat ihre Haare gerade frisch blondiert, und während sie in ihrem Porsche über den Highway brettert und unsere Haare im Wind flattern, erzählt sie, dass sie nun als Rentnerin ihr Wissen in den Dienst der Nachkommen von Sklaven stellt, um Reparationszahlungen zu berechnen. Sie fährt dafür auf Konferenzen, oft ist sie die einzige weiße Frau dort, die nur akzeptiert wird, weil sie als Deutsche als Expertin für das Thema Wiedergutmachung gilt. Die Diskussionen sind kompliziert und langwierig. Viel wird darüber gestritten, ob Geld über Jahrhunderte erlittenes Unrecht ausgleichen kann oder nur wieder auf die Opferrolle verweist.
Geld ist immer besser als kein Geld, sagt Lille, das ist meine Meinung.