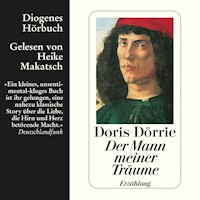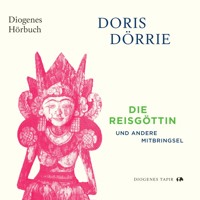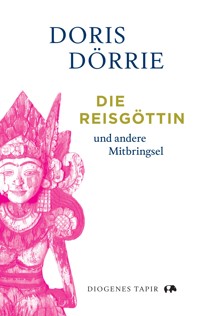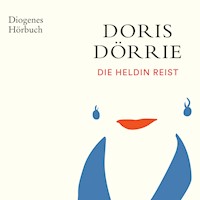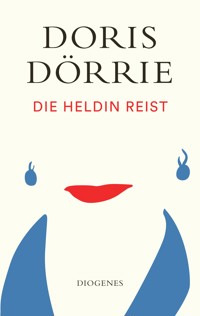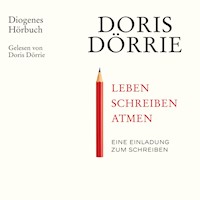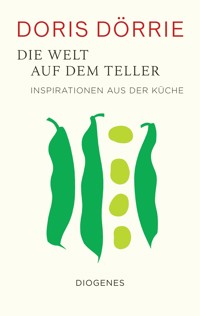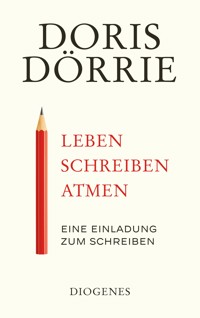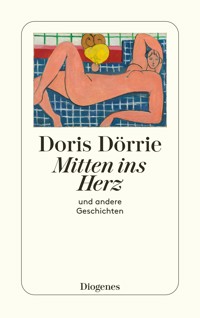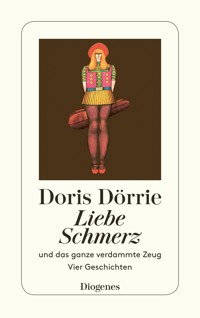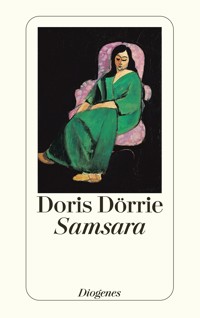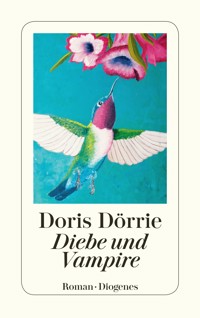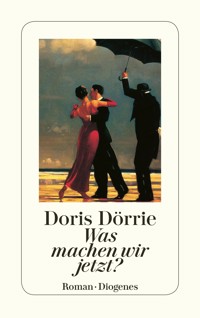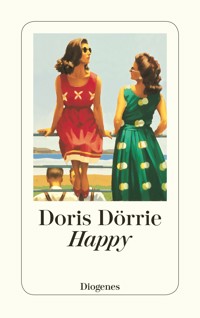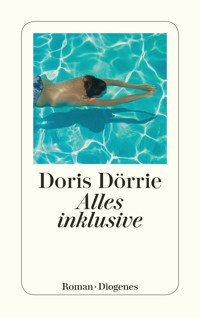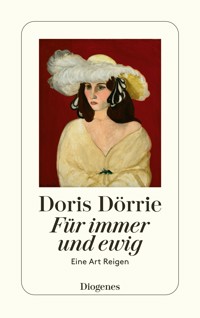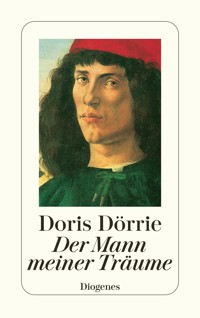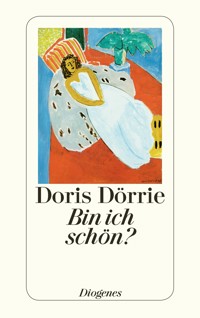Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser Berlin
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Hanser Berlin LEBEN
- Sprache: Deutsch
Doris Dörrie, die gefeierte Filmemacherin und Autorin, erzählt ihr Leben als Wohnende und fragt, wie und mit wem wir wohnen wollen – eine unendliche Vielfalt des Wohnens tut sich auf.
Doris Dörrie ist eine Wohnende wider Willen. Nie wollte sie sich niederlassen, fest einrichten, Wurzeln schlagen, aber wie andere wohnen, hat sie immer schon fasziniert. In Kalifornien geht sie zu Hausbesichtigungen, nur um sich andere Leben in anderen Räumen auszumalen. Auf ihren unzähligen Reisen nach Japan, Mexiko, Marokko, Amerika und Südeuropa sieht sie, wie eng das Wohnen an die jeweilige Kultur geknüpft ist. Und bei ihrer Arbeit als Filmemacherin wird sie zur Expertin für das Erschaffen künstlicher Wohnwelten. Doch während sie ihr eigenes Elternhaus beschreibt, die Studentenbuden, Wohngemeinschaften und das versuchsweise Leben auf dem Land, drängt sich ihr eine Frage immer wieder auf: Wo ist eigentlich in all diesen Häusern und Wohnungen der Raum für die Frauen geblieben? Könnte es etwa sein, dass aus der Hausfrau nur eine Frau im Haus mit anderen geworden ist? Doris Dörrie ist fest entschlossen: Sie will ihre ganz eigene Art des Wohnens finden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 148
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Doris Dörrie, die gefeierte Filmemacherin und Autorin, erzählt ihr Leben als Wohnende und fragt, wie und mit wem wir wohnen wollen — eine unendliche Vielfalt des Wohnens tut sich auf.Doris Dörrie ist eine Wohnende wider Willen. Nie wollte sie sich niederlassen, fest einrichten, Wurzeln schlagen, aber wie andere wohnen, hat sie immer schon fasziniert. In Kalifornien geht sie zu Hausbesichtigungen, nur um sich andere Leben in anderen Räumen auszumalen. Auf ihren unzähligen Reisen nach Japan, Mexiko, Marokko, Amerika und Südeuropa sieht sie, wie eng das Wohnen an die jeweilige Kultur geknüpft ist. Und bei ihrer Arbeit als Filmemacherin wird sie zur Expertin für das Erschaffen künstlicher Wohnwelten. Doch während sie ihr eigenes Elternhaus beschreibt, die Studentenbuden, Wohngemeinschaften und das versuchsweise Leben auf dem Land, drängt sich ihr eine Frage immer wieder auf: Wo ist eigentlich in all diesen Häusern und Wohnungen der Raum für die Frauen geblieben? Könnte es etwa sein, dass aus der Hausfrau nur eine Frau im Haus mit anderen geworden ist? Doris Dörrie ist fest entschlossen: Sie will ihre ganz eigene Art des Wohnens finden.
Doris Dörrie
WOHNEN
Hanser Berlin
Für meine Schwestern
»Die Küchen in meinen Träumen. Wie viele werden es sein? In meiner Vorstellung und in der Wirklichkeit. Auf Reisen, allein, unter Menschen, zu zweit. Überall, wo mein Leben sich abspielt. Und ich bin sicher: Es werden viele sein.«
Aus Kitchen, Banana Yoshimoto
Als Kind besaß ich ein Puppenhaus. Es war kein altmodisch romantisches Haus, sondern ultramodern mit klaren Linien und wenig Schnickschnack. Es hatte zwei Stockwerke und ein rotes Dach, im Parterre befanden sich Wohnzimmer mit Couch und grünem Teppich, eine Küche mit gelben Einbauschränken, im ersten Stock das Elternschlafzimmer mit Doppelbett und klitzekleinen, weißen Schleiflackmöbeln, ein Kinderzimmer mit einem Stockbett und ein Bad mit Badewanne. Bewohnt wurde das Haus von einer vierköpfigen Familie: Vater, Mutter, Tochter und Sohn. Sie waren fingergroß und biegsam, ich konnte den Vater auf die Couch setzen, die Kinder ins Bett legen, auf den Teppich und in die Badewanne, die Mutter an den Herd stellen, oder ich ließ sie von Zimmer zu Zimmer wandern und aufräumen. Das hatte etwas Ermüdendes und wurde schnell langweilig, deshalb setzte ich manchmal die Mutter auf die Couch, legte den Vater ins Stockbett, stellte die Kinder an den Herd, aber dann wollte das ganze Haus nicht mehr recht funktionieren. Es schien zu streiken und nur darauf zu warten, dass die vorgesehene Ordnung wiederhergestellt wurde und alle an ihrem Platz waren. Mir fiel nichts anderes für sie ein, als Zeitung zu lesen (der Vater), in einem Topf zu rühren (die Mutter), bewegungslos auf dem Teppich zu sitzen (die Kinder). Sie schienen nicht das Haus zu bewohnen, sondern das Haus sie, was sie anscheinend trübsinnig werden ließ, obwohl das Haus doch so hübsch war!
Ihre Melancholie verstand ich nicht recht, bis ich auf die Idee kam, sie allesamt aus ihrem Haus herauszuholen: Ich malte ihnen Straßen, wilde Tiere und einen Dschungel, hohe Berge und das Meer. Die Mutter ließ ich auf einem Tiger reiten und den Vater durch den Wald robben, die Kinder von einem Berggipfel direkt ins blaue Meer springen. Davon konnten sie gar nicht genug bekommen, und nur unwillig ließen sie sich abends von ihren Abenteuern nachhause und ins Bett bringen, wo sie hingehörten: die Eltern ins Elternschlafzimmer, die Kinder ins Stockbett. Sie schliefen schnell ein und freuten sich auf den nächsten Tag, wenn sie das Haus wieder verlassen durften. Befriedigt löschte ich das Licht.
Meine früheste Erinnerung ist eine Tapete neben meinem Kinderbett, schwarze Hände auf weißer Raufaser. Meine Eltern waren jung und fanden das anscheinend sehr cool. Ihre erste eigene Wohnung in der Stadtmitte von Hannover war eine kleine Zweizimmerwohnung gleich neben den Trümmern des Hauses, in dem mein Vater aufgewachsen war. Beide Eltern wurden im Krieg ausgebombt, die Familie meines Vaters flüchtete zu Verwandten aufs Land, meine Mutter wohnte mit ihrer fünfköpfigen Familie zunächst im Keller des zerstörten Hauses. Ich kannte diesen Keller nur aus Erzählungen, obwohl er unter dem wiederaufgebauten Haus meiner Großeltern lag, in dem ich als Kind viel Zeit verbracht hatte, aber nie war ich auf die Idee gekommen, ihn sehen zu wollen. Erst als eine amerikanische Freundin meine Mutter unbefangen nach ihren Kriegserlebnissen befragte, zeigte meine Mutter ihn uns bereitwillig. Ich konnte nicht fassen, wie eng, feucht, kalt und klein der Keller war. Ganz genau wusste meine Mutter noch, wo die Betten gestanden hatten und wo der Herd, an welcher Stelle sie sich an dem niedrigen Kellergewölbe immer den Kopf gestoßen hatte, aber auch, wie die Familie die allgemeine Zerstörung als Preis für die Befreiung vom Faschismus akzeptierte. Sie war fast vierzehn, als sie am 10.4.1945 in ihr Tagebuch schrieb: Nachdem wir die ganze Nacht wegen Artilleriebeschuss im Rathauskeller gesessen hatten, kam um 10 Uhr die Nachricht: Britische Infanterie am Schwarzen Bären! Nun war der Augenblick da, auf den wir wochenlang gewartet hatten! Das war unsere Befreiung von den Nazis, die uns jahrelang schikaniert und geknechtet haben. Jetzt können wir alle Nachrichten hören. Wir können ruhig ins Bett gehen, weil wir keinen Alarm mehr fürchten müssen. Wie schön, dass wir uns jetzt ausgezogen ins Bett legen können!
Und sofort träumte die Familie vom Wiederaufbau: Heute Nachmittag haben wir Kinder wieder Steine geschleppt. 360 haben wir schon. 5000 müssen wir haben! Morgen Nachmittag gehen wir wieder in die Trümmer und suchen welche. Papa hat schon mit Herrn Habekost gesprochen. Der würde uns eine Wand davor ziehen. Das soll dann nur ein Behelf sein, bis wir unser ganzes Haus wiederaufbauen können. Martin (der Bruder) hat schon Pläne für das Haus gemacht. Man kann doch mal wieder an so was denken, weil die Angriffe aufgehört haben! Wir gingen auf unseren Schutt und fingen an der Westseite an zu graben. Wir fanden aus Omamas Vitrine mehrere winzige Krüge, Vasen, Töpfchen.
Das verlorengegangene Haus ihrer Kindheit, in dem sie behütet und privilegiert aufgewachsen war, beschrieb meine Mutter noch im hohen Alter mit verblüffender Genauigkeit, als hätte sie es nie verlassen: ein weinbewachsenes Fachwerkhaus, rosa gestrichen, mit grünen Fensterläden, 1840 von ihrem Urgroßvater erbaut, in dem auch ihr Großvater und Vater aufgewachsen waren. Sie erinnerte sich an die Sandsteinstufen vor der Haustür, die blanken Messingknäufe, die Klingelzüge mit weißen Porzellangriffen an einem Draht, den Ton der Klingel, den muffigen Geruch im Flur und nach Ölfarben im Zimmer der wunderlichen alten Tante, die malte, den Geruch von Papier und Tinte in der Kanzlei ihres Vaters, nach Kohle und Holz vom Badeofen im Badezimmer. In ihren Erinnerungen ging sie durch jedes Zimmer bis hinauf auf den Taubenboden, wo ihr Vater Flugtauben züchtete und wo es scharf nach Vogelmist roch.
In der Nazizeit wurde das Haus zunehmend zur Burg, meiner Mutter und ihren beiden Geschwistern schärfte der Vater ein, niemandem außerhalb der eigenen vier Wände und des engsten Familienkreises zu trauen. In allen Diktaturen werden die Wohnungen zum Rückzugsort, der jedoch immer auch von Spitzeln und Verrätern bedroht ist. Es kursierten Geschichten, in denen sogar Kinder ihre Eltern verpfiffen hatten, die heimlich im Radio die Kriegsnachrichten der BBC hörten. Je gefährlicher die Welt draußen wurde, desto enger rückte die Familie zusammen. 1943 wurde das Haus von Spreng- und Brandbomben getroffen und die gesamte Altstadt von Hannover in einem gewaltigen Feuersturm in Schutt und Asche gelegt. Die Überlebenden stelle ich mir vor wie all die Menschen, die in den heutigen Kriegen und Naturkatastrophen ihre Wohnungen verlieren und denen ich in Echtzeit dabei zusehen kann, wie sie verwirrt umherirren, aufs reine Überleben konzentriert. Wir haben uns an diese Bilder gewöhnt, sie taugen kaum noch zum empathischen Aktivismus, außer die Katastrophe rückt uns nah. Wir sind froh, dass sie uns nicht erwischt hat. Früher stand an den Bauernhäusern als Bitte an den heiligen Sankt Florian, den Schutzpatron der Feuerwehr: Schon’ dieses Haus, zünd’ andere an.
Zum Glück war die Familie meiner Mutter kurz vor dem Angriff aufs Land verteilt worden und überlebte, aber ihre Schutzburg war bis auf die Grundfesten zerstört.
In langer, mühevoller Arbeit räumte sie den Schutt des zusammengebrochenen Hauses beiseite und zog in die zwei niedrigen Kellerräume. Aus den Trümmern wurde ein Kohleherd geborgen und wieder funktionsfähig gemacht, der Vater führte vom Keller aus sogar bald wieder sein Anwaltsbüro. Ein Stück Garten wurde freigeräumt und Gemüse angebaut, was vorher nie möglich gewesen war, weil der Garten im Schatten des Hauses gelegen hatte, jetzt aber besaß er die schönste Sonnenlage, und es wurden Radieschen, Salat und Möhren gepflanzt. In den Erzählungen meiner Mutter klang es fast wie ein Abenteuer. Die so mühsam errichtete Kellerwohnung wurde überschwemmt, im Winter holten sich die Kinder Frostbeulen und wegen des beizenden Qualms des Kohleofens ständig entzündete Augen, aber die Familie hielt in ihrem Notquartier zusammen wie Pech und Schwefel, was die Vorstellung meiner Mutter von Leben, Wohnen und Familie entscheidend beeinflusste. In einer richtigen, eigenen Wohnung wohnen zu können, wurde zum Synonym für Frieden und Freiheit.
Mein Großvater suchte im Bombenschutt weiter nach Überbleibseln, Gegenständen und Erinnerungen an das Leben zuvor, und ich erinnere mich, dass bei ihm immer ein kaputter Teller, eine kaputte Skulptur oder altes Spielzeug auf dem Schreibtisch stand, Dinge, die er aus dem Schutt ausgegraben hatte und jahrzehntelang geduldig reparierte. Ein kleines Pferd mit Reiter. Den sterbenden Gallier als Replika. Einen Teller mit Zwiebelmuster. Einen Briefbeschwerer aus Bronze. Vieles wurde nie wieder ganz, aber das war vielleicht gar nicht wichtig, es waren seine Erinnerungen, die er immer wieder auffüllte. In Gedanken lebte er weiterhin in der verlorenen Wohnung.
Mit den Eltern besuchten wir als Kinder Pompeji, später lief ich durch die Museen von Athen, Rom, Mexiko, und immer wieder blieb ich an den Vitrinen mit Scherben von Tellern, Bechern, Vasen und Gebrauchsgegenständen hängen. Die Überbleibsel von Leben und Wohnen aus lang vergangenen Zeiten erinnerten mich an meinen Großvater. Viele Jahre später überfiel mich die Erinnerung an ihn und die Geschichte meiner Eltern in der Katastrophenregion von Fukushima. In Japan gibt es die Technik Kintsugi, mit der man Kaputtes kittet und mit Gold die Risse sichtbar macht. Ein zerbrochener Teller verliert nicht seinen Wert, sondern wird dadurch nur wertvoller. Die Vergangenheit wird sichtbar gemacht — hier ist etwas kaputtgegangen — und gleichzeitig die Gegenwart: Es ist weiterhin am Leben.
Wir tragen den Ort, an dem wir aufgewachsen sind, für immer in uns, und wenn wir Glück haben, war es ein geschützter, sicherer Ort.
Ich frage mich, wie sehr meine Art, zu wohnen, von der Wohnung meiner Kindheit geprägt wurde, wie sehr wir Wohnmuster in uns tragen, die wir entweder imitieren oder gegen die wir revoltieren. Meine Schwestern wohnen ganz anders als ich. Sie interessieren sich für Möbel und Design, in ihren Wohnungen herrschen Schönheit und Ordnung, sie sind neben ihren Berufen fantastische Köchinnen und Gärtnerinnen. Ich dagegen bin nie der Wohntyp gewesen, mich hat mein eigenes Wohnen nie so wirklich interessiert, sondern immer eher das Wohnen der anderen.
Im Zeit Magazin (16/2024) gab es einen (hoffentlich) nicht ganz ernst gemeinten Test, mit dem man seine Wohnpersönlichkeit und seinen Wohntyp herausfinden und die Frage beantworten konnte: »Residierst oder haust du?« Ich habe keine Ahnung. Ganz sicher residiere ich nicht, aber wie eine Maus in ihrem Loch hause ich auch nicht. Mit leichtem Bangen versuchte ich, den Test zu absolvieren, aber scheiterte bereits an der Frage, an welchem Schreibtisch ich besonders produktiv wäre:
Replik des »Resolute Desk«, der im Oval Office steht 5 PUNKTE
Tisch »Offset« von MDF Italia 2 PUNKTE
Stehpult »Germania« (bueroshop24.de) 1 PUNKT
Sekretär »D.847.1« von Molteni & C 3 PUNKTE
Keiner der zur Auswahl stehenden Schreibtische war mir bekannt, ich war versucht, den »resoluten Tisch« (heißt er so, weil an ihm resolute Entscheidungen getroffen werden?) aus dem Oval Office anzukreuzen, weil es für ihn die meisten Punkte gab, aber mich verwirrte die Annahme, ein bestimmter Schreibtisch sei spielentscheidend für die Produktivität. Ist es nicht viel mehr die Möglichkeit, schreiben zu können, und die Frage, ob es überhaupt einen Raum zum Schreiben gibt? Und ob dieser Raum Männern wie Frauen gleichermaßen zur Verfügung steht?
In ihrem berühmten Essay von 1929 A Room of One’s Own schrieb Virginia Woolf, man bräuchte als Frau ein Zimmer und 500 Pfund im Jahr, um schreiben zu können. Obwohl ich seit vielen Jahren über beides verfüge, 500 Pfund und ein Zimmer, zischt doch immer wieder und immer noch die gemeine Frage durch mein Hirn, ob ich denn auch nützlich bin, wenn ich in einem Raum sitze und »nur« schreibe. Also die Frage, ob und wann eine Frau überhaupt Raum einnehmen darf, den sie nicht mit anderen teilt. Und wo der ideale Raum wäre, der ihr den Raum gibt, um zu schreiben? Wie viel Raum wird ihr gestattet? Wie viel Raum gestattet sie sich selbst?
Virginia Woolf konnte sich ihren eigenen Raum erst leisten, als ihr Roman Orlando zum Bestseller wurde. In einem Anbau des Monk’s House auf dem Land richtete sie sich ein Büro ein, wo sie auch manchmal schrieb, aber meist ging sie dafür in ihr Gartenhäuschen, wo sie nur ihr Mann störte, wenn er unbedingt genau da die frisch gepflückten Äpfel sortieren wollte. Im Winter wurde es dort zu kalt, und sie musste zum Schreiben zurück ins Schlafzimmer ziehen. Ganz gleich wo, schrieb sie jedoch täglich auf einem Holzbrett in ihrem Schoß. Der Schreibtisch war also nicht entscheidend für sie, sie hatte ihren Laptop immer dabei. Wenn es wieder wärmer wurde und sie zurückziehen konnte in ihr Gartenhaus, beschrieb sie den Weg dorthin so: »[Ich] werde an einer roten Rose schnuppern; werde sanft über den Rasen wogen (ich bewege mich, als trüge ich einen Korb mit Eiern auf dem Kopf), mir eine Zigarette anzünden, mein Schreibbrett auf die Knie nehmen; und mich, wie ein Taucher, sehr vorsichtig, in den letzten Satz hinablassen, den ich gestern geschrieben habe.«
Vielleicht geht es immer eher um den Raum im Kopf, den ein tatsächlicher Raum ermöglichen soll. Der ewige Traum vom perfekten Ort, den perfekten Bedingungen: der Traumraum im Traumhaus, das Wolkenkuckucksheim. Von welchem Haus träume ich?
Vielleicht vom blauen Haus von Frida Kahlo in Coyoacán in Mexico City, in dessen direkter Nachbarschaft ich eine Zeitlang gewohnt habe. Sie war in dem Haus aufgewachsen, als es noch ein graues Steinhaus war, aber als sie später mit ihrem Mann Diego Rivera dort wohnte (und zeitweise auch mit Leo Trotzki), ließ sie es azurblau anstreichen, in der Farbe der Hoffnung. Sie träumte von einem harmonischen Leben und Arbeiten mit Diego, der machte, was er wollte — wie sie allerdings auch. Jede Ecke des Hauses zeugt von ihrer Anstrengung und dem Willen, sich mit fröhlicher Schönheit zu umgeben. Die Küche ist quietschgelb, das Atelier blickt auf einen paradiesischen Garten mit Kakteen und wilden Pflanzen neben präkolumbianischen Skulpturen wie in einer Dschungelfantasie. Auf diesen Garten sah Frida am Ende ihres Lebens von ihrem Bett aus, in dem sie in ihrem Gipskorsett lag, das sie nach einem Unfall in ihrer Jugend fast ständig tragen musste. Sie malte dennoch weiter. Ihr ganzes Leben lang hatte sie unter Schmerzen gelitten, physischen wie psychischen.
Jeden Tag ging ich in ihren Garten, um dort zu schreiben. Auf einer der blauen Wände steht: »Frida y Diego vivieron en esta casa«, Frida und Diego haben in diesem Haus gelebt. Das rührte mich, weil ebenfalls Fridas Traum in ihrer casa azul gewohnt hatte, der noch deutlich zu spüren war: der Traum, eine Umgebung zu finden und so zu gestalten, dass sie unseren Lebenstraum beherbergt und wahr werden lässt.
Deutlich sehe ich noch mein Puppenhaus vor mir, das unserer Wohnung ähnelte, und statt meiner Puppenfamilie hätte auch meine Familie dort wohnen können. Wir waren zu sechst, vier Kinder, ein Vater, der nur zu den Mahlzeiten auftauchte und sonst arbeitete, eine Mutter, die immer zuhause und dort nützlich war, mir als Kind aber seltsam ortlos erschien, wie nicht ganz existent. Einen eigenen Raum, ein eigenes Zimmer, hatte sie nicht, was keinem von uns jemals auffiel. Aber wozu auch? Sie hatte doch die ganze Wohnung! Und jede Menge Bewegung: Tagein, tagaus rannte sie von einem Raum in den anderen, machte die Betten, räumte auf, saugte die Böden, raste in die Küche, um dort einen Topf vom Herd zu nehmen, auf den Dachboden, um Wäsche aufzuhängen, ins Wohnzimmer ans Telefon, wieder in die Küche usw. Sie bewegte sich ständig um uns herum, und wir Kinder spürten sie wie einen anhaltenden Windhauch, der uns gleichzeitig beruhigte und ein wenig belästigte. Meine Mutter behütete uns und die Wohnung. Niemals wäre ihr in den Sinn gekommen, allein ins Kino zu gehen oder in eine Kneipe. Das wäre erklärungsbedürftig gewesen: Warum wollte sie das Haus verlassen, ganz allein und ohne uns? Und wer wäre sie da draußen gewesen?
Meine Mutter verstand sich selbst nie als reine Hausfrau, sondern als eine moderne Frau, die das Familienleben mit vier Kindern managte. Gleichzeitig kämpfte sie mit Minderwertigkeitskomplexen und haderte ihr Leben lang damit, dass sie ihr Medizinstudium abgebrochen hatte, was sie aber nie auf Genderungerechtigkeit, Rollenzuschreibungen oder — Gott bewahre — das Patriarchat zurückführte. Zuhause bleiben zu dürfen, galt zu der Zeit als Privileg, das mit zunehmendem Wohlstand zumindest im Westen als Lebensziel verkauft wurde. Die Hausfrau wurde idealisiert und gleichzeitig verachtet, sie war die Therapeutin des vom Krieg traumatisierten Mannes und Quelle des häuslichen Glücks oder machtbesessen und Hausdrache. Als intellektuell galt sie natürlich nie, obwohl sie, so der männliche Verdacht, nach dem bisschen Hausarbeit tagsüber auf dem Sofa lag und las. Die Wohnung oder das Haus waren ihr »Reich«, sie kontrollierte den Zutritt, und wenn der Mann von der wohlverdienten (er brachte schließlich »die Brötchen« nachhause) Sause nachhause kam, wartete sie schon mit dem Nudelholz auf ihn. Manchmal wurde die Hausfrau »ausgeführt« wie ein Haustier und bekam, wenn sie Glück hatte, nach vielen Jahren der Ordnungsdienste im Heim, eine Nerzjacke wie ein Ehrenabzeichen. Ohne ihr Reich war sie nichts, ohne sie war die Familie heimatlos.
Fast siebzig Jahre lang bereitete meine Mutter für ihre Familie einen sicheren Raum, einen ewigen safe space,