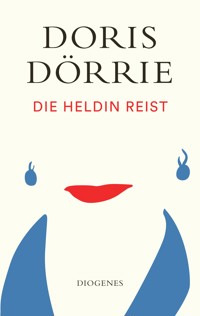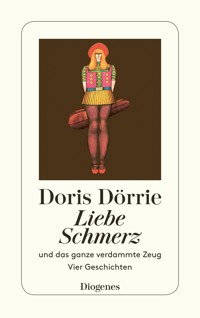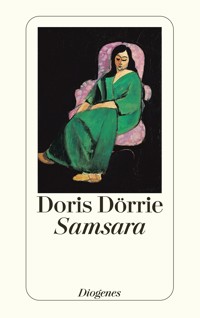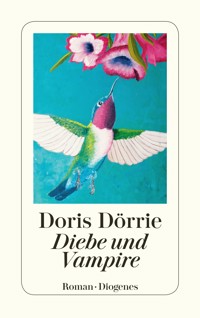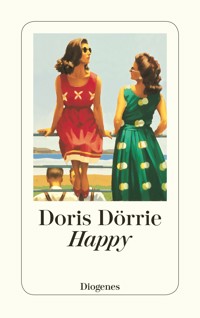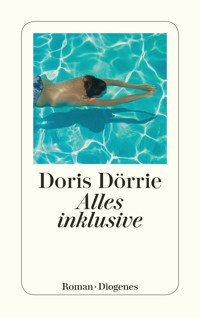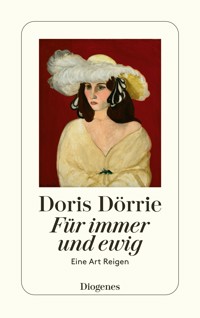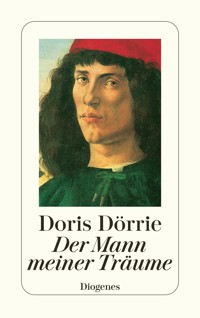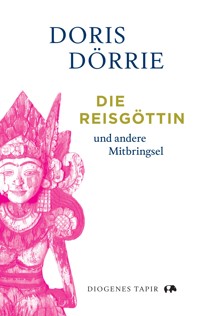
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Tapir
- Sprache: Deutsch
Nie kann Doris Dörrie der Versuchung widerstehen, von einer Reise etwas mitzubringen: eine Origami-Schnecke aus Japan, eine Ringer-Maske aus Mexiko, die Figur einer Reisgöttin aus Bali, Boxerstiefel aus New York oder Borotalco, ein Wundermittel gegen Flecken aus Italien. Nützliches, Krimskrams, exotische Lebensmittel, Zauberutensilien und kitschige Staubfänger. In der Begegnung mit den Dingen erzählt Doris Dörrie auf ihre unverwechselbar persönliche Art vom Leben, Schreiben und Reisen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 80
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Doris Dörrie
Die Reisgöttin
und andere Mitbringsel
Diogenes
Das Bürstenballett
An einer Brücke in Kyoto, die über den Fluss Kamo führt, liegt ein sehr altes Bürstengeschäft, das anscheinend von mehreren älteren Damen geführt wird, denn immer stehen andere hinter der Theke, wann immer ich hineinschaue – und das ist ziemlich oft. Mich faszinieren die weit über hundert verschiedenen Bürsten, über deren Verwendungszweck ich oft nur rätseln kann. Mein Japanisch reicht nicht für eine Erklärung aus, also führen mir die Damen abwechselnd den Gebrauch mit möglichst eindeutigen und gleichzeitig eleganten Bewegungen vor: ah, ja, Schuhe bürsten. Den Rücken. Gemüse. Einen Topf. Aber was soll das sein? In kurzen Strichen eine Wand abbürsten? Ein Fenster? Einen Schnurrbart? Auf den Knien den Boden bürsten mit einer winzigen Bürste mit langem Stiel? Ich nenne die Damen mein Bürstenballett und kann nicht genug bekommen. Am Ende kaufe ich eine Gemüse- und eine Topfbürste für mich und einen Haufen Rätselbürsten für Freunde und Verwandte.
Traurig nehme ich irgendwann Abschied, überzeugt davon, dass es ein so reiches Bürstensortiment und die theatralische Vorführung desselben nur in diesem Laden in Kyoto gibt. Bis ich in einer deutschen Kleinstadt, deren Namen ich aus Diskretion nicht nenne, einen alten Bürstenladen entdeckte. Eine überaus freundliche und kurvenreiche Verkäuferin führt mir hingebungsvoll eine Dekolleté-Bürste vor, eine Weinglas-Bürste und eine Bartbürste, und weil sie genauso enthusiastisch bei der Sache ist wie ihre Kolleginnen in Kyoto, lasse ich mir auch noch eine Heizungsbürste, Steckdosenbürste und Jalousiebürste vorführen. Als ich glücklich, aber ohne Bürste (wie viele Bürsten braucht der Mensch wirklich?) aus dem Laden wieder herausfalle, passt mich ein älterer Herr ab, der offensichtlich vor dem Laden gewartet hat. Unaufgefordert erzählt er mir, dass der Besitzer des Ladens ab und zu einen Zettel an die abgeschlossene Tür hängt: Wer Bürsten will, bitte bei meiner Frau klingeln. Bürschten, sagt er auf Bayerisch, bürschten, verstehen S’? Er lacht selig, und als ich weitergehe, wartet er weiter vor dem Laden, um dem nächsten Kunden denselben dämlichen Witz zu erzählen. Manchmal jedoch, wenn ich mit meiner japanischen Gemüsebürste das Gemüse putze, denke ich an ihn und gluckse unfreiwillig vor mich hin.
Erinnerungssplitter
Seit ich denken kann, sammle ich am Strand die smaragdgrünen Glassplitter, hebe sie in Gläsern auf, vergesse sie in Hosentaschen. Immer sind diese glatt geschliffenen Splitter flaschengrün, ganz selten braun und noch seltener blau. Wer auf dieser Welt wirft all die grünen Flaschen ins Meer, die an den Felsen zerschellen und überall an den Küsten antreiben, damit ich sie aufsammle? Sie erinnern mich an die seltsame fröhliche Einsamkeit als Kind, mit der man den ganzen Tag Strandglas gesammelt, Sandburgen gebaut und Muster aus Muscheln gelegt hat. Hoch konzentriert und selbstvergessen. Im Flow. Definition von Glück. Voller Absicht absichtslos. Wie schwer das sonst zu erreichen ist. Wie viel Zen-Meditation und Räucherstäbchen und Sportunterricht und Drogen und Coaching und Atemtherapie und Lachyoga der Mensch glaubt zu brauchen, um genau diesen Zustand wieder zu erreichen, der bei allzu großer Anstrengung in immer größere Ferne rückt.
Meine Strandglassammlung erinnert mich an lange, stumme Strandspaziergänge als Kind mit meinem Vater, wo wir uns näher waren als sonst, an endlose Tage im Wasser, nach denen man sich fühlte wie ein Fisch, und das tolle Gefühl, wenn einem nachts im Bett plötzlich Meerwasser aus den Ohren rann, an traurige Zeiten, wo das Meer tröstete und mir kleine grüne Edelsteine in die Hände spülte und ich mich fragte, wie es wäre, einfach so im Wasser herumzuliegen als kaputte Flasche und von Ebbe, Flut und Kieseln abgeschliffen zu werden, ohne dass man etwas dazu tun müsste, um immer weicher und schmeichliger zu werden, bis einen irgendwann jemand aufsammelt und meint, einen wirklichen Schatz gefunden zu haben. Wäre das nicht ein prima Lebenskonzept? Vielleicht kann ich deshalb nicht aufhören, gebückt in den Sand zu starren und die kleinen Smaragde aus dem Wasser zu fischen, voller Sehnsucht und mit dem klaren Bewusstsein, dass dieses Lebenskonzept unerreichbar für mich ist.
Ein Gehirn
Ich war in den Iran eingeladen, um Filme zu zeigen und zu unterrichten. Aber ich hatte politisch große Vorbehalte und traute meinem eigenen Gehirn nicht über den Weg, denn es ist gewohnt, nicht nur denken zu dürfen, was es will, sondern auch Gedanken laut zu äußern. Die Veranstalter redeten mit Engelszungen auf mich ein, man dürfe doch den Dialog gerade in politisch schwierigen Zeiten nicht aufgeben, und man solle doch bitte ein ganzes Volk nicht nach seiner Regierung beurteilen, und überhaupt: Man freue sich auf mich. Besonders als Frau.
Ha, damit hatten sie mich. Die Reise wusch mir gründlich den (ängstlich vorschriftsmäßig verhüllten) Kopf. Ich staunte über die Offenheit und das riesige Interesse, die Ironie und den kreativen Umgang (vor allem der Frauen) mit all den Einschränkungen, Vorschriften und der staatlichen Willkür, ich saß fassungslos vor einer sinnentleerten, zensierten Fassung meines Films und freute mich über das Zischen des Publikums an den durch rabenschwarze Dunkelheit markierten Fehlstellen. Ich diskutierte scheinbar frei, im nächsten Augenblick schüttelte ich einem Mann auf der Bühne überschwänglich und gedankenlos die Hand und riskierte damit seine Entlassung. Immer, wenn so viel möglich erschien, war im nächsten Augenblick gar nichts mehr möglich. Kein Klischee über den Iran stimmte, aber das Gegenteil stimmte auch nicht. Mein Gehirn platzte fast. Als ich im Schaufenster eines Ladens für medizinische Lehrbücher das Modell eines menschlichen Gehirns sah, schien es mir die Situation perfekt zu illustrieren. Ich erstand es und trug es lachend unter dem Arm aus dem Laden. Jeder machte Witze: Das Gehirn müsste dringend gewaschen werden. War es ein amerikanisches Hirn, weil doch sehr klein? Oder ein iranisches, weil so tief gewunden? Weiblich, weil so hübsch rosa? Männlich, weil so unbefleckt? Es wurde ein sehr lustiger Tag mit sehr bitteren Untertönen. Am Abend saß ich erschöpft in meinem mit Sicherheit verwanzten Hotelzimmer und prostete mit Traubensaft statt Rotwein aus der Minibar dem Gehirn zu, dieser knuddeligen, unschuldigen Masse, die wir mit uns herumtragen und die wir mit so vielen wunderbaren und schrecklichen Ideen füllen, mit so viel Liebe und so viel Hass. Jetzt steht es auf meinem Schreibtisch.
Der Ersatzkaktus
Dieses kümmerliche Blatt eines Nopal-Kaktus habe ich aus Spanien im Koffer nach Deutschland geschleppt (was wahrscheinlich streng verboten ist), nicht, damit er mich an Spanien erinnert, sondern an Mexiko, Land der Kakteen. Ein Ersatzkaktus sozusagen, der jetzt bei mir nicht auf dem Balkon – viel zu kalt! –, sondern auf der Fensterbank steht. In Mexiko gibt es um die zweihundert verschiedene Kakteenarten, unter ihnen die saguaros, seltsame Armleuchter, die organos, Orgelpfeifen, und asiento de la suegra, Sitz der Schwiegermutter, ein kugeliger, besonders stachliger Kaktus. Mein Liebling ist jedoch der Nopal, der mit seinen ovalen Blättern gigantische olivgrüne Skulpturen vor den stahlblauen Himmel wachsen lässt. Früher fand ich Kakteenliebhaber in Deutschland doof, die verstaubt wirkende Miniaturkakteen in winzigen Töpfchen halten, aber in meiner Sehnsucht nach Mexiko habe ich diesen Nopal in eigens ausgegrabener Erde seiner Mutterpflanze in einer Plastiktüte mitgebracht und gehofft, dass er den Betrug nicht merkt. Zu Hause bräuchte er jetzt nichts mehr als brütende Hitze und ab und zu einen Tropfen Wasser.
Hier aber sieht er traurig aus seinem Topf auf die permanent verregnete Straße und sehnt sich nicht nur nach Sonne und dem mexikanischen Himmel, sondern wahrscheinlich auch nach der richtigen Musik, und in seiner schwarzen Stimmung vielleicht sogar nach den Bäuerinnen in ihren weiten Röcken, die mit der Machete die jungen Blätter abschneiden, die Stacheln rausziehen und Salat aus ihnen machen. Der schmeckt nur in den ersten Minuten frisch, dann zieht er seltsame Schleimfäden, an die ich mich nie gewöhnen konnte. Mein Nopal hat in seiner Depression sogar seine teuflischen Stacheln abgeworfen. Einem Freund, der mal betrunken nachts in einen Nopal gefallen war, habe ich die ganze Nacht mit der Pinzette die Stacheln aus dem Hintern gezogen. Aber was ist ein Kaktus ohne Stacheln? Vielleicht erlöse ich ihn, meinen armen Nopal, schlachte ihn und verarbeite ihn zu Salat. Ich werde Mariachi-Musik hören, während ich ihn esse. Und morgen fahre ich dann meine Stacheln aus.
Mokassins
Immer, immer wollte ich Mokassins haben, denn meine halbe Kindheit lang war ich Nscho-tschi und trug eine schwarze Wollperücke, schlich barfuß durch den Wald meiner Familie beim Sonntagsspaziergang hinterher, bastelte mir Täschchen aus Baumrinde, saß in einem als Tipi verkleideten Zelt und träumte von einem Leben in der Prärie. Nur Mokassins hatte ich keine. Ich konnte sie mir noch nicht einmal wünschen, denn es gab in Deutschland gar keine. Winnetou trug natürlich wunderschöne perlenbestickte Mokassins, die man auf dem Bravo-Starschnitt sehen konnte, den ich mir in Lebensgröße an die Wand gehängt hatte. Jeden Abend stieg ich auf einen Stuhl und küsste meinen großen Bruder auf die Wange. Er schaute an mir vorbei in die Prärie, gleichmütig, aber auch voll sanften Kummers, denn es fehlte ihm der rechte Fuß samt Mokassin, da ich dieses Heft nirgendwo hatte auftreiben können. Diese Tatsache beschwerte meine Tage ungeheuer.