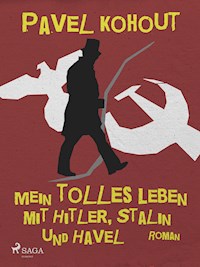Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lizinka, die Tochter eines Philologen, wird mit sechs männlichen Kollegen auf der "Höheren Lehranstalt für Exekutionswesen" zur Henkerin ausgebildet. Im Zuge der Emanzipation zur ersten Henkerin der Welt übrigens. An der Fachschule für Poenologie lernt sie hängen, guillotinieren, pfählen und rädern. Der vielbödige Roman ist mit einer Fülle von Episoden und Geschichten angefüllt, gleichzeitig garniert mit (pseudo-)wissenschaftlichen Essays und Zoten: eine Mischung wie von Bruegel.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 660
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pavel Kohout
Die Henkerin
Roman
Deutsch von Alexandraund Gerhard Baumrucker
Saga
Für Jürgen und Liza, die mich so viele Jahre überzeugten, dieses Buch müsse geschrieben werden, bis ich es schrieb!
PK
Personen, Schauplätze und Geschehnisse dieses Buches sind, leider, frei erfunden, dafür sind die historischen Informationen und die zitierte Literatur, gottlob, streng authentisch.
Wir leben in einer Welt, wo das Przewalskipferd beinahe schon ausgestorben ist. Wir werden immer häufiger Zeugen, wie die Monopolisierung auf der einen und die Kollektivierung auf der anderen Seite der Welt nicht nur kleine Gewerbetreibende und Landwirte vernichten, sondern auch freie Berufe, mit denen oft schon unersetzliche Erfahrungen der Menschheit verlorengehen.
Ich möchte meinen bescheidenen Text dazu beitragen, daß wir eines Morgens nicht in einer Welt ohne Scharfrichter aufwachen.
Pavel Kohout
Sázava, im August 1978
I
Am Gründonnerstag erwies sich, daß Lízinka Tachecí die Eignungsprüfung für das Konservatorium der dramatischen Künste nicht bestanden hatte.
Der Vorsitzende der Kommission, ein prominenter Mime, teilte ihrer Mutter Lucie voll ungeheucheltem Bedauern mit, die Jury habe erst nach stürmischer Diskussion so befunden, da auch wiederholte Versuche gezeigt hätten, daß ihre Tochter aufgrund ihrer Verschlossenheit sicherlich viel eher als Ärztin ihr Auskommen finden würde, als Wissenschaftlerin oder als Schriftstellerin.
Am Karfreitag offenbarte sich, daß Lízinka auch die Aufnahmeprüfung für die weiterführende Stufe des humanistischen Gymnasiums, von ihr auf dem Anmeldeformular an zweiter Stelle angeführt, nicht bewältigt hatte.
Der Direktor der Schule, ein eminenter Pädagoge, eröffnete ihrer Mutter voll unverhohlener Wehmut, das Kollegium habe erst nach hitziger Debatte befunden, da auch neue Tests erbracht hätten, daß ihre Tochter aufgrund ihres Aussehens gewiß viel eher als Fotomodell Karriere machen würde, als Mannequin oder als
1
Schauspielerin.
Als Dr. phil. Tachecí aus dem Büro heimkam, fand er nur seine Tochter vor. Sie saß im Eckwohnzimmer vor dem Fernsehgerät und betätigte die Schaltknöpfe. Drückte sie den einen, so schlugen zwei Männer verbissen mit den Fäusten aufeinander ein. Drückte sie den zweiten, so sang ein Kinderchor Volkslieder. Drückte sie beide zugleich, so erschien eine weiße, rauschende Fläche.
– Na, wie war’s? fragte Doktor Tachecí.
Lízinka zog, anderweitig eingenommen, die schmächtigen Schultern hoch.
– Wo ist Mama? fragte Doktor Tachecí.
Lízinka nickte in Richtung Schlafzimmer.
Doktor Tachecí ging in die Diele und drückte sacht die Klinke herunter. Es war zugeschlossen. Nach einer kleinen Weile klopfte er leise an. Nichts rührte sich. Nach weiterem Zögern fragte er seine Gattin schüchtern durch die Tür, ob sie Tee wolle oder etwas anderes.
Darauf stürzte Frau Lucie in die Diele heraus und schrie, sie wolle vor allem nicht mit einem Menschen zusammen leben, der seiner einzigen Tochter nicht zum Studium verhelfen könne. Dann schloß sie sich weinend im Bad ein.
Doktor Tachecí briet seiner einzigen Tochter das einzige noch vorhandene Ei – die anderen waren schon gefärbt und schickte sie, die zu zart und empfindsam war, um Zeuge der weiteren Ereignisse zu werden, ins Bett. Dann begann er an die Badezimmertür zu klopfen und besänftigende Worte zu äußern. Die Stille entsetzte ihn immer mehr. Er wußte nicht, wo das Gas abgeschaltet wurde, wußte jedoch, daß im Bad auch Rasierklingen und Tabletten waren. Er begab sich zum Telefon und blätterte zerquält im Teilnehmerverzeichnis. Mit seiner Familie verkehrte er nicht, Freunde hatte er keine, und die Polizei fürchtete er; unter dem Druck der Situation beschloß er, die telefonische Lebenshilfe anzurufen.
Der diensthabende Psychiater hörte sich seinen unzusammenhängenden Bericht an und fragte:
– Wie lange ist sie schon dort?
– Etwa zwei Stunden, sagte Doktor Tachecí.
– Macht sie das oft? fragte der Psychiater.
– Nein sagte Doktor Tachecí, gewöhnlich schließt sie sich im Schlafzimmer ein.
– Wo schlafen dann Sie? fragte der Psychiater.
– Gewöhnlich im Bad, sagte Doktor Tachecí.
– Dann schlafen Sie heute im Schlafzimmer, sagte der Psychiater, so können auch Sie es mal genießen.
– Entschuldigen Sie, sagte Doktor Tachecí, aber ich habe die begründete Befürchtung ...
– Entschuldigen Sie, sagte der Psychiater, aber ich habe heute zum drittenmal nacheinander Nachtdienst, ich würde selbst mit dem Bad vorliebnehmen. Glauben Sie, sie würde ans Telefon kommen?
– Ich glaube nicht, sagte Doktor Tachecí, ich dachte, ob Sie nicht hierher ...
– Schwerlich, sagte der Psychiater, ich muß am Telefon bleiben, in diesen Tagen drehen uns massenhaft Eltern durch. Haben Sie kein Stemmeisen?
– Was ist das? fragte Doktor Tachecí.
– Sie sind Philosoph? fragte der Psychiater.
– Philologe, sagte Doktor Tachecí.
– Aha, sagte der Psychiater, wie wär’s dann, wenn Sie ihr sagen, der Schulinspektor möchte sie sprechen?
– Entschuldigen Sie, sagte Doktor Tachecí, ich lüge grundsätzlich nicht.
– Herr Doktor, sagte der Psychiater, vielleicht ruft mich gerade jemand an, dem ich wirklich helfenkann. Solange Sie sich Grundsätze leisten können, ist Ihr Fall keineswegs hoffnungslos.
Doktor Tachecí legte langsam den Hörer auf. Da kam seine Frau aus dem Bad. Sie war festlich frisiert und ausdrucksvoll geschminkt, als ginge sie zu einem Ball. Ohne ihren Mann eines Blickes zu würdigen, zog sie ein goldenes Notizbüchlein aus der Handtasche, trat ans Telefon, wählte eine Nummer und wartete, mit dem Absatz aufstampfend. Dann fragte sie mit glockenheller Stimme:
– Oskar?
– Ja, sagte Oskar, wer spricht dort?
– Lucie, sagte Frau Lucie.
– Welche Lucie? fragte Oskar.
– Lucie Alexandrová, sagte Lucie Tachecí.
Doktor Tachecí stand vor dem Bad, schluckte.
– Lucie Alexandrová! sagte Oskar, ist ja phantastisch! Lucie!
– Was machst du, Ossi? fragte Frau Lucie, immer noch ledig?
– Versteht sich, sagte Oskar, und du immer noch verheiratet?
– Versteht sich, sagte Frau Lucie, ich dachte, ich könnte wieder einmal auf ein Gläschen bei dir vorbeikommen.
Doktor Tachecí sagte vom Bad her:
– Lucie ...
– Das wäre ja phantastisch, sagte Oskar, bloß ...
– Du bist nicht allein, sagte Frau Lucie.
– Versteht sich, sagte Oskar.
– Ich komme gern ein andermal, sagte Frau Lucie, heute brauche ich eher deinen Rat.
– Suchst du ein Auto? fragte Oskar, oder eine Wohnung?
– Nein, sagte Frau Lucie, ich habe eine Tochter.
– Gratuliere, sagte Oskar, suchst du einen Hort?
– Ich habe sie seit fünfzehn Jahren, sagte Frau Lucie.
– Was? Ja so, entschuldige. Das war also schon vor fünfzehn ...? Ist ja phantastisch!
– Man hat sie nicht in die höhere Schule aufgenommen, sagte Frau Lucie, sie schien ihnen entweder zu schön oder zu gescheit.
– Wozu braucht sie dann die höhere Schule? fragte Oskar.
– Ich will, daß sie etwas wird, sagte Frau Lucie, ich will nicht, daß es ihr so ergeht wie mir.
– Lucie ... sagte Doktor Tachecí vom Bad her.
– Höhere Schule, sagte Oskar, Herrschaft, wer wäre da ... Wer hat mir da ... Moment, da gibt es doch so eine Kommission ... Sekunde, Krümelchen ...
– Das hast du schon lange nicht mehr zu mir gesagt, sagte Frau Lucie.
– Was? Ja so, entschuldige, ich sag’s auch nicht zu dir.
– Schade, sagte Frau Lucie.
– Hat es eine Woche Zeit? fragte Oskar, bis ich aus den Bergen zurück bin? Wir könnten dann alles auf einmal erledigen.
– Kannst du mir wenigstens die Kommission nennen?
– Ja so, sagte Oskar, ich weiß schon. Städtische Berufsberatungskommission. Der Name des Vorsitzenden ist mir entfallen, aber du kannst dich ruhig auf mich berufen, ich habe ihm ein Hausboot besorgt.
– Dann beschränke ich mich einstweilen auf ein Danke, Ossi, sagte Frau Lucie, und geh, damit du dich nicht erkältest.
– Woher weißt du das? fragte Oskar.
– Versteht sich doch, sagte Frau Lucie, sag Krümelchen, deine Tante habe angerufen. Fröhliche Ostern, Ossi!
Sie legte den Hörer auf und die strahlende Miene zugleich ab. Vom Bad her ließ Doktor Tachecí sich vernehmen:
– Lucie, wer war das?
– Ein Mensch, sagte Frau Tachecí, der mich einmal heiraten wollte. Du gestattest?
Ihr Mann trat zurück, damit sie wieder ins Bad konnte.
– Warum rufst du ausgerechnet den an? fragte er.
– Das kann ich dir sagen, erwiderte seine Frau, wäre ich vor sechzehn Jahren nicht so strohdumm gewesen, dann wäre Lízinkas Vater heute
2
er!
– Schon möglich, ja sogar sehr wahrscheinlich, sagte trocken der Vorsitzende der Berufsberatungskommission, und es war vielleicht sogar jenes Hausboot, weswegen mein Vorgänger dieses Amt fristlos aufgeben mußte.
Für Frau Tachecí war dies der letzte Beweis, daß Lízinkas Sache unter keinem guten Stern stand. Schon am Dienstag nach Ostern war sie von der Benachrichtigung erschüttert worden, daß sie ordnungshalber erst am Donnerstag vorsprechen konnten. Oskar sumpfte in den Bergen herum, ihrem Mann konnte sie mit so etwas nicht kommen, sie hatte sich also aufs Bett gelegt und Erschöpfung vorgetäuscht. Dies hatte bei ihrem Temperament so viel Beherrschung erfordert, daß sie am Mittwoch einem Zusammenbruch nahe war. Nur die Liebe zu Lízinka und das Wissen, daß Doktor Tachecí sich im Amtsverkehr wie ein überführter Verbrecher benahm, hatten sie am Donnerstag abermals in den tristen Korridor vor den Raum getrieben, aus dem gedämpft das Weinen erfolgloser Schüler und das Geschrei gekränkter Väter drangen.
Erfahrung und Gewohnheit hatten sie gezwungen, sorgsam zu überlegen, wie sie und Lízinka sich am passendsten kleiden sollten. Das gesteckte Ziel riet zur Kaschierung sämtlicher Vorzüge, wie stets, wenn man sich mehr aufs Bitten denn aufs Fordern verlegen muß, und unbedingt immer dann, wenn man es mit einer Frau zu tun bekommt. Partner sollte jedoch ein Mann sein, überdies der Freund eines Mannes, der, wie sie wußte, weibliche Schönheit krankhaft vergötterte. Deshalb hatte sie auf die stärkste Karte gesetzt.
Sie trug ein enganliegendes, buntgemustertes Modellkleid aus Frankreich, das ihre schmale Taille, den vollen Busen und den schlanken Hals betonte. Für Línzinka hatte sie ein weißes, ärmelloses Minikleid gewählt, in einem Farbton, wie er dem Schnee vor Sonnenaufgang eignet.
Jetzt stellte sie bestürzt fest, daß ein Nonnengewand eher angebracht gewesen wäre.
Vorsitzender der Kommission war gegenwärtig ein Mann, der sich seiner undankbaren Funktion über Jahre hinweg angepaßt hatte wie ein mittelalterlicher Krieger der Rüstung. Sein kinnbärtiger Kopf, der auf dem robusten Körper saß, als bedürfe er keines Halses, erhöhte den Eindruck von Unverwundbarkeit. Die weißen Finger verrieten Frau Tachecí den Nichtraucher, die leicht miefige Kleidung den Junggesellen. Sie erkannte, daß er keinerlei Leidenschaften frönte, kein Schmiergeld brauchte und Frauen fürchtete.
Außer ihm war eine Sekretärin da, eine ältere, knochige Person, die sie beide scharf musterte, angewidert die Augen abwandte und auf ihrem Notizblock eine Reihe von Kreuzchen zu kritzeln begann. All dies sagte Frau Tachecí, daß sie sich hier für ihr gescheitertes Leben schadlos hielt, indem sie sich am Scheitern anderer weidete, zu dem sie kräftig beitrug.
Der Vorsitzende blickte nicht einmal auf. Er hatte schon allzu viele niedergeschlagene Gesichter gesehen, um sie unterscheiden zu können; bei dieser Massenabfertigung konnte er sich den Luxus der Anteilnahme gar nicht leisten. Nachdem er seinen Vorgänger mit dem einen Satz zu Grabe getragen hatte, deutete er mit dem Handrücken auf freie Stühle, schlug Lízinkas Akte auf und schüttelte ablehnend den Kopf.
– Konservatorium natürlich ... Gymnasium, natürlich, natürlich –
sagte er fast angeekelt,
– einfach um jeden Preis Abitur, ob es dazu reicht oder nicht. Also, kurzum, liebe Frau: Von den Schulen mit Reifeabschluß bleibt hier nur die höhere Musikschule für sichtbehinderte Jugendliche, aber davon kann bei ihr, wie ich dem ärztlichen Gutachten entnehme, leider keine Rede sein. Dem Abitur können Sie also adieu sagen, liebe Frau, und Gott danken. Wenn Sie und Ihr Mann –
fuhr der Vorsitzende der Kommission fort,
– sie wirklich lieben, dann trachten Sie danach, ihr eine Fachausbildung zu sichern, solange noch Zeit ist. Handwerk hat nach wie vor goldenen Boden, und aufs Konservatorium zu gelangen, ist einfach ein Kinderspiel, gemessen daran, auf eine Fachschule für Stewardessen oder Friseusen zu kommen. Schlagen Sie sich das also einfach aus dem Kopf und seien Sie froh! Warum soll ein so junges und gesundes Mädchen –
fuhr der Vorsitzende der Kommission fort, ohne den Blick zu heben,
– sein Leben mit Fönwellen verpulvern oder in der Luft verpuffen lassen, wenn ihr zum Beispiel so eine Fachlehranstalt für Gartenbau das ganze Jahr über festen Boden unter den Füßen und frische Luft bietet. Also?
– Aber sie ... ist kälteempfindlich ... sagte Frau Tachecí.
Der Überraschungsangriff hatte bewirkt, daß ihr nichts Besseres einfiel.
– Natürlich, sagte der Vorsitzende herablassend. Aber was tut’s! Es gibt interessantere Berufe, als bei Regen und Matsch Kohlrabi setzen und häufeln; wenn sie einfach wärmefreudig ist, dann weiß ich nichts Besseres als eine Fachlehranstalt für das Bäckereiwesen. Also?
– Sie verträgt auch keine Wärme ... sagte Frau Tachecí zutiefst deprimiert.
– Natürlich, natürlich, sagte der Vorsitzende befriedigt, weil er sich dem Ziel nahe wähnte, na, macht auch nichts. Warum soll sie winters wie sommers für ein paar Kröten um drei Uhr früh aufstehen, zumal ihr so eine landwirtschaftliche Lehranstalt mit dem Zweig Großmästereien automatisierte Arbeit bei Vollklimatisierung bietet. Und, wird sie nach Schulabschluß direkt auf dem Land eingesetzt, sogar Haus und Mitgift, was einfach praktisch auf einen Bräutigam hinausläuft. Also abgemacht?
Mit geübter Bewegung hielt er der Sekretärin Daumen und Zeigefinger hin, und sie legte in die Lücke dazwischen genauso mechanisch ein Formular.
– Großer Gott, sagte Frau Tachecí, einer Ohnmacht nahe, großer Gott, kann man sie denn zu Schweinen schicken?
Hätte sie geschrien, gedroht oder geweint, er hätte es gar nicht wahrgenommen, doch da sie mit sonderbar erstickter Stimme flüsterte, als sei der angerufene Allmächtige ebenfalls anwesend, hob der Vorsitzende unwillkürlich den Kopf – und erblickte Lízinka.
Lízinka hatte die ganze Zeit den Bleistift der Bürokraft beobachtet. Diese machte jedenfalls, wenn der Vorsitzende »natürlich« sagte, einen kleinen Strich. Wenn er »einfach« sagte, einen Punkt. Wenn sie fünf Striche oder Punkte gemacht hatte, verband sie sie durch eine Gerade und vollendete ein weiteres Kreuz. Nun schwebte die Bleistiftspitze in der Luft, und Lízinka wartete, wann sie aufsetzen würde.
Aber der Vorsitzende der Kommission schaute auf ihre schmächtigen Ellbogen und Knie, auf ihr noch kindliches und gleichsam durchsichtiges Gesichtchen, das in der Flut langer goldener Haare schier unterging, und da spürte er, wie ihn ein jäher Ansturm von Empfindungen und Erinnerungen aus dieser kargen Amtsstube fegte, seiner etablierten Kleider und Gewohnheiten entledigte und gegen den Strom von Funktionen und Sitzungen in die Gefilde naiver Unschuld trieb, und plötzlich hörte er auch die Stimme, die er längst verhallt geglaubt hatte: Die Madonna, sagte seine Mutter wie damals auf dem Wallfahrtshügel, den sie mit der Prozession eben erreicht hatten, knie nieder, Bub, das ist die heilige Jungfrau!
Er ließ die Hand mit dem Anmeldebogen sinken, obwohl er die vorgeschriebene Quote hätte erfüllen müssen, und wandte sich an die Sekretärin.
– Geben Sie mir, sagte er, den Ordner PST!
Die knochige Person riß den Blick von den Kreuzchen los und sah Lízinka noch einmal an, diesmal verdattert. Sie kannte ihren Chef und begriff nicht, was diese ungewöhnliche Wendung herbeigeführt haben mochte. Unwillig legte sie den Bleistift aus der Hand, ging zum Safe und reichte dem Vorsitzenden die Mappe mit der Aufschrift Papiere streng geheimer natur. Sie enthielt eine Liste spezieller Fachgebiete, die einige zentrale Institutionen ausgeschrieben hatten. Neben jeder Eintragung stand klipp, aber klar definiert, was vom Bewerber erwartet wurde.
Als Ehrenmann, der seinem Gewissen nur einmal untreu geworden war, als er seinen Gott verleugnen mußte, um dem Staat dienen zu dürfen, gedachte der Vorsitzende auch jetzt nichts Staatsschädigendes zu tun. Beim Durchgehen der Fachgebiete, die sowohl für Knaben als auch für Mädchen ausgeschrieben waren, schied er redlich alles aus, für die es Lízinka an Voraussetzungen, Bildung oder Klassenabstammung mangelte, wie etwa die Gebiete diplomatischer Kurier, Botschafter oder Abgeordneter. Erstmals zögerte er bei Gegenspionage, die gleich drei Schüler angefordert hatte. Noch eine Erinnerung huschte ihm durch den Kopf: an die fragile Greta Garbo in der Rolle der Mata Hari. Der Film riß jedoch, als er merkte, daß er sich schon in der Abteilung Geschlecht m befand. Er blätterte um. Sein Blick fiel geradewegs auf die Charakteristik, die den Teil Geschlecht w abschloß, und damit die gesamte Liste:
Spez. Fach humanit. Richtg. M. Abit.: Absolv. D. 9 JG. Grundschule (w). – Vertr. Erweckd. – Eign. F. Öff. Auftr. – Phlegm. Natur. – Sehr Angen. Äusseres. Dahinter eine Anmerkung in Klammern, die einzige dieser Art im Ordner PST: (Wie man ihr beim zahnarzt begegnen möchte!)
Der Vorsitzende blickte wieder auf. Selbst der strengste Richter in seinem Inneren konnte nicht leugnen, daß nichts an Lízinka den Erfordernissen widersprach. Im Gegenteil, er hatte noch nie ein Gesicht gekannt, zu dem er vom Zahnarztsessel aus, wo er schon so viele Qualen erdulden mußte, lieber emporgeblickt hätte. Einmal zur Überzeugung gelangt, im Einklang mit den Interessen der Gesellschaft zu handeln, entschloß er sich immer sehr rasch.
– Fräulein, fragte er Lízinka geradeheraus, möchten Sie nicht Vollstreckerin werden?
– Was ist das? fragte die Mutter, schnell die Fassung wiedererlangend.
Der Vorsitzende der Berufsberatungskommission vertiefte sich in die Liste.
– Ein Spezialfach der humanitären Richtung mit Abitur, sagte er nach kurzem Sinnen.
– Und was für eins in etwa? fragte die Mutter ganz unaggressiv, um das Flämmchen ihrer Hoffnung nicht auszublasen.
Er bemerkte erst jetzt, daß zu der Annonce ein Postskriptum gehörte: Bew. tel. zw. Gespr. Prof. Wolf 61460!
– Bewerber, übersetzte er, telefonieren zwecks Gesprächs mit Professor Wolf, siehe Rufnummer. Daraus geht einfach hervor, daß der betreffende Funktionär Ihnen die näheren Einzelheiten mitteilen wird. Ich muß allerdings wissen, ob Sie grundsätzlich einverstanden sind, damit ich Ihnen einen Laufzettel für ihn mitgeben kann. Also dann –
rief der Vorsitzende ungeduldig aus, da er der Miene seiner Sekretärin allmählich entnahm, daß er seinem Ruf untreu zu werden begann.
– Gärtnerin, Bäckerin, Mästerin oder ...
– Unbedingt, schrie Frau Tachecí, unbedingt
3
Vollstreckerin!
– Was ist das? fragte Dr. phil. Tachecí, nachdem seine Frau ihren Bericht abgeschlossen hatte.
Sie saßen im Wohnzimmer, über die Suppe gebeugt. Lízinka beobachtete die Oberfläche, in der sich ihr Gesicht spiegelte. Tauchte sie den Löffel ein, so runzelte sich das Gesicht wellenförmig, nahm sie den Löffel heraus, zerfloß es zum Rand des Tellers.
– Was soll es schon sein, sagte Frau Tachecí, ein humanitäres Fach mit Abitur.
– Was für eins denn ungefähr? fragte Doktor Tachecí ganz unmilitant, um nicht den Brand eines neuen Steites zu entfachen. Er stand auf, ging zum Bücherschrank und begann in einem Wörterbuch zu blättern.
– Vollstreckerin steht gar nicht da, sagte er nach einer Weile, nur vollstreckbar; Vollstreckbarkeit, w.; Vollstrecker; Vollstreckung; Vollstreckungsbeamter.
– Dann wird sie eben Gerichtsvollzieherin, sagte Frau Tachecí, um so besser!
– Die Charakteristik paßt allerdings eher auf ein Animiermädchen, sagte Doktor Tachecí.
– Lízinka, sagte Frau Tachecí, aufessen, Kindchen, und ins Bett, morgen mußt du zur Schule!
Kaum hatte die Tochter ihnen den Gutenachtkuß gegeben und hinter sich die Tür geschlossen, sprach die Mutter weiter, diesmal ohne Ausrufe und Tränen, was um so schwerer wog.
– Das einzige, was du für deine Tochter getan hast, sagte sie, war, daß du vor sechzehn Jahren meine Vertrauensseligkeit ausgenützt und mich in den Klee geworfen hast wie irgendein Dienstmädchen. Ich hatte keine Ahnung, daß ein Mensch mit einem akademischen Grad mir gleich beim erstenmal ein Kind machen würde, und vor allem habe ich geglaubt, er würde sich zumindest seiner annehmen. Aber du –
fuhr sie immer sachlicher fort, so daß Doktor Tachecí schnell begriff, wie kritisch die Situation war,
– genierst dich, aufzumucken, wenn dir der Straßenbahnschaffner auf einen Hunderter nicht herausgibt, geschweige denn, ein normales Schmiergeld zu geben, damit deine Tochter die Aufnahmeprüfung besteht. Das einzige, was du mir angeboten hast, als ihre Zukunft in Trümmern lag, war Tee. Und als ich ihr an deiner Stelle eine letzte Chance herausschlug, damit sie nicht Kühe weiden muß, da sagst du mir, ich mache sie zur Hure? Ich –
sie hob ein wenig die Stimme, wie um einem Einwand zuvorzukommen, den Doktor Tachecí sich erst gar nicht einfallen zu lassen getraute,
– weiß nicht, was eine Vollstreckerin ist, ich brauche es gar nicht zu wissen, mir genügt, daß sie das Abitur machen wird und anschließend gehen kann, wohin sie will. Und wenn du willst, daß sie dich weiterhin Vater nennt, dann rufst du morgen diesen Wolf an und machst einen Termin mit ihm aus. Und zu diesem Termin nimmst du wie jeder anständige Vater eine Flasche Kognak mit, und wenn er am Telefon Zicken macht, dann zwei, denn falls du das nicht schaffst –
fügte Frau Tachecí hinzu, und er erblickte verblüfft ein strahlendes Lächeln auf ihrem Gesicht,
gehe ich zu ihm und biete ihm alles, was ich zu bieten habe, als Mutter und als
4
Frau!
Am Freitagmorgen hatte Dr. Tachecí kaum hinter seinem Tisch in der Abbreviaturenerfassungsstelle der Akademie der Wissenschaften Platz genommen, als er die Rufnummer 61460 wählte.
– Ja bitte? sagte der Angerufene.
– Hallo, sagte der Anrufer, könnte ich bitteschön Professor Wolf sprechen?
– Wer spricht? fragte der Angerufene.
– Hier Doktor Tachecí, sagte Doktor Tachecí.
– Kenne ich nicht, sagte der Angerufene.
Doktor Tachecí spürte, wie er rot wurde. Just solche herrischen Stimmen bewirkten, daß er sich beim Schlangestehen überholen und beim Wiegen übervorteilen ließ, daß er protestlos Gänseblut aß, das man ihm statt Gänseleber brachte, und widerspruchslos die Konfetti bezahlte, die man ihm statt Konfekt eingepackt hatte. Es fehlte nicht viel, und er hätte eine Entschuldigung gestammelt und aufgelegt. Doch die peinigende Vorstellung, dadurch ausgerechnet dieser Stimme seine vergötterte Frau auszuliefern, peitschte ihn zu unerhörtem Mut auf.
– Verzeihung, sagte er, ich rufe wegen meiner Tochter an.
– Welcher Tochter? fragte der Angerufene.
– Wegen meiner Tochter Lízinka, fuhr Doktor Tachecí fort und schloß die Augen wie beim Sprung in einen Abgrund, sie war gestern mit meiner Frau bei der Kommission, und man hat ihnen diese Nummer gegeben.
– Wie ist Ihre? fragte der Angerufene.
– 271425, sagte Doktor Tachecí gehorsam, Nebenstelle 15.
– Legen Sie auf, sagte der Angerufene, ich rufe zurück.
Ein Klicken verriet, daß er aufgelegt hatte. Doktor Tachecí tat ein gleiches und blieb sitzen, von der eigenen Courage gelähmt. Unmittelbar darauf öffnete er die Augen und sah ein, daß er nicht nur nichts erreicht hatte, sondern auch nicht wußte, wann man ihn anrufen würde, so daß er trotz seines Erfolgs zu Hause nichts würde mitzuteilen haben. Das Telefon schwieg. Blieb nur noch eines, nämlich erneut anzurufen, was über seine Kräfte ging. Aber sein wissenschaftlich funktionierendes Gehirn, gewöhnt, nur erwiesene Fakten zu verarbeiten, strahlte plötzlich ein lebendes Bild aus: Er sah seine Frau, nackt und begehrenswert, abermals ins Gras sinken, diesmal unter dem Gewicht eines fremden eroberungslüsternen Körpers. Er griff augenblicklich nach dem Hörer. Da klingelte der Apparat.
– Hier Professor Wolf, sagte die bekannte Stimme; sie klang jetzt freundlich, nahezu freundschaftlich. Verzeihung, ich mußte das erst überprüfen. Sie haben also eine Tochter. Würden Sie sagen, daß sie Vertrauen erweckt?
– Ich glaube, ja, sagte Doktor Tachecí. Sie hat jedes Jahr unter dem Weihnachtsbaum gesammelt.
– Ist sie für öffentliches Auftreten geeignet? fragte Professor Wolf.
– Ich denke schon, sagte Doktor Tachecí. Bei Schulfesten hat sie immer das Dornröschen gespielt.
– Darf ich daraus schließen, daß sie über ein angenehmes Äußeres verfügt? fragte Professor Wolf.
– Ich glaube, ja, sagte Doktor Tachecí.
– Und in etwa phlegmatischer Natur ist? fragte Professor Wolf.
– Ich glaube, ja, sagte Doktor Tachecí.
– Und ist sie, Herr Doktor, fragte Professor Wolf, ein Mädchen, dem man gern in einer unangenehmen Situation begegnen möchte, sagen wir beim Zahnarzt?
– Das weiß ich nicht, sagte Doktor Tachecí wahrheitsgemäß.
– Sie meinen nicht? fragte Professor Wolf beunruhigt.
– Ich weiß nicht, wiederholte Doktor Tachecí, ich war noch nie beim Zahnarzt.
– Da gratuliere ich Ihnen, sagte Professor Wolf erleichtert auflachend, Zahnärzte sind schlimmer als Mörder. Meiner ausgenommen. Sie schließen also nicht aus, daß Ihr Töchterchen beim Zahnarzt einen beruhigenden Eindruck machen würde?
– Das schließe ich gewiß nicht aus, sagte Doktor Tachecí.
– Das ist ja großartig, sagte Professor Wolf, großartig!
– Allerdings, sagte Doktor Tachecí, ist uns nicht ganz klar, um welchen Beruf es sich eigentlich handelt. Deshalb hat meine Frau mich gebeten, mich mit Ihnen zu treffen.
– Treffen müssen wir uns vor allem mit dem Fräulein Tochter, sagte Professor Wolf, um sie einer Prüfung zu unterziehen.
– Dürfte ich wissen, auf welchem Gebiet? fragte Doktor Tachecí, damit sie sich ein bißchen vorbereiten könnte ...
– Nicht nötig, sagte Professor Wolf, es handelt sich lediglich um einen psychotechnischen Test.
– Wohin sollen wir also mit ihr kommen? fragte Doktor Tachecí.
– Haben Sie ein Bad? fragte Professor Wolf.
– Ich glaube, ja, sagte Doktor Tachecí überrascht und korrigierte sich sofort, ja, bestimmt haben wir eins.
– Wir kommen lieber zu Ihnen, sagte Professor Wolf, im häuslichen Milieu wird sie sich wohler fühlen, und wir können alles in Ruhe besprechen. Paßt es Ihnen morgen um 14.30 Uhr?
– Morgen ist Samstag, sagte Doktor Tachecí.
– Wir arbeiten vornehmlich samstags, sagte Professor Wolf. Richten Sie der Frau Gemahlin eine freundliche Empfehlung aus, und das Töchterchen soll beruhigt schlafen. Wenn sie ein normales junges und gesundes Mädchen ist, dann schafft sie das mit einer
5
Hand.
– Und wenn es zwei sind? fragte Frau Tachecí. Wie willst du die Flasche teilen?
– Sie werden sie eben gemeinsam hier austrinken, sagte ihr Mann.
– Du hast phantastische Vorstellungen von Bestechung! sagte seine Frau.
Sie saßen im Eckwohnzimmer, zu qualvollem Warten verurteilt. Frau Tachecí rauchte nervös und zuckerte ab und zu den Marmorkuchen nach. Doktor Tachecí ging seine Alben durch und reinigte voll Sorgfalt häufig die Lupe. Lízinka beobachtete eine Fliege auf der Fensterscheibe. Schloß sie das rechte Auge, so erklomm die Fliege den Transformator. Schloß sie das linke Auge, so krabbelte die Fliege über den Feldweg. Ließ sie beide Augen offen und schielte ein wenig, so sah sie zwei Fliegen, dafür verschwammen Transformator und Feldweg.
– Wenn jemand zu mir sagt, wir kommen, dann frage ich, wer! sagte Frau Tachecí.
– Ich dachte, er spricht im Pluralis majestatis, sagte ihr Mann.
– Heilige Einfalt! sagte seine Frau. Mein Gott, möchtest du nicht endlich diese albernen Briefmarken lassen?
Nach der am Donnerstag gemachten Erfahrung hatte sie ein graues Sackkleid inländischer Erzeugung an, das Taille, Busen und Hals kaschierte.
– Verzeih, sagte ihr Mann überrascht, ich hatte keine Ahnung, daß dich das stört.
Er hatte den englischen, aus dem Nachlaß seines Vaters stammenden und umgearbeiteten Anzug an, den er seit Jahren zum samstäglichen Tee trug.
– Es stört mich erst seit ungefähr fünfzehn Jahren, sagte seine Frau. Lízinka, schiel nicht!
Lízinka hörte auf, die Fliege anzuschielen. Sie hatte einen langen Rock von der Farbe ihres Haars an und ein weißes Blüschen, das sich rührend über den winzigen Brüsten bauschte.
Frau Tachecí zuckerte den Marmorkuchen nach und zündete sich eine neue Zigarette an.
– Solltest du nicht weniger rauchen? fragte Doktor Tachecí besorgt.
– Das ist der einzige Luxus, den sich deine Frau leisten kann, sagte Frau Tachecí.
– Ich dachte nur, wenn er zufällig Nichtraucher sein sollte, sagte ihr Mann kleinlaut.
– Glaubst du? erschrak sie, drückte die Zigarette aus, öffnete beide Fensterflügel und half dem Rauch mit den Händen nach. Dabei warf sie einen Blick auf die Uhr.
– Eine Minute nach halb, sagte sie beunruhigt.
– Eine Minute vor halb, sagte ihr Mann beruhigend.
Von irgendwoher erklang das Zeitzeichen und gleichzeitig die leise Wohnungsklingel. Frau Tachecí ergriff den Aschenbecher und leert ihn zum Fenster hinaus.
Im Treppenhaus standen drei Männer. Sie hatten fast gleiche schwarze Raglanmäntel an, schwarze Hüte von klassischer Form und weiße Handschuhe. Der erste trug einen Strauß roter Rosen. Der zweite einen zylinderförmigen Gegenstand in Geschenkpapier. Der dritte eine Milchkanne und einen umfangreichen Koffer.
– Ich bin Professor Wolf, sagte der erste, zog den Hut und streifte die Handschuhe ab. Gnädige Frau, darf ich Ihnen die Hand küssen und diese kleine Aufmerksamkeit überreichen?
Er war ein stattlicher Sechziger mit tiefliegenden Augen, dessen schwarze Mähne und buschige, zusammengewachsene Brauen nur spärlich mit Grau durchsetzt waren. Er weckte Erinnerungen an aufgeklärte Landärzte aus verarmten Adelsgeschlechtern.
– Freut mich, Sie kennenzulernen, sagte Frau Tachecí mit ähnlich berückter Stimme wie damals, als sie zum erstenmal Doktor Tachecí begrüßt hatte. Sie roch an den Rosen und bedauerte heftig, nicht das Kleid vom Donnerstag angezogen zu haben. Unwillkürlich begann sie Lízinka zu beneiden.
– Gestatten Sie, sagte Professor Wolf, daß ich Ihnen meinen Stellvertreter, Dozent Schimssa, vorstelle.
– Dozent Schimssa, sagte Dozent Schimssa, verbeugte sich und überreichte Doktor Tachecí den zylinderförmigen Gegenstand, wir haben angenommen, Sie würden einen guten Kognak vorziehen.
Er war ein Altersgenosse von Frau Tachecí, ein mittelgroßer, wendiger Mann von athletischer Statur, die der kurze Haarschnitt noch betonte. Die Fältchenfächer in den Augenwinkeln verrieten, daß er oft und gern lachte.
– Das war doch nicht nötig, flüsterte Doktor Tachecí höchst verlegen. Zugleich wurde er auf den Dozenten eifersüchtig. Um all dies zu verbergen, stellte er die Flasche auf den Boden und beeilte sich, den dritten Mann von seinen Lasten zu befreien.
Er war ein beleibter Mensch unbestimmten Alters. Seine Augen verschwanden fast in dem fleischigen Gesicht, aus dem der zackige Rücken einer gebrochenen Nase aufragte. Das Ganze erinnerte an ein altes Schlachtfeld, in das sich das Gesicht ehemaliger Boxer zu verwandeln pflegt.
– Das ist Karli, sagte Professor Wolf, unser Gehilfe und Fahrer. Könnten Sie so freundlich sein und ihm das Bad zeigen?
– Ja, sagte Doktor Tachecí, natürlich, gewiß, selbstverständlich ...
Er öffnete die entsprechende Tür und betätigte den Lichtschalter. Der Mann namens Karli wartete respektvoll, bis der Doktor zur Seite trat, dann setzte er sein Gepäck neben der Wanne ab. Gleich darauf zog auch er den Hut, und im Vorzimmer erglänzte eine Glatze. Dienstbeflissen hob er die Flasche auf und reichte sie Doktor Tachecí.
– Karli, sagte Professor Wolf, wenn wir in fünfzehn Minuten noch nicht zurück sind, fährst du die Geräte weg, gehst nach Hause und holst uns punkt fünf Uhr ab!
– Zu Befehl, Chef, sagte Karli, blieb aber stehen, ohne den treuergebenen Blick von ihm zu wenden.
– Darfst dir dreißig Zentimeter von meinem abschneiden, sagte Professor Wolf gönnerhaft.
– Vielen Dank, Chef, sagte Karli und wandte sich an die anderen. Mein Kompliment, küß die Hand, Gnädigste.
Er setzte sich den Hut auf und salutierte. Seine riesige Hand flappte wie ein Elefantenohr.
– Dürfen wir ablegen? fragte Professor Wolf.
– Mein Gott, Emil, sagte Frau Tachecí, sei den Herren doch behilflich!
Doktor Tachecí stellte die Flasche wieder auf den Boden, aber sowohl der Professor als auch der Dozent waren schneller. Unter den Raglanmänteln trugen sie karminrote Sakkos von gleichem Schnitt. Auf dem rechten Ärmel und der linken Brustseite war das Staatswappen aufgenäht. Sie sahen aus wie Funktionäre einer Olympiamannschaft, was Frau Tachecí beruhigte.
– Sie müssen entschuldigen, gnädige Frau, sagte Professor Wolf, wir kommen geradewegs von der Arbeit. Aber wo ist eigentlich das Fräulein Tochter?
– Sie wartet im Wohnzimmer, sagte Frau Tachecí mit einem entschuldigenden Lächeln, sie hat Lampenfieber. Kein Wunder. Sie ist ja noch ein Kind.
– Wenn sie Ihnen nachgeraten ist, gnädige Frau, sagte Professor Wolf, dann braucht sie sich vor nichts im Leben zu fürchten. Könnten Sie uns freundlicherweise miteinander bekannt machen?
– Lízinka! rief Frau Tachecí.
Die Wohnzimmertür öffnete sich. Lízinka stand in ihrem Rahmen wie ein holdes altes Bild.
– Das ist unsere Lízinka, sagte Frau Tachecí voll glücklichem Stolz. Lízinka, das ist Herr Professor Wolf, und das Herr Dozent Schimssa.
Lízinka knickste artig. Professor Wolf und Dozent Schimssa sahen einander offenkundig erregt an. Sie wirkten wie Anwerber eines Profiklubs, was Doktor Tachecí beunruhigte.
– Emil, sagte Frau Tachecí, bitte die Herren doch weiter! Doktor Tachecí machte eine entsprechende Geste.
– Nein, nein, sagte Professor Wolf, wenn Sie freundlichst gestatten, gehen wir mit dem Fräulein zunächst
6
ins Bad.
– Was machen die dort mit ihr? fragte Doktor Tachecí schon zum drittenmal.
– Ich bitte dich, beruhige dich, sagte zum drittenmal seine Frau, du selbst hast mir gesagt, sie muß eine Prüfung ablegen.
– Werden Prüfungen denn im Bad abgelegt? fragte ihr Mann.
– Jedenfalls werden sie ohne Eltern abgelegt, sagte seine Frau.
– Dann hätten wir ja in die Küche gehen können, sagte ihr Mann.
– Sie wollten uns eben nicht stören. Dieser Professor sieht aus wie ein englischer Lord.
– Dafür sieht dieser Dozent aus wie ein Laffe.
– Genauso hast du ausgesehen, als ich dich kennengelernt habe.
– Aber nur ausgesehen! sagte ihr Mann.
– Leider! sagte seine Frau.
Durch zwei Türen war zu hören, wie im Bad Wasser floß.
– Sie füllen die Wanne, sagte Doktor Tachecí.
– Sie machen irgendeinen Versuch, sagte seine Frau.
– In der Wanne? sagte ihr Mann.
– Ihr habt diese Formel nicht gelernt? fragte seine Frau, wie das Gewicht des Wassers dem Gewicht eines Körpers gleich ist?
– Wir haben sie anders gelernt. Und nicht in der Wanne.
– Glaubst du vielleicht, die baden sie dort, oder was?
– Es sollte mich nicht wundern.
– Du kannst dir wohl nicht vorstellen, daß es Männer gibt, sagte seine Frau, die ein Mädchen nicht gleich beim erstenmal in den Klee werfen.
– Ich möchte dich erneut daran erinnern, sagte ihr Mann, daß es ein englischer Rasen war und daß ich dich zunächst in aller Form um Erlaubnis gebeten habe.
Durch zwei Türen hindurch erklangen aus dem Bad gedämpfte Schläge.
– Was schlagen sie dort? fragte Doktor Tachecí.
– Es ist ihnen etwas runtergefallen, sagte seine Frau.
– Das waren Schläge, sagte ihr Mann.
– Dann nageln sie dort eben was fest, sagte seine Frau.
– Hast du jemals in einem fremden Bad etwas festgenagelt?
Durch zwei Türen hindurch erscholl aus dem Bad ein unmenschliches Geräusch.
– Und was ist das? fragte Doktor Tachecí.
– Jemand lacht, sagte seine Frau.
– Jemand schreit! sagte ihr Mann. Ich gehe hin!
– Ich bitte dich, mach dich nicht lächerlich!
Das Geräusch schwoll an.
– Das ist doch ein Huhn! sagte Doktor Tachecí.
– Du bist ja übergeschnappt! sagte seine Frau.
Das Geräusch riß ab.
– Sag, was du willst, sagte Doktor Tachecí, das war ein Huhn!
– Um Gottes willen, wie käme ein Huhn in unser Bad? fragte seine Frau.
– Das frage ich mich ja gerade!
– Emil, ich bitte dich, befaß dich lieber eine Weile mit deinen Briefmarken. Für Lízinka geht es jetzt ums Ganze, und du machst hier Geschichten!
– Bitte, sagte ihr Mann, aber wenn sie dieses Ganze in unserem Bad verliert, dann klag dich selbst an! Ich wasche meine Hände in Unschuld.
– Solange ich dich kenne, tust du nichts anderes, sagte seine Frau. An dir gemessen, war Pilatus ein Dreckfink!
In diesem Moment war zu hören, wie sich die Badezimmertür öffnete. Männerstimmen erklangen, und gleich darauf öffnete sich auch die Wohnzimmertür. Auf der Schwelle standen Professor Wolf und Dozent Schimssa. Im Bad rauschte die Dusche.
– Meine Herren! sagte Doktor Tachecí, ich glaube es ist höchste Zeit, daß Sie uns reinen Wein einschenken!
– Das ist eben das Problem, sagte Professor Wolf finster. Frau Tachecí erbleichte.
– Wir haben nämlich glatt den Champagner vergessen, sagte Dozent Schimssa heiter.
Frau Tachecí begann zu strahlen. Professor Wolf trat vor die Eltern und drückte ihnen feierlich die Hand.
– Gratuliere. Gratuliere. Ihre Lízinka hat hervorragend bestanden. Nun, da kann man nichts machen, wir müssen eben mit Kognak darauf anstoßen.
Dozent Schimssa hatte die mitgebrachte Flasche schon aus dem Geschenkpapier gewickelt und ein Mehrzweckmesser gezückt.
– Ich habe es gewußt, sagte Frau Tachecí, ihre Rührung bekämpfend, Emil, ich hab’ es dir gleich gesagt!
– Meine Herren, wiederholte Doktor Tachecí in jähem Eigensinn, erfahren wir endlich ...
– Deshalb sind wir ja da, Herr Doktor, sagte Professor Wolf und legte ihm freundschaftlich die Hand auf die Schulter. Aber sollten wir nicht auf sie warten?
– Wo bleibt sie überhaupt? fragte Doktor Tachecí.
– Sie säubert die Wanne, sagte Professor Wolf, trinken können wir freilich auch ohne sie, da entgeht ihr nichts.
Frau Tachecí hatte inzwischen aus der Vitrine die Feiertagsgläser geholt, die Dozent Schimssa bis zum Rand mit Courvoisier füllte. Professor Wolf hob sein Gläschen mit so fester Hand, daß der Flüssigkeitsspiegel nicht einmal erbebte.
– Das Leben, sagte er, hat mir leider kein solches Glück beschieden wie Ihnen, Herr Doktor. Ich habe keine Kinder. Aber meine Arbeit hat mich befähigt, vieles zu verstehen. Deshalb kann ich mich in die Gefühle der Eltern hineinleben, deren einzige Tochter am ersten und zugleich entscheidenden Kreuzweg des Lebens steht. Ich trinke darauf, daß der Pfad, den sie heute einschlägt von schöpferischen Erfolgen und Freude am gelungenen Werk begleitet sein möge!
Er und der Dozent reckten sich, grüßten mit einem Senken des Kopfes und leerten die Gläser bis auf den Grund. Die gerührte Frau Tachecí schloß sich spontan an. Doktor Tachecí tat es ihnen gleich, obwohl das seinen Gewohnheiten zuwiderlief.
– Gestatten Sie, gnädige Frau, fragte Professor Wolf, daß wir uns setzen? Wir sind seit halb fünf auf den Beinen.
Frau Tachecí war entsetzt.
– Um Gottes willen! sagte sie, Emil, biete den Herren doch einen Stuhl an! Sagen Sie, meine Herren, haben Sie überhaupt etwas gegessen?
– Besten Dank für die Aufmerksamkeit, gnädige Frau, sagte der Professor und nahm am Tisch Platz. Essen und Trinken gab es mehr als genug, aber Arbeit doppelt soviel. Wieder das alte Lied vom Personalmangel!
– Denen haben Sie aber Bescheid gegeben! sagte Dozent Schimssa voll Bewunderung.
– Ich habe ihnen gesagt, sagte der Professor, das sei das gleiche, als wolle man von jemandem verlangen, den Hamlet zu spielen und dabei noch Kulissen zu schieben.
– Und auch noch Haare zu schneiden! ergänzte der Dozent.
– Ja, sagte der Professor entrüstet, es überläuft einen kalt, wenn man bedenkt, wie leicht ein paar Bürokraten und Verrückte die Menschheit der ältesten Traditionen berauben könnten. Allerhöchste Zeit –
fuhr er, schon wieder ausgeglichen, fort und bedeutete dem Dozenten, einzuschenken.
– daß sich anständige und einflußreiche Leute gefunden haben, die das begreifen. Bevor Lízinka ausstudiert hat, bleibt davon nur ein peinlicher Absatz in den Skripten.
– Sie hatten, fragte Frau Tachecí, irgendeine Probe?
– Probe, Premiere und zugleich letzte Reprise, sagte Dozent Schimssa.
– Und das lohnt sich?
– Je nachdem, sagte Dozent Schimssa grinsend, für uns drei hat es sich gelohnt, für zwei andere nicht. Also dann, auf deren Wohl!
Eine Bestätigung, daß er um einen Scherz nie verlegen war. Professor Wolf und Frau Tachecí stimmten in sein Lachen ein. Ehe er es sich versah, merkte auch Doktor Tachecí, daß er ein leeres Glas in der Hand hielt, das Dozent Schimssa abermals füllte.
– Meine Herren, sagte er zum drittenmal; er hatte beabsichtigt, sehr kategorisch zu sprechen, doch seinem Mund entrang sich nur ein Flüstern.
– Sie haben eine hübsche Wohnung, sagte der Professor anerkennend und trat an die Fenster, bloß die Umgebung ist ein bißchen unfreundlich.
Aus einem der Fenster waren nur die Fenster des Hauses gegenüber zu sehen, aus dem anderen das Feld hinter der Wohnsiedlung, wo ein keilförmiger Abladeplatz auslief, der von oben so aussah wie eine ausgeschlachtete Matratze.
– Das sage ich zu meinem Mann seit Ewigkeiten, sagte Frau Tachecí, ohne den bewundernden Blick von ihm zu wenden, solange Lízinka ein Kind war, hatte das seine Vorteile, doch nun, da sie heranwächst, ist es hier einfach zum Fürchten!
– Eine Frau versteht sich besser zu verteidigen als ein Mann, sagte der Dozent, Männer sind Feiglinge. Mit einer Frau werden manchmal erst vier fertig.
– Und wenn es tatsächlich vier sind?
– Dann kann sie nur noch beten, lächelte Dozent Schimssa.
– Ich, sagte Frau Tachecí, ließe solchen Kerlen die Haut bei lebendigem Leib abziehen.
Professor Wolfs Miene verdüsterte sich.
– Aber, aber! sagte er streng, wie kämen die denn dazu? Frau Tachecí stutzte.
– Ja, aber, sagte sie verwirrt, bringt eine Mutter denn ihre Tochter nur deshalb zur Welt, päppelt sie sie deshalb auf, damit sie dann von vier Strolchen straflos vergewaltigt wird?
– Ach so, sagte der Professor, und seine Miene hellte sich sofort auf, ich habe nicht gleich verstanden, wen Sie meinen. In dieser Hinsicht haben Sie natürlich recht. Die Strafe des Schindens war bei uns sogar schon einmal eingeführt, und zwar im sechzehnten Jahrhundert unter König Vladislav.
– Dann also auf König Vladislav! sagte Frau Tachecí, dankbar, daß die momentane Mißstimmung verflogen war.
– Auf König Vladislav! wiederholte zustimmend Professor Wolf und erhob sich, um mit ihr und ihrem Mann anzustoßen.
Doktor Tachecí trank mechanisch aus, Dozent Schimssa schenkte ihm mit anerkennendem Zwinkern wieder ein.
– König Vladislav, fuhr der Professor fort, war überhaupt ein interessanter Mann. Anno 1509 verurteilte er einen Missetäter dazu, aus der Kanone geschossen zu werden. Leider hat sich bei uns weder die eine noch die andere Strafe durchgesetzt.
– Ich, sagte Frau Tachecí, würde sie für solche wieder einführen!
Sie trank sonst ebenso selten, wie ihr Mann und kam gerade zu dem Schluß, das sei schade. Der Alkohol vervielfachte die Freude über den Erfolg der Tochter, und die Gesellschaft der beiden interessanten Männer setzte Gedanken frei, die an der Seite Doktor Tachecís in der Regel unausgesprochen blieben.
– Ich, fuhr sie fort, würde ihnen eigenhändig bei lebendigem Leib die Haut abziehen, und alle Mütter würden mir dafür die Hände küssen. Schade, daß ich kein Mann bin!
Ihr Mann hob zum Protest immerhin schlaff die Hand. Zufällig war es die Hand mit dem Glas. Der Professor hob sofort das seine, bis Glas an Glas klang.
– Richtig, Herr Doktor, sagte er bewundernd, da kann man nur auf das Wohl Ihrer Gattin trinken.
Doktor Tachecí stand auf, trank aus und setzte sich, ohne sich erklären zu können, warum. Die anderen blieben stehen.
– Gnädige Frau, sagte Professor Wolf, so denkt wohl jede normale Frau, aber kaum eine getraut sich, es auszusprechen. Es waren ja auch Frauen, die den harten Kern des ständigen Publikums vor der Guillotine bildeten, wie zeitgenössische Radierungen bezeugen. Doch selbst die Französische Revolution, die Exekutionen zu Volksfesten erhob, hat das allergrößte Unrecht nicht beseitigt; die Gleichberechtigung ist einer einzigen menschlichen Tätigkeit nicht zuteil geworden, und just der, bei der ein Mensch am meisten Mensch ist. Noch zweihundert Jahre lang, bis –
Professor Wolf verlor allmählich seine kühle Gemessenheit und begann einem romantischen Dichter zu ähneln,
– zum heutigen Tage, blieb das Privileg der gesetzlichen Vergeltung unlogischerweise dem Manne vorbehalten. Der Frau wurde nicht nur verwehrt, in den Strafvollzug ihre Kaltblütigkeit und Gewitztheit einzubringen, sie durfte überdies, wenn sie selbst ihr Leben verwirkt hatte, den Tod nicht aus weiblicher Hand empfangen. Welche Ungerechtigkeit und –
Professor Wolf suchte einen Moment lang nach dem richtigen Wort,
– Rückständigkeit in einer Zeit, da Frauen Raumschiffe lenken und Kriege führen. Um so größer soll unsere Freude sein, daß wir vier es sind, die als erste den Anbruch einer modernen Ära begrüßen dürfen. Dank sei den Aufgeklärten, die diesem Gedanken ihr ganzes Leben geweiht haben ...
– Dank sei Ihnen, Herr Professor! warf Dozent Schimssa ein.
– Nein, nein, Kollege, sagte Professor Wolf bewegt, aber kategorisch, wir sind nur die Schiffsjungen toter Kapitäne. Sie haben das Ziel bestimmt, uns ist es nur vergönnt, vom Mastkorb aus ›Land!‹ zu rufen. Unser Beruf hat zum erstenmal in der Geschichte eine würdige Stätte gefunden, wo er sich unter den gleichen Bedingungen entwickeln kann wie viel, viel jüngere Berufe. Mehr noch: Nach dem 21.Januar 1790, als die französische Nationalversammlung die Exekutionsgleichheit deklarierte, wird der heutige Tag in die Geschichte eingehen als der Tag, an dem die Gleichheit der Vollstreckungsbeamten eingeführt wurde. Hier haben wir sie! –
rief er herzlich aus, als sich die Tür öffnete und Lízinka eintrat, den blassen Teint von der überstandenen Anspannung rosig überhaucht,
– hier ist sie, unsere zukünftige erste Vollstreckerin und aller Wahrscheinlichkeit nach die erste
7
Henkerin der Welt!
Die letzten Worte hörte Frau Tachecí nicht mehr, weil sie sie gar nicht zu hören brauchte. Von Rührung überwältigt, ging sie auf ihre Tochter zu, umarmte sie und drückte ihr Gesichtchen an den vollen Busen.
– Du mein Lízikind, sagte sie unter Tränen, mein Goldschatz, du ahnst ja nicht, wie glücklich ich bin!
Professor Wolf bedeutete Dozent Schimssa, erneut die Gläser zu füllen.
– Na, Herr Doktor, sagte er, das ist doch ein Grund zum Trinken!
Doktor Tachecí begann zu lachen.
– Das ist gelungen! sagte er, das ist Ihnen gelungen! Das ist Ihnen aber wirklich gelungen!
Er lachte immer lauter, bis er einen Schluckauf bekam. Obwohl sich sein Gesichtsausdruck nicht veränderte, sah es aus, als weinte er.
Dozent Schimssa ging auf ihn zu, offenbar in der Absicht, ihm den Rücken zu klopfen. Doch der Professor war schneller. Er hielt seine Hand fest und sagte warnend:
– Nicht, Kollege, lieber nicht ...
Schimssa warf unwillkürlich einen Blick auf die eigene Hand, deren scharfe Kanten die Karateausbildung verrieten, und nickte verstehend. Dorktor Tachecí schluchzte und weinte vor Lachen. Endlich merkte er, daß ihm der Erstickungstod drohte, und er versuchte aufzustehen. Er wartete, bis der schwankende Raum sich stabilisierte, dann konzentrierte er sich darauf, durch den Engpaß zwischen den zwei karminroten Sakkos in die Diele zu gelangen.
Einen Moment lang verwirrte es ihn, daß er sich in einer Winterlandschaft voller rodelnder Kinder befand, bevor ihm klar wurde, daß er die Stirn an den Rahmen eines Bildes gelehnt hatte. Er schloß die Augen und schob den Kopf weiter, bis er die Wand des Ganges spürte, die ihn sicher wie ein Schienenstrang ins Bad führte.
Dort zog er das Jackett aus und hängte es dicht neben den Kleiderhaken. Dann schob er die Krawatte sorgfältig bis auf den Rücken, um sie nicht naß zu machen, beugte sich über die Wanne und drehte tastend den Hahn der Dusche auf. Als der kalte Wasserstrahl ihn wohltuend ins Genick traf, öffnete er die Augen. Er erblickte ein anderes Bild, diesmal ein Stilleben, eine ›nature morte‹ mit Huhn und Karpfen. Während ihm das Wasser über die Krawatte in die Hose rann, versuchte er sich angestrengt zu erinnern, wer es gemalt hatte und wie es in die Badewanne gekommen war. Schließlich begriff er: Das war kein Bild, sondern wirklich.
8
ein toter Karpfen und tatsächlich ein geschlachtetes Huhn.
– Hinaus! rief Doktor Tachecí, als er wieder auf der Schwelle des Wohnzimmers erschien. Aus Haaren, Hemd und Hose tropfte Wasser, ansonsten sah er erstaunlich nüchtern aus. Lízinka saß artig auf dem Stuhl ihrer Mutter, die das Hochzeitskaffeeservice auf den Tisch gestellt hatte und nun den Marmorkuchen anschnitt.
– Um Gottes willen, Emil, sagte Frau Tachecí entsetzt, wieso ... Was hast du da in der Hand?
– Ein Huhn, sagte ihr Mann, schweig! Sie sind Professor? fragte er Wolf.
– Allerdings, Herr Doktor, sagte Wolf.
– Was für ein Professor? fragte Doktor Tachecí.
– Ich bin der Professor der Exekutionswissenschaft Wolf, und dies ist der Dozent der Exekutionswissenschaft Schimssa.
– Ihr seid Henker! sagte Doktor Tachecí zürnend.
– Unsere Diplome, Herr Doktor, sagte Professor Wolf würdevoll, sind ebenso gültig wie das Ihre.
– Ihr seid Henker! rief Doktor Tachecí, und kommt von der Arbeit!
– Emil, besinn dich! rief seine Frau.
– Sei still! schrie ihr Mann. Und Sie wagen mir vorzuschlagen, meine Tochter soll Menschen morden?
Professor Wolf erhob sich. Jetzt ähnelte er weder einem Landarzt noch einem romantischen Dichter. Der Farbe seines Sakkos entströmte Blutgeruch. Er drohte in der nächsten Sekunde zu explodieren, und das Staatswappen verlieh seinem Zorn übermenschliches Format.
Doktor Tachecí erschrak jedoch nicht. Er war im kritischen Moment endlich zum Vater herangereift, und die Verteidigung des eigenen Nachwuchses flößt größere Kräfte ein als das Staatsinteresse. Obwohl er sich noch nie mit jemandem geschlagen hatte, war er bereit, auf den Widersacher mit dem toten Huhn einzudreschen.
Wolf war ein zu guter Psychologe, um dies nicht zu merken. Er besann sich anders und strebte zum Bücherschrank.
– Sie gestatten? fragte er kurz; und ohne eine Antwort abzuwarten, nahm er das zweite von acht Büchern heraus, deren Rücken ein weithin sichtbares Ganzes bildeten.
– Ich könnte eine Reihe von Koryphäen meines Berufes zitieren, sagte er dann, aber ich beschränke mich auf diejenigen, die Sie anerkennen, Herr Doktor. Alexander Dumas würden Sie gewiß nicht beschuldigen, es auf die Seele Ihrer Tochter abgesehen zu haben. Überzeugen wir uns also, was er auf Seite 381 des zweiten Teils der ›Drei Musketiere‹ sagt: »Als sie das Flußufer erreichten, näherte sich der Henker Milady und fesselte sie an Händen und Füßen. Da brach sie das Schweigen, indem sie ausrief: ›Ihr seid niederträchtige, gemeine Mörder, es bedarf eurer zehn, um eine einzige Frau zu überwältigen!‹ – ›Sie sind keine Frau‹, sagte Athos eisig, ›Sie sind nicht einmal ein Mensch, sondern ein Dämon, der Hölle entkommen, den wir der Hölle wieder zurückgeben!‹
– ›Ach, edle Herren‹, sagte Milady, ›bedenkt, daß derjenige von euch, welcher mir ein einziges Haar krümmt, zum Mörder wird!‹ – ›Der Henker kann töten, ohne deshalb ein Mörder zu sein‹, sprach der Mann im roten Mantel, wobei er an sein breites Schwert schlug. ›Das ist der letzte Richter, das ist –
Professor Wolf klappte das Buch zu und stellte es an seinen Platz zurück,
– alles!‹« Sie sind aber Theoretiker, Herr Doktor, und können einwenden, die Romangestalt bringe lediglich die Meinung des Verfassers zum Ausdruck. Streifen Sie einmal alle Emotionen ab und folgen Sie mir aufs Gebiet der Wissenschaft. Sie haben den Ausdruck ›Henker‹ gebraucht, um Ihrer Verachtung freien Lauf zu lassen. Und doch sollte gerade dieser altüberkommene Ausdruck gerade Ihnen ein Beweis sein, daß der Henker als Sendbote längst vergangener Kulturen in unsere Geschichte eintritt. Die neuzeitliche Genese der Funktion erhellt wohl am besten aus der Schrift ›Zum Ursprung von Richtern und Scharfrichtern‹ von Rudolf Rauscher, Pierwsza drukarnia Lwów, 1930, wo gesagt wird, ich zitiere: »Ihr Ursprung fällt bei uns ins 13. Jahrhundert. Sie waren accusatores publici, von König Przemysl Ottokar II. aus alten Adelsgeschlechtern bestellt, die nach und nach auch zu Richtern und Scharfrichtern wurden.« Gewiß ist es Ihnen nicht entgangen, Herr Doktor, daß sie in dreieiniger Gestalt die gesamte Justiz darstellen, und zwar um hundert Jahre früher, als aus der ersten juristischen Hochschule der erste Doktor der Rechte hervorging. Nichtsdestoweniger bleibt für Sie wie für die verbrecherische Milady der Henker oder amtlich »Scharfrichter« oder neuerdings »Vollstrecker« nichts als ein Mörder. Welch gegenteilige Haltung vertritt dagegen Ihr Kollege Joseph de Maistre, wenn er in seinen ›Soirées de Saint Pétersbourg ou Entretiens sur le gouvernement temporel de la Providence‹ schon 1821 die berühmte Studie über den Henker verfaßt, ich zitiere zumindest ein Bruchstück: »Die Resultante dieses schrecklichen Prärogativs« – ein Prärogativ ist –
erläuterte Professor Wolf, an Lízinka gewandt,
– jedes Vorrecht eines Herrschers, das die Mitentscheidung des Volkes ausschließt, zum Beispiel bei der Bestrafung eines Schuldigen, seine Resultante ist also, ich zitiere weiter: »... die unerläßliche Existenz eines Menschen, dazu bestimmt, ein Verbrechen durch Strafen zu ahnden, welche die menschliche Gerechtigkeit festgesetzt hat; und dieser Mensch tritt tatsächlich überall auf, ohne daß man zu erklären vermöchte, wie; denn der Verstand findet in der Natur des Menschen kein Motiv, das imstande wäre, ihn zur Wahl dieses Berufes zu bewegen. Was ist das für ein unerklärliches Wesen, das jedem angenehmen, einträglichen, ehrbaren, ja ehrlichen Beruf einen solchen vorzieht, der seinesgleichen foltert und zu Tode bringt? Sind dieser Kopf, dieses Herz so beschaffen wie die unserigen? Enthalten sie nicht etwas Eigentümliches und unserer Natur Fremdes? Was mich betrifft, so zweifle ich nicht daran. Es ist äußerlich so beschaffen wie wir; wird so geboren wie wir; aber es ist ein Ausnahmewesen, für das es in der Menschenfamilie eine besondere Bestimmung geben muß. Es ist erschaffen wie –
fuhr Professor Wolf fort,
– die Welt«, Ende des Zitats. Ich entschuldige mich für geringfügige Ungenauigkeiten, die im übrigen höchstens in der Syntax zu finden sein werden, denn das war mein Habilitationsthema, und ich müßte es bald zur Kenntnis Ihrer –
sagte Professor Wolf, an Frau Tachecí gewandt,
– Lízinka bringen. Eine besonders schöne Passage schildert die Beziehung des Scharfrichters zu seiner Arbeit, ich zitiere: »Er trifft auf einem öffentlichen Platz ein, den eine wimmelnde Menge bedeckt. Man bringt ihm einen Giftmischer, einen Vatermörder oder einen Frevler: Er ergreift ihn, streckt ihn, bindet ihn an ein waagerechtes Kreuz, hebt den Arm: Da entsteht eine entsetzliche Stille, man hört nichts als das Knirschen der Knochen, die unter der Barre splittern, und das Wehklagen des Opfers ... Es ist fertig: Sein Herz hämmert, jedoch vor Freude; er applaudiert sich, er sagt sich insgeheim: Keiner rädert besser als –
fuhr Professor Wolf fort,
– ich.« Nach dieser suggestiven Schilderung komponiert de Maistre die weltbekannte Apotheose, die zum Lebenscredo eines jeden Henkers werden sollte, und die ich deshalb bei jeder Prüfung –
sagte Professor Wolf, an Lízinka gewandt,
– abfragen werde. Ich zitiere: »Alle Größe, alle Macht, aller Gehorsam der Welt beruht auf dem Scharfrichter; er ist der Schrecken und das Band der menschlichen Gesellschaft. Man entferne diesen unbegreiflichen Faktor aus der Welt; im selben Moment verwandelt Ordnung sich in Chaos, Throne stürzen, die Gesellschaft verschwindet. Gott, der Schöpfer der Souveränität, ist auch der Schöpfer der Strafe: Er hat unsere Erde auf diese beiden Pole gegründet und läßt die Welt um sie kreisen.« Sie, Herr Doktor –
sagte Professor Wolf ohne jeden Anflug von Vorwurf oder Hohn, an Doktor Tachecí gewandt,
– sind sicherlich, wie es sich für Sie geziemt, ein Anhänger der These Jean Jacques Rousseaus, daß der Mensch von Natur aus gut ist, aber von der Gesellschaft verdorben wird, auf der der gesamte sogenannte europäische Humanismus fußt. Nicht zufällig erschien bereits 1764, also nur zwei Jahre nach der Erstausgabe des ›Contrat social‹ von Rousseau, in Monaco das berühmt-berüchtigte Pamphlet des Cesare Beccaria, ›Dei delitti e delle pene‹, was soviel heißt wie ›Über Delikte und Strafen‹ – übersetzte Professor Wolf, an Frau Tachecí gewandt,
– das mit Hilfe einer gewaltsam logischen Konstruktion nachweist, daß das menschliche Leben nicht zu den Gütern gehört, über die die Gesellschaft verfügen darf, und als erstes die Abschaffung der Todesstrafe vorschlägt. Jedoch, wie Goethe sagt, »grau, teurer Freund, ist alle Theorie, und grün des Lebens –
zitierte Professor Wolf, an Lízinka gewandt,
– goldner Baum«! La Révolution, die Rousseaus Theorie von einer neuen Gesellschaft verwirklicht hat, kam nach und nach ohne Marat, ohne Danton und Robespierre aus, ja auch ohne Rousseau, nicht jedoch ohne den Mann, der eine jahrhundertealte Gesellschaft in drei Jahren praktisch ausgerottet hat, und das war der Citoyen Charles Sanson, in der Revolutionszeit Henker von Paris. Er ist der Held der bekannten ›Mémoires pour servir à l’histoire de la Révolution Française‹, die er sogar als Autor signierte, obwohl sich später herausgestellt hat, daß er sein Aushängeschild einem literarischen Anfänger mit dem nichtssagenden Namen Honoré –
fuhr der Professor fort,
– de Balzac geliehen hatte. Mit ihm beginnt eine prachtvolle Porträtgalerie von Scharfrichtern, die nicht nur der Schotte Walter Scott um Meisterwerke erweitert hat, sondern auch der Tscheche Karel Hynek Mácha, dessen Romanfragment ›Der Henker‹ den Helden sogar als den letzten Sproß des Königsgeschlechts der Przemysliden präsentiert. »Er war groß, schlank«, schreibt Mácha, »das schwarze Kraushaar, von keiner Kappe gebändigt, bedeckte die ganze Stirn bis zu den dichten Brauen, unter denen zwei flammende Augen aus der Tiefe hervorfunkelten; das übrige Gesicht war von schwarzem Barte bewachsen. Über der schwarzen Gewandung wehte ein roter Mantel, und quer über seinen Rücken hing ein breites –
zitierte Professor Wolf, und Frau Tachecí schien es, als beschreibe er seine eigene Fotografie aus der Studentenzeit,
– Schwert mit langem Heft.« Übrigens glaube ich, daß Karel Krejčí in seiner Studie ›Das Symbol von Henker und Verurteiltem in Máchas Werk‹ irrt, wenn er die Zusammenziehung des Typs König mit dem Typ Henker als Zeichen einer zerrütteten Gesellschaftsordnung begreift. Im Gegenteil: Im zweischneidigen Oxymoron ihrer gegenseitigen Anrede »König Henker!« und »Henker König!« klingt abermals die de Maistresche Polarität beider fundamentalen gesellschaftlichen Funktionen an. – Dies ist die Betrachtungsweise verantwortungsbewußter Künstler, die in den genialen Werken von Franz Kafka und Pär Fabian Lagerkvist kulminiert, der völlig zu Recht mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde. Dies ist das wirkliche Bild des Henkers, und falls es einzelne gegeben haben sollte, die seiner nicht würdig waren, so gibt Ihnen das als Wissenschaftler nicht das Recht, alles geringzuschätzen, was Tausende von ehrlichen Henkern generationenlang für Vaterland und Menschheit geleistet haben. Denn Hand aufs Herz –
fuhr Professor Wolf fort, an Doktor Tachecí gewandt, und in seiner Stimme schwang zum erstenmal feine Ironie mit,
– nicht jeder Absolvent der philosophischen Fakultät wird ein Schopenhauer, nicht wahr, Herr Doktor, und so mancher von ihnen endete rechtens durch die Hand des Henkers, den wiederum jedes halbwegs seriöse Konversationslexikon hervorhebt. Stellvertretend für alle zitiere ich zumindest Meyers Neues Lexikon, Leipzig 1964, Stichwort ›Scharfrichter‹: »Person, die berufsmäßig die vom Gericht ausgesprochene Todesstrafe an dem Delinquenten in der gesetzlich vorgeschriebenen Form vollstreckt.« Das und nichts anderes sollte auch Ihre Tochter tun. Es ging also nicht darum –
fuhr Professor Wolf fort, an Doktor Tachecí gewandt, und in seiner Stimme schwang zum erstenmal ein leichter Vorwurf mit,
– daß sie Menschen mordet, sondern daß sich ihr das wohl ausgefeilteste und unbedingt populärste Gebiet menschlicher Betätigung erschließt, das unermeßlich älter ist als Medizin, Rechtswissenschaft, von der Philosophie ganz zu schweigen. Ich, hier der Kollege –
fuhr Professor Wolf fort, an Dozent Schimssa gewandt,
– und die anderen Pädagogen hatten die Absicht, ihr das reiche Wissen zu übermitteln, das, wie schon meine kleine Improvisation angedeutet hat, zu den Grundlagen der Zivilisation gehört. Wir wollten ihr auch unsere reichen Erfahrungen aus der Praxis übermitteln, damit das ›capital punishment‹, wie die Engländer so treffend sagen, die Haupt-Strafe, nicht zur Erwerbstätigkeit von Dilettanten wird, sondern wieder zur Domäne der besten Söhne und jetzt auch der besten Töchter ihrer Zeit. Falls Sie, Herr Doktor –
fuhr Professor Wolf fort, an Doktor Tachecí gewandt,
– ein echter Humanist sind, dürfen Sie nicht die Augen vor der Tatsache verschließen, daß bei jeder größeren Aktion, sei es nun eine lokale Revolution oder ein Weltkrieg, eine Menge Leute von Personen hingerichtet werden, für die Hängen einfach Hängen bedeutet. Es ist jedoch, glauben Sie mir, ein ziemlich großer Unterschied, ob der Strang Ihnen perfekt das Genick bricht oder Sie eine Viertelstunde langsam erwürgt, bis Sie sich zu Tode zappeln. Heute zum Beispiel hat Kollege Schimssa so geschickt gearbeitet, daß der Amtsarzt den Tod des ihm Anvertrauten schon nach achtundzwanzig Sekunden feststellen konnte.
– Sie waren um drei Sekunden besser! sagte Dozent Schimssa bewundernd.
– Übrigens steht nirgends –
fuhr Professor Wolf rasch und mit der Noblesse eines von Eitelkeit freien Mannes fort,
– geschrieben, daß sie hinrichten muß. Vielleicht widmet sie sich nach dem Abitur der Theorie. Doch selbst wenn sie aktive Henkerin werden sollte, kann niemand von ihr verlangen, daß sie jemanden etwa mit Zangen reißt oder aufs Rad flicht. Sie wird ausschließlich Strafen vollstrecken, die heute in der zivilisierten Welt gesetzlich verankert sind. Läßt man das Erschießen außer acht, das aus alter Tradition den Soldaten vorbehalten ist, so sind dies in Europa alles in allem die Garrotte, die Guillotine und der Strang. Amerika ist etwaigen Henkerinnen schon entgegengekommen, als es begann, durch Elektrizität und Gas hinzurichten, denn beides ist den Frauen –
fuhr Professor Wolf fort, an Frau Tachecí gewandt,
– aus jeder modernen Küche vertraut. Es kann behauptet werden, daß der Scharfrichter heutzutage seine Arbeitskleidung viel seltener in die Reinigung gibt als ein Arbeiter den Overall. Und das ist alles –
fuhr Professor Wolf fort, an Doktor Tachecí gewandt,
– was ich zu Ihrer Bemerkung anmerken wollte, und nun –
sagte er, an Dozent Schimssa gewandt und mit einem Blick auf die Uhr, die fünf Minuten vor fünf anzeigte,
– gehen wir. Nein, nein, gnädige Frau –
fügte er noch hinzu, als er sah, wie Lízinkas Mutter Atem holte, um ihn vielleicht weniger fundiert, aber um so temperamentvoller zu unterstützen,
– der Herr Gemahl hat unbestritten das Recht, meine Argumente in Ruhe zu überdenken und sie entweder so leicht zu finden, daß eine wissenschaftliche Kontroverse sich erübrigt, oder aber so gewichtig, daß er um die Aufnahme Ihres Töchterchens schriftlich ansucht. Denn wir, Herr Doktor, haben wiederum unbestritten das Recht, aus der Flut von Bewerbern diejenigen auszuwählen, denen es auch an gutem Hinterland nicht mangelt. Zahlreiche verdiente Scharfrichter würden wer weiß was dafür geben, damit wir ihre Sprößlinge aufnehmen. Wenn wir jedoch dem überholten Brauch des Familienbetriebs ein Ende bereiten und auch den Kindern von Sprachwissenschaftlern eine Chance geben wollen, dann müssen wir die Gewißheit haben, daß wir dieser Konzeption zu einem vollen Erfolg verhelfen können. Wir dürfen nicht riskieren, daß ausgerechnet die erste Henkerin der Welt unter dem Unverständnis des eigenen Vaters leidet. Wenn sie auch noch von solchen Problemen belastet sein sollte, müßte sich ja jeder Delinquent bestens bei ihr bedanken. Gestatten Sie also, daß wir uns jetzt –
Professor Wolf küßte Frau Tachecí die Hand und lächelte Lízinka aufmunternd zu,
– verabschieden.
Dann bot er Doktor Tachecí freundschaftlich die Hand.
– Oh, Verzeihung, sagte er, nahm ihm das tote Huhn aus der Rechten und reichte es Frau Tachecí.
– Nach so viel Spannung, sagte er, wird die Familie ein ausgiebiges Abendessen sicher nicht verschmähen. Die Vorspeise finden Sie in der Badewanne.
– Sie werden sich doch, sagte Frau Tachecí mit belegter Stimme, nach alledem unseretwegen nicht in Unkosten stürzen!