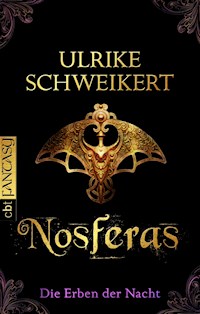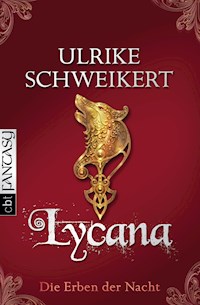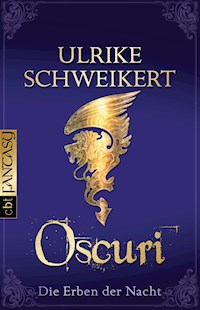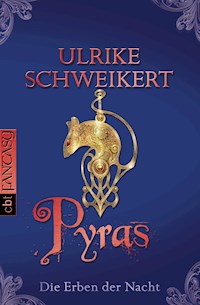5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Burg Wehrstein im 13. Jahrhundert: Tilia bekommt von ihrem Vater einen heiklen Auftrag. Sie soll auf die Burg der Zollern reisen, um der Tochter des dort ansässigen Grafen zu dienen. Begleitet wird sie von der unfreien Magd Gret, die für sie wie eine Schwester ist. Tilia wird bald klar, dass sie auf der Burg mehr als unerwünscht ist - und dass die Gräfin ein düsteres Geheimnis umgibt. Inmitten von Intrigen und Missgunst, Eifersucht und roher Gewalt muss die junge Frau lernen, sich zu behaupten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 670
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Kurzbeschreibung:
Burg Wehrstein im 13. Jahrhundert:
Tilia bekommt von ihrem Vater einen heiklen Auftrag. Sie soll auf die Burg der Zollern reisen, um der Tochter des dort ansässigen Grafen zu dienen. Begleitet wird sie von der unfreien Magd Gret, die für sie wie eine Schwester ist. Tilia wird bald klar, dass sie auf der Burg mehr als unerwünscht ist - und dass die Gräfin ein düsteres Geheimnis umgibt.
Inmitten von Intrigen und Missgunst, Eifersucht und roher Gewalt muss die junge Frau lernen, sich zu behaupten.
Ulrike Schweikert
Die Herrin der Burg
Roman
Edel Elements
Edel Elements
Ein Verlag der Edel Germany GmbH
© 2017 Edel Germany GmbH Neumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 2017 by Ulrike Schweikert
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Montasser Medienagentur.
Covergestaltung: Anke Koopmann, Designomicon, München.
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-96215-014-3
www.facebook.com/EdelElements/
www.edelelements.de/
PROLOG
Stolz führte er seine jungfräuliche Braut durch die Grafschaft. Er zeigte ihr die von seinem Vater neu gegründete Stadt Hechingen, die auf einem Bergsporn über der Starzel in Form eines Hufeisens gebaut wurde. Mit einer breiten Marktstraße und einer wehrhaften Stadtmauer sollte sie Handwerker und Kaufleute anziehen. Trotz Nieselregen und Kälte wurde unentwegt gesägt und gehämmert, stabile Balken eingegraben und Lehm mit Mist und Wasser gestampft, um das Flechtwerk zwischen den Balken damit zu bestreichen. Die ersten Häuser standen schon, die Dächer waren mit frischem Stroh gedeckt.
Bevor sie zur Burg auf dem Zollernberg ritten, führte der junge Zoller das Edelfräulein unweit des Hechinger Dorfes zu einem schlichten Gebäude. Eine Nonne im Ordenskleid der Augustinerinnen öffnete. Schweigend führte sie den Grafensohn und seine Braut zu der dem heiligen Johannes geweihten Kapelle. Die gräflichen Begleiter warteten draußen.
»Liebste Udelhild«, begann Friedrich, als sie allein vor dem roh geschnitzten Kruzifix standen, »ich möchte diese Klause ausbauen. Hier sollen Töchter unserer Vasallen leben und für die zollerischen Lande beten. Hier sollen einst unsere Särge und die unserer Kinder in einer Gruft vereint werden. Lass uns eine Kirche bauen – Gott zu Ehren und uns zur Freude!«
Mit ausgebreiteten Armen stand der große, schlanke Mann vor ihr. Das schmale Gesicht mit der geraden Nase und den vollen Lippen ihr erwartungsvoll zugewandt, in den blaugrauen Augen ein seltsames Strahlen.
Das blasse, schwarzhaarige Mädchen, das an diesem Tag noch nicht viel gesprochen hatte, lächelte ihren zukünftigen Gemahl scheu an und legte dann zögernd ihre Hand in die seine.
»Ja, Herr, lasst uns hier an diesem Ort beten. Er ist wunderschön.« Sie ließ ihn los und drehte sich einmal um ihre Achse. Ja, hier will ich dereinst begraben werden.«
Friedrich lachte. »Du bist so jung, das soll noch nicht dein Gedanke sein. Jetzt wirst du erst einmal leben – mit mir leben!« Voller Stolz betrachtete er seine junge Braut. Das herrliche Haar, die reine, blasse Haut, die zarten Brüste, von edler Seide umschmeichelt.
Schüchtern schlug sie die Augen nieder, als sie das begehrliche Brennen seines Blickes gewahrte. Er trat einen Schritt näher und küsste zart ihre Stirn.
»Ich werde dich lieben und ehren, Udelhild von Dillingen, das verspreche ich dir, hier vor dem Gekreuzigten und der Heiligen Jungfrau. Wir werden das Geschlecht der Zollern vom Schatten ins Licht führen. Von unseren Nachkommen soll die ganze Welt sprechen!«
Sie zitterte, doch da die Glocke ins Refektorium rief, schickte er die Braut zu den Nonnen hinaus.
»Geh und setz dich zu ihnen, iss mit ihnen und wärme dich auf. Danach reiten wir zur Burg.«
Als sie die Tür hinter sich geschlossen hatte, trat er an das Kruzifix heran und betrachtete es eine Weile schweigend.
»Gnädiger Herr Jesu Christ«, sagte er dann mit fester Stimme, »zu Deiner und der heiligen Jungfrau Ehre will ich den Nonnen ein richtiges Heim geben.« Er breitete die Arme aus. »Ich werde nicht geizen und ihnen reichlich Ländereien schenken. Sie sollen hier Dein Lob singen. Großartig soll das Kloster werden – die Gebäude um einen geschützten Hof einhundertfünfzig Fuß lang oder mehr. Einen Saal mit spitzbogigen Fenstern will ich erbauen und einen Kreuzgang mit herrlichem Gewölbe – und eine Kirche« – er riss die Arme in die Höhe –, »die bis in den Himmel reicht.« Schwer atmend ließ er die Arme wieder sinken.
»Doch, Herr, alles ist ein Geben und Nehmen.« Er trat näher an das Kruzifix heran. Seine Stimme wurde eindringlich. »Lass das Geschlecht der Zollern erblühen. Segne diese Ehe mit kräftigen Söhnen – und nimm dieses herrliche Weib nicht wieder von mir. Sie ist wie die erste Blüte unter schmelzendem Schnee, und ich schwöre Dir, ich fasse kein anderes Weib mehr an, wenn ich ihre Liebe erringe. Nach vielen Jahren, Seite an Seite, soll sie dann dereinst zu mir in mein kaltes Grab steigen. Amen.«
Die Augustinerinnen bekamen ihre Ländereien. Sie begannen das Kloster zu errichten, doch auf ihre neue Kirche mussten sie lange warten. Es war nicht die Zeit, himmelwärts strebende Gotteshäuser zu errichten. Die Hände wurden zum Kämpfen und zum Beten gebraucht, denn das Land – das ganze Reich – drohte für immer unterzugehen.
GESCHICHTSÜBERBLICK
Ein düsterer Schicksalsstern stand über dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, als der Enkel Barbarossas, Kaiser Friedrich II., kurz vor Weihnachten im Jahre 1250 erkrankte. Nur wenige Tage später starb er auf seinem Jagdschloss Fiorentino in Apulien. Seinem Sohn Konrad VI. waren nur vier Jahre als König gegönnt. Er hinterließ einen Knaben, kaum der Ammenbrust entwöhnt: Konradin, mit dem das stolze Geschlecht der Staufer im Jahre 1268 erlöschen sollte. Nach einem Scheinprozess richtete Karl von Anjou den halbwüchsigen Schwabenfürst in Neapel hin, trennte ihm mit einem Schwertstreich das Haupt vom Rumpf. Doch schon 1254, kaum dass König Konrad in seinem Grab ruhte, begann der Zank um Reich und Krone. Blutige Kämpfe wüteten unter dem zweifach erkauften Königsthron. Alfons von Kastilien und Richard von Cornwall brachten mit ihren Anhängern Leid und Tränen über die deutschen Völker.
Das Interregnum, wie die kaiserlose Zeit auch genannt wurde, zeichnete ein Bild des Grauens. Kein Recht, keine Gerechtigkeit mehr, nur die Schärfe des Schwertes entschied. Noch bevor das letzte Lichtlein des einst mächtigen Hauses von Hohenstaufen erlosch, krochen aus den Trümmern die Geschlechter hervor, die einst im Schatten der hohen Herren kaum zu sehen gewesen waren. Sie machten sich frei und zerrissen die alten Bande. Selbst Klöster und Städte lösten sich von den einstigen Herren. Jeder suchte mit der Macht des blanken Schwertes an sich zu raffen, was er erwischen konnte. Grausige Fehden färbten die Erde rot. Auch die Geschlechter der von Zollern und der von Hohenberg suchten die Grenzen ihrer Besitzungen in des Nachbarn Eigen zu schieben. Vor wenigen Generationen noch verwandtschaftlich verbunden, brach nun erbitterte Fehde zwischen den Häusern am Rande der Schwäbischen Alb aus. Eifersucht und Machtgier schürten die Glut des Hasses. Brennende Gehöfte, verwüstete Felder und gequälte Bauern waren die Waffen, den Gegner in die Knie zu zwingen. Nichts mehr erinnerte an edles Rittertum, an Minnesang und Ehre, wenn die Horden der Grafen mordend und sengend über die Landschaften herfielen.
An Allerheiligen im Jahre des Herrn 1267 zog Graf Friedrich von Zollern, der Erlauchte genannt, mit seinem Erstgeborenen und seinen Lehensmännern gen Haigerloch. Man sah die Schenken von Zell-Andeck und den Truchsessen von Bisingen in seinem Gefolge, die Ritter von Lichtenstein und die von Ringingen, Edelknechte von Boll und von Steinhofen und Bewaffnete aus Hechingen, aus Balingen und Schömberg. Auch so mancher Bauer folgte mit Sense und Dreschflegel dem Tross der Reiter.
Graf Albert von Hohenberg, der den Zorn mit kalter Berechnung geschürt hatte, erwartete den Gegner vor Haigerloch. Doch der Zoller war schlau. Er umging die Falle und brannte eine kleine Ortschaft südlich der Stadt Haigerloch nieder, die denselben Namen führte wie das Kloster, das er für sein Eheweib hatte errichten lassen: Stetten.
KAPITEL 1
Zwei Ritter näherten sich von Süden her dem kleinen Ort Stetten bei Haigerloch. Der Edelfreie Hildebolt von Wehrstein kam mit seinem Lehensmann Ritter Wolfram von Husen an Allerheiligen von Konstanz her. Schon von weitem sahen sie die dunklen Rauchwolken in den Himmel steigen. Vorsichtig ritten sie heran und zügelten dann ihre Rösser. Es war den Bauersleuten gelungen, zwei der brennenden Häuser zu löschen, der Rest der Ortschaft lag in Asche. Nun machte sich das schmutzige Grüppchen daran, seine Toten auf den Platz an der Linde zu schaffen, um sie zu beweinen und dann der Erde zu übergeben.
»Nun geht es also wieder los«, sagte Wolfram leise und ließ seinen Blick über erschlagene Körper und rauchende Trümmer schweifen.
Sein Lehensherr seufzte. »Ja, da hat der Zoller ganze Arbeit geleistet. Das wird Albert nicht schmecken. Nein, das wird ihm ganz sauer aufstoßen.«
Hatten die beiden Männer in den letzten Stunden noch fröhlich gescherzt, so war der Wehrsteiner, als sie weiter ins Eyachtal hinabritten, schweigsam und in seine Gedanken versunken. Nun, nachdem die lang schwelende Fehde wieder in einen offenen Kampf ausgeartet war, würde es für ihn schwierig werden.
Bis vor wenigen Jahren waren die Verhältnisse klar gewesen. Die Herrschaft Wehrstein war teilweise zu Eigen, Teile aber zu Lehen vom Pfalzgraf von Tübingen. Die Wehrsteiner waren immer wieder im Gefolge der Zollerngrafen gewesen, hatten bisher jedoch noch keinen Zank mit ihren Nachbarn von Hohenberg. Nun waren aber im letzten Jahr, durch die Heirat der Pfalzgrafentochter Luitgard mit Burkhard von Hohenberg, die Wehrsteiner Lande als Mitgift an Hohenberg gekommen. Sich in einer offenen Schlacht und als Gefolgsmann des Zollerngrafen gegen seinen neuen Lehensherrn zu stellen, war sicherlich nicht klug.
Ritter Hildebolt dankte Gott und der heiligen Jungfrau, dass er an diesem Tag noch auf Reisen gewesen war. Doch würde der Zoller in Zukunft so einfach auf die Gefolgschaft der Wehrsteiner verzichten? Konnte er sich aus diesem Gezänk um alte Erbansprüche und neue Gebietsaufteilungen heraushalten? Sorgenfalten zeichneten sich auf seiner Stirn ab. Zwischen den großen Mühlsteinen zweier sich streitender Grafenhäuser konnte ein kleines Rittergut rasch zermahlen werden.
»Schaut nicht so grimmig drein, Herr«, unterbrach der Begleiter das finstere Grübeln. »Es wird schon alles gut gehen. Die Weiber sind robuster, als man denkt.«
Hildebolt sah den Gefolgsmann verständnislos an, doch dann nickte er, und die Falten auf der Stirn glätteten sich ein wenig. Er verzichtete darauf, dem anderen Ritter zu sagen, dass die Sorgen nicht seinem hochschwangeren Weib gegolten hatten. Stattdessen gab er seinem Pferd die Sporen und jagte in halsbrecherischer Geschwindigkeit den schmalen Pfad entlang, so dass Wolfram Mühe hatte, ihm zu folgen.
»Ich hoffe, sie kommt ihrer Pflicht endlich nach und schenkt mir meinen Erben«, rief der Wehrsteiner Wolfram zu, als die beiden zusammen die Eyach überquerten.
»Vielleicht könnt Ihr ihn schon heute Abend in Euren Armen halten«, antwortete der Lehensmann und trieb sein Pferd die steile Böschung hinauf.
»Dann beeilen wir uns. Heute Nacht die Füße am Kamin zu wärmen, lockt mich weit mehr als eine weitere Nacht unter Gottes eisigem Himmel, und wir haben noch ein ganzes Stück vor uns.«
Der Wehrsteiner duckte sich dicht über den Hals des Pferdes, um dem kalten Wind bei diesem steifen Ritt kein so leichtes Ziel zu bieten. Nun flogen seine Gedanken wie ein Falke zur heimischen Burg voraus und zu seinem Weib, das er dort vor fast drei Wochen zurückgelassen hatte.
Die Feste Wehrstein thronte stolz wie der Adlerhorst über dem Neckartal und dem Weiler Fischingen. Sie hatte schon viele Könige kommen und gehen sehen, bot schon seit vielen hundert Jahren sicheren Schutz für ihre Bewohner und die Reisenden, die sich ihr für eine Atempause auf ihrer Wanderung anvertrauten. Umgeben von runden Türmen an jeder Ecke und einer hohen, zinnenbewehrten Stützmauer, erhob sich von der höchsten Stelle auf felsigem Grund der Bergfried. Trutzig ragte er über dem kahlen Steilhang auf, der sich gleich hinter den letzten Fischinger Häusern erhob. Burg Wehrstein war eine großartige Anlage. Wie viele Menschen hatten dereinst wohl im nahen Steinbruch die grauen Brocken gebrochen, sie auf krummem Rücken hierher getragen und auf schwankendem Gerüst zu festen Mauern gefügt? Hatten dies mächtige Bauwerk für ein ganzes Jahrtausend errichtet? Mächtig und wehrhaft, ja, den Edlen von Wehrstein in alten Zeiten angemessen, doch heute zu groß für ein Geschlecht, dem nur noch Güter in der Größe derer des Ritters Hildebolt zur Verfügung standen. So reichte der Frondienst der Bauern gerade mal, die Außenmauern und den Turm immer wieder auszubessern. Dabei hätte der Palas schon lange ein neues Dach nötig gehabt. Im oberen Stock war nur noch der kleine Raum auf der Südseite trocken, der nun der Edelfrau und ihrer Tochter Anna als Kemenate diente. Der Hausherr schlief seit dem Winter bei seinen Mannen im großen Saal, in dem sich auch die Wächter, Mägde und Knechte zusammendrängten, denn einige der altersschwachen Nebengebäude waren beim letzten Erdbeben in sich zusammengefallen und bisher nicht wieder aufgebaut worden. Die Steine dienten nun dazu, wenigstens die Küche auszubessern und eine kleine Vorratskammer anzubauen.
An diesem Allerheiligenmorgen wurden die Bewohner und Gäste auf Wehrstein noch vor dem Morgengrauen durch schauderhafte Schreie geweckt. Lang gezogen und quälend drangen sie durch die mit Fellen verhängten Fensterschlitze, krochen durch Mauerritzen und Gebälk und verscheuchten auch den Trunkenen die Schläfrigkeit.
»Nanu, wird heute in solch finsterer Früh schon ein Schwein geschlachtet?«, gähnte der Franziskanermönch, der auf seiner Pilgerreise nach Santiago heute Nacht hier Schutz gesucht hatte. Er erhob sich ächzend und zupfte sich ein paar Binsenhalme aus der zerschlissenen Kutte.
»Aber nein«, klärte ihn ein mageres Bürschlein von kaum acht Jahren auf, das neben ihm unter der Bank geschlafen hatte. »Das ist die Herrin, die da so schrecklich brüllt, dass Gott sich selbst die Ohren zuhalten muss.« Ein neuer, anhaltender Schrei drang die hölzernen Stiegen herab.
»Sie kriegt den Erben des Herrn – vielleicht, wenn es nicht wieder ein Mädchen wird«, erklärte der Knabe und fügte dann – für den Mönch – noch altklug hinzu: »Wenn die Kinder kriegen, dann schreien die Weiber halt so.«
Von draußen schallte es nun ähnlich weh und schmerzlich. Verwundert drehte der Mönch sein ergrautes Haupt.
»Mir scheint trotz allem, es wird heute Abend einen festlichen Schweinebraten geben.«
»Aber nein«, sagte der Junge noch einmal und schüttelte in komischer Verzweiflung den Kopf. »Das ist die Hailwig, meine Schwester. Die ist nämlich schon mindestens fünfzehn und kriegt jetzt auch ein Kind.« Plötzlich färbten sich seine Wangen rot. »Sie hat keinen Mann, Pater, aber weil doch das Kind vom Herrn ist, dann ist das doch sicher keine so große Sünde, oder?« Er sah den alten Mönch mit weit aufgerissenen, fragenden Kinderaugen an.
»Der Herr Jesu Christ wird ihr die Sünden vergeben«, murmelte der Gottesmann und strich über das mausbraune, verfilzte Haar des Kindes, bevor er sich langsam bückte und begann, seine wenigen Habseligkeiten in seinem Bündel zu verstauen. Eine Magd drückte ihm noch ein wenig Brot und Käse in die Hand. Dann machte er sich, schwer auf seinen Stab gestützt, weiter nach Westen auf. Die Schreie der Gebärenden begleiteten ihn zum Tor hinaus.
In ein dickes Wolltuch gehüllt, die vom Reißen geplagten Glieder nur notdürftig an den glimmenden Kohlen gewärmt, saß die weise Frau aus Fischingen auf einem Schemel in der zugigen Kemenate der edlen Dame. Vom Fußende her betrachtete die Alte die Schwangere schweigend und kaute ungerührt auf einer gelblichen Wurzel herum, während das junge Fräulein von Neueck, das die Hand der Schwangeren hielt, jedes Mal zusammenzuckte, wenn ein neuer Krampf den Leib erfasste und die Herrin gequält aufstöhnte.
»Nun tu doch endlich etwas!«, hob sie ihre helle Stimme. »Merkst du nicht, wie sie leidet?«
»Dass sie leidet, ist nicht meine Schuld. Da müsst Ihr Gott und dem Herrn Ritter zürnen.« Sie spuckte gelb schäumenden Speichel in die frischen Binsen. »Und außerdem tue ich was, wenn es so weit ist – und wenn diese Schlampen von Mägden endlich mit dem heißen Wasser kommen!«
Das Fräulein von Neueck haderte noch mit sich, ob sie der unverschämten Alten darauf eine Antwort geben sollte, als die Tür aufgestoßen wurde und die beiden Mägde, mit geschürzten Röcken und rot glühenden Wangen, den Wasserkessel hereinschleppten.
»Na dann wollen wir mal«, murmelte die Hebamme, strich sich ihre schmutzigen Hände mit ranzigem Fett ein, trat ans Bett, schob die Röcke der Schwangeren hoch und fuhr ihr zwischen die Beine, bis die Edelfrau einen spitzen Schmerzensschrei ausstieß.
»Was steht ihr rum und glotzt«, keifte die Alte die Mägde an. »Haltet sie fest!«
Drunten, nur wenige Schritte über den gefrorenen Hof rüber, in dem niederen Küchengebäude, das etwas schief an der Ringmauer lehnte, kauerte die Unfreie Hailwig auf einem Strohsack nahe am Herd. Sie hatte es hier wärmer als die Herrin in ihrer Kemenate, und das Fehlen der Hebamme bezeichnete die Köchin als echten Segen. Den jüngeren Bruder, der neugierig nachsehen gekommen war, hatte Hailwig mit rüden Worten hinausgeworfen, so dass nun nur noch die Köchin und das Küchenmädchen bei ihr waren. Das Küchenmädchen rührte wild in der Milchsuppe, die sie gleich in den Saal bringen musste, und warf der Gebärenden ab und zu nervöse Blicke zu. Adelheid jedoch, die selbst schon eine ganze Schar lebender und toter Kinder zur Welt gebracht hatte, war nicht aus ihrem Gleichmut zu bringen. Sie wischte den Schweiß von der Stirn, stützte bei den Wehen Hailwigs Rücken, drückte, massierte, schob und zog, gab klare Befehle und hielt nach wenigen Stunden ein kerngesundes, lauthals schreiendes Mädchen in Händen, krebsrot und wild um sich schlagend, als sie das Würmchen in warmem Wasser wusch.
Der Kampf in der Kemenate oben zog sich hin. Die Schreie der Edelfrau begleiteten die Mägde und Knechte bei ihrem Tagewerk und verklangen erst, als die Sonne sich bereits dem Horizont näherte.
Müde, schweißbedeckt und abgekämpft ritten die beiden Männer im Glanz der Sterne durch das Burgtor. Die Wächter grüßten ihren Herrn ehrerbietig und hielten ihm das zitternde Ross, während er sich schwerfällig aus dem Sattel schwang. Steifbeinig schwankten die Männer zum Palas hinüber, traten in den vom Kaminfeuer nur schwach erleuchteten Saal und ließen sich dann auf eine Bank vor den wärmenden Flammen sinken. Waffenrock, Schwert und Kettenhemd fielen achtlos zu Boden, von wo sie einer der Knechte aufhob, um sie zu reinigen. Erleichtert seufzte der Edelfreie, als ihm eine Magd die Schuhe auszog und er die schmerzenden kalten Füße den Flammen entgegenstrecken konnte. Eine Weile nippten die beiden Männer schweigend an ihren Bechern mit heißem Gewürzwein.
»Euer Eigen hat sich um zwei schreiende Rotznasen erweitert, Herr«, rief einer der Edelknechte dem Wehrsteiner nach einer Weile zu und hob seinen Becher.
»Keine Verluste zu beklagen!«, ergänzte ein anderer.
Hildebolt von Wehrstein nickte seinen Leuten zu. »Dann müssen wir wohl ein Fass für euch alle aufmachen.«
Die fröhliche Zustimmung war bis hoch in die Kemenate zu hören, wo die Wöchnerin, halb ängstlich, halb hoffnungsvoll mit dem Kind in den Armen ihren Gatten erwartete. Sie lauschte seinem schweren Schritt und hörte die ängstlich erwartete Frage, noch bevor sie den Ritter zu Gesicht bekam.
»Ist es ein Sohn?«
Sie richtete sich ein wenig auf und sah in das bärtige, abgekämpfte Antlitz ihres Gemahls.
»Nein, eine Tochter – aber ein gesundes kräftiges Kind«, fügte sie noch hinzu, doch er hatte sich bereits auf dem Absatz umgedreht und die Kemenate wieder verlassen.
Weinend drückte sie das schlafende Kind an sich. »Zwei Töchter und sonst nur totes Fleisch, ach, Herr im Himmel, muss er mir da nicht zürnen?« Und dennoch nagte auch heißer Zorn in ihrer Brust.
»Ist es denn meine Schuld, Heilige Jungfrau? Ist es meine Sünde allein, die uns straft? Ist nicht der Same des Mannes des Kindes Keim? Die Mutter nur das wärmende Nest?«
Der Wehrsteiner ging mit langen Schritten über den Hof, stieß die Tür zur Küche auf und trat in die Wärme. Respektvoll wichen die Frauen zurück, die sich um den Strohsack der jungen Mutter versammelt hatten.
»Und du, hast wenigstens du mir einen Sohn zustande gebracht?« Trotzig sah ihm Hailwig in die Augen. Die Lippen zu einem dünnen Strich zusammengepresst, schüttelte sie den Kopf.
Dem Ritter entfuhr ein Fluch, so dass sich die Frauen hastig bekreuzigten. »Du wirst meiner Tochter Amme«, stieß er noch hervor, ehe er in die Nacht stürmte. Die Tür fiel krachend ins Schloss.
Im Turm holte er sich Wein, stürzte ihn so hastig hinunter, dass ihm ein rotes Rinnsal über den Bart floss und in das Hemd tropfte. Ein zweiter Krug folgte dem ersten. Ziellos taumelte der Hausherr über den Hof, lief schwankend an der Mauer entlang, stieg zum Turm hoch bis auf die Plattform, erbrach sich und sank dann auf den kalten Boden. Den Rücken an den rauen Stein gepresst, sah er in den klaren Sternenhimmel und haderte mit seinem Schicksal und mit Gott.
»Warum, warum«, brüllte er in die Nacht. »Herr im Himmel, bin ich kein richtiger Mann, dass ich keinen Knaben zeugen kann? War ich nicht ein frommer Christ und Ritter? Was für Sünden habe ich auf mich geladen? Sag es mir, du dort oben auf deinem Wolkenthron!«, schrie er. Die Wächter sahen betreten zur Seite.
»Das Kind kommt ins Kloster«, sagte er bestimmt, als er am nächsten Morgen die Kemenate wieder betrat. »Ich habe nicht die Güter, zweimal eine Mitgift zu bezahlen. Vielleicht wirst du mir ja doch noch meinen Erben schenken, für den dann noch ein Rittergut da sein muss.«
Sein Eheweib nickte unter Tränen. »Ich werde beten und alles versuchen.«
Rau und ein wenig unbeholfen strich er ihr über das Haar. »Vielleicht erhört der Herr unsere Gebete, wenn wir ihm dieses Kind schenken.«
Während der Hohenberger in die zollerischen Lande einfiel und Balingen verwüstete, wuchsen die beiden Mädchen abseits der Fehde heran. Sie tranken Milch von derselben Mutterbrust, spielten zusammen auf dem Burghof, streiften gemeinsam über Wiesen und Felder und liefen beide weinend zu Hailwig, wenn sie sich das Knie aufgeschlagen oder die Hände im Dornengestrüpp zerkratzt hatten. Sie liebten sich, sie waren Schwestern, sie hatten den gleichen Vater, der sie beide ignorierte, und dennoch war Tilia von Wehrstein Ritterstochter und edelfrei, Gret ein Leben lang leibeigene Magd.
Ein wenig wehmütig beobachtete Sibylla von Wehrstein ihre Jüngste mit dem Gesinde im Hof herumtollen, wenn sie mit der älteren Tochter Anna auf einer Bank vor dem Palas saß, Stoffe säumte und Borten bestickte. Doch sie ließ das Kind gewähren, bis es seinen fünften Sommer gesehen hatte.
KAPITEL 2
Wir haben einen neuen König!«, rief der Bote, als er über die hölzerne Zugbrücke donnerte. Neugierig schwatzend strömten die Wehrsteiner in den Saal und scharten sich um den Mann, der die Nachricht in alle Lande trug.
»Fast zwanzig Jahre herrschten Kriegswirren und Fehdengewühl, heißer Zorn und wilde Gier. Die Dörfer sind verwüstet, Felder liegen brach, die Bauern und die Herren hungern«, begann er seine ausschweifende Rede, nahm dankbar den Becher entgegen, den die Hausherrin ihm reichte, stieg auf die Bank, um mit seiner Stimme auch alle zu erreichen, und fuhr dann mit seiner Geschichte fort.
»Die Herren suchen die Juden auf. Keiner hat Geld in seinen Truhen. Immer lauter erschallten die Stimmen durch das Reich. Ein König muss her, das Land zu befrieden!«
Er machte eine Pause, ohne das ungeduldige Scharren und Räuspern seiner Zuhörer zu beachten. Wie einer der reisenden Geschichtenerzähler beugte er sich vor, ließ den Blick über die Ritter, Edelknechte und das Gesinde schweifen und senkte dann seine Stimme.
»Doch wer sollte es sein? Der mächtige König Ottokar der Zweite von Böhmen? Der war den Herren Kurfürsten nicht so recht geheuer. König Philipp der Zweite aus Frankreich? Ein Franzose schon gar nicht!« Wieder hielt er inne und trank genüsslich seinen Becher leer.
»In Frankfurt oben saßen unsere mächtigen Fürsten des Reiches zusammen, die Erzbischöfe aus Mainz, Köln und Trier, der Pfalzgraf bei Rhein, der Herzog von Sachsen und der Markgraf von Brandenburg. Anstelle des mächtigen Ottokar von Böhmen haben sie den Bayernherzog noch dazugeladen.«
Erneut machte er eine Pause, ließ sich den Becher wieder füllen, trank ausgiebig, rülpste und fuhr dann fort:
»Ein König muss her, stark muss er sein, doch auch nicht zu stark, denn keiner will die mühsam erkämpften Ländereien und das eilig zusammengeraffte Krongut wieder herausgeben.«
»Wer ist denn nun unser neuer König?«, unterbrach ihn eine helle Kinderstimme ungehalten. Tilia stampfte mit dem Fuß auf die Erde. Der Bote lachte, bückte sich hinab und strich ihr über das Blondhaar.
»Es steht einer Jungfrau nicht an, so ungeduldig zu sein und einen Mann zu unterbrechen, kleines Ritterfräulein, doch ich werde es dir verraten: Ihre Wahl fiel auf den Landgrafen Rudolf von Habsburg. Er ist kein Schwächling und scheint dennoch genug Respekt vor den mächtigen Herzögen und Bischöfen zu haben.«
»Rudolf von Habsburg? Den kenne ich nicht«, sagte das Mädchen enttäuscht und wandte sich wieder ihrer Puppe zu.
»So reiste der Burggraf von Nürnberg nach Basel, wo unser König, nichts von der ihm angetragenen Ehre wissend, sich mit dem treuebrüchigen Bischof schlug. Der Bischof von Basel ist zwar eigensinnig, aber nicht dumm. Zähneknirschend hat er dem Habsburger Frieden angeboten. Und so zieht König Rudolf der Erste von Habsburg nun durch das Schwabenland und dann nach Aachen, um die Krone entgegenzunehmen.«
»Wo ist er denn jetzt, der neue König?«, mischte sich Tilia noch einmal ein.
»Nun, im Moment ist er sicher in Haigerloch bei seinem Schwager Albert von Hohenberg. Vielleicht werden dort gerade Ochsen und Hühner, Schweine und Gänse für ein herrliches Festmahl geschlachtet.« Der Bote schnalzte mit der Zunge.
Die Hausherrin verstand den Wink, lud den Gast ein, zu bleiben, und versprach, bis zum Dunkelwerden ein feines Mahl auf den Tisch zu bringen.
Am anderen Tag, als der Bote bereits weitergeritten war, rief Sibylla von Wehrstein ihre Zweitgeborene zu sich in die Kemenate und gebot ihr, sich auf die große Kleidertruhe zu setzen. Bedächtig fädelte die Edelfrau einen grünen Seidenfaden ein, während Tilia ungeduldig auf dem polierten Holz hin und her rutschte. Gret wartete draußen. Sie wollten nach Brombeeren suchen und sehen, ob das Eichhorn wieder auf dem Nussbaum saß. Doch die Mutter ließ sich Zeit, betrachtete ihre Tochter im braunen, knielangen Kittel, mit dem schmutzigen Gesicht und den zerzausten blonden Zöpfen. Dann endlich senkte sich ihr Blick wieder auf die Stickerei, und sie begann zu sprechen.
»Ich habe dich lange gewähren lassen, mein Kind. Du hast die Freiheit genossen, doch nun bist du alt genug, die Dinge zu lernen, die eine Frau können muss. Dein Vater hat dich fürs Kloster bestimmt. Für erbauliche Psalmen und heilige Gesänge ist der Pater zuständig. Von mir jedoch wirst du lernen, deine Hände zu gebrauchen. Die Nonnen werden dankbar sein, wenn du einen Schleier wohl zu säumen oder ein Altartuch zu besticken weißt.« Sie sah ihre Tochter scharf an, ob diese auch den Ausführungen lauschte. Das Kind faltete rasch die Hände, die bisher eifrig den geschnitzten Verzierungen an den Rändern der Truhe nachgefahren waren, und sah die Mutter aus großen, blauen Augen an.
»Dein Platz ist nun hier bei mir – und manche Stunde auch bei Pater Seifried. Du wirst nicht mehr durch die Wälder streichen oder dich bei den Wachen herumtreiben.«
»Aber was ist mit Gret? Ich muss doch zu ihr und muss in die Küche und aufs Feld zu Hailwig«, wagte das Mädchen einzuwenden.
»Sie werden nicht mehr da sein.« Die Mutter ließ das Stickzeug sinken. »Dein Vater hat sie und ein paar andere Mägde und Knechte an die Mönche von Kirchberg verkauft. Sie werden für das Kloster auf einem Gut in Isenburg arbeiten.«
Der Kindermund öffnete sich zu einem tonlosen O. Hinter der gekrausten Stirn schien es zu arbeiten, dann krampften sich die kleinen Hände um die Schnitzereien, als sie verstand. »Sie werden für immer weggehen?« Tränen schossen ihr in die Augen. »Aber das geht nicht, weil – weil …« Sie schluchzte auf.
Sibylla seufzte, legte ihr Stickzeug sorgfältig zusammen, erhob sich und schritt hinüber zur Truhe. Sie zog das Kind auf ihren Schoß, wiegte es und ließ es einige Zeit weinen.
»Tilia, mein Kind, Hailwig ist nur eine Magd, und auch Gret wird später eine sein. Du sollst nicht um sie weinen. Du kannst – du darfst dein Herz nicht an sie verschwenden.«
Das Mädchen hob den Kopf und sah die Mutter streng an. »Ich muss die Gret aber liebhaben. Sie ist meine Schwester!«
»Ist sie nicht. Anna ist deine Schwester.«
Tilia schob schmollend die Lippen vor. »Hailwig hat das aber gesagt.«
Der Mutter entschlüpfte ein ärgerlicher Laut, doch die Tochter unterbrach sie sogleich.
»Kann nicht wenigstens die Gret bleiben? Sie ist doch noch so klein und kann für die Mönche noch nicht richtig arbeiten, und ich bin dann immer ganz brav und lerne die Psalmen und sticke und …«
Vor Eifer zitternd, presste sie ihren Vorschlag heraus und sah mit starrem Blick zur Mutter hoch, als könne sie so eine Zustimmung erzwingen.
Die Edelfrau seufzte, dachte nach und begann geistesabwesend das Kinderhaar zu entwirren. Als es streng geordnet in zwei Zöpfen auf den Rücken fiel, entließ sie die Tochter und ging hinunter in den Saal, um mit dem Edelmann zu sprechen.
Drei Tage später zog eine kleine Schar Männer, Frauen und Kinder in aller Früh zum Tor hinaus, um sich in Begleitung zweier Mönche nach Isenburg aufzumachen. Auch Hailwig, hochschwanger, war mit ihrem neuen Ehegatten dabei. Mit Tränen in den Augen folgte sie dem Tross, drehte sich jedoch immer wieder um, um noch einen Blick auf ihre Tochter und ihr Ammenkind zu werfen, die sie beide auf Burg Wehrstein zurücklassen musste.
So blieben die Freundinnen und Halbschwestern ungetrennt, doch Gret begriff schnell, welch großen Unterschied es bedeutete, Edelfräulein oder Magd zu sein. Nicht nur, dass sie Tilia nun mit »Ihr« und »Euch« ansprechen musste – zumindest, wenn andere Ohren es hören konnten –, die gemeinsame Zeit schmolz mit jedem Jahr ein Stück mehr dahin. Die freie Kindheit war vorüber. Gret war nicht dumm. Ihre wachen Augen beobachteten die Welt, ihr Mund formte Fragen, die keiner hören wollte und die ihr niemand zufriedenstellend beantworten konnte.
Warum bekam Tilia einen fellgefütterten Mantel, während sie selbst in ihrem alten löchrigen Umhang frieren musste? Warum tranken Mägde und Knechte Molke und Wasser und die Ritter roten Wein? Warum froren die Wächter im Turm, während sich die Ritter am Kamin im Saal wärmten? Warum konnte der Herr Menschen einfach verkaufen, verschenken, eintauschen? Warum, warum, warum …
Doch sie sah auch, welch Unterschied es war, Frau oder Mann zu sein. Auch Edelfrauen hatten zu gehorchen, wenn der Herr etwas befahl. Sie mussten vom Morgengrauen bis in die Nacht schuften, während die Ritter und Edelknechte, die auf der Burg dienten, an manchen Tagen sich nur müßig ins sonnenbeschienene Gras flegelten, ihre Waffen putzten, aßen und tranken, Geschichten erzählten und den vorbeieilenden Mägden in den Po zwickten.
Die Herrin war streng zu ihren Mägden und ihren Töchtern, aber auch zu sich selbst. Jeden Morgen musste der Saal gereinigt werden, Knochen, Essensreste und die schmutzigen Binsen hinausgeschafft und über die Mauer geworfen werden, der Kamin von Asche gereinigt, die abgebrannten Kienspäne ersetzt, der lange Tisch geputzt und poliert werden, bis das Holz makellos glänzte. Oft legte die Edelfrau selbst mit Hand an. Erst wenn die Herrin zufrieden war, durften die sauberen Binsen ausgestreut werden. Am Tag unterschied sich die Herrin auf den ersten Blick kaum von ihren Mägden. Auch sie trug einfache Röcke aus ungebleichter Wolle, vielleicht ein wenig sauberer, feiner genäht, der Saum eine Hand breit länger. Nur ihr Gebende, streng geschnürt, dass sie kaum den Mund öffnen konnte, war immer blütenweiß und aus feinster Seide.
Verschwendung gab es nicht auf Wehrstein. Jedes Kleidungsstück wurde sorgfältig immer wieder geflickt, dann noch von den Mägden getragen, bis der Stoff fast auseinanderfiel. Auch das Essen auf der Burg war nur selten üppig. Der Völlerei durfte nur an hohen Festtagen gefrönt werden, und dann hatten auch die Unfreien ihren Teil daran – vielleicht nicht gerade am Wildbret, aber doch an Schweinefüßen, Kutteln, Speck und anderen Köstlichkeiten.
»Wohin reitet Ihr, Ritter Wolfram?«, fragte Tilia neugierig und trat an das braune Streitross heran, das gesattelt im Hof stand. Sie bot dem Tier ein Stück ihrer Rübe an und strich ihm über den schwarzen Fleck an der Stirn.
»Ich reite nach Fischingen runter und dann zur Mühle. Zwei Sack Mehl ist der Müller uns noch schuldig.«
»Oh, nehmt mich mit«, rief das Kind. »Ich werde ganz still sitzen und auch beim Müller brav und sittsam sein.«
Wolfram von Husen zog den Sattelgurt nach. »Kleine Tilia, das geht nicht. Eure Mutter würde mir den Kopf abschlagen.«
Das Mädchen verlegte sich aufs Betteln. »Oh bitte, Ihr seid doch ein tapferer Mann, und sie braucht es ja nicht zu erfahren. Außerdem muss eine Edelfrau lernen, eine Burg zu führen. Wie oft sind der Vater und all die Ritter weit weg?« Flehend sah sie zu dem Lehensmann ihres Vaters hoch.
Wenige Augenblicke später ritt Wolfram von Husen, Tilia vor sich im Sattel, zum Tor hinaus, über die Zugbrücke und dann den engen Pfad nach Fischingen hinunter. Das Mädchen strahlte den Ritter aus blauen Augen an. Voll Freude, ein Stück der weiten, unbekannten Welt zu sehen, stimmte sie ein Lied an, das sie bei den Mägden schon oft gehört hatte. Der junge Ritter lächelte zärtlich. Zwar hatte er daheim ein Weib und einen Knaben, aber die sah er nur selten. Das aufgeweckte Mädchen seines Lehensherrn jedoch, das ihn so oft wissbegierig mit Fragen löcherte, war ihm lieb wie eine Tochter.
Die Hände in die Hüften gestützt, die Lippen zu einem schmalen Strich zusammengepresst, stand Sibylla von Wehrstein vor dem Palas, als der Ritter und das Kind zurückkehrten.
»Mutter, es war so aufregend!«, rief Tilia und ließ sich vom Pferd gleiten. »Ich durfte die Mühle sehen. Das riesenhafte Rad, das vom Strom des Wassers bewegt wird und dann die Steine rührt, um ohne Menschenkraft feines Mehl zu mahlen.«
Der Ritter bemerkte die Gewitterwolken hinter der weißen Stirn sehr wohl. Entschuldigend verbeugte er sich.
»Ich habe gut auf sie Acht gegeben, Herrin. Zürnt uns nicht. Es war ein erfolgreicher Ritt. Die Mehlsäcke werden noch heute auf der Burg sein.«
»Dazu bedurftet Ihr wohl kaum der Hilfe des Kindes«, sagte Sibylla gepresst.
»Nein, sicher nicht.« Er senkte den Kopf. »Es ist nur – sie hat so gebettelt, mitkommen zu dürfen. Tilia ist nicht wie Anna oder wie die anderen Kinder. Sie ist eher wie ein kleines wildes Tier.«
»Ja, und wenn Ihr sie mit hinausnehmt, dann wird sie noch wilder. Wollt Ihr an dem Leid schuldig sein, wenn sie den Duft von Freiheit gekostet hat und ihr Vater sie dann hinter Klostermauern sperrt? Sie wird jetzt lernen, dass das Leben harte Arbeit und Verzicht bedeutet.«
Der Ritter verbeugte sich steif. »Es wird nicht wieder vorkommen, Dame Sibylla.« Er drehte sich um und führte sein Pferd in den Stall.
»Du kommst mit mir!«, herrschte die Mutter das Mädchen an, das dem Ritter folgen wollte. »Du wirst heute noch ein Schleiertuch säumen. Sauber und mit kleinen Stichen, sonst trenne ich die Arbeit wieder auf. Dabei kannst du mir die Psalmen aufsagen, die du gelernt hast.«
Tilia verdrehte die Augen, wagte jedoch nicht zu widersprechen. Während die Nadel noch etwas unbeholfen durch den Stoff glitt und ihre Zunge die lateinischen Worte plapperte, wanderten ihre Gedanken noch einmal hinaus vor die Burg und ins Tal zum rauschenden Neckar hinab.
Die Feste Wehrstein lag abseits der viel berittenen Routen und abseits von großer Politik und Zank, und doch musste Hildebolt von Wehrstein immer wieder mit seinen Mannen hinausziehen, um fremde Streitereien auszufechten. Das Land war zu klein, die Abgaben zu hoch, um nur von den Früchten des Bodens zu leben. Manchmal blieben die Frauen, Kinder und das Gesinde monatelang nur mit einem Ritter oder Edelknecht als Schutz auf der Burg zurück. Müde, schmutzig und manchmal auch verletzt kamen die Männer dann irgendwann nach Hause. Auf manche warteten die Daheimgebliebenen jedoch vergeblich.
»Der Wolkhart ist in Ehre gefallen, sonst sind alle wohlauf«, war das Einzige, was Sibylla ihrem Gatten entlocken konnte, als die Männer im späten Herbst von einem langen Zug zurückkamen. Sie begnügte sich mit dieser Antwort und fragte nicht weiter, reichte ihm stattdessen ein mageres Hühnchen und mit Wasser verdünnten Wein. Es interessierte sie nicht, was außerhalb der Burg geschah. Hauptsache, auf Wehrstein ging das Leben weiter. Doch Tilia schaute oft vom Bergfried ins weite Land hinaus und fragte sich, wie es hinter dem Wald und den Hügeln wohl aussah. Sie hatte ihren Ritt nach Fischingen nicht vergessen und träumte oft von rauschenden Bächen und weiten Wiesen. Es drängte sie, mehr zu erfahren. So stellte sie sich vor den Vater hin, verschränkte die Hände hinter dem Rücken und fragte:
»Wo wart Ihr die ganze lange Zeit? Erzählt mir davon.«
Hildebolt sah mit ernster Miene auf seine Tochter hinab. »Wir waren bis in Wien, um des Königs Stadt aus der Hand des Feindes zu befreien, denn der verschmähte Ottokar aus Böhmen will sich nicht damit abfinden, dass ein anderer die Krone trägt.«
Tilia kratzte sich an der Nase. »Der Ottokar wollte König werden, aber der Rudolf ist es geworden, und nun ist der Ottokar böse und will dem König seine Stadt wegnehmen?«
Der Wehrsteiner lachte. »Ja, so ist es, doch dein Vater und Wolfram von Husen und all die anderen Ritter haben Wien befreit. Und nun lass mich in Frieden essen.«
Das Mädchen lief zu Wolfram hinüber.
»Wo ist Wien? Ist das schön dort? Nehmt Ihr mich das nächste Mal mit?«
Wolfram von Husen zog das Mädchen am Zopf. »Solch vorwitzige blonde Jungfrauen können wir nicht gebrauchen, wenn die Schwerter blitzen und die Pfeile schwirren. Es würde dir eh nicht gefallen, kleine Tilia.«
Tilia schob schmollend die Lippen vor. »Doch, das würde es. Erzählt mir mehr davon.« Der Ritter zog das Mädchen auf seinen Schoß, schlang die Arme schützend um die zarte Gestalt und begann zu erzählen. Von tapferen Rittern und schnaubenden Rössern, von einer langen Reise durch ein unbekanntes, wildes Land.
»Bleibt Ihr jetzt lange hier und schnitzt mir eine neue Puppe?«
Der Ritter riss einem gebratenen Huhn den Flügel ab und drückte ihn dem Mädchen in die Hand. Den Rest behielt er für sich und grub seine Zähne tief in das weiße Fleisch.
»So lange, dass es für eine neue Puppe reicht, bleiben wir ganz bestimmt«, sagte er mit vollem Mund. »Doch wer weiß, was der Frühling bringen wird. Vielleicht werden wir hier in Schwaben Arbeit für unsere Schwerter bekommen.«
»Warum?«, fragte Tilia und leckte sich das Fett von den Lippen.
»Das ist nicht einfach zu erklären. Bisher haben viele der Fürsten an der Seite des Königs gekämpft. Doch nun hat der König auf dem Reichstag in Augsburg eine Urkunde aufgesetzt.« Das Mädchen legte den abgenagten Flügel auf den Tisch und gähnte. »Er fordert alle Krongüter zurück. All die Verträge und Schenkungen, heimlichen Absprachen und Räubereien, seit Friedrich der Zweite König und Kaiser war, sind nichtig.« Tilia schloss die Augen.
»Es gibt keinen unter den Fürsten, der nicht zornig wäre. Haben sie ihm deshalb zu seiner Krone verholfen? Welch Undank von einem Mann aus solch unbedeutendem Haus. Doch es gibt auch einige, die sich auf die Seite des Königs stellen, weil sie sich Vorteile davon versprechen.«
Die gleichmäßigen Atemzüge zeigten, dass das Kind in seinen Armen eingeschlafen war, doch der Ritter redete mit leiser Stimme weiter.
»Nun hat der König, da er mit dessen Schwester Anna verheiratet ist, den Hohenberger damit beauftragt, die Reichslehen wieder einzutreiben. Er ist jetzt Vogt für Niederschwaben. Der heißblütige junge Graf Eberhard von Württemberg schäumt vor Wut. Er wird es nicht zulassen, dass man ihm auch nur ein Gehöft wegnimmt. Weißt du, was das bedeutet, kleine Tilia?«
Das Kind grunzte im Schlaf.
»Es wird Krieg in Schwaben geben. Einen Krieg, wie wir ihn hier noch nicht erlebt haben.«
Vorsichtig erhob er sich und trug das schlafende Mädchen zur Treppe, wo Fräulein von Neueck schon wartete. Behutsam legte er sie ihr in die Arme, doch das Fräulein ließ das Mädchen zu Boden sinken, schüttelte es, bis es erwachte, und führte es dann die Treppe hinauf.
»Komm mit, ich muss dir etwas zeigen«, sagte Gret und nahm Tilia bei der Hand.
Die Ritterstochter zögerte. Sie sah an sich herunter und betrachtete den langen Rock aus feinem Barchent, den die Mutter ihr genäht hatte. Wie praktisch doch die knielangen Kittel gewesen waren! Tilia seufzte leise.
»Wohin willst du? Wird man dabei sehr schmutzig?«
Gret zuckte die Schultern. »Es ist eine Überraschung. Willst du sie dir nicht ansehen?«
Tilias Wangen glühten. »Doch, natürlich.« Sie raffte den Rock und ließ sich von Gret über den Hof in die Scheune ziehen, die windschief an der Burgmauer lehnte.
»Komm mit hinter den Heuhaufen«, forderte Gret ihre Schwester auf und sank auf die Knie.
Sie erklomm das duftende Heu und ließ sich dann auf der anderen Seite des Haufens wieder hinuntergleiten. Auf allen vieren kroch sie an der Wand entlang, bis zu einem losen Brett.
»Hier müssen wir durch«, raunte sie. Tilia folgte ihr dicht auf den Fersen.
»Da sieh, ich habe sie gefunden!«, strahlte Gret und zeigte auf die drei winzigen Fellbündel, die hinter der Scheune in einer geschützten Mauernische auf einem alten Lumpen lagen.
»Oh! Hier hat die Alte sie also versteckt«, staunte Tilia und drückte ein getigertes Kätzchen, das die Augen noch geschlossen hatte, an ihre Brust. »Ich dachte schon, die Hunde hätten sie geholt.«
»Nein, die Katze ist schlau«, sagte Gret und kitzelte ein schwarzweiß Geflecktes an der Nase. »Hier kommen die Hunde bestimmt nicht her.«.
»Fräulein Tilia, seid Ihr hier drin?«, erklang die Stimme des Paters. Die Mädchen sahen sich an, grinsten und legten die Hände auf ihre Lippen.
»Bist du sicher, dass sie hier hineingelaufen sind?«, fragte der Pater. Seine Stimme klang ärgerlich.
»Aber ja«, hörten die Mädchen die Stimme eines Knechtes. »Tilia, komm sofort her!«, befahl die Mutter.
Das Mädchen ließ die Schultern hängen, das Lächeln auf ihren Lippen erlosch. Vorsichtig schob sie das Brett zur Seite und kroch über den Heuberg zurück.
Den ganzen Weg zurück schimpften die Mutter und der Pater von beiden Seiten auf das Mädchen ein. Betreten senkte sie ihren Blick auf den nun mit braunen Flecken übersäten Rock und schwieg. Bis zum Abend saß sie mit ihrem Lehrer zusammen, wiederholte die lateinischen Worte, die für sie keinen Sinn ergaben, und ertrug die Stockschläge auf die Finger, wenn sie sich verhaspelte. Dann sang sie Kyrie eleison und Ave Maria, und der Wind trug ihre Stimme bis zu Gret, die, drei junge Katzen im Schoß, auf der Schwelle der Scheune in der Abendsonne saß.
Der Streit im Reich schwelte weiter. Immer wieder bat ein Bote, wichtige Briefe und Urkunden im Gepäck, um warme Suppe und ein Nachtlager. Dann lauschte die Schar der Ritter und Edelknechte gespannt, was draußen im Land so vor sich ging. Auch so mancher wandernde Mönch wusste Neues. Am Abend, wenn alle sich im Saal versammelt hatten, die Mägde Schüsseln mit dampfender Suppe und graues Brot verteilten, und die Becher mit rotem Neckarwein gefüllt waren, dann war es Zeit, Geschichten zu erzählen. Etwas abseits der großen Tafel saß die Edelfrau mit ihren beiden Töchtern und dem Fräulein von Neueck. Doch sobald das Essen vorüber war, schlich sich Tilia näher zu den Rittern und Edelknechten. Wenn die Mutter sich in die Kemenate zurückgezogen hatte, dann krochen Tilia und Gret unter den Tisch. Eng umschlungen in die Binsen gekuschelt, die Ohren gespitzt, lauschten die Mädchen atemlos, was in der Welt dort draußen Spannendes passierte. So erfuhren sie, dass des Königs Sohn Hartmann im Rhein ertrunken war, dass der Bischof von Straßburg die Feste Durlach plünderte und dann in Asche legte, dass der Graf Ludwig von Dettingen das Kloster Ellwangen in Brand steckte und den Abt Ekkehard festhielt und dass die Bürger der freien Reichsstadt Esslingen des Württembergers Burg Kaltenthal am Nesenbach belagerten. Zu viel hätten die stolzen Bürgersleute schon unter dem ungestümen Fürsten leiden müssen. Die Mädchen sogen all die Neuigkeiten in sich auf. Tagelang spukten diese Geschichten dann in ihren Köpfen, und sie wunderten sich, warum alle Welt ständig im Streit miteinander lag.
Auch der Edelfreie Hildebolt von Wehrstein beobachtete die Entwicklung der Dinge genau. Es war ihm egal, ob er den Zins für sein Lehen an den Hohenberger oder den König zahlen musste, dennoch war er besorgt. Tief in seinem Innern spürte er, dass der Tag der Entscheidung näher rückte.
KAPITEL 3
Bald war die Zeit vorüber, da sich die Mädchen unter dem Tisch verstecken konnten, um den Geschichten der Ritter zu lauschen.
Sie wuchsen zu hübschen Jungfrauen heran, beide groß und schlank, mit kleinen Brüsten, reiner Haut, blondem Haar und blauen Augen, die von Gret vielleicht ein wenig dunkler und ausdrucksvoller. Auch war ihre Gestalt bereits mit vierzehn Jahren mehr die eines Weibes, während Tilia schlanker – biegsamer – an eine Weide am Fluss erinnerte. Ihre Hände waren weiß und schmal, die von Gret dagegen rot und rissig.
Im Frühling nach Tilias vierzehntem Geburtstag starb Pater Seifrieds jüngster Bruder. Daher machte sich der Geistliche für ein paar Wochen in seine Heimat nach Rottenburg auf, um der Witwe zur Seite zu stehen. Seinen strengen Augen für eine Weile entkommen, atmete die Ritterstochter erleichtert auf. Kaum war er unter dem Tor verschwunden, raffte sie den Rock und lief zu Gret, die vor der Küche auf dem Boden saß und eine Gans rupfte. Tilia ließ sich in den Staub sinken und schloss die Augen. Die wärmende Sonne im Gesicht, saß sie da und genoss die Ruhe.
»Da kommt Anna«, unterbrach Gret die Stille, als diese, eine Näharbeit unter dem Arm, aus dem Palas trat.
»O nein«, seufzte Tilia, doch Anna war anscheinend nicht auf der Suche nach der pflichtvergessenen jüngeren Schwester. Sie blinzelte in die grelle Sonne, sah sich um und schritt dann langsam auf einen Mauervorsprung zu. Die Steine schienen leidlich sauber, so dass sie sich vorsichtig niederließ. Sorgfältig breitete sie ihren zartgrünen Rock um sich aus und widmete sich dann ihrer Stickerei. Wolfram von Husen näherte sich vom Tor her kommend. Fröhlich winkte ihm Tilia zu. Er grüßte zurück, lenkte seinen Schritt jedoch zu Anna hinüber. Er verbeugte sich und sprach sie an, sie errötete, schlug die Augen nieder und antwortete so leise, dass er sich vorbeugen musste, um sie zu verstehen.
»Warum kommt er nicht zu uns?« Unruhig rutschte Tilia hin und her. Sie wollte aufspringen, doch Gret hielt sie zurück.
»Der Ritter wird schon kommen, wenn er sich mit dir unterhalten will.«
Wolfram von Husen setzte sich zu Anna auf den Mauervorsprung und erzählte ihr etwas, das ihr immer wieder ein kurzes Lachen entlockte. Ab und zu sah sie ihn an, nur um schnell die Augen wieder niederzuschlagen. Als ihr Knäuel aus silbernem Garn vom Schoß rollte, sprang er sofort auf, um es ihr zu reichen. Nur kurz berührten sich ihre Fingerspitzen, doch die Wangen der Ritterstochter glühten.
»Er weiß ja noch gar nicht, dass der Pater weg ist«, fiel Tilia ein. Sie sprang auf und klopfte ungestüm den Staub aus ihrem Rock. »Ich muss ihm doch sagen, dass ich nun nicht den ganzen Tag in der Kemenate sitzen muss.« Mit großen Schritten überquerte sie den Hof. Gret sah ihr kopfschüttelnd nach.
»Ritter Wolfram, wie schön, dass Ihr zurück seid«, sprudelte sie hervor und strahlte ihn an. »Wie war Euer Ritt? Wie steht es mit den Ländereien? Ihr wart bei Eurer Familie? Welch Glück für uns, dass sie Euch nicht lange festhalten konnte. Habt Ihr schon gehört, der Bruder von Pater Seifried ist gestorben, und er ist nun nach Rottenburg gezogen.«
Wolfram kniff Tilia in die Wange. »Das scheint Euch nicht sonderlich zu betrüben.«
Tilia schüttelte den Kopf. »Ein paar Wochen ohne Psalmen werde ich genießen. Ich kann Gottes Schöpfung sicher auch hier in der Sonne loben.«
Der Ritter grinste und nickte. »Oh ja, auch wenn sich dann Eure Wangen röten und sich Euer Naschen mit Sommersprossen überzieht.«
Tilia rümpfte die Nase. »Das ist doch egal. So braun wie Gret werde ich sicher nicht.«
Anna beugte sich noch tiefer über ihre Arbeit. Die Lippen fest zusammengepresst, sagte sie kein Wort mehr, während Tilia mit dem Ritter lachte und scherzte. Sibylla setzte dem ein Ende, als sie beide Töchter zu sich rief.
»Wie konntest du so mit ihm sprechen!«, ereiferte sich Anna später, als die Schwestern in der Kemenate arbeiteten.
»Warum? Was habe ich denn getan?«, fragte Tilia verständnislos. »Solche Bemerkungen über seine Familie zu machen, wo seine Gattin doch im Kindbett gestorben ist.«
»Was?« Tilia ließ ihre Arbeit sinken. »Hat er dir das eben erzählt? Woher sollte ich davon wissen?«
Anna arbeitete eifrig weiter. »Nein, das habe ich schon vor zwei Monaten von ihm erfahren. Es war wohl kurz nach Aschermittwoch, als das Kind viel zu früh auf die Welt kommen wollte. Sie war mit ihrer Magd allein, der Schnee lag hoch, und so kam das Kind nicht richtig heraus. Beide starben.«
»Aber warum hat er mir das nicht gesagt?«, stotterte Tilia fassungslos.
»Vielleicht, weil du ihn nur über Ländereien und Ritter ausfragst«, bemerkte Anna spitz.
»Dass er dir das erzählt hat«, wunderte sich die Jüngere und schüttelte den Kopf. Sie schwieg eine Weile und dachte nach, dann stieß sie hervor:
»Hat er sich schon ein neues Weib gewählt?«
Anna senkte den Kopf tief über die Nadel und schüttelte den Kopf. »Nein, der Knabe ist vorläufig bei seinem Bruder untergebracht.«
Von da an schwieg sie eisern. Kein weiteres Wort mehr war ihr über den Ritter zu entreißen.
Es war schon lange dunkel. Der Mond hing silbern in den frischgrünen Buchen, als Hildebolt von Wehrstein in einer lauen Sommernacht vor Jakobi aus Haigerloch zurückkehrte. Der große Saal lag verwaist da, das Feuer im Kamin glühte nur noch leicht. Einige der Männer waren für den Abt von Kirchberg unterwegs, Wolfram von Husen mit seines Bruders Sohn Heinrich noch in Haigerloch. Die Mägde und Knechte, die zur Feldarbeit gebraucht wurden, schliefen in diesen Nächten meist im Gehöft der Wehrsteiner, das, nur ein kurzes Stück den ausgefahrenen Karrenweg hoch, auf der Ebene über dem Neckartal lag.
So trat der Herr in den leeren Saal, ließ den Mantel auf den Boden gleiten, warf sich in seinen lederbezogenen, hochlehnigen Sessel und legte die schlammbespritzten Harnischschuhe auf einen Hocker. Er sehnte sich nach einem kräftigen Schluck, war jedoch zu müde, noch einmal aufzustehen.
Das Knarren der hölzernen Stufen zum oberen Stock ließ ihn aufhorchen. Nur undeutlich nahm er eine schlanke Gestalt wahr, die leise die Treppe hinunterschlich, einen Umhang eng um die Schultern gezogen. Die Binsen raschelten unter ihren Füßen, als sie sich zur Tür hinübertastete.
»Tilia?«
Die Gestalt erstarrte. »Nein, Herr, ich bin es, Gret.«
»Was hast du mitten in der Nacht oben zu suchen?«, brummte der Hausherr, war jedoch offensichtlich nicht wirklich an einer Antwort interessiert, denn er fuhr gleich fort. »Komm her. Du kannst mir aus der Rüstung helfen und mir Wein bringen.«
Zögernd trat Gret näher. Sie entzündete zwei Kienspäne an der Glut im Kamin und steckte sie in die eisernen Halter an der Wand. Im Schein der Flammen schürte sie das Feuer, rückte einen Krug an die Glut heran und holte einen Tonbecher aus der großen Truhe im Eck. Der Edelfreie löste die Nesteln seiner langen Panzerstrümpfe und streckte dann Gret seine lehmverkrusteten Beinkleider entgegen. Sie versuchte, die engen Kettenstrümpfe herunter zu ziehen, doch die winzigen, sauber verarbeiteten Eisenringe rutschten ihr immer wieder aus der Hand. Als der Panzerstrumpf dann doch plötzlich vom Bein glitt, verlor Gret das Gleichgewicht und fiel nach hinten. Der Umhang rutschte von ihren Schultern. Fröstelnd zog sie ihn wieder um sich.
Trotz der warmen Sommernacht war es in dem alten Gemäuer empfindlich kühl. Es roch nach kaltem Rauch und ranzigem Fett. Die lieblichen Düfte der Nacht vermochten nicht die abgestandene Luft durch die winzigen Fensterschlitze hinauszudrängen.
Gret hob den achtlos weggeworfenen Mantel vom Boden auf und zupfte ein paar Halme ab. Sorgsam faltete sie ihn zusammen und legte ihn auf die Truhe. Dann brachte sie dem Ritter den gewärmten Wein. Er rutschte ein wenig in seinem Sessel vor, zog sich den Waffenrock über den Kopf, warf ihn in die Binsen und ließ sich dann, während er trank, die Lederbänder seines Ringpanzers von dem Mädchen lösen. Klirrend glitt das kunstvoll geschmiedete Geflecht aus Eisenringen zu Boden. Der Ritter seufzte erleichtert auf, das drückende Gewicht des kalten Metalls endlich von seinen Schultern nehmen zu können. In seinem knielangen leinenen Hemd saß er nun vor dem Feuer und trank Wein. Unschlüssig trat Gret von einem Fuß auf den anderen. Sie musste sich dringend draußen erleichtern, doch sie wagte nicht, sich unaufgefordert zu entfernen. Die nackten Zehen krallten sich um die pieksenden Halme. Fragend sah sie den Wehrsteiner an, dessen blonder Haarschopf entspannt an dem verschlissenen Leder ruhte, überragt von den Geweihen erlegter Hirsche, deren Schatten im unruhigen Fackellicht einen grotesken Tanz an Wand und Decke aufführten.
»Komm, hol dir einen Becher und trinke Wein mit mir«, forderte er das Mädchen auf.
In ihrer Magengrube kribbelte es warnend, doch was hätte sie tun sollen? Widerstrebend nahm sie sich einen Becher, füllte ihn bis zum Rand und stürzte ihn in einem Zug hinunter.
»He, he, nicht so hastig«, lachte der Ritter und streckte ihr seinen leeren Becher entgegen. »Sonst bleibt für mich ja nichts mehr übrig.«
Während er trank, betrachtete er das junge Gesicht. Warm flackernd ließ das Licht sie von einem zum anderen Augenblick vom Kind zur Frau werden. Zum ersten Mal in ihrem Leben sah er sie richtig an.
»Komm näher, Kind, stell dich hier ins Licht«, sagte er zwischen zwei Schlucken. Sein Blick glitt über das lange, blonde Haar, das, sonst unter groben Tüchern versteckt, in leichten Wellen bis zur Hüfte hing. Die dunkelblauen Augen wirkten fast schwarz und waren so weit aufgerissen, dass er sich selbst in ihnen zu sehen glaubte.
Mit der Linken griff er nach dem Umhang und zog ihn langsam von ihren Schultern. Er sah, wie sich die knospenden Brüste rasch unter dem locker geschnürten Hemd hoben und senkten. Achtlos fiel sein Becher zu Boden, und der Rest des Weines floss zwischen die Binsen.
»Mein Gott, sie ist ein richtig prächtiges Weib«, flüsterte er heiser und zog das sich sträubende Mädchen zu sich heran. Staunend und genießerisch wanderten seine großen Hände über die schmale Taille, zeichneten die Linien der sich rundenden Hüften nach, legten sich sanft auf die jungen Brüste. Gret atmete rasch. Ihr Blick irrte ziellos den tanzenden Schatten nach. Nur nicht auf den sich wölbenden Stoff in des Ritters Schoß sehen. Als Magd hatte ihre Seele schon lange die jungfräuliche Unschuld verloren. Wer des Winters im überfüllten Saal oder in dem neuen Anbau hinter der Küche schlief, mit Männern, Weibern und Kindern, der wusste bald um die Geheimnisse des Lebens und um die Eigenheiten und Vorlieben der Männer, denen sich die Weiber fügen mussten. Dass sie mit ihren vierzehn Jahren noch einen unberührten Körper hatte, lag nur daran, dass sie der Bastard des Ritters war. Den ein oder anderen Vasallen oder Knecht hatte das wohl abgehalten, die köstliche Frucht zu pflücken.
Ganz langsam hob der Wehrsteiner den Saum ihres Leinenhemdes. Enthüllte Stück für Stück die weißen, schlanken Beine.
»Tut das nicht!« Die Stimme der Herrin erklang in ungewohnter Schärfe von der Treppe her. »Versündigt Euch nicht an Gott, Ritter, sie ist Euer Fleisch und Blut.«
Hildebolt von Wehrstein ließ das Hemd los. Seiner Miene war nicht zu entnehmen, was er dachte, als seine Gemahlin den Saal durchschritt und vor den Kamin trat.
»Wie ich sehe, habt auch Ihr entdeckt, dass sie zu einem Weib geworden ist«, bemerkte die Herrin kühl, bückte sich trotz ihres hochschwangeren Leibes und reichte der Magd ihren Umhang, den diese sogleich um sich schlang.
»Sie ist gesund und nutzt bereits bei jedem Mond die Leinenstreifen«, fuhr die Edelfrau mit fester Stimme fort. »Ihr solltet sie verheiraten.«
Der Ritter nickte. »Ja, das sollte ich. Der Schmied ist ein kräftiger Kerl. Wir könnten auf viele gesunde Kinder hoffen.«
Sibylla von Wehrstein legte ihm zustimmend ihre Hand auf die Schulter. »Noch vor dem nächsten Vollmond. Du kannst jetzt gehen, Gret.«
Ohne ein Wort zu sagen, raffte Gret Hemd und Umhang und lief in den nächtlichen Hof hinaus. Sie spürte nicht die Steine unter ihren Füßen, nicht das taunasse Gras. Eilig rannte sie zur nördlichen Mauer, wo in einer Grube die Küchenabfälle gesammelt wurden. Gret hob ihr Hemd und hockte sich auf den schmalen Balken am Grubenrand, um sich zu erleichtern. Nachdenklich verharrte sie eine Weile so. Eine fette Ratte näherte sich neugierig, drehte jedoch einen Schritt weit vor ihr ab und tippelte zu den Abfallbergen zurück. Während sie der Ratte nachsah, grübelte Gret, ob sie der Herrin dankbar oder böse sein sollte. Obwohl das Mädchen in dieser Nacht nicht schlief, sondern bis zum Morgengrauen unruhig über den Hof und an der Mauer entlangschritt, konnte sie, als die Hähne krähten und die Sonne sich über die Wipfel erhob, auf diese Frage immer noch keine Antwort geben.
Der nächste Vollmond rückte unerbittlich näher. Der Knecht Rüdger, der hin und wieder auch als Schmied arbeitete, wenn auf Wehrstein Arbeit anfiel, hatte beinahe schon doppelt so viele Sommer erlebt wie seine jugendliche Braut. Er war sehr erfreut, von seinem Herrn eine Gattin zu bekommen. Zwar hatte er in den letzten Jahren nicht gerade selten seine Hände um ein weibliches Gesäß gelegt, doch solch ein zartes Geschöpf sein Eigen zu nennen, ließ ihm geradezu das Wasser im Munde zusammenlaufen. Dass der Wehrsteiner, sein Herr, wie es der Brauch war, die erste Nacht für sich beanspruchen konnte, störte ihn nicht. Eine Jungfrau mit der unbändigen Kraft männlicher Lenden zu beglücken war schon seit jeher das Privileg der Herren. Für die Knechte blieb zwischen den weichen, weißen Schenkeln immer noch Lust genug.
Leise summend wendete er das rot glühende Eisen mit einer Zange in der Glut. Schweiß stand ihm auf der Stirn, schweißnass war auch der vor Schmutz starrende, kurze Kittel. Als sich seine Lippen zu einem Grinsen teilten, entblößte sein rotes, fleischiges Gesicht abgebrochene Schneidezähne, deren Reste sich langsam schwarz färbten. Rüdger strich sich mit seinen schwieligen Händen durch das kurze, mausbraune Haar, dann schwang er den Hammer und ließ ihn auf das rötlich schimmernde Hufeisen niedersausen. Prall wölbten sich die Muskeln und pulsierenden Adern unter der sonnenverbrannten Haut. In immer gleichem Rhythmus klangen die Schläge über den Hof, bis hinüber zum Palas, auf dessen Stufen Tilia und Gret in der Sonne saßen.
Gret hatte eine große Schüssel mit Bohnen neben sich gestellt und eine kleinere Holzschale auf ihrem Schoß. Mit flinken Händen schnitt sie die Enden der Schoten ab, ließ diese ins Unkraut zu ihren Füßen fallen und teilte den Rest mit einem scharfen Messer in kleine Stücke. Tilia saß einige Stufen höher, mit dem Rücken an die glatt behauenen Steine des Türbogens gelehnt, und nähte emsig. Sie wollte es sich nicht nehmen lassen, der Schwester einen Hochzeitsrock aus feinem, hellgrauem Barchent zu nähen. Am liebsten hätte sie den herrlich grün gefärbten Stoff aus Mutters Truhe genommen, doch das hatte sie nicht gewagt. Auch so war sie ihrer verdienten Strafe nicht entkommen. Ohne mit der Wimper zu zucken, ertrug sie die Schläge, dann ergriff sie die bereits zugeschnittenen Stoffe, Nadel und Garn und trug sie in den Hof hinunter. Nun war der Rock fast fertig, schön an den Säumen mit Ranken aus rotem Garn bestickt. Von ihrem eigenen Rock löste Tilia vorsichtig ein grünes Band und nähte dieses nun um den Halsausschnitt.
»Willst du den Rüdger denn heiraten?«, fragte sie die Schwester, als der Wind das Hämmern herübertrug.
Gret hielt einen Moment in ihrer Arbeit inne und betrachtete anscheinend aufmerksam die Bohne in ihrer Hand.
»Ich weiß nicht. Er ist so, so …« Sie suchte nach Worten und schleuderte die Bohne in die Schüssel. »So breit und kräftig und alt, und er riecht so, und – ich glaube, er macht mir ein wenig Angst«, fügte sie noch leise hinzu.
Tilia nickte zustimmend. »Ja, ich glaube, ich wollte ihn auch nicht. Schon der Gedanke an diese starken Arme.« Sie schüttelte sich. »Da muss man ja fürchten, zerquetscht zu werden.«
Gret kicherte. Der Gedanke, ein Edelfräulein könnte einen unfreien Knecht heiraten, belustigte sie.
»Andererseits«, fuhr Tilia fort und zog die Nase kraus, »so viel besser sind die Ritter auch nicht. Der Benz, beispielsweise, ist ein grober Geselle und mit seiner gespaltenen Nase nicht gerade schön anzusehen. Und der Mägerin furzt immer, wo er steht und geht, und im Winter läuft ihm ohne Unterlass der Rotz aus der Nase.«
Die Magd lachte. »Dann nimm du doch den Wetzel. Ich gebe zu, er hat verfaulte Zähne und zieht das Bein nach, aber er kann einer Braut sicher eine gute Morgengabe bieten.«
Tilia warf einen Erdklumpen nach der Schwester. »Der ist schon uralt und hatte schon zwei Frauen.«