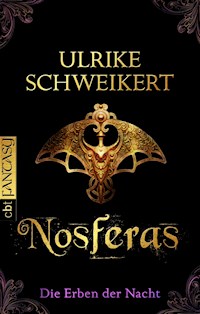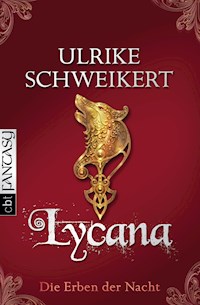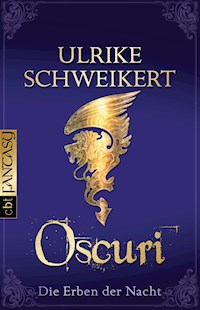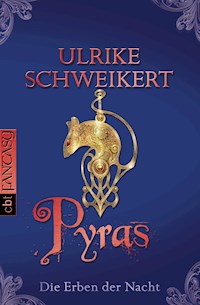5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Deutschland am Vorabend des 30-jährigen Krieges: Als die Zwillinge Sibylla und Helena im Alter von fünf Jahren den Tod des Vaters vorhersehen, werden die Schwestern, die nur Unglück zu bringen scheinen, getrennt. Während die tugendhafte Helena in einem Kloster aufwächst, wird ihre eigenwillige Schwester Sibylla zur Hebamme ausgebildet. Als Vertraute des Vogts lernt sie die dunklen Geheimnisse der Mächtigen kennen. Doch dieses Wissen ist gefährlich, und bald rüsten die Häscher der Inquisition zur Hexenjagd …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 645
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Kurzbeschreibung:
Deutschland am Vorabend des 30-jährigen Krieges: Als die Zwillinge Sibylla und Helena im Alter von fünf Jahren den Tod des Vaters vorhersehen, werden die Schwestern, die nur Unglück zu bringen scheinen, getrennt. Während die tugendhafte Helena in einem Kloster aufwächst, wird ihre eigenwillige Schwester Sibylla zur Hebamme ausgebildet. Als Vertraute des Vogts lernt sie die dunklen Geheimnisse der Mächtigen kennen. Doch dieses Wissen ist gefährlich, und bald rüsten die Häscher der Inquisition zur Hexenjagd …
Ulrike Schweikert
Die Hexe und die Heilige
Roman
Edel Elements
Edel Elements
Ein Verlag der Edel Germany GmbH
© 2017 Edel Germany GmbH Neumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 2017 by Ulrike Schweikert
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Montasser Medienagentur, München.
Covergestaltung: Anke Koopmann, Designomicon, München.
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-96215-013-6
www.facebook.com/EdelElements/
www.edelelements.de/
ERSTES BUCH
KAPITEL 1
Der Wind fuhr heulend um die Ecke, strich an der Hauswand entlang, griff nach dem hölzernen Laden und riss ihn von seinem eisernen Haken. Mit einem Krachen schlug er ihn gegen das mit Pergament bespannte Fenster. Die Magd knallte den Wassereimer auf den Boden, dass der heiße Inhalt über den Rand schwappte. Agatha fluchte leise, lief zum Fenster, stemmte es auf und fing den widerspenstigen Laden ein. Als sie ihn eingehängt hatte, drangen die Schreie vom oberen Stockwerk wieder zu ihr herab. Vor sich hin murrend griff die Magd nach dem Eimer.
»Wo bleibst du denn?«, fragte eine Kinderstimme vorwurfsvoll. »Hörst du nicht, wie Mutter ruft? Außerdem sollst du nicht fluchen, hat der Herr Pfarrer gesagt.«
Die Magd unterdrückte die Verwünschungen, die ihr auf der Zunge lagen, schließlich konnte die Kleine nichts dafür und die Herrin ja eigentlich auch nicht. Und dennoch empfand sie es als ungerecht, dass das Kind sich entschlossen hatte, ausgerechnet zu Martini auf die Welt zu kommen. Alle anderen Mägde und Knechte waren zu Hause bei ihren Eltern und Freunden, schmausten und tranken, sangen und lachten, nur sie selbst musste hier bei ihrer Herrin bleiben und der Wehmutter zur Hand gehen. Sicher, sie hätte ihre Stelle zu Martini wechseln können und sich eine andere suchen, doch eigentlich gefiel es ihr beim Sternenwirt ganz gut. Wie viele Mägde beneideten sie darum, dass sie das ganze Jahr über Arbeit hatte und sich nicht von Martini bis Lichtmess als Tagelöhnerin verdingen musste. Und doch grollte sie wegen des verpassten Festmahls und setzte ihre Füße härter auf die hölzernen Stufen, als es nötig gewesen wäre.
Das Gasthaus »Zum Goldenen Stern« zu Ellwangen lag am Ende der Herrengasse, in der einige der Chorherren und hohen Beamten des Propstes ihre prächtigen Häuser errichtet hatten. Nur der kleine Herrenfriedhof und die Peter-und-Paul-Kapelle trennten das Gasthaus von der im Westen hoch aufragenden Stiftskirche, die dem heiligen Veit geweiht war. Südlich der Kirche, im ehemaligen Laienfriedhof, stand die Magdalenen-Kapelle. Dieser Bereich des Friedhofs wurde schon eine ganze Anzahl von Jahren nicht mehr genutzt, denn die Bürger und Handwerker der Stadt wurden nun bei St. Wolfgang in dem Weiler Schuppach südlich der Stadt beigesetzt. Seitdem wucherten Hütten und Baracken vom Rand her immer weiter in den Friedhof hinein. Trödler und Devotionalienhändler stritten um die Münzen der Pilger, und auch der Bettelvogt hatte hier seine Hütte. Selbst einer der Almosenempfänger, hatte er dafür zu sorgen, dass die Armen die Vorschriften einhielten, sich registrieren ließen und nur zu den erlaubten Zeiten ihre Runden drehten. Wer sich nicht daran hielt, den sperrte der Bettelvogt in das kleine Gelass neben seiner Hütte. Oft war das Bettlergefängnis so voll, dass er erst einige wieder auf freien Fuß setzen musste, bevor er die nächsten wegschließen konnte.
Westlich des alten Friedhofs stand das Rathaus, ein prachtvoller Bau, dessen dunkle Hölzer einen schönen Kontrast zu den weiß gekalkten Fächern bildeten. Südlich der Stiftskirche, in respektvollem Abstand, spannten sich in einem weiten Bogen die ersten Häuser der Stadt. Vorbei am Rathaus und am Friedhof bis zur Herrengasse reihten sich fast ein Dutzend Wirts- und Gasthäuser aneinander, von der »Krone« und dem »Schwarzen Bären« im Westen bis zum »Goldenen Stern« ganz im Osten.
Normalerweise war der Sternenwirt Hans Schenckh stets in der Schankstube zu finden, um für das Wohl seiner Gäste zu sorgen und Neuigkeiten mit ihnen auszutauschen. Seine Gattin Helena hatte in der Küche das Sagen, doch heute musste der Knecht Melchior sich allein um die Gäste kümmern, die sich mit einem Humpen Bier oder heißem Gewürzwein ein wenig aufwärmen wollten, denn die Herrin lag im Kindbett, und der Herr schritt in der Stube des Hinterhauses nervös auf und ab.
»Agatha, ist die Mundistin gekommen?«, klang die Stimme des Hausherrn der Magd entgegen, als diese den Wassereimer stöhnend auf dem oberen Treppenabsatz abstellte.
Agatha wollte dies gerade verneinen, als unten an die Tür gepocht wurde. Kurz darauf führte Regina Schenckh die Hebamme die Treppe hinauf. Als sie ihren Vater entdeckte, lief das fünfjährige Mädchen zu ihm, lehnte ihren Blondschopf an den unter dem Wams hervorquellenden Bauch und umklammerte die große, fleischige Hand.
»Vater, kommt das Kind nun? Hört Mutter dann auf zu schreien?«
Der Ratsherr Hans Schenckh nahm seine Tochter beruhigend in die Arme.
»Eine Weile wird es schon noch dauern, doch dann – wenn Gott es will – hast du einen Bruder oder eine Schwester.«
»Lieber eine Schwester«, entschied Regina. »Ich habe ja schon zwei Brüder. Das reicht.« Ein Lächeln teilte den rotblonden Vollbart, der schon einige graue Fäden zeigte, und auch in den grünen Augen spiegelte sich ein Lachen.
»Wo sind eigentlich deine Brüder?«, fragte der Vater plötzlich, und der strenge Ton wischte das Lächeln fort. »Sie sollten doch dem Melchior zur Hand gehen!«
Regina zuckte die Schultern. »Caspar ist raus nach dem Pelzmärte sehen. Thomas wollte mit, doch Caspar hat ihm recht Angst eingejagt, dass der Märte den Kleinen bös den Rock verhaut. Da hat sich Thomas dann drüben in der Küche verkrochen und ärgert sich nun, dass er so feige ist.«
Der Vater zog die Augenbrauen zusammen und wollte gerade etwas erwidern, als in der ehelichen Kammer der entsetzte Ruf der Hebamme erklang. Hans Schenckh setzte seine Tochter unsanft auf eine Truhe und eilte in die eheliche Schlafkammer hinüber.
»Ihr werdet es nicht glauben, Herr Richter«, sprudelte die Magd los, doch der Hausherr brachte sie mit einer Handbewegung zum Schweigen.
»Was ist los?«, fragte er beunruhigt und sah von seinem Eheweib zur Hebamme hinüber, die langsam den Kopf schüttelte.
»Es sind Zwillinge! Das bedeutet Unglück.« Die Mundistin schüttelte wieder den Kopf. »Großes Unglück. Habt Ihr nicht darauf geachtet, keine zusammengewachsenen Früchte zu essen?«, fragte sie die Gebärende vorwurfsvoll. Die beiden Nachbarinnen, die der Hebamme zur Hand gehen sollten, sahen betreten zu Boden.
Hans Schenckh ließ den Blick über das hutzelige Weiblein vor sich wandern und presste die Lippen fest aufeinander. Vielleicht war es ein Fehler gewesen, die Mundistin zu holen. Ging nicht das Gerücht um, auch sie wäre auf dem Galgenberg gewesen, als die Hexe Margaretha Sinai mit ihrem Sohn Jacob auf einer Gabel des Nachts ausgefahren war? Das sollte der Nachrichter Hans Vollmair zumindest behauptet haben. Was, wenn das stimmte und die Kinder starben? Dann konnte sie die armen, ungetauften Wesen dem Teufel weihen. Auch flüsterte man, sie sei eine Abtrünnige und würde es mit den Lutherischen halten. Der Ratsherr schalt sich einen Narren.
Doch andererseits war sie unbestritten die geschickteste Wehmutter in Ellwangen und der ganzen Umgebung. Vielleicht war sie ja gar keine Hexe. Vielleicht schaffte sie es, sein Weib und die Kinder zu retten. Wenigstens hatte er es nicht versäumt, mit Dreikönigskreide einen Drudenfuß ans Bett zu malen. Das sollte gegen Hexen doch genügen. Außerdem lag im Kinderkörbchen unter der Matratze ein scharfes Messer, das jeder Hexe das Reiten schon austreiben würde.
Helena Schenckh stöhnte unter einer Wehe und warf ihrem Gatten einen flehenden Blick zu. »Hans, es tut mir Leid«, wimmerte sie.
Der Ratsherr strich ihr flüchtig über die schweißnasse Hand, die einen Blutstein fest umklammert hielt.
»Bete, das ist das Einzige, was du jetzt kannst. Ich werde es auch tun.«
Er warf einen Blick auf die brennende Taufkerze am Bett. Dann verließ er die Kammer und schloss die Tür hinter sich.
Die Sonne war schon lange untergegangen und die kalte Novembernacht hereingebrochen. Obwohl ein stürmischer Wind durch die Gassen jagte und immer wieder eisige Schauer vor sich hertrieb, herrschte noch lärmendes Treiben in der Stadt. Von der Spitalgasse her ertönte Schellenklang und Gelächter. Das Gesicht halb unter einem tief hängenden Hut versteckt, der Rest mit Asche geschwärzt, in einem zerlumpten Pelzumhang und mit einem Schellenriemen gegürtet, stapfte der Märte durch die Gassen. In den Beuteln unter seinem weiten Mantel trug er Nüsse, doch am Gürtel hing ein kräftiger Stock. Eine ganze Horde Buben tanzte um ihn herum. Sie sangen Spottlieder und lachten schadenfroh, wenn der Märte einen von ihnen mit seinem Prügel traf. Nur den kleineren Kindern, die sich höflich verbeugten, drückte der Pelzige ein paar Nüsse in die Hand. Doch der Märte war nicht der einzige Vermummte, der sich in dieser Nacht in Ellwangen herumtrieb. Zu zweit oder in kleinen Gruppen zogen die Burschen von einem Gasthaus zum anderen, tranken sich warme Bäuche und überschäumenden Mut an und liefen dann durch die Gassen. Wehe den unvorsichtigen Mädchen oder Frauen, die sich in dieser Nacht auf die Gasse wagten! Sie wurden frech gekniffen oder mit einem biegsamen Stöckchen geklatscht. So mancher der Burschen hoffte, von einer Schönen einen Kuss rauben zu können. Da die Mädchenröcke jedoch äußerst rar waren, spielten sich die Burschen untereinander so manchen Streich und versuchten, sich gegenseitig zu erschrecken.
Dem Fürstpropst Wolfgang von Hausen und seinen Chorherren war das ausgelassene Treiben an Martini schon lange ein Dorn im Auge, und es mangelte auch nicht an Verboten gegen die Vermummung und all die Schamlosigkeit, doch da selbst die Söhne der Richter und der Jüngste des Stadtvogtes ihr Unwesen trieben, drückten Schultheiß und Büttel beide Augen zu. Waren sie nicht selbst früher mit Feuereifer dabei gewesen? Damals, als man in den Wirtshäusern noch ausgelassen feiern konnte. Als man noch trinken und lachen durfte und zum Klang der Pfeifen und Schalmeien die halbe Nacht durchtanzte. Doch seit der große Hunger und dann der schwarze Tod durch die Stadt gezogen waren, hatte der Fürstpropst alle Vergnügungen verboten. Gottes Zorn galt es zu besänftigen.
Der Schultheiß verließ die Lange Gasse. Sehnsüchtig wanderte sein Blick zu den erleuchteten Stubenfenstern hoch, hinter denen sein Weib und seine Töchter bei einer Handarbeit zusammensaßen, doch es war noch zu früh, um nach Hause zu gehen. Seufzend zog Franz Preinlin seinen Umhang fester um die Schultern und duckte sich unter einen Dachvorsprung, als der nächste Regenschauer herabprasselte. In dieser Nacht schien sich Gottes Zorn mit all seiner Macht über den Häuptern der Ellwanger Bürger zu entladen. Oder waren wieder die Hexen am Werk?
Franz Preinlin sah, dass in der Sulzgasse alles ruhig war, dennoch folgte er der Gasse, bis die Stadtmauer vor ihm aufragte. Durch das Heulen des Windes hörte er die Glocken der Stadtkirche schlagen.
Noch eine Stunde, dachte der Schultheiß, dann würde er das junge Volk nach Hause treiben. Die Letzten, die er erwischen würde, hätten dann ein paar Stockhiebe oder eine Nacht im Turm zu erwarten, doch bis dahin gedachte Franz Preinlin sich beim Stadtpfarrer mit einem Krug heißen Bieres aufzuwärmen. Mit großen Schritten durchquerte er einen brachliegenden Garten, der ihn zur Pfarrgasse führte.
Kaum war der Schultheiß verschwunden, löste sich ein Schatten zwischen zwei baufälligen Schuppen.
»Das war knapp«, sagte Caspar Schenckh leise zu sich selbst und war froh, dass der Regen das Licht in seiner ausgehöhlten Rübe gelöscht hatte. Vorsichtig tastete er sich um den Schuppen herum und starrte in die Dunkelheit. Dort über den Hof rüber zur Sulzgasse, bewegte sich da nicht etwas? Vielleicht war es Konrad oder der kleine Hannes. Caspar grinste. Dieses Mal würde er seinen Freunden einen Schreck einjagen. Zwischen angefaulten Kohlköpfen schlich er langsam weiter. Die dicken Lehmklumpen wogen schwer an seinen durchweichten Stiefeln. Seine Sinne waren hellwach, als er sich über den Hof tastete, dennoch hörte er sie nicht kommen. Eiskalt durchfuhr es ihn, als sich plötzlich eine schwere Hand auf seine Schulter legte, und nur mühsam unterdrückte er einen Schrei.
»Verdammt«, fluchte er, als sein Herzschlag seinen Rhythmus wieder gefunden hatte. »Ich dachte, einen von euch dort vorn zu sehen.«
Die schwarz vermummte Gestalt zog den Burschen in einen schmalen Durchgang zwischen Haus und Scheune.
»Ist ja gut, ihr habt gewonnen«, seufzte Caspar. »Du kannst mich jetzt loslassen.«
Der Angreifer war ungewöhnlich kräftig. »Bist du das, Konrad?«, fragte der Knabe misstrauisch.
Er hörte das Schlagen eines Feuersteines, dann flammte ein Licht auf. Ein schwarzer Handschuh riss ihm den Hut vom Kopf und wischte dann grob über sein mit Asche geschwärztes Gesicht.
»Er ist es, Herr«, sagte eine tiefe Stimme, die Caspar irgendwie bekannt vorkam, die aber ganz gewiss nicht seinem Freund Konrad gehörte. Der Knabe setzte sich seinen Hut wieder auf.
»Wer seid Ihr, und was wollt Ihr?«, fragte Caspar und versuchte, von seinem Häscher mehr zu erkennen. Hinter Maske und Umhang schien ein muskulöser Mann zu stecken.
»Die erste Antwort musst du nicht wissen, die zweite Antwort lautet: dein Leben.«
Der Junge lachte ein wenig unsicher. »Wenn Ihr den Straßenräuber mimen wollt, solltet Ihr nicht solch einen schönen Mantel tragen.« Er nestelte an seinem Gürtel. »Wie kann ich mich freikaufen? Ein Krug Bier, wo Ihr wollt – außer bei meinem Vater«, fügte er schnell hinzu.
Der Vermummte schüttelte den Kopf und zog etwas aus dem Gürtel. Eine Windböe zerriss die Wolkendecke. Silbern spiegelte sich das Mondlicht auf der Klinge eines langen Dolches.
Caspars Herz pochte wild. »Hört auf«, sagte er mit zitternder Stimme. »Ihr überspannt den Bogen!« Mit einem schnellen Griff riss er die Maske herab. Der Schrei des Entsetzens wurde von der Hand erstickt, die der zweite Mann ihm auf den Mund legte.
»Ihr seid es!«, ächzte der Knabe, Hoffnung in der Stimme, als sich die Hand lockerte. »Welch seltsamer Spaß!«
»Es ist kein Spaß, Caspar«, raunte der zweite Mann in sein Ohr. »Der Tod ist nicht spaßig. Bete, dass die Engel des Herrn bei dir sein werden.«
»Aber warum? Warum?«, stöhnte der Junge, und plötzlich liefen ihm Tränen über das rußverschmierte Gesicht.
»Es geht nicht um dich«, flüsterte der Mann, »entschuldige, doch wir müssen deinen Vater überzeugen, dass unsere Drohungen durchaus ernst zu nehmen sind.«
Noch einmal strich das Mondlicht über die Klinge, dann verschwand sie unter dem Umhang des Knaben. Er riss die Augen auf. Seine Schreie wurden von einem ledernen Handschuh erstickt.
Respektvoll trat der Maskenmann zurück und säuberte sein Messer im Gras, während der andere die Kleidung des Jungen durchsuchte. Er löste die auffällige goldene Kette von dem schlanken Hals und warf sie seinem Begleiter zu.
»Euer Lohn. Nehmt auch die Münzen des Knaben, doch lasst den Beutel liegen.«
Stumm nickte der Vermummte, steckte die Kette ein und ließ die wenigen Hellermünzen in seine Hand gleiten. Lautlos verschwanden die Männer in der Nacht.
»Es sind zwei Mädchen, und beide wohlauf«, berichtete die Hebamme, als der Hausherr Stunden später die Kammer wieder betrat. Die grauen Augen der Mutter strahlten, als sie das zweite, frisch gewaschene Kind an ihren Busen legte. Ein paar schweißnasse Haarsträhnen lugten unter ihrer Haube hervor, doch ihre Miene war entspannt, als sie ihren Gatten anlächelte. Er trat zu ihr und strich über die rote, schrumpelige Haut der Erstgeborenen.
»Wir werden sie Sibylla und Helena nennen«, sagte er weich. Die Verkrampfung seines Herzens löste sich. Er sah sein Weib an. Trotz der sieben Kinder, die sie ihm geboren hatte, von denen immerhin noch fünf lebten, wirkte sie so zierlich wie an dem Tag, an dem seine Eltern ihm die Braut zum ersten Mal gezeigt hatten. Ihre Haut war glatt und rosig und ihr Haar war noch immer von sattem Braun. Doch über die grauen Augen, die sonst so aufmerksam die Welt betrachteten, legte sich nun der trübe Schleier der Erschöpfung.
»Ich muss in der Wirtsstube nach dem Rechten sehen«, verabschiedete sich der Hausherr, drückte der Hebamme sechzehn Heller in die Hand und schloss die Tür hinter sich.
»Herr Jesu Christ, ich danke Dir«, murmelte er voll Inbrunst, als er leichtfüßig die Treppe hinuntereilte. Natürlich hätte er vor keinem Menschen zugegeben, wie groß die Angst um das Leben seines Eheweibes gewesen war. Zwei Töchter, nun gut, immerhin hatte er bereits zwei prächtige Söhne, warum sich dann nicht über zwei Mädchen freuen?
Er riss gerade die Haustür auf, um über den kleinen Hof hinüber zum »Goldenen Stern« zu eilen, als der Nachtwächter und der Schultheiß die Leiche seines ältesten Sohnes brachten.
In einer Nacht kurz vor Weihnachten, als die Gasthäuser schon geschlossen waren und nur noch der Nachtwächter in den Gassen unterwegs sein sollte, ließ der Sternenwirt zwei Männer durch die Hintertür herein. Er brachte sie nicht in die Wirtsstube hoch, denn nach dem Erlass des Propstes durfte sich zu dieser Zeit niemand mehr dort aufhalten. Die hohen Herren mussten daher mit einer winzigen Kammer an der Rückseite des Wagenverschlages vorlieb nehmen. Hans Schenckh ging nach oben, sah nach, ob auch wirklich keiner mehr auf den Beinen war, und brachte den Besuchern zwei Krüge süßen Weins. Dann setzte er sich zu ihnen.
»Seht Euch das an!« Der fürstpröbstliche Kanzler Johann Hildenbrand legte eine Pergamentrolle auf den Tisch und glättete das Schreiben. Eine unendlich scheinende Liste von Namen wurde von den beiden Kerzen auf dem Tisch erhellt.
Hans Schenckh schluckte trocken, als sein Blick an den Namen entlangwanderte. Der Ratsherr Martin Hasel schien eher an den Zahlen interessiert, die hinter den Namen standen.
»Ich werde dem ein Ende setzen«, durchbrach Kanzler Hildenbrand nach einer Weile die Stille. Anklagend deutete er auf das Pergament.
»Wenn das Gottes Wille ist, dann komme seine Strafe über mich!«
Die anderen Männer bekreuzigten sich, murmelten jedoch zustimmend. Sie rückten enger um die flackernden Kerzen zusammen und senkten ihre Stimmen zu einem Flüstern. Dann schob Johann Hildenbrand seinen Hocker energisch zurück.
»Herr Senator, Ihr wisst, was Ihr zu tun habt!«
Hans Schenckh senkte den Blick und nickte kaum merklich. Der Kanzler nahm das als Zustimmung, rollte das Pergament zusammen und steckte es unter seinen Wams. »Wir sollten aufbrechen«, trieb er den Bäckermeister Hasel zur Eile an. Die Männer hüllten sich in ihre Mäntel und zogen die breitkrempigen Biberhüte ins Gesicht. Martin Hasel legte seine Hand auf des Sternenwirts Arm.
»Schon was Neues, wegen Eures Sohnes?«
Hans Schenckh schüttelte den Kopf. »Der Vogt meint, einer der Bettler muss sich diese Nacht zu Nutze gemacht und ihn dann erstochen haben, als er sich wehrte und seine Kette und den Beutel nicht herausgeben wollte.«
Der Kanzler nickte. »So wird es wohl gewesen sein.«
Auch der Wirt nickte zustimmend, obwohl er es besser wusste.
Als die beiden hohen Herren, tief in ihre Mäntel gehüllt, die kleine Kammer unter der Wirtsstube verlassen hatten, zog Hans Schenckh ein Stück Papier ins Licht, notierte, was an diesem Abend besprochen worden war, faltete das Blatt zusammen und wartete. Es dauerte nicht lange, da klopfte es an der Seitentür, durch die die beiden Männer das Wirtshaus kurz vorher verlassen hatten. Ohne ein Wort zu sagen, öffnete Hans Schenckh die Tür einen Spaltbreit und reichte das Schreiben an die vermummte Gestalt, die es schweigend entgegennahm und dann in den Schatten der Nacht verschwand.
KAPITEL 2
Ruhe kehrte in die Fürstpropstei ein, und die Menschen atmeten auf. Es kam der Frühling und dann der Sommer. Das Wetter wurde freundlicher, und die nächste Ernte fiel reichhaltiger aus. Der Scharfrichter Hans Vollmair zog nach Biberach zurück. Es gab keine Unholde mehr, die es aus ihren Verstecken zu zerren galt, keine peinlichen Befragungen, keine flackernden Scheiterhaufen. Die lange Liste der Besagten samt der Auflistung ihrer Vermögenswerte schlummerte unter einem Stapel Akten und Briefe in einem Sekretär der Kanzlei. Das Originalpergament des Stadtschreibers schien vergessen, doch die heimlich erstellte Kopie dieser Liste wurde in einer Schlafkammer in der Herrengasse sorgfältig gehütet.
Die Jahre zogen durch das Land. In diesen hellen, sonnigen Tagen wuchsen die Zwillinge des Sternenwirts heran. Sibylla immer vorneweg. Pausbäckig, mit den wissbegierigen grauen Augen der Mutter und dem widerspenstigen, rötlich blonden Haar des Vaters, erforschte sie auf ihren speckigen Beinchen die Welt. Helena folgte ihr wie ein Schatten. Die beiden Mädchen glichen sich bis auf das Haar, und doch schien bei Sibylla alles ein wenig kräftiger, ein wenig farbiger und lebendiger zu sein.
Die anderen Kinder gewöhnten sich schnell daran, dass sie mit Sibylla verhandeln mussten, wenn es beispielsweise darum ging, Naschwerk aus der Wirtshausküche zu stibitzen, oder wenn sie die bunten Murmeln ausleihen wollten, die Vater Schenckh aus Wasseralfingen mitgebracht hatte. Helena sprach nur wenig und wenn, dann nur mit Sibylla. Die Erstgeborene entschied, die Zweitgeborene nickte zustimmend.
Wenn es darum ging, einen Streich auszuhecken, dann war Sibylla bei den Spielkameraden, den Kindern der Wirte und Bäcker am Kirchenplatz, gern gesehen. Sie war beispielsweise mutiger als Georgius vom Schwarzen Bären, und der war immerhin drei Jahre älter und auch forscher als des Hofbecken Sohn Vitus. Sibylla hatte sich sogar getraut, dem Bettelvogt das Glöckchen von seinem Stab zu stibitzen. Nur so zum Spaß. Später hatte sie es ihm, genauso unbemerkt, wieder zurückgebracht. Und dennoch, oder vielleicht gerade deswegen, mieden manche Kinder die Sternenwirtszwillinge.
»Etwas an ihnen ist unheimlich«, sagte Johannes, der Sohn des Mang- und Färbemeisters, immer wieder. Natürlich nie, wenn Sibylla es hätte hören können. Sie laut auf der Gasse zu beschimpfen wäre ihm nicht in den Sinn gekommen. Das traute er sich nur bei des Mangenbecks Töchtern. Schließlich waren die Kinder einer Unholdin. Auch wenn der Bäcker kurz darauf die Patin seiner jüngsten Tochter geheiratet hatte, ihre richtige Mutter, Apollonia Hasel, war oben auf dem Galgenberg als Hexe verbrannt worden. Das war schon Jahre her, doch noch immer deutete man mit dem Finger auf die Unholdskinder und rief ihnen bösen Spott hinterher.
»Wer kann schon sagen, was sie den Töchtern von ihrer Kunst so alles beigebracht hat, bevor sie auf den Scheiterhaufen kam?«, pflegte Johannes’ Mutter zu sagen.
»Meint ihr, die Eva ist eine Unholdin und kann wie ihre Mutter auf einer Gabel ausreiten?«, fragte Georgius, als die jüngste Haseltochter mit einem Einkaufskorb unter dem Arm mit schnellen Schritten den Stadtbach überquerte.
Die Buben saßen einige Schritte von der Brücke entfernt am Ufer des Stadtfischerbaches und ließen die Füße ins kalte Wasser hängen.
Vitus schürzte nachdenklich die Lippen, dann nickte er, doch Johannes winkte ab.
»Wenn es hier noch Hexen gibt, dann ist die Sibylla eine.« Hastig sah er sich um, ob die Zwillinge nicht doch in der Nähe waren. Er senkte die Stimme. »Ich sage euch, das ist kein normales Mädchen. Der Teufel hat sie gezeugt und ihr eine Schwester als Dienerin mitgegeben.«
Andreas Pfitzer lachte und klopfte mit der Hand auf einen der Käfige, die der Fischer von gegenüber in den Bach gestellt hatte, um seinen Fang frisch zu halten.
»Aber dann müsste ja die Sternenwirtin mit dem Teufel gebuhlt haben und eine Unholdin sein. Das glaube ich nicht«, gab Andreas zu bedenken.
»Was glaubst du nicht?«, erklang da plötzlich eine Stimme dicht hinter ihm und ließ die vier Buben erschreckt zusammenfahren. Andreas lief puterrot an, als er sich umdrehte und zu dem rotblonden Mädchen aufsah.
»Nichts für dich«, sagte er nur trotzig und wandte sich wieder ab.
»So?«, erwiderte Sibylla und stemmte die Hände in die Hüften. »Ich dachte, ihr habt über unsere Mutter gesprochen.«
Helena, die dicht hinter ihrer Schwester stand, schwieg wie immer. Plötzlich lachte Johannes gackernd los, bis Sibylla dem um mehr als einen Kopf größeren Jungen gegen das Schienbein trat.
»Noch kannst du lachen, doch warte ab, das Lachen wird dir vergehen, wenn sie deine Mutter holen.«
Johannes zog Sibylla am Zopf. »Wer sollte sie denn holen? Die Pelzmärte vielleicht?«
Sibylla tat so, als spüre sie den Schmerz nicht. »Nein, der Hexenkanzler vom Propst, du Dummkopf!«
Sie drehte sich um, nahm die Hand ihrer Schwester und ging, Helena mit sich ziehend, davon.
»Es gibt gar keinen Hexenkanzler in Ellwangen«, schrie Johannes Simon, der Sohn des Mangmeisters, ihr hinterher.
»Morgen, vor Einbruch der Dämmerung, bin ich zurück«, teilte Hans Schenckh seiner Gattin mit, warf sich den pelzverbrämten kurzen Mantel über die Schultern und setzte den Biberhut auf sein inzwischen ergrautes Haar. Dann küsste er seinem Eheweib leicht die Wangen. »Wo sind Thomas und die Zwillinge?«, fragte der Vater, während er seiner ältesten Tochter Regina zum Abschied die Wangen tätschelte.
»Thomas ist sicher drüben in der Küche«, erwiderte die Mutter, als die Zwillinge Sibylla und Helena in die Stube stürmten.
»Vater, o Vater«, rief Sibylla, schlang ihre Arme um seine Hüfte und presste ihr Gesicht in die rosshaargepolsterten, kurzen Hosen. Helena griff nach seiner Hand und klammerte sich daran fest. Tränen rannen ihr über das Gesicht.
»Aber, aber«, beschwichtigte Hans Schenckh seine beiden Töchter und strich ihnen über das schimmernde Haar, »ihr tut ja gerade so, als würden wir uns nie wieder sehen! In zwei Tagen schon bin ich wieder da, und ich verspreche euch, ich bringe euch Naschwerk aus Nördlingen mit.«
Helena weinte nur noch heftiger, doch Sibylla ließ den Vater los, fuhr sich energisch mit dem schmutzigen Hemdärmel über die Nase und sah aus großen grauen Augen zu ihm auf. Langsam schüttelte sie den Kopf.
»Nein, du wirst uns kein Naschwerk mitbringen, weil du nie wieder zurückkommen wirst!«
Helena schluchzte auf und ließ sich auf den Boden sinken. Zusammengekauert saß sie auf den sauber gescheuerten Bohlen und tränkte ihren grauen Kittel mit ihren Tränen. Hans Schenckh ließ sich auf die Knie nieder und zog seine Töchter an sich.
»Was für einen Unsinn habt ihr in euren hübschen Köpfchen«, sagte er und lachte. »Warum sollte ich denn nicht zurückkommen, wenn ich solch liebe Töchter hier lasse?« Sein Lachen klang etwas gepresst. Er sah, dass sich seine Gattin bekreuzigte.
»Trocknet eure Tränen, oder soll ich euch in Gedanken mit rotz- und tränenverschmierten Gesichtern vor mir haben, wenn ich an euch denke?«
Helena schnäuzte sich geräuschvoll in ihren Kittel, stand auf und drängte sich an ihre Schwester. Mit ernstem Blick sahen die Kinder zu ihrem Vater auf. Hans Schenckh wandte sich ab.
Es ist, als stünden sie an meinem Grab.
Ein kalter Schauder rann über seinen Rücken. Hilfe suchend sah der Wirt zu seiner Gemahlin hinüber. Doch dann schüttelte er die dunklen Schatten von seiner Seele, strich noch einmal über die Kinderköpfe, versprach einen ganzen Berg an Süßigkeiten und lief dann schnell die Treppe hinunter, ohne noch einmal zurückzusehen. Das Letzte, was er von seiner Familie hörte, war das Wehklagen der Zwillinge.
Sieben Tage lang wartete Helena Schenckh vergeblich auf die Rückkehr ihres Gatten. Als am achten Abend der Stadtpfarrer Johannes Planckh und die Wirtsleute Schober vor der Tür standen, empfing Helena sie mit blassem Gesicht, aber gefasst. Sie führte die Gäste nicht in die Wirtsstube, sondern nahm sie mit über den Hof in den schmalen Anbau, in dem die Familie wohnte. Ohne eine Miene zu verziehen, servierte sie Bier und Gewürzkuchen, ehe sie sich einen Schemel nahm und sich zu den Gästen setzte.
Der Pfarrer fuhr sich nervös mit der Zunge über die Lippen, wollte etwas sagen, trank aber dann doch einen kräftigen Schluck aus dem Krug. Regina Schober griff nach Helenas Hand, als die Zwillinge plötzlich in der Stube standen.
»Du solltest sie hinausschicken«, sagte Regina leise und streichelte Helenas Hand.
»Warum müssen wir hinausgehen?«, begehrte Sibylla auf und reckte das Kinn vor. »Weil der Vater tot ist?«
Johannes Planckh zuckte zusammen. Regina Schobers Augen weiteten sich ungläubig.
»Aber wie können die Kinder das wissen? Ich meine, der Kaufmann hat ihn doch eben erst auf seinem Karren mitgebracht und …«
Sie verstummte, als sie sah, wie die Lippen der Wirtin bebten.
»Heilige Jungfrau, dann ist es also doch passiert, wie die Kinder es vorausgesehen haben. Dabei habe ich mich kaum von meinen Knien erhoben, habe gefastet und gebetet und Kerzen gestiftet, dass er von dieser Reise gesund wiederkehren möge.«
Regina Schober legte den Arm um die Freundin, doch es fehlten ihr die Worte des Trostes.
Jacob Schober schüttelte erstaunt den Kopf. »Die Kinder haben es vorhergesehen?«, fragte er mit Zweifel in der Stimme.
Die Sternenwirtin nickte unter Tränen. »Ja, sie wollten ihn nicht gehen lassen und weinten.«
Der Pfarrer seufzte erleichtert auf. »Das ist doch ganz normal.«
Doch die Mutter schüttelte energisch den Kopf. »Er versprach Naschwerk mitzubringen, doch Sibylla sagte, dass er nie zurückkommen werde.«
Die Wirtin schnäuzte sich geräuschvoll in das Wischtuch, das an ihrem Gürtel hing. Die Männer tauschten viel sagende Blicke.
»Kommt mal her«, forderte der Pfarrer die Mädchen auf, die noch immer unter dem Türrahmen standen. »Warum dachtet ihr, dass dem Vater etwas passieren könnte?«
Wie üblich antwortete Sibylla. »Ich habe es gesehen«, sagte sie schlicht. »Wir beide haben es gesehen!«
»Ihr habt schlecht geträumt«, warf Jacob laut in einem Tonfall ein, der keine Widerrede duldete, doch das Mädchen schüttelte störrisch den Kopf.
»Nein, nicht geträumt, gesehen. Er ist von seinem Pferd gefallen, und dann hat sein Kopf geblutet, und dann war er tot.«
Die kleine Helena schluchzte und knetete den Kittel ihrer Schwester in den Händen. Der Pfarrer wand sich.
»Entweder der Herr oder der Teufel hat hier seine Hand im Spiel«, flüsterte er heiser. »Es ist, wie das Kind sagt. Der Kaufmann fand ihn mit eingedrücktem Schädel bei Bopfingen auf der Straße. Von seinem Pferd fehlte jede Spur.«
»Welch schreckliches Unglück«, weinte die Wirtin und zog ihre beiden Töchter an sich.
»Ein Unglück?« Jacob Schober ließ die Worte in der Luft hängen und tauschte wieder Blicke mit dem Pfarrer.
»Ja, ein unglücklicher Zufall war es, der sein Pferd scheuen ließ«, bestätigte Johannes Planckh mit Nachdruck und sprach der Witwe sein Beileid aus, ehe er auf die notwendigen Vorbereitungen zum Begräbnis des Sternenwirts zu sprechen kam.
Als er sich verabschiedet hatte, drehte er sich noch einmal um und musterte die Zwillinge. Dann bekreuzigte er sich und stieg rasch die Treppe hinunter.
Hans Schenckh lag nun in der kalten Erde. Das Begräbnis war zu Ende, die Gäste auf dem Heimweg. Viele waren nach St. Wolfgang gekommen, um vom Sternenwirt Abschied zu nehmen: die Wirtsleute vom Kirchplatz und die Schobers aus der Langen Gasse, der Mangmeister mit Frau und Kindern und der Jagstbäcker, der Stadtmüller mit seiner Familie und viele andere mehr. Alle folgten sie dem Stadtpfarrer zum Steinernen Tor hinaus bis nach St. Wolfgang. Die Witwe weinte am Grab. Regina drückte sich an die Seite ihrer Patin, Jacob Schober legte Thomas die Hand auf die Schulter. Der Knabe war wie erstarrt, und auch die Zwillinge zeigten keine Tränen. Sich an den Händen haltend, standen sie am offenen Grab und sahen in die Grube hinab, in der ihr Vater für immer verschwinden sollte. Es wurde gesungen, die Totenglocke läutete, der Pfarrer sprach lateinische Worte und verteilte Weihwasser mit einem Wedel, Erdklumpen wurden auf den Sarg geworfen. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Langsam bewegte sich der Zug zur Stadt zurück, um im »Stern« dem Toten bei Wein und Gebäck zu gedenken.
Dann war es vorbei. Nur noch Regina und Jacob Schober saßen bei Helena Schenckh in der Wirtsstube. Sie schwiegen, während die Magd Agatha die Tische abwischte. Als sie, den Eimer in der Hand, die Treppe hinunterstieg und die Tür zum Hof hinter ihr zuschlug, räusperte sich Jacob. Helena hob den Blick.
»Der Pfarrer sagt, das Unglück haust in deiner Familie.«
Helena nickte. »Erst holt sich der Herr meinen Caspar und nun auch noch Hans so früh.«
»Es ist nicht nur der Tod«, fügte Jacob hinzu. »Die Mädchen beunruhigen ihn.«
Die Wirtin seufzte.
»Es ist nicht so, dass es deine Schuld wäre, sagt er«, beeilte sich Regina hinzuzufügen. »Doch vielleicht kannst du Gott und die Heiligen gnädig stimmen, damit das Unglück in Zukunft an diesem Haus vorbeigeht. Es kann dir doch nicht entgangen sein, wie die Leute reden, und ich will bestimmt nichts Schlechtes sagen, verstehe mich nicht falsch, aber wenn Sibylla einen ansieht, dann kann es einem schon komisch zu Mute werden und …« Sie verstummte, als ihr Gatte sie in die Seite stieß.
Helena zuckte hilflos die Schultern. »Bete ich denn nicht genug? Gehe ich nicht dreimal in der Woche zur Messe, wie es sich gehört? Stifte ich nicht regelmäßig Kerzen, und gebe ich den Armen nicht immer reichlich, wenn sie dienstags mit ihren Büchsen durch die Stadt ziehen?«
Regina Schober nickte zustimmend. »Das habe ich dem Herrn Pfarrer auch gesagt, doch er meint, Gott fordert manches Mal mehr von einem. Ich verstehe da ja nicht viel davon, doch der Herr Pfarrer steht dem Herrn und den vielen Heiligen und auch der Jungfrau Maria natürlich viel näher, und da weiß er am besten, was richtig ist und …«
»Was soll ich ihm denn geben?«, rief die Sternenwirtin aus.
Nun ergriff Jacob wieder das Wort. »In diesen Tagen ist ein alter Ordensmann im Pfarrhaus zu Besuch. Bruder Theobald nennt er sich. Er ist der neu ernannte Beichtvater der Zisterzienserinnen in Kirchheim und wird in den nächsten Tagen dorthin ziehen.«
»Ja und?«, fragte die Hausfrau, die noch nicht begriff, worauf Jacob hinauswollte.
»Für ein Stück Wald und eine Wiese oder ein paar Stück Vieh würden die Nonnen eines der Mädchen sicher aufnehmen«, fuhr er behutsam fort.
Helena starrte ihn an. Eine ganze Weile schwieg sie, und dann musste sie sich erst einmal räuspern, bevor sie antworten konnte.
»Nach meinem Sohn und meinem Mann soll ich nun auch noch eine meiner Töchter verlieren?«
Regina Schober legte den Arm um die Freundin. »Nicht verlieren. Du gibst sie Gott, und sie wird für den Schutz der ganzen Familie beten. In einem Kloster ist sie gut versorgt. Stell es dir doch nur einmal vor, wie die liebe Kleine, eingehüllt in das Gewand der Nonnen – es wird ihr sicher ganz vortrefflich zu Gesicht stehen – in der großen, prächtigen Kirche Gottes Lob singt. Ihre reine Stimme …«
»Zisterzienser haben keine prächtigen Kirchen!«, unterbrach sie ihr Mann. In drängendem Ton wandte er sich noch einmal an die Wirtin. »Die Leute reden über Sibylla, das weißt du. Ich habe die Kinder gehört. Sie nennen sie Hexe. Sie ist nicht wie die anderen, und das ist gefährlich.«
»So viel ich weiß, nehmen die Zisterzienserinnen keine Oblaten«, begehrte die Wirtin trotzig auf.
Jacob nickte. »Das stimmt, doch sie unterrichten Schulkinder, und der Pater hat versprochen, sich dafür einzusetzen, dass sie auch im Kloster wohnen kann, bis sie für das Gelübde alt genug ist.«
»Sprich wenigstens mit dem Pater«, schlug Regina vor, »dann kannst du dich immer noch entscheiden. Ich habe ihn gesehen, und ich muss sagen, er macht einen sehr netten und gütigen Eindruck, so dass ich glaube, du kannst ihm Sibylla getrost für die Reise anvertrauen. Er …«
Ein Geräusch vor der Tür ließ alle drei hochschrecken. Ein erstickter Laut, dann hastige kleine Füße, die die Treppe hinabpolterten.
»Sie haben wieder gelauscht«, seufzte die Mutter. »Es wäre besser gewesen, sie hätten es von mir erfahren.« Resignierend schüttelte sie den Kopf. »Aber vielleicht haben sie es schon gewusst. Vielleicht schon vor uns?«
Jacob Schober erhob sich abrupt von der Bank, obwohl sein Krug gerade mal zur Hälfte geleert war.
»Überlege es dir. Wir können dir nur dazu raten.« Er zog seine Frau von der Bank hoch. »Wir sollten gehen, es ist schon spät. Es muss ja nicht sein, dass wir Preinlins Kasten wieder um zehn Batzen reicher machen.«
Regina küsste die Gastgeberin auf beide Wangen. »Grüße mir mein Patenkind auf das Herzlichste und mach dir keine Sorgen, es wird schon alles gut«, sagte sie. Dann zog Jacob sein Weib mit sich fort.
Helena Schenckh sah den Schobers nach, bis sie in der Nacht verschwunden waren. Dann schritt sie über den Hof und öffnete die schmale Tür zum Hinterhaus. Langsam stieg sie die Treppe hoch. Es war, als hinge eine Zentnerlast an ihrer Seele, und sie musste sich eingestehen, dass sie sich vor dem fürchtete, was in Sibyllas großen grauen Augen zu lesen stand.
»Die Mutter hat gerufen«, keuchte Helena atemlos, als sie ihre Zwillingsschwester an der Scheunentür eingeholt hatte.
»Ich habe es gehört!« Sibylla funkelte ihre Schwester böse an. »Sie wollen mich wegbringen, doch ich bleibe hier!«
Helena folgte ihrer Schwester in die Scheune.
»Dieses Mal vergrabe ich mich so tief, dass sie mich nie finden.«
Von fern war wieder die Stimme der Mutter zu hören. Sie klang sehr ärgerlich. Helena zuckte zusammen. »Aber wir können doch nicht für immer hier im Heu bleiben. Was sollen wir essen?«
Sibylla, die schon fast unter den trockenen Halmen verschwunden war, schnaubte verächtlich. »Nicht für immer, aber so lange, bis der dumme Pater wieder abgereist ist.«
Draußen waren die Schritte der Mutter zu hören, doch sie ging an der Scheunentür vorüber zum Stall, in dem die Pferde der Gäste standen.
»Helena, nun komm schon!«, zischte Sibylla aus dem Heu hervor.
Die Schwester trat nervös von einem Fuß auf den anderen. »Und wenn ich zu Mutter gehe und ihr sage, dass du nicht da bist?«
»Pah, sie wird dir so lange zusetzen, bis du ihr mein Versteck verrätst. Komm endlich ins Heu, bevor Mutter dich hier sieht!«
Doch Helena schüttelte trotzig den Kopf. Es war das erste Mal, dass sie sich ihrer Zwillingsschwester widersetzte. Sie drehte sich um, lief mit wehenden Zöpfen zur Scheunentür, schob sie einen Spalt auf und drückte sich hindurch.
»Helena, bleib!«, rief ihr Sibylla nach. Tränen schossen ihr in die Augen. »Weißt du’s denn nicht? Wenn du jetzt gehst, dann werden wir uns vielleicht nie mehr wieder sehen.«
Das Kind umklammerte seine angezogenen Knie und schluchzte in seine schmutzige Schürze.
Die letzten Gäste verabschiedeten sich gerade und schwankten an der Friedhofsmauer entlang dem Marktplatz zu, als Sibylla mit hängendem Kopf in die Wirtsstube trat.
Agatha, die mit einem nassen Lappen die Wein- und Bierreste von den Tischen wischte, hielt in ihrer Arbeit inne. Mitleidig betrachtete sie das Mädchen, das schmutzig, mit rot geweinten Augen und hängendem Kopf vor ihr stand. Die Magd strich der Kleinen über die zerzausten Zöpfe.
»Deine Mutter ist in der Küche.«
Doch da kam die Wirtin schon in die Stube. Die Strenge in ihrer Miene verflog, als sie die Pein im Antlitz ihrer Tochter sah. Ohne auf ihre blütenweiße Schürze zu achten, zog sie das Kind in ihre Arme.
»Sie ist weg, nicht wahr? Und ich werde sie nicht wieder sehen.«
Helena Schenckh ließ ihre Tochter eine Weile weinen, dann trocknete sie die Tränen.
»Ja, sie ist weg. Sie reist mit dem Pater nach Kirchheim und wird dann bei den Zisterzienserinnen in einem Kloster wohnen. Dort wird sie viel beten und singen und Gott loben.«
Sibylla zog geräuschvoll die Nase hoch. »Du hast sie weggeschickt, weil du mich nicht finden konntest. Ich bin schuld, dass sie zu den Nonnen muss.«
Die Mutter schüttelte den Kopf. »Vielleicht hat Gott sie auserwählt. Wie können wir Menschen sagen, was Er mit uns vorhat? Wer weiß, vielleicht hat sie so das einfachere Schicksal? Wer kann das schon sagen? Und wenn sie mit ihren Gebeten unsere Familie in Zukunft vor dem Bösen beschützt, dann müssen wir ihr alle sehr dankbar sein.«
»Ja, aber«, Sibylla schnäuzte sich in den Lappen, den ihr die Mutter vor die Nase hielt. »Werden wir uns wieder sehen?«
Helena zuckte hilflos die Schultern. »Ich weiß es nicht, mein Kind, höre in dich hinein und bete zu Gott dem Allmächtigen und zur Heiligen Jungfrau Maria.«
Gehorsam faltete das Mädchen die Hände, schloss die Augen und saß einige Augenblicke reglos auf den Knien der Mutter.
»Ich sehe sie. Sie ist angezogen wie eine der Seelschwestern. Sie kommt auf mich zu, aber es ist so dunkel, ich kann sie gar nicht richtig sehen.«
Sibylla stieß einen Schrei aus, dass Agatha vor Schreck den Wassereimer vom Tisch stieß. Das Kind bäumte sich auf und fiel zu Boden. Sie kauerte sich unter die Bank, presste die Arme um den Leib und schrie schrill wie im Todeskampf.
»Sibylla, Sibylla!« Die Mutter kniete sich auf den Boden und zog das Kind zu sich. »Was ist mit dir? Sei ruhig, sei ganz ruhig.«
»Das Feuer, das Feuer, ich kann es spüren, es ist so heiß, es verbrennt mich!«
Das Kind bäumte sich noch einmal auf, dann erschlaffte der schlanke Körper. Zitternd und totenbleich im Gesicht erhob sich die Mutter und trug das ohnmächtige Mädchen über den Hof zu seiner Kammer hinüber. Die ganze Nacht saß die Mutter am Bett des Mädchens, betete und versuchte die Angst in ihrem Herzen zu vertreiben. Es war ein Fehler gewesen, Helena wegzuschicken. Jacob hatte sie gewarnt. Doch die Urkunden waren aufgesetzt und unterschrieben, der Pater drängte ungeduldig zur Abreise, und Sibylla war nirgends zu finden. War Gott so wählerisch? Würde er nicht auch die Schwester gnädig als Geschenk empfangen und die Familie nun vor weiterer Unbill schützen? Jacob beharrte darauf, Sibylla müsse von Ellwangen fort, doch die Wirtin verschloss ihre Ohren vor seiner Rede. Ja, sie war ein wenig altklug, und die Kinder redeten, doch das würde vergehen, wenn sie erst älter war und gelernt hatte, auf ihre Worte zu achten. Und schließlich, hatten nicht beide Zwillinge die Gabe des Gesichts? Seufzend hielt die Mutter die schweißnassen Kinderhände, als das Mädchen im Schlaf aufschrie.
Am Morgen erwachte Sibylla mit einem Lächeln auf den Lippen. Der vorherige Abend schien aus ihrer Erinnerung gelöscht.
KAPITEL 3
Es fiel ihr schwer, sich daran zu gewöhnen, dass Helena weg war. Immer wieder sah sich Sibylla um, als erwarte sie, die Schwester hinter sich zu finden. Dann presste sie entschlossen die Lippen zusammen und schritt noch forscher daher als zuvor. Sie blieb nun öfter bei Agatha und Veit im Wirtshaus oder spielte allein im Hof. Sie hatte keine Lust mehr, sich mit den anderen Kindern in den engen Gassen herumzutreiben oder den Bettlern Streiche zu spielen.
Mit einem Korb unter dem Arm kam die Mutter aus der Wirtshausküche und stieg die Treppe hinunter.
»Möchtest du mitkommen und mir ein wenig zur Hand gehen?«, fragte sie Sibylla, die allein auf den Stufen saß, den Kopf in beide Hände gestützt.
Das Kind nickte, erhob sich und klopfte den Staub aus seinem neuen hellblauen Kleid. Schweigend folgte sie der Mutter. Zu ihrer Rechten lag der Herrenfriedhof, zur Linken passierten sie das imposante Haus des Chorherrn Ferdinand von Freyberg. Daneben lag die Kronenherberge, in der wichtige Besucher des Stifts untergebracht wurden. Sibylla zählte die Schritte bis zum Gasthaus »Adler« neben dem Amman-Amtshaus. Vor der Apotheke standen einige Bürger. Sie schienen aufgebracht. Es waren vor allem Frauen, die die Fäuste ballten und wegen irgendetwas schimpften. Sibylla reckte den Hals und erkannte auf den Stufen die Apothekersfrau, ein dickes Weib mit rotem Gesicht, das bereits neun Kindern das Leben geschenkt hatte. Man sagte hinter vorgehaltener Hand, über keinen Bürger oder Hausgenossen aus Ellwangen gäbe es bei Gericht einen solch dicken Stapel Pergament wie über die zanksüchtige Ester Pröbstin.
Sibylla versuchte zu verstehen, was die Frauen so erzürnte, doch die Mutter zog sie weg, vorbei am »Schwan« und dem »Geigersbeck« zum Rathaus hinüber. Die Freitreppe zum ersten Stock hoch, die zur Ratsstube und zum großen Sitzungssaal führte, war nur für die Ratsleute und andere wichtige Männer bestimmt. Das untere Tor jedoch führte Mutter und Tochter ins Brothaus und die Metzigt. Die Brothüterin verkaufte hier, was die Bäcker der Stadt heute Morgen geliefert hatten. Im Nebenraum wurde, unter strenger Aufsicht des Beschauers, das Fleisch gehauen und verkauft, dahinter in der Schranne Korn gemessen und auf der großen Waage Schmalz ausgewogen. Die Läden der Tucher und Loder waren heute leer.
Helena Schenckh strebte einem der Bäckerstände zu und packte zwei feine weiße und ein dunkles Brot mit viel Roggenschrot in ihren Korb. Sie wechselte ein paar Worte mit der Brotaufseherin, drückte ihr die gewünschten Münzen in die Hand und schritt dann aufmerksam an den Fleischbänken entlang.
Meister Hiebner hielt der Badersfrau Elisabeth Mösmer einen Schweinefuß unter die Nase. Hinter ihr stand die Hebamme Helena Veit mit der Grollin, des Bettelvogts Weib.
Sibylla schob sich zwischen den Frauen hindurch und zupfte den Metzger am Rock. Hans Hiebner ließ den Schweinefuß sinken und wandte sich dem Mädchen zu.
»Ah, Sibylla! Da kommt eine wirkliche Verehrerin meiner Kunst. Ich habe etwas ganz Neues für dich. Das wird dir schmecken!« Achtlos legte er den Schweinefuß beiseite und griff nach zwei kleinen Würsten. Er sah zu Sibylla hinüber, ließ den Blick suchend schweifen und legte dann schnell eine der Würste wieder zurück. Die hellen Augen blinzelten freundlich aus seinem aufgeschwemmten Gesicht, als er dem Kind das Würstchen in die Hand drückte.
»Und, wie findest du mein neues Rezept?«, fragte er sie lächelnd.
Sibylla biss herzhaft zu, kaute, überlegte und strahlte dann den Metzger an.
»Das habt Ihr richtig gut gemacht, Meister Hiebner«, sagte sie undeutlich mit vollem Mund.
Zufrieden kniff ihr der Metzger in die Wange. »Sag’s ruhig auch den anderen gnädigen Herrschaften hier. Ich habe noch fünf Ellen davon!«
»Geht es jetzt mal weiter?«, keifte die Grollin und klapperte mit den wenigen Kreuzern, die sie in ihrem Beutel trug. »Oder habt Ihr nichts Besseres zu tun, als Euer Fleisch an das seltsame Balg zu verschenken.«
»Natürlich wäre es dir lieber, wenn du die Würste geschenkt bekommen würdest«, murmelte die Badersfrau und tauschte mit Sibylla einen kurzen Blick. Das Mädchen kicherte.
Helena Veit murrte: »Wenn die liebe Elisabeth sich endlich entschließen könnte, den Schweinefuß zu nehmen oder es sein zu lassen, dann müssten wir nicht den ganzen Tag in der Metzigt zubringen.«
»Aber, aber!«, versuchte der Metzger die Gemüter zu beschwichtigen, doch keine der Frauen hörte auf ihn. Es flogen böse Worte und Verwünschungen hin und her, andere Frauen drängten sich heran, um sich für die eine oder andere einzumischen, oder einfach nur, um nichts zu verpassen.
Da der Streit noch eine Weile zu dauern schien, schob sich Helena Schenckh zu Meister Hiebner vor, zeigte auf ein großes Stück Speck und bat ihn, ihr auch noch fünf der Würste mitzugeben.
»So!«, keifte da die Grollin los. »Erst das freche Balg vorschicken und dann auch noch drängeln!«
»Ihr wart ja mit sinnlosen Streitereien beschäftigt«, antwortete die Sternenwirtin kühl.
»So eine Frechheit!«, ereiferte sich des Bettelvogts Weib. »Aber da braucht man sich ja nicht mehr zu wundern, warum das Kind so seltsam ist. Ich sehe nun klar, wer ihm die Kunst beigebracht hat!«
»Ich weiß nicht, wovon Ihr sprecht!«, erwiderte Helena ruhig, drückte dem Metzger vier Batzen in die Hand und griff nach Sibyllas Hand.
»Davon, dass dein freches Balg eine Hexe ist«, kreischte die Grollin über das Stimmengewirr hinweg. Die Frauen verstummten. »Das weiß doch jeder!«, platzte die Grollin in die plötzlich eintretende Stille hinein. »Hinter vorgehaltener Hand geht es von Mund zu Mund. Die anderen sind nur zu feige, es auszusprechen. Das Kind ist nicht geheuer!«
»Rede keinen Unsinn!«, zischte Helena Schenckh scharf und wollte Sibylla mit sich ziehen, doch das Mädchen riss sich los. Mit funkelnden Augen baute sie sich vor Barbara Groll auf.
»Ich bin keine Hexe!«, sagte sie mit fester Stimme. »Aber auf dich werden sie mit dem Finger zeigen. Ich habe gesehen, wie sie dich binden und schlagen und zur Stadt hinauszerren. Du wirst sterben.« Sie schloss die Augen. Panik schlich sich in ihre Stimme. »Im Feuer wirst du sterben!« Kreischend warf sie sich auf den Boden. Die Frauen und der Metzger standen um sie herum, wie vom Donner gerührt, einige bekreuzigten sich. Helena Schenckh ließ ihren Korb fallen, packte das schreiende und sich wehrende Mädchen und zog es mit sich fort.
Mit ruhiger Stimme wandte sich der Metzger wieder an die Badersfrau, doch der Schweinefuß in seiner Hand zitterte. Sie nahm das Fleischstück ohne ein Wort entgegen, gab drei Kreuzer und eilte davon.
Eine Stunde später klopfte es, und Regina Schober trat in die Küche des Gasthauses »Zum Goldenen Stern«. Sie stellte Helenas Korb auf den Boden, legte die Brote ins Regal und Speck und Würste auf den Tisch. Dann setzte sie sich neben Helena auf die Bank.
Die Wirtin schnitt in Windeseile Zwiebeln und Lauch. Sie schwieg, doch ab und zu tropfte eine Träne auf das große Messer.
»Wie geht es ihr?«, fragte Regina nach einer Weile.
»Sie schläft jetzt, und wenn sie erwacht, wird sie sich nicht mehr daran erinnern.« Das Messer stand plötzlich still, und die rot geweinten Augen sahen Regina Schober an.
»Aber die Leute, die werden sich umso besser an den Vorfall erinnern! Die Zungen werden gewetzt und gerieben, und bis zur Messe weiß es die ganze Stadt.«
Die Schneide rückte wieder unerbittlich gegen die Lauchstangen vor.
»Ja, so wird es sein«, bestätigte die Freundin, «doch bis zur nächsten Messe haben die Zungen bereits etwas anderes, woran sie sich wetzen können. Sie vergessen auch sehr schnell!«
»Glaubst du das wirklich?« Helena sah sie scharf an. Errötend senkte Regina den Blick.
»Wenn es nicht mehr vorkommt?«
»Es wird wieder vorkommen!«, flüsterte Helena, und noch mehr Tränen fielen zwischen die Lauchstreifen.
»Vielleicht solltest du sie für eine Weile aufs Land schicken«, schlug Regina mit leiser Stimme vor.
Erst als zwei weitere Zwiebeln und eine Lauchstange in kleine Stücke zerhackt worden waren, antwortete Helena Schenckh.
»Ich werde darüber nachdenken.«
Als sie am anderen Morgen die Haustür öffnete, fand sie einen zerbrochenen Reisigbesen auf ihrer Schwelle, am nächsten Tag war es eine tote schwarze Katze. Die Wirtin hatte den Kadaver gerade im heimlichen Gemach versenkt, als ihr Sohn Thomas mit großen Schritten über den Hof kam.
»Jemand hat einen Drudenfuß an die Schwelle zum Schankzimmer gemalt!«, ereiferte er sich, und seine Wangen leuchteten rot vor Zorn.
»Agatha muss das sofort entfernen!«, rief die Mutter und wollte davoneilen, doch ihr Sohn hielt sie am Arm fest.
»Auf diese Idee bin ich auch schon gekommen. Aber meinst du nicht, wir sollten einmal in Ruhe darüber sprechen?« Er sah sie ernst an.
Heilige Jungfrau, er wird zum Mann, dachte Helena Schenckh und sah zum ersten Mal den Hauch des ersten Bartwuchses am Kinn ihres Zweitgeborenen.
»Ja, wir werden darüber sprechen.«
Und wieder setzte sich die Sternenwirtin mit den Schobers und dem Pfarrer zusammen. Dieses Mal jedoch waren auch Thomas, Regina und Sibylla dabei.
»Sie sollte zu Helena ins Kloster gehen«, sagte Thomas mürrisch. Er sorgte sich um sein Erbe. Was sollte aus dem Wirtshaus werden, wenn seine Schwester als Hexe verschrien wurde? Wer würde dann noch im »Goldenen Stern« einkehren, noch dazu, wo es in Ellwangen weit mehr als ein Dutzend Gasthäuser und Schenken gab?
»Ja, ich will zu Helena!«, rief Sibylla und sah ihre Mutter erwartungsvoll an, doch diese schüttelte den Kopf.
»Der Pater hat für die Nonnen mehr verlangt, als ich ihm eigentlich geben konnte. Wir können es uns nicht leisten, noch mehr Äcker und Wiesen zu verlieren.«
Alle schwiegen und dachten nach. Es war schon dunkel, nur ein paar Talglichter erhellten trüb die blitzsaubere Wirtsstube, in der zu dieser Stunde keine Gäste mehr saßen.
»Du hast doch eine Schwester in Lorch? Wäre es nicht möglich, Sibylla für eine Zeit lang dorthin zu schicken?«, schlug Regina Schober vor.
Die Wirtin zuckte die Schultern. »Ja, schon, doch nach Lorch sind es zwei Tagesmärsche, und auch mit einem Fuhrwerk ist man kaum schneller. Ich kann das Gasthaus nicht vier Tage allein in Thomas’ Händen lassen!« Den Protest des Jünglings wischte sie mit einer Handbewegung beiseite.
»Lorch! Sagt mir, wie soll ich Sibylla dort hinbekommen?«
In diesem Moment öffnete sich die Tür, und eine Frau trat in die Stube.
»Lorch?«, fragte der späte Gast, der die letzten Worte vernommen hatte. »Wer will nach Lorch?«
Schweigend betrachteten die um den Tisch Versammelten die Besucherin. Es war ein Weib von kleinem Wuchs mit einem aufgedunsenen roten Gesicht und wasserblauen Augen. Ein paar mit Grau durchzogene Strähnen lugten unter ihrer schmuddeligen Haube hervor, und als sie sich lächelnd vorstellte, entblößte sie eine Reihe krummer gelber Zähne.
»Ich bin Catharina Müller aus Leonberg, und ich bin Krämerin«, sagte sie und deutete auf die beiden sichtlich schweren Säcke, die sie über der Schulter trug.
Die Sternenwirtin entsann sich ihrer Gastgeberpflichten, sprang auf und bot der Krämersfrau einen Platz auf der Bank an. Thomas eilte auf einen Wink der Mutter herbei und nahm ihr die schweren Bündel ab.
»Was kann ich Euch Gutes tun?«
Catharina Müller streckte sich, dass ihre dicken Füße unter dem schmutzigen Saum ihres Rockes hervorlugten.
»Ach, eine heiße Suppe und ein Stückchen Brot. Vielleicht etwas Dünnbier?«, seufzte die Alte. »Es muss nichts Feines sein«, fügte sie noch hinzu.
Die Wirtin nickte. Sie verstand, es sollte nicht viel kosten. »Vier Kreuzer, mit Speck darin – fünf«, sagte sie bestimmt. »Oder soll ich Euch den Weg zum Spital beschreiben? Dort bekommt Ihr vielleicht noch etwas Warmes.«
Die Krämerin wehrte ab. »Nein, nein, bringt mir die Suppe mit ein wenig Speck.«
Der Pfarrer hatte es plötzlich eilig, sich zu verabschieden, und auch die Schobers zogen nach Hause, als sie das Lied des Nachtwächters vernahmen, der die neunte Stunde ausrief. Helena Schenckh schickte die Kinder hinüber ins Haus. Während Agatha in der Küche den Kessel schrubbte, setzte sich die Wirtin zu der Krämerin an den Tisch und wartete geduldig, bis sie gegessen hatte.
»Ich muss Euch nun wegschicken«, sagte Helena Schenckh. »Wenn die Büttel vorbeikommen und Euch hier finden …« Sie beendete den Satz nicht, doch die Krämerin verstand es auch so.
»Kann ich denn kein Nachtlager bekommen?«, fragte sie, bewegte vorsichtig ihre Beine und verzog dann voller Schmerz das Gesicht.
Die Wirtin überlegte. »Eigentlich sind wir keine Herberge mehr, aber wenn Euch ein frischer Strohsack in der Kammer hinter dem Stall genügt?«
Die Krämerin nickte und stieg dann schwerfällig hinter der Sternenwirtin die Treppe hinunter.
Als Helena Schenckh bei Sonnenaufgang in den Hof trat, saß die Krämerin schon auf den Stufen der Hintertür und reinigte ein paar grünlich verfärbte Holzschachteln. Zu ihren Füßen kauerte Sibylla und folgte dem Tun schweigend mit den Augen. Grüßend trat die Wirtin näher.
»Es wird ein schöner Tag werden. Reist Ihr heute weiter? Wollt Ihr noch eine Milchsuppe?«
Die Krämerin schüttelte den Kopf. »Heute fährt kein Fuhrwerk in die richtige Richtung. Alle wollen sie nach Hall oder nach Osten. Doch vielleicht habe ich morgen nach dem Markt mehr Glück.« Sie zeigte mit einer Grimasse auf ihre Füße, die aus den verschlissenen Schuhen quollen. »Auf meinen Beinen schaffe ich so eine Strecke nicht mehr.«
Helena stemmte die Hände in die Hüften. »Ihr sagtet, Ihr wollt nach Lorch, nicht wahr?«
Die Alte schüttelte den Kopf. »Ich reise nach Leonberg. Mein alter Vater ist endlich zu Gott dem Herrn gerufen worden, und so wartet dort wohl ein hübsches Häuschen auf mich. Aber ich werde an Lorch wohl vorbeikommen, warum?«
Röte schoss in Helenas Antlitz, als das Kind ernst zu seiner Mutter hochsah.
»Sibylla soll den Winter dort bei meiner Schwester verbringen, doch ich habe niemanden, der sie auf dieser Reise begleiten könnte.«
Catharina Müller sah das Mädchen überrascht an. »Eine solch weite Reise? Warum denn?«
Die Röte vertiefte sich noch eine Spur, doch da Agatha sich eben aus dem Küchenfenster lehnte und nach der Wirtin rief, entschuldigte diese sich und eilte davon, ohne die Frage zu beantworten.
Schulterzuckend sah ihr die Krämerin nach, dann wandte sie sich wieder den Schachteln zu, die den intensiven Duft von Kräutern verströmten.
»Die anderen behaupten, ich sei eine Hexe«, sagte Sibylla plötzlich, »deshalb wollen sie mich zu meiner Muhme schicken, denn das Kloster ist zu teuer.«
»Und, bist du eine?«, fragte die Krämerin, ohne ihre Arbeit zu unterbrechen.
Das Mädchen überlegte kurz, dann schüttelte es den Kopf. »Nein, bin ich nicht. Aber manchmal sehe ich Sachen, die die anderen nicht sehen können.«
Catharina Müller ließ ihre Arbeit sinken und musterte das Mädchen neugierig. »Was denn, zum Beispiel?«
»Menschen, die sterben werden«, sagte das Kind schlicht.
»Alle Menschen müssen sterben«, erwiderte die Krämerin ungerührt.
»Ja, aber wenn ich ihnen sag, wie, dann regen sie sich fürchterlich auf.«
Catharina betrachtete das Kind mit wachsendem Interesse. »Siehst du auch, wie ich sterben werde?«, fragte sie gespannt.
Sibylla sah das dicke Weiblein kurz an und schüttelte dann den Kopf. Die Krämerin schien erleichtert. Sie packte die Schachteln in ihr Bündel und kramte eine Dose mit klebrigen Fruchtzuckern hervor. Gierig steckte sich das Mädchen zwei in den Mund, als die Alte ihr die Dose auffordernd entgegenhielt.
»Du könntest mit mir reisen«, schlug Catharina vor, »wenn du möchtest und wenn es deine Mutter erlaubt.«
Sibylla zögerte. Sie wusste nicht, wo Lorch lag, und sie hatte auch die Muhme und den Oheim noch nie gesehen. Ob sie viele Kinder hatten? Wie alt die wohl waren? Wie lange sie dort bleiben musste? Sie wollte nicht von der Mutter weg, und wenn schon, dann zu ihrer Zwillingsschwester Helena, nicht an einen fremden Ort zu fremden Leuten. Andererseits – sie dachte an die anderen Kinder hier, die nun offen mit dem Finger auf sie zeigten, an die Mütter mit ihren Kleinen, die ihr schräge Blicke zuwarfen und dann einen weiten Bogen um sie schlugen, damit sie ja nicht in die Nähe der Sprösslinge kam. Im fremden Lorch konnte es eigentlich nur besser werden. Sibylla erhob sich und nickte.
»Ist gut. Ich werde mit dir kommen. Ich geh nur noch mein Bündel schnüren.« Mit festem Schritt überquerte sie den Hof und verschwand im Hinterhaus, das mit seiner Schmalseite an eine hohe Mauer stieß.
»Ist das schon die Stadtmauer?«, wunderte sich die Krämerin.
»Nein«, sagte die Wirtin, die gerade mit einer Schüssel voller Bohnen durch die Tür in den Hof trat. »Dahinter liegt die Priestergasse. Dort wohnen die Vikare und Kapläne der Chorherren.« Die Wirtin lächelte verschmitzt. »Die Mauer soll sie wohl von der sündigen Welt fern halten, damit sie von ihren heiligen Gedanken nicht abgelenkt werden. Einen Chorherrn jedoch können Wirtshäuser und das Leben in der Stadt nicht anfechten. Sie bevorzugen ein stattliches Haus hier am Kirchplatz oder dort in der Herrengasse.«
Catharina ließ ihre schiefen Zähne sehen. »Ohne die Mauer hättet Ihr die Wirtsstube wohl ständig voller Schwarzröcke und Tonsuren.«
Helena schmunzelte. »Ach, es gibt durchaus einen Weg um die Mauer herum, und solange sie bezahlen und sich nicht nach neun Uhr von den Bütteln erwischen lassen … Ach übrigens«, wechselte sie das Thema, »Eure Milchsuppe steht oben bereit.«
Da stürmte Sibylla wieder in den Hof. Sie trug ihr warmes braunes Winterkleid und hatte einen Wollumhang über die Schultern geworfen, unter ihrem Arm klemmte ein Bündel mit einem zweiten Kleid und Unterröcken, einer Schürze, dem feinen weißen Spitzenkragen, den sie beim Besuch der Messe immer trug, zwei warmen Tüchern, Hemden und Strümpfe und einem Kruzifix, das der Vater ihr im letzten Jahr geschnitzt hatte.
»Ich bin fertig«, verkündete sie.
»Dann ist das wohl schon beschlossene Sache«, stellte Helena unsicher fest.
Die Krämerin nickte. »Wenn Ihr ein wenig mehr Wegzehrung in ihr Bündel packt und dem Kind ein paar Kreuzer für die Fuhrleute mitgebt, dann begleite ich sie gern bis zu Eurer Schwester.«
Helena Schenckh dachte den ganzen Nachmittag darüber nach, doch dann ging sie zu Agatha in die Küche, um die Wegzehrung zu packen. Aus der Truhe hinter ihrem Bett holte sie zehn Kreuzer für den Fuhrmann und vier Gulden, die sie Sibylla in einem Beutel um den Hals hängte, als die Krämerin hinunter in das heimliche Gemach gegangen war.
Der Abschied von ihren Geschwistern Thomas und Regina am nächsten Morgen fiel eher kühl aus. Thomas war erleichtert, denn nun würde alles wieder seinen normalen Lauf nehmen. Regina hoffte, dass sie jetzt wieder der Mittelpunkt der Zuneigung ihrer Mutter sein würde. Als dann jedoch die Mutter Sibylla ein letztes Mal in ihre Arme nahm, flossen Tränen.
»Es ist doch nur für einen Winter«, flüsterte ihr die Mutter ins Ohr.
Sibylla weinte lautlos. Sie wusste, dass sie lange, sehr lange weg sein würde. Ob sie die Mutter überhaupt jemals wiedersehen würde? Sie hatte Angst, in ihrem Herzen danach zu forschen, darum presste sie nur die zitternden Lippen aufeinander, klammerte sich fest an die Mutter und drückte ihr nasses Gesicht an deren Busen.
»Nun komm aber«, forderte sie die Krämerin freundlich auf. »Das Fuhrwerk wird nicht ewig warten.«
Widerwillig löste sich Sibylla von der Mutter, ließ sich noch einmal küssen und trottete dann, ihr Bündel auf dem Rücken, der schwerfälligen Frau nach, am Friedhof vorbei und den Gasthäusern entlang, zwischen »Schwarzem Bären« und »Rössle« hindurch, zur Schmiedgasse hinunter und dann zum Jagsttor.
Draußen vor dem Tor stand ein plumper, mit allerlei Kram bepackter Karren, vor den zwei alte Ochsen gespannt waren. Während die Krämerin mit dem Fuhrmann verhandelte, sah sich Sibylla neugierig die Waren an: Kupferkessel und Tontöpfe, Gürtel und grobe Decken, Messer mit Hirschhorngriffen, geschnitzte Löffel und gusseiserne Pfannen.