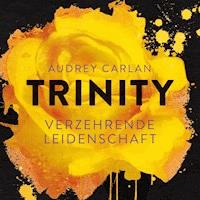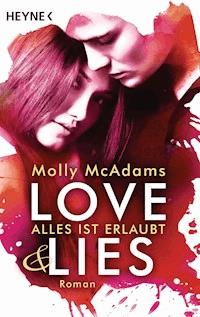Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: blue panther books
- Kategorie: Erotik
- Serie: Erotik Fantasy Romane
- Sprache: Deutsch
Dieses E-Book entspricht 208 Taschenbuchseiten ... Die junge Anna führt ein behütetes Leben fernab von dunklen Wäldern, verwunschenen Verliesen und den kargen Steppen der Orks. Das alles ändert sich, als sie bei einem Überfall in die Hände von Banditen gerät. Damit beginnt eine Reise, bei der sie genusssüchtige Elfen, sadistische Magier und stolze Minotauren kennenlernt, aber auch sich selbst und ihre Vorlieben und Bedürfnisse. Mehr und mehr wächst ihr Wunsch nach einem selbstbestimmten Leben. Wird sie dieses allen Widerständen zum Trotz führen können? Diese Ausgabe ist vollständig, unzensiert und enthält keine gekürzten erotischen Szenen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum:
Die Hexe und die Orks - Lehrjahre | Erotischer Fantasy Roman
von Timothy Morgan
Timothy Morgan wuchs umgeben von Büchern auf. Science-Fiction und Fantasy faszinierten ihn gleichermaßen, und als mit vierzehn ein wachsendes Interesse an BDSM hinzukam, dauerte es nicht lange, bis seine sehr aktive Vorstellungskraft begann, alle drei Aspekte zu kombinieren. Diese interessante Tagträumerei entwickelte sich mehr und mehr. Schließlich fing er an, seine Ideen in kürzeren und längeren Texten festzuhalten. Ein besonderer Reiz liegt für ihn in Szenarien, die nicht oder noch nicht möglich sind. Timothy lebt zusammen mit seiner Freundin in einer offenen D/s-Beziehung an der Küste.
Lektorat: Sandra Walter
Originalausgabe
© 2020 by blue panther books, Hamburg
All rights reserved
Cover: © Digital Storm @ shutterstock.com
Umschlaggestaltung: MT Design
ISBN 9783964773456
www.blue-panther-books.de
Eine ungewöhnliche Allianz
Die Luft war stickig im Zelt des Kriegstreibers. Obwohl es das Größte war, an das Broombul sich erinnern konnte, war die Luft abgestanden und schwer. Alte Pelze lagen auf dem Boden, es roch nach ranzigem Fett und dem Rauch von Mohn- und Sternblatt-Tabak. Vor dem Zelt, an langen Tafeln, schmausten die einfachen Krieger, die Blutheiler, die Kräuterfrauen und die verschiedenen Meister und ihre Gesellen, während die Generäle, die Geistertreiberin und Helden hier im Zelt ihren Sieg feierten. Die Söhne Aanouk-Nuuns, unter der Führung des jungen Kriegstreibers Karaatasch, hatten eine weitere Schlacht gegen ihren Feind, die Menschen, gewonnen.
Broombul, der älteste unter den Generälen, ließ seinen Blick über die Menge wandern. Nach dem Essen waren die Krieger träge geworden und frönten dem Rauch, prahlten in einem merkwürdigen Singsang von der Schlacht. Die Geistertreiberin Beblaar, eine fette Matrone, die nicht einen Hauch der Würde besaß, die sonst mit diesem Amt einherging, hatte sich mürrisch in eine Ecke verzogen und warf die Steine; Broombul war sich sicher, dass sie die Große Mutter befragte, wann die Herrschaft Karaataschs zu Ende gehen würde. Er war ihr schon immer ein Dorn im Auge gewesen. Karaatasch … war nicht unter den rauchenden Kriegern und Generälen. Er machte sich wenig aus den Feiern, die er für seine Obersten ausrichtete, und vielleicht sogar noch weniger aus seinem stetig anwachsenden Reichtum. Er saß, wie schon seit Beginn des Festes, auf seinem Thron, errichtet aus Hirschknochen und Nimrodfellen, seine Augen halb geschlossen, sein Großschwert über den Knien, die Linke fest um das Heft geschlossen. Erst vor kurzer Zeit, so schien es Broombul, war ihm die Erziehung des jungen Karaatasch übertragen worden, weshalb ihn jeder weitere Sieg mit Stolz auf seinen ehemaligen Schützling erfüllte; nur fragte er sich, woher die Schweigsamkeit, die fast völlige Abkehr von seinen Stammesbrüdern, kam. Karaatasch konnte das Feuer, den Blutdurst in selbst dem ängstlichsten Krieger wecken, aber wenn er nicht sprechen musste, blieb der Kriegstreiber stumm.
Auch während der Schlacht selbst war er seinen Männern so nahe, wie er nur sein konnte: Er war keiner der falkenäugigen Anführer, die die Schlacht aus der hintersten Reihe beobachteten und Signale nach vorne warfen, nein, Karaatasch führte mit seiner Leibwache den Sturm in die Reihen des Feinds an und brachte mehr Schädel ins Lager als jeder andere. Aber sobald die Schlacht geschlagen war, zog er sich in sein Zelt zurück, allein. Es war seinen Untergebenen, selbst Broombul, ein Rätsel. Karaataschs Eigenbrötlerei verunsicherte die Männer, aber sie allein hätte man noch tolerieren können, etwas anderes aber nicht. Denn das Merkwürdigste an Karaatasch, das, was ihn für Beblaar und ihre Verbündeten so unausstehlich machte, war das Menschenweib, das gerade jetzt unbewegt auf den Stufen vor seinem Thron lag und mit funkelnden Augen Broombuls Blick erwiderte.
Wie alle Menschen war sie mickrig, wie ein Kind im dreizehnten Sommer, dessen Mutter nicht genug Milch für es übrig gehabt hatte. Sie trug, wie es orkische Sitte war, ihre Brust unbedeckt, und sie hatte die obere Hälfte ihres Gesichts geschwärzt; aber ihre Haut glänzte in einem hellen Bronzeton, eine völlig absurde Farbe, als ob sie sich zwischen trockenen Gräsern verstecken wollte. »Hexe« nannten sie das Weib, ein Wort, das ihre Sprache nicht kannte und das sie sich von den Menschen ausborgen mussten. Sie war als Gefangene in ihr Lager gekommen und teilte jetzt das Bett des Kriegstreibers. Und mehr noch: Sie genoss sein Vertrauen. Weder Broombul noch sonst einer der Krieger konnte es verstehen, aber sie beugten sich dem Willen ihres Anführers.
Man musste, wenn auch zähneknirschend, zugeben, dass sie die Söhne Aanouk-Nuuns stärkte mit ihrer fremdartigen Magie und ihrem nicht von der Hand zu weisenden Geschick auf dem Schlachtfeld. Aber dass sie, ob man es sich eingestand oder nicht, unter allen Obersten den stärksten und weitreichendsten Einfluss auf Karaatasch ausübte, war nur schwer zu akzeptieren. Beblaar sprach von einem Fluch, den die Hexe gegen die Seele des Kriegstreibers gerichtet haben musste, alle anderen schüttelten den Kopf und knurrten unentschlossen.
Denn die Hexe war eine Unsicherheit, eine noch nie dagewesene Irritation; nicht einmal als Sklaven wurden Menschen sonst in das Lager aufgenommen, geschweige denn in das Zelt des Kriegstreibers. Und obwohl Konkubinen keine Seltenheit waren, glich die Position der Hexe inzwischen mehr der einer … (und hier musste Broombul wieder ein Wort suchen, das seine Sprache nicht kannte) einer »Königin«, etwas, das unter Meerleuten zuweilen vorkam und bei Gnomen die Regel war. Der Alte wollte auf den Boden spucken, besann sich aber noch rechtzeitig, dass die Augen der Hexe noch immer auf ihm ruhten.
Die Hexe; sie war von Vorteil für den Klan, aber das galt auch für einen tollwütigen Eber, den man auf Feindesland ausgesetzt hatte. Broombul schüttelte den Kopf, wandte sich ab und gesellte sich zu den jüngeren Generälen. Es war Zeit, von der geschlagenen Schlacht zu prahlen, denn viele, das wusste er, würde er nicht mehr erleben.
***
Der alte, fette Broombul hatte endlich genug gestarrt und sich zu den anderen Orks gesellt. Anna verabscheute die Feste fast so sehr wie Karaatasch; für ihn waren sie eine Übung in Geduld, für sie dienten sie dazu, von tumben Orks unsicher angestarrt zu werden. Die offene Feindseligkeit Beblaars empfand sie inzwischen fast als einen Freundschaftsdienst, als einen soliden Faktor in der Politik der Söhne, als etwas, auf das sie sich verlassen konnte. Die anderen Orks waren ihr gegenüber unsicher und verzagt, da sie immerzu ihre Abneigung gegenüber Annas Herkunft und ihren Respekt vor Karaatasch gegeneinander abwägen mussten. Sie hätte sich jedem von ihnen lieber im Kampf gestellt, als zuzusehen, wie es unter den breiten, grünen Stirnen brodelte, aber diese Möglichkeit hatte sie leider nicht. Die Tradition erlaubte zwar Männern jede Form von Duell, aber keine Einzige den Frauen. Noch dazu galt sie noch immer nicht als ein Sohn Aanouk-Nuuns, sondern, so schien der Konsens zu sein, nur als die Lustsklavin des Kriegstreibers. Der Gedanke amüsierte sie, da sie es genoss, diese Funktion für ihn zu erfüllen, aber gleichzeitig auch wusste, dass sie für ihn weit, weit mehr war und auch dem Klan mehr Nutzen brachte, als jede Sklavin es je könnte . Sie hatte gehofft, dass ihre Siege auf dem Schlachtfeld die Orks überzeugen würden, dass sie zu ihnen, und nicht länger zu den Menschen gehörte, aber anders als ihr Kriegstreiber wollte scheinbar keiner von ihnen einsehen, dass man Verbündete nicht ausschlagen sollte, sahen sie auch noch so fremdartig aus.
In diesem Augenblick beschloss Karaatasch, das Fest lange genug mit angesehen zu haben und erhob sich. Er stieg über Anna hinweg und verschwand in dem privaten Teil des Zelts. Das hieß für sie, dass sie ihm bald folgen konnte und die wechselweise vorgetragenen Lobhudeleien der vom Rauch halb besinnungslosen Orks nicht länger mit anhören musste. Die in ihrer Sprache ohnehin reichlich vorkommenden Vokale wurden von den Orks im berauschten Zustand noch bis zum Äußersten gedehnt, sodass Anna bei jedem Wort schon die nächste Silbe, und bei jedem Satz den Ausgang erraten konnte. »Und mit starkem Arm erschlug ich …«, »Und so fand mein Speer, mein Schwert sein Ziel in …«, »… kann Menschlein dankbar sein, zu unserer Größe beigetragen zu haben«, brummten die Krieger vor sich hin. Sie hatte es schon Hunderte Male gehört. »Menschlein« war dabei noch eine der netteren Bezeichnungen für ihre Landsleute. Draußen, vor dem Zelt, prahlten die einfachen Krieger in ganz anderen Tönen.
Anna hatte lange genug gewartet; sie erhob sich, warf einen letzten Blick auf die Krieger, erwiderte das hasserfüllte Funkeln aus Beblaars Ecke mit einem kalten Lächeln und trat durch den Fellvorhang, hinter dem Karaatasch wartete.
Sie wusste, dass sie im Vergleich zu Orks schwach war, trotzdem überraschte Karaataschs Stärke sie immer wieder. Der Kriegstreiber packte sie mit einer Hand an der Kehle und hob sie spielend empor, kaum dass der Vorhang hinter ihr zugefallen war, und drückte sie an eine der breiten und stabilen Zeltstangen. Mit beiden Händen umklammerte sie sein Handgelenk und blickte mit einer Mischung aus Furcht und Erregung in das Gesicht ihres Gebieters. Karataaschs Blick bohrte sich hart und gnadenlos in ihr Innerstes; sein Atem ging ruhig. Anna derweil kämpfte um Luft; sie wusste, dass Karaatasch sie nicht ernstlich verletzen würde, aber dennoch, mit seinem eisernen Griff fest um ihren Hals geschlossen und ihren wiederholten, nutzlosen Versuchen, einzuatmen, kroch Panik in ihr empor. Sie strampelte mit den Beinen, versuchte, mit den Händen seinen Griff zu lockern, kratzte über seine Haut. Vergebens. Dann hatte er genug und ließ sie fallen. Eben noch hatte sie dem Kriegstreiber in die Augen geblickt, jetzt stürzte sie fast einen Schritt in die Tiefe. Bevor sie sich wieder aufrappeln, oder auch nur ein Wort hätte sprechen können, hatte Karaatasch sie, diesmal mit der Rechten, im Nacken gepackt, sie erneut auf die Füße gezerrt und ihr mit der Linken den schlichten, blau-braunen Lederkilt vom Leib gerissen. Als Nächstes presste er sie auf die Knie, befreite seine bereits stattliche Erektion mit einfachem Handgriff und presste Annas Kopf grob auf sein Gemächt. Sie hatte keine andere Wahl, als ihren Mund zu öffnen und seinem Wunsch Folge zu leisten. Sie bemühte sich, ihre Lippen fest um sein stetig wachsendes Glied zu schließen, die richtigen Stellen mit ihrer Zunge zu verwöhnen und ihn so tief in ihren Mund gleiten zu lassen, wie sie konnte – keine leichte Aufgabe, da sie noch immer nicht wieder zu Atem gekommen war.
Karaatasch, nachdem er sie eine Weile schweigend an ihm hatte arbeiten lassen, grunzte, ein Zeichen, dass ihm gefiel, was sie tat, griff Anna mit einer Hand an der Kehle und zog sie auf sein Lager, wo er ihr mit der anderen Hand den Mund zuhielt. Er griff nach seiner Henaaka, dem orkischen Äquivalent einer Reitgerte, die aus einer Vielzahl von steifen Lederriemen geflochten war und legte sie auf dem kniehohen Tisch neben seinem Lager bereit. Anna wusste, was nun folgen würde. Ihr Körper, ihr privatester Teil, reagierte sofort; sie liebte es, von ihm bestraft zu werden, für ihn Schmerzen zu erdulden. Trotzdem presste sie ihre Oberschenkel fest aneinander, um Karaatasch Gelegenheit zu geben, sie auseinanderzuzwingen. Er tat es, verpasste ihr eine Ohrfeige und begann dann, Schläge mit der flachen Hand auf die Innenseite ihrer Oberschenkel und ihr Geschlecht zu setzen. Anna wimmerte leise, genoss aber jeden Moment. Der Schmerz durchzuckte sie wie eine plötzliche, angenehme Erinnerung, jeder Schlag erinnerte sie an das Band, das sie und Karaatasch verband. Sie wusste, dass er sie für die noch folgende, tiefergehende Liebkosung vorbereitete. Als sie nicht mehr wimmerte, sondern bei jedem Schlag zusammenzuckte, als ihre von der Steppensonne bronzefarben getönten Schenkel rot leuchteten, griff ihr Liebhaber wieder zu seiner Henaaka. Sie war kürzer als üblich, eine Spezialanfertigung, die nicht dem Treiben von Hornschafen diente, kaum eine Elle lang. Das steife Leder biss trotzdem tief in Annas Schenkel und hinterließ einen deutlichen, brennenden Schmerz und hervortretende Striemen. Karaatasch schlug wieder und wieder zu, arbeitete sich langsam zu ihrem wartenden Geschlecht vor, um ihm dann kaum mehr als drei mäßig harte Schläge zu verpassen, die Anna trotzdem schreien und hart zusammenzucken ließen. Trotzdem: Drei Schläge waren nichts, und sie hätte, wenn er es verlangt hätte, um mehr gebettelt, bettelte jetzt schon innerlich. Aber heute schien Karaatasch der Sinn nicht nach Bestrafung zu stehen, denn er zog Anna zum Rand des Lagers, ließ sie sich auf allen vieren präsentieren und begann dann, sie mit harten Stößen von hinten zu nehmen. Keine schlechte Alternative, das sah sie ein. Sie stöhnte laut. orkische Männer waren üblicherweise größer als Menschen, aber Karaatasch überragte auch, da war sie sich sicher, seine Stammesgenossen. Und heute schien er sich sogar selbst zu überragen – vielleicht war Anna auch einfach weniger entspannt als sonst. So oder so, Karaatasch hämmerte sein Glied wieder und wieder in ihren dafür kaum vorbereiteten Körper, und sie genoss jede Sekunde. Morgen würde sie vermutlich wund sein, aber morgen war morgen. Mit einer Hand griff sie sich zwischen die Beine und begann, sich zu reiben. Ein Knurren entkam Karaataschs Kehle; keine Drohung (in diesem Fall), sondern ein knappes Zeichen von Zustimmung. Sie rieb sich heftiger, während auch Karaatasch wilder und wilder wurde. Sie stöhnte, schrie, fluchte in Worten, die jungen Priestern den Glauben ausgetrieben hätten, und kam zuletzt, ein erstes Mal, dann ein zweites und drittes Mal, während Karaatasch unbeirrt und mit schier endloser Ausdauer weiter seine Hüften gegen die ihren schlagen ließ. Auch er war stetig lauter geworden, bis sich zuletzt aus dem Grunzen und Stöhnen ein fast schon erschöpftes Seufzen hervorarbeitete. Sie spürte seine Explosion in ihr, dann, wie er sie, immer noch in ihr, hochhob, an seinen Körper presste und sich gemeinsam mit ihr auf sein Lager fallen ließ.
Schweißfeucht lagen sie beide im Licht der drei roten Talkleuchten, die um Karaataschs Lager herum aufgehängt waren. Der Mann, der Anna jetzt in seinen Armen hielt und zufrieden brummte, der Kriegstreiber der Orks, faszinierte sie, genau wie die Sanftheit, die er in solchen Augenblicken (und nur solchen Augenblicken) unter Beweis stellen konnte. Gleiches galt für seine Fähigkeit, in jeder Situation die Kontrolle gewinnen und halten zu können. Fast automatisch geschah es: Um seine Dominanz zu etablieren, hatte er, kaum, dass Anna es selbst gemerkt hatte, ihre besonderen Fähigkeiten in Zaum gehalten, hatte ihr nicht gestattet, auch nur ein einzelnes Wort zu sprechen, bis er sicher sein konnte, dass sie fest unter seiner Kontrolle stand. Hätte sie ihn nicht so gut gekannt, hätte sie es vielleicht als Zufall abgetan, aber so wusste sie ganz genau, dass auch das eine Demonstration für sie und ein Test für ihn selber gewesen war: Auch ein Spruchmagier war ihm nicht gewachsen – auch auf diesem Schlachtfeld nicht. Selbst hier, in seinem privaten Heiligtum, hier, wo es um seine Lust allein ging und sie nichts anderes als sein (ausgesprochen!) williges Spielzeug war, ließ er zu keinem Zeitpunkt zu, dass sie einen (wenn auch noch so kleinen) taktischen Vorteil hätte erringen können.
Karaatasch war ein Krieger und mehr als das. Er dachte Krieg, atmete Krieg, war Krieg. Egal ob mit dem Schwert im Zweikampf, oder als General die Bewegungen ganzer Armeen steuernd: Für Karaatasch gab es nichts als den Kampf und zu kämpfen, hatte für ihn schon immer bedeutet, zu siegen. Er sah die Welt, den Kampf, anders als andere Wesen, soviel wusste Anna, auch wenn sie den Unterschied nur in besonderen, lichten Momenten erkennen konnte. In Schlachten, die beide gemeinsam geschlagen hatten, hatte sie zuweilen seinem Blick folgen können, hatte dadurch die kleinen Verwirbelungen im Strom der aufeinanderprallenden Heere ausmachen können, die seinen nächsten Befehl bestimmten, die winzigen Schwachstellen, das Zurückzucken des ersten Soldaten, welches das Kollabieren einer ganzen Formation ankündigte.
Karaatasch siegte, weil er die Gesetzmäßigkeiten verstand, nach denen alle Arten von Kämpfen entschieden wurden. Sein Leben war der Krieg. Das hieß wiederum aber auch, dass er ohne Krieg kein Leben hatte. Anna begegnete ihm mit Ehrfurcht, keine Frage. Dass sie allerdings auch Verständnis, ja, Mitleid mit ihm und seiner besonderen Position in der Welt hatte, musste sie sich ebenfalls eingestehen. Er war gezwungen, auf alle Zeiten neue Kämpfe, Konflikte und Kriege zu suchen, bis ihn einer von ihnen das Leben kosten würde.
Die Geräusche des Fests, das nur wenige Schritte entfernt immer noch tobte, wurden durch die dicken Fellvorhänge fast völlig erstickt. Nur besonders tiefe Stimmen, wie die Broombuls etwa, konnte sie noch ausmachen.
Karaatasch strich langsam über Annas schweißfeuchte Brust. Liebte sie ihn? Sie war sich nicht sicher. Sie wusste, was er brauchte, sie wusste, wie sehr er unter dem Frieden und der Tatenlosigkeit, die er brachte, litt. Es gab wenig Beschäftigungen, die Karaatasch auch nur ansatzweise geben konnten, was der Krieg ihm gab. Dabei war es völlig gleichgültig, dass er selbst diesen Frieden erst produziert hatte, indem er den Menschen mehrere empfindliche Niederlagen beigebracht hatte. In seinen breiten Schultern und auf seinen Unterarmen spielten die Muskelstränge wie Schlangen, während er weiter abwesend mit ihrer Brust spielte. Sie tat, was sie konnte, um ihm zu dienen, sowohl als seine Beraterin auf dem merkwürdigen politischen Parkett der Söhne von Aanouk-Nuun, als auch als seine Konkubine und Vertraute in seinem Bett. Sie lächelte. Eine merkwürdige Position für einen Menschen, nein, eine merkwürdige Position für egal wen oder was. Viel war geschehen, seit sie aus ihrer Heimat und dem Schoß ihrer Familie gerissen worden war. Und nicht nur Schlechtes, wie sie jetzt im Rückblick erkennen konnte. Nicht nur Schlechtes, aber genug.
Teil 1: Veränderte Pläne
Als Anna ihren Vater hatte überzeugen können, sie endlich, wie er es seit Jahren versprochen hatte, mit auf eine seiner Handelsreisen zu nehmen, wusste sie nichts von Orks, nichts von ihrer Sprache, nichts von Karaatasch, wenig über ihren Vater und auch wenig über sich selbst. Sie war achtzehn Jahre alt und sehr zufrieden mit sich, wie sie in dem mit gelben Stoff bespannten Wagen saß, der den Abschluss der kleinen Handelskolonne bildete. Das helle, sanfte Licht des Spätherbstes fiel durch das Tuch, tauchte das Innere des Wagens in sanfte Farben und funkelte auf der Spitze des Griffels, den Anna in den Händen hielt. Das gemächliche Schaukeln des Wagens ließ den Kasten mit Schreibutensilien leise klappern. Anna rechnete konzentriert. Auf einem Wachstäfelchen reihte sie Zahl an Zahl. Schließlich fand sie das Ergebnis, nach dem sie gesucht hatte und setzte einen dünnen Strich darunter; sie lächelte. Jetzt konnte sie ihrem Vater doch zeigen, dass sie ihm bei seiner Arbeit zur Seite stehen konnte. Obwohl er immer behauptete, dass Schulwissen nichts im Händlerberuf half, hatte sie nur mit dem, was ihre Arithmetiklehrer ihr beigebracht hatten, das Gegenteil bewiesen. Anna schlug die Plane des Wagens zurück und sprang in einen sonnigen Herbstnachmittag hinaus. Die Kolonne, die aus drei Wagen bestand, zog gemächlich an einem Waldstück vorbei. Die Blätter leuchteten golden, die Hufe der Zugpferde klopften langsam über den gepflasterten Weg. Die Wachmannschaft, von der Anna nicht wusste, wozu sie sie eigentlich brauchten, schritt wachsam wie eh und je neben den Wagen her. Die Blicke einiger der Männer folgten ihr; sie hatte das Gefühl, dass sie, immer wenn Anna in der Nähe weilte, besonders auf sie achten wollten. Vielleicht hatte ihr Vater sie extra instruiert. Jetzt konnte sie auch schon seine Stimme vom ersten Wagen her hören. Er war zornig – wie so oft.
Anna wusste, dass man ihren Vater, Karsten, oft den garstigen Karsten nannte, aber sie wusste auch, dass er tief in seinem Inneren ein guter Mann war, der sich sehr um seine Frau, seine Tochter und seine Angestellten sorgte. Sicherlich tat man ihm mit einem solchen Spitznamen unrecht.
»Eine Abmachung wird nicht einfach so geändert, nur weil man seine Arbeit nicht mehr machen will! Was glaubst du, wo ich wäre, wenn ich versuchen würde, auf die Art Geschäfte zu machen! Sicher nicht dort, wo ich jetzt bin! Dafür sollte man Banditen wie dich enthaupten! Vierteilen, damit die ganze Stadt noch Spaß daran hat!«
Inzwischen war Anna nahe genug am Wagen, um die Stimme des Anführers der Wächter hören zu können. Er war ein ruhiger Mann, den Anna bisher nie auch nur in Eile, oder gar zornig gesehen hatte. Seine Männer nannten ihn den Müller.
»Karsten, es ist Teil unserer Abmachung, es bringt dir überhaupt nichts, zu schreien. Falls sich zeigen sollte, dass die Kolonne in konkreter Gefahr ist, waren drei Gold pro Kopf mehr ausgemacht. Nun, hast du den abgebrannten Hof gesehen, oder nicht? Und sicher willst du nicht behaupten, der Bauer, seine Frau und seine Kinder hätten sich alle zufällig vor der Scheune die Kehlen …« Aber er sprach nicht weiter, als er merkte, dass Anna zuhörte. Karsten, der mit dem Rücken zu Anna stand, drehte sich nach der Störung um und zwang sich zu einem Lächeln.
»Anna, Schatz, ich muss gerade etwas Geschäftliches besprechen. Kann, was auch immer du willst, nicht etwas warten?«
Der Müller stand auf und wandte sich zum Gehen.
»Sprich mit deiner Tochter, Karsten. Vielleicht wird dich das überzeugen, dass deine Leibwächter die letzten sind, die du um ihren Lohn prellen möchtest.«
Karsten folgte dem Müller aus dem Zelt, schien ihm noch etwas hinterherrufen zu wollen, überlegte es sich dann aber anders und wandte sich an Anna.
»Mädchen, was willst du denn?«
Gerade war Anna in Gedanken noch bei den Worten des Müllers gewesen, jetzt aber fiel ihr das Wachstäfelchen in ihren Händen ein und sie lächelte. Endlich würde sie ihren Vater beeindrucken können! Ihr Vater lief in Richtung des Endes der Kolonne und sie folgte ihm.
»Nun, Vater, du weißt doch noch, wie du sagtest, dass ich mit meinem Schulwissen hier überhaupt nichts schaffen könnte, und ich meinte, genau deshalb wolle ich ja mitkommen, damit ich etwas lernen könne? Ich glaube, wir werden jetzt beide etwas lernen. Weißt du, was ich getan habe?«
Karsten blickte nervös in Richtung des Waldes und der Wächter, die, wie Anna etwas irritiert merkte, ihre Sachen zu packen schienen. Stockend fuhr sie fort.
»Also, ich bin die Bücher durchgegangen. Und, na ja, die Zahlen …«
Plötzlich fuhr Karstens Kopf ruckartig zu ihr herum. Sein Blick erinnerte sie an eine Schraubzwinge; plötzlich hörte er ihr ganz genau zu.
»Was ist mit den Zahlen, Mädchen?«
»Ich … also, ich will ja nicht sagen, dass du einen Fehler gemacht hast, aber … aber, wenn die Magistrate deine Zahlen prüfen …«
Karsten packte sie am Arm und drückte sie gegen die Zeltplane des Wagens.
»Mädchen«, zischte er, »du auch? Du auch? Von allen warst du die Letzte, von der ich es erwartet hätte. Willst du also auch an mein Gold, ja? Aber …«
Anna verstand nicht, was ihr Vater meinte. Warum sollte sie an sein Gold wollen? Sie waren doch eine Familie! Und überhaupt, sie hatte ihm doch nur von einem Fehler …
Aber genau wie Karsten in seinen Worten, wurde auch Anna in ihren Gedanken unterbrochen, als einer der Wächter mit einem dumpfen Aufprall zu Boden ging.
Karsten blickte sich verdutzt um, gewann aber die Fassung zurück und zischte seine Tochter an: »In den Wagen! Wir klären das später.«
Dann zückte er einen Dolch, drehte sich um und schrie: »Angriff! Wir werden angegriffen!«
Wie auf sein Stichwort ergoss sich ein Hagel aus Armbrustbolzen aus dem Waldstück. Einer von ihnen durchbohrte direkt neben Annas Kopf das gelbe Tuch des Wagens, in dem sie noch vor wenigen Minuten ruhig gerechnet hatte. Um sie herum brach Chaos aus, Menschen sanken unter Schreien zu Boden und die Pferde wieherten laut vor Angst. Die Wachen, die eben noch die Händler im Stich lassen wollten, formierten sich jetzt zwischen den Wagen und dem Waldrand. Aus dem, unter lautem Gebrüll, eine Horde schmutziger und wilder Männer gestürmt kam. Anna beeilte sich, im Wagen zu verschwinden. Das geheime Fach im Boden, in dem ihr Vater die verschiedenen, von ihm so innig verehrten Geschäftsbücher aufbewahrte, sollte gerade groß genug sein, damit sie sich darin verstecken konnte. Während sie den Rand der Klappe mit zittrigen Fingern nach dem gut eingepassten Öffnungsmechanismus abtastete, hörte sie von draußen das Aufeinanderschlagen von Waffen, die wilden Schreie der Angreifer und die ruhige Stimme des Müllers, der wieder und wieder Befehle rief – bevor er mitten im Satz verstummte. Annas Herz pochte wie wild, als sie die Klappe über sich schloss und versuchte, sich zu beruhigen. Sicherlich würden die restlichen Wächter die Situation meistern können. Sicherlich! Ihr Vater wäre doch niemals ohne ausreichenden Schutz in die Randgebiete des Königreichs gezogen …
Doch dann hörte sie, wie direkt neben dem Wagen jemand auf die Knie gestoßen wurde, gefolgt von einem widerwärtigen, gurgelnden Geräusch. Jemand lachte.
»Das war der Letzte!«, gefolgt von mehr dreckigem Lachen. Die Wächter waren tot, vielleicht auch alle anderen. Anna war allein.
***
Vorsichtig, ganz vorsichtig und so leise, wie sie nur konnte, drehte sich Anna in ihrem Versteck und Gefängnis. Sie durfte auf gar keinen Fall ein Geräusch machen, wer wusste schon, was die wilden Männer dort draußen mit ihr machen würden, würden sie sie entdecken! Aber sie hatte einen Lichtschimmer durch einen Spalt in den Brettern sehen können. Sie musste einfach wissen, was draußen vor sich ging! Sie glaubte, sie hätte die Stimme ihres Vaters gehört …
Die trockenen Bretter, die sie umgaben, knarrten nur leise, trotzdem fürchtete Anna das Schlimmste – aber jetzt konnte sie nach draußen blicken und sah, dass niemand in ihre Richtung eilte, niemand zu ihr herüberblickte. Die Erleichterung, die durch ihren Körper strömte, verwandelte sich fast sofort in eiskalte Angst: Niemand bewegte sich, weil alle Räuber um eine einzelne, kniende Gestalt standen, umgeben von toten Wächtern. Und der Mann, der auf dem Boden kniete, war niemand anderes als ihr Vater, Mund und Nase verschmiert von frischem Blut. Vor ihm stand, unverkennbar, der Hauptmann der Räuber. Er überragte alle anderen Männer um mindestens eine Haupteslänge, seine Schultern waren breit und unter seinem dreckigen Lederpanzer trug er ein grobes, rotes Hemd. Seine Waffe, eine Keule, hatte er neben sich auf den Boden gesetzt, seine Haare und Bart waren ungepflegt. Dann sprach er mit lauter Stimme:
»Ich hab gesagt: Wo ist das Gold! Na los, wo hast du’s, oder willst du weiter überredet werden?«
Ihr Vater spielte, wie Anna es von ihm kannte, natürlich das Unschuldslamm. Sie war erstaunt von so viel Mut! Selbst jetzt, in dieser so hoffnungslosen Situation, gab Karsten nicht auf, versuchte, das Blatt doch noch zu wenden.
»Bitte, ich sagte doch schon, ich habe kein Gold! Waren habe ich, aber noch nichts verkauft, Schrauben und Bolzen, in allen Wagen!«
»Ein Händler ohne Gold. Dass ich das noch erleben darf!« Die Männer, die bisher schweigend ihrem Hauptmann zugesehen hatten, stimmten in dessen Gelächter ein.
»Keiner von euch würde ohne Gold auch nur zum Scheißen gehen. Dafür kenne ich euch zu gut. Ihr zwei!«
Er zeigte auf zwei seiner Männer.
»Geht und holt dem Fettsack ein paar seiner Bolzen. Dass er nur keine Mahlzeit verpasst!«
Wieder lachten die Räuber und Anna hatte das Gefühl, sie könnte den Schweiß auf der Stirn ihres Vaters ausbrechen sehen. Er fing an, zu sprechen, wurde aber rüde durch einen Schlag des Hauptmanns unterbrochen. Karsten fiel auf die Seite und blieb still liegen.
»Du hattest deine Chance, Trödler. Jetzt wirst du fressen, und am Ende kriegen wir dein Gold trotzdem.«
Annas Herz pochte – wenn sie nun ihren Vater töten würden – musste sie zusehen – sie konnte nichts tun – musste sich verstecken – aber ihr Vater? Was sollte sie nur tun? Zusehen, wie er gefoltert wurde? Sie wollte schon die Holzklappe über sich öffnen, nach draußen klettern und sie wusste nicht, was tun, als ihr Vater wieder versuchte, zu sprechen. Er hatte sich aufgerappelt, aber wieder schickte ein Schlag des Hauptmanns ihn zu Boden. Anna konnte unmöglich helfen, was sollte sie gegen diese Monster ausrichten? Eine eiserne Hand schien ihr Herz zu greifen und es zusammenzudrücken. Sie konnte ihrem Vater nicht helfen. Sie konnte nur zusehen.
Aus dem ersten Wagen kamen jetzt die zwei Räuber und schwenkten triumphierend einen Eimer, der laut rasselte. Sie stellten, unter Jubelrufen der Zusehenden, die Bolzen vor ihrem Hauptmann ab, der mit einer Hand hineinlangte, bösartig grinste und sich wieder Karsten zuwandte. Die zwei Räuber, die die Bolzen geholt hatten, griffen ihn fest unter seinen Armen und zerrten ihn auf seine Knie. Ein dritter sprang dazu und zwang seinen Kiefer nach unten. Anna konnte seine vor Furcht geweiteten Augen sehen, als der Hauptmann nach einem Blechtrichter griff, der von seinem Gürtel hing.
»Sei froh, Alter«, knurrte der Hauptmann, »dass du Eisenwaren transportierst. Viel mehr Spaß macht uns das Ganze bei Bauern, die gerade Gülle austragen!«
Das Gelächter der Banditen brandete über Anna hinweg. Ihr Vater begann, zu zappeln, sich zu wehren, hatte aber keine Chance gegen seine Peiniger. Der Hauptmann rammte ihm den Trichter zwischen die Zähne und hielt ihn in Position. Karsten presste seine Augen panisch zu. Tränen sickerten durch die geschlossenen Lider. Auch Anna weinte, Tränen der Angst, der Hilflosigkeit und des Zorns. Wie konnten diese Kreaturen es wagen? Was gab ihnen das Recht dazu?
Der Augenblick streckte sich. Der Hauptmann ließ einige der Bolzen zurück in den Eimer fallen. Er griff hinein, wühlte in ihnen herum.
Auf den Knien, nah vor Karstens Gesicht, fragte er:
»Händler. Du hast Gold, nicht wahr?«
Karsten nickte panisch und schnell.
»Viel Gold, nicht? Der Eisenhandel ist lukrativ in diesen Tagen?«
Karsten nickte erneut. Noch immer wagte er es nicht, seine Augen zu öffnen.
»Wirst du uns geben, was wir wollen?«
Karstens Augen flogen auf, starrten kurz in die des Hauptmanns. Dann nickte er, und der Hauptmann zog ihm langsam den Trichter aus dem Mund.
Anna wagte es nicht, erschöpft auszuatmen. Vielleicht würden sich die Räuber ja doch mit dem Gold ihres Vaters zufriedengeben. Aber was, wenn nicht? Jetzt brauchten sie Karsten auch nicht mehr. Aber vielleicht hatte er doch einen Plan? Eine Idee, die Räuber fortzulocken? Sicherlich würde er ihnen nicht sagen, dass das Gold im ersten Wagen lagerte, in einem Versteck ganz ähnlich demjenigen, in dem sie selbst gerade lag.
»Das Gold … mein Gold«, wimmerte Karsten, und Anna hatte das Gefühl, dass sein Blick kurz zu ihrem Versteck wanderte, dass er ihr durch den winzigen Spalt hindurch in die Augen sah. »Mein ganzes Gold ist in einem Fach unter … unter den Brettern im … im dritten Wagen versteckt.«
Sofort sprangen einige Räuber los, um das Versteck zu plündern. Anna war starr, fassungslos. Hatte ihr Vater gerade … wusste er … Sie wurde unterbrochen von groben Händen, die an den Brettern über ihr zerrten. Sie fanden den Mechanismus, der die Klappe öffnete, Anna schrie. Die Männer lachten, zogen sie an einem Arm aus der Klappe.
»Ein Bonus, nicht nur Gold, sondern endlich auch frisches Fleisch! Merle wird sich freuen …«
Der eine hielt Anna fest, der andere suchte unter den Rechnungsbüchern nach Gold, aber vergebens.
»Verdammich, der Alte hat wieder gelogen!«
Sie zogen Anna aus dem Wagen heraus, die noch immer benommen war von der Tat ihres Vaters. Sie wehrte sich nicht.
Schweigend beobachtete die Räubermeute, wie sie aus dem Wagen bugsiert und vor den Hauptmann gestellt wurde. Der musterte sie mit steinerner Miene, dann breitete sich unter seinem dichten, schmutzigen Bart ein breites Grinsen aus. Anna bemerkte, wie merkwürdig hell seine Zähne waren.
»Schaut euch das an, Jungs«, brüllte er und griff sich Anna, »was für einen Spaß wir mit ihr haben werden!«
Damit zog er fest an Annas Arm, sodass sie herumgewirbelt wurde, presste ihren Rücken gegen seinen Bauch und zerrte mit beiden Händen ihr Kleid von ihren Schultern, sodass ihre nackten Brüste für alle Räuber zu sehen waren. Jubel brach aus, und in dem kurzen Augenblick der Unachtsamkeit hechtete Karsten von den Knien nach vorne auf seine Füße und wand sich wie das Wiesel, das er war, zwischen den Räubern hindurch zum Wagen.
Der Hauptmann hob seine Hand.
»Lasst den Feigling laufen! Wir haben heute etwas viel … viel Besseres gefunden als sein Gold!«
Anna sank zu Boden, unfähig, sich länger aufrecht zu halten. Sie hörte, über das Jaulen und Toben der Banditen, wie ihr Vater dem Pferd die Peitsche gab und verschwand. Er hatte sie verraten und verkauft. Nackt und hilflos einer Horde Männer überlassen, die vor dem Töten, und Schlimmerem, nicht zurückschreckten.
Man knebelte und fesselte sie. Sie ließ es geschehen. In einem der erbeuteten Wagen wurde sie ins Lager der Räuber gefahren. Der Griffel, den sie vor wenigen Minuten noch benutzt hatte, schaukelte über ihr: unerreichbar, da sie nicht einmal eine Hand ausstrecken konnte. Und so begann Annas neues Leben, stumm und hilflos. Aber nicht mehr lange.
Lektionen
Das Gefühl der Betäubung und des Schocks hielt noch lange vor. Während der Fahrt, die etwa einen halben Tag in Anspruch nahm, spürte Anna kaum etwas, nur ein dumpfes, entferntes Pochen in ihrer Brust. Auch nach ihrer Ankunft im Lager der Banditen, tief in dem goldenen Wald, ließ sie sich ohne Widerstand von den Räubern in einen geräumigen Käfig stecken, um dann, als die Nacht hereinbrach, plötzlich in Schluchzen und heiße Tränen auszubrechen. Das Pochen in ihrer Brust war zu einem Feuer geworden. Verraten und verkauft! Die Verzweiflung suchte sich ihren Weg wie ein reißender Strom, der sie erbarmungslos mit sich fortriss. Zuletzt fühlte sie sich noch leerer als zuvor, aber ihre Tränen waren versiegt. Sie schlief auf einem Bündel stinkenden Strohs ein.
Der nächste Tag brach gräulich herein. Anna war bereits kurz vor der Dämmerung aufgewacht. Das Lager schien schon länger auf den Beinen zu sein; niemand schenkte ihr Beachtung. Neugierig blickte sie sich um. Ihrem Gefängnis gegenüber sah sie ein großes Zelt mit rechteckiger Grundfläche, geschmückt mit militärischen Fahnen, aber sie konnte die Farben nicht zuordnen, obwohl sie ihr bekannt vorkamen. Direkt neben dem großen Zelt erhob sich ein nur wenig kleineres, rundes Zelt, aus dessen Spitze sich ein Schornstein erhob. Das musste das Küchenzelt sein. Wiederum rechts vom Küchenzelt plätscherte ein Bach, der das Lager in dieser Richtung abschloss. Die übrigen Seiten waren mit einer stabilen Palisade gesichert. Zu Annas Linken zogen sich kleinere Versionen des großen Zelts in ordentlichen Reihen, und vor diesen wiederum eine Menge bedeutend weniger ordentlicher Zelte verschiedenster Machart. Zwischen den Zelten konnte sie ein Tor sehen, das zwar bewacht wurde, aber scheinbar nicht zu streng. Die Räuber hatten sich offenkundig eingerichtet und rechneten nicht mit Angriffen. Trotz Annas hoffnungsloser Situation arbeitete ihr Verstand wie wild, verschlang und prüfte alles. Was sollte sie auch sonst tun? Ihre Tränen waren geweint und da sie nicht unmittelbar in Gefahr war, war es nur klug, sich, so gut sie konnte, mit ihrer neuen Umgebung vertraut zu machen.
Es herrschte rege Aktivität im Lager. Einige Männer holten Wasser, das zu einem allgemeinen Waschplatz bei den Zelten gebracht wurde, außerdem in Teilen zu dem großen Zelt, in dem sicher der Hauptmann Hof hielt. Es wurde Feuerholz aus dem Wald gebracht und in handliche Scheite gehackt, welche neben dem Küchenzelt gestapelt wurden. Außerdem wurde die Palisade ausgebessert, und unter Jubel trugen zwei Männer einen erlegten Hirsch durchs Tor. Einer der beiden hatte sie gestern aus dem Versteck gezerrt! Jetzt, wo ihm seine Kumpanen gratulierten, wirkte er, trotz der wilden Haare, viel weniger erschreckend.