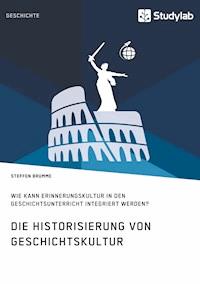
Die Historisierung von Geschichtskultur. Wie kann Erinnerungskultur in den Geschichtsunterricht integriert werden? E-Book
Steffen Brumme
29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Studylab
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Geschichtskultur ist ein kontrovers diskutiertes Thema. Wie genau dieses nun in den Schulunterricht übernommen werden kann vielleicht sogar noch mehr. Dieses Buch greift diese Kontroverse auf und nimmt außerdem die Historizität von Geschichtskultur genauer in den Blick. Hierzu wird die von Schönemann und Pandel geführte Debatte um die Historisierungsfähigkeit von Geschichtskultur ausführlich dargestellt und diskutiert. Ziel dieser Untersuchung ist die Beantwortung der Leitfrage, wie Erinnerungs- und Geschichtskulturen konzeptionell historisiert werden können und welche Potentiale sie für den Geschichtsunterricht besitzen. Aus dem Inhalt: - Geschichtsbewusstsein; - Geschichtsdidaktik; - Geschichtskultur; - Erinnerungskultur; - Historisierung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 87
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Geschichtsbewusstsein, Geschichtskultur und historische Geschichtskultur in der Geschichtsdidaktik
2.1 Geschichtsbewusstsein
2.2 Geschichtskultur
2.3 Historische Geschichtskultur als Unterrichtsgegenstand? Der Disput zwischen Schönemann und Pandel
3 Historisierung von Geschichtskultur
3.1 Überblick über den Forschungsstand
3.2 Synthese gelungener Konzepte zur Historisierung von Erinnerungskulturen
3.3 Entwicklungsmodell der Erinnerungskulturen
4 Potentiale historischer Erinnerungs- und Geschichtskultur für den Geschichtsunterricht
4.1 Die gegenwärtige Geschichtskultur verstehen
4.2 Gegenwärtige geschichtskulturelle Objektivationen verstehen
4.3 Eine Vergangenheit anhand ihrer Erinnerungskultur erschließen
4.4 Integration in das Kompetenz-Strukturmodell historischen Denkens
5 Zusammenfassung
6 Literaturverzeichnis
7 Anhänge
1 Einleitung
Geschichtskultur ist seit vielen Jahren das bestimmende Thema der Geschichtsdidaktik. Eine schier unüberschaubare Masse an Dissertationen, Zeitschriftenartikeln und Sammelbänden mit geschichtskulturellen Themen überfluten den geschichtsdidaktischen Markt, Konferenz an Konferenz diskutiert über die Auswirkungen dieser inzwischen nicht mehr allzu neuen Zentralkategorie für die Disziplin und den Geschichtsunterricht. Augenfällig sind in diesem Zusammenhang zwei Dinge: Ein konsensorientierter Debattenstil hat die Freude an der kontroversen Zuspitzung abgelöst, die die (zumindest westdeutsche) Geschichtsdidaktik über Jahrzehnte prägte. Im Vordergrund stehen nicht mehr die großen gesellschaftspolitischen Kämpfe. Vielmehr diskutiert die Geschichtsdidaktik heute nuanciert über Kompetenzen, Unterrichtsmethoden etc. Darüber hinaus überrascht die Tatsache, dass innerhalb der geschichtsdidaktischen Forschung zur Geschichtskultur die Historizität eben dieser kaum eine Rolle spielt. Für eine geschichtswissenschaftliche Disziplin ist das Ausblenden der Geschichtlichkeit einer zentralen Untersuchungskategorie atypisch. Diese Arbeit setzt an diese beiden Beobachtungen an. Einerseits wird die prominent ausgetragene Kontroverse rund um das Thema Geschichtskultur aufgegriffen, anderseits die Historizität von Geschichtskultur genauer in den Blick genommen. Die von Bernd Schönemann und Hans-Jürgen Pandel geführte Debatte um die Historisierungsfähigkeit von Geschichtskultur und die darin vorgebrachten Argumente werden ausführlich in Kapitel 2.3. dargestellt und diskutiert. Durch die Auseinandersetzung mit den Positionen der beiden renommierten Vertretern der Geschichtsdidaktik wurden die zwei erkenntnisleitenden Fragestellungen dieser Arbeit abgeleitet: Wie kann Geschichtskultur konzeptionell historisiert werden und welche Potentiale besitzt vergangene Geschichtskultur für den Geschichtsunterricht? Im Laufe dieser Arbeit werden diese Fragen umformuliert zu: Wie können Erinnerungs- und Geschichtskulturen konzeptionell historisiert werden und welche Potentiale besitzen diese für den Geschichtsunterricht? Um verständlich zu machen, warum diese Fragen für die Geschichtsdidaktik und den Geschichtsunterricht relevant sind, bedarf es einer ausführlichen Hinführung. Kapitel 2.1. und 2.2. geben daher einen Überblick über die Forschung zu den beiden Zentralkategorien der Disziplin: Geschichtsbewusstsein und Geschichtskultur. Ein Abriss der Definitionen, des wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Kontextes ihrer Durchsetzung sowie ihrer wechselseitigen Bedingtheit soll die Bedeutung der Forschungsfragen für die Geschichtsdidaktik und den Geschichtsunterricht zeigen. Die zentralen Kapitel 3 und 4 dienen der Beantwortung der erkenntnisleitenden Fragestellungen. Die Historisierung von Geschichtskultur wird in Kapitel 3.1. durch einen kursorischen Überblick über die geschichts- und kulturwissenschaftliche Forschungsliteratur in diesem Themenfeld eingeleitet. In Kapitel 3.2. wird mittels einer Synthese vorhandener Ansätze zur Historisierung des gesellschaftlichen Umgangs mit der Vergangenheit ein eigenes Modell entwickelt. Im Rahmen einer Masterarbeit kann allerdings lediglich ein vorläufiges Modell konzipiert werden. Dieses soll der fachwissenschaftlichen und geschichtsdidaktischen Forschung als Orientierung dienen, um theoretische und empirische Untersuchungen durchführen zu können. Im Laufe dieser Arbeit kam ich zu der Einsicht, dass die bis Kategorie Geschichtskultur unter die übergeordnete Kategorie der Erinnerungskulturen subsumiert werden muss. Kapitel 3.3. erklärt daher ausführlich, warum Geschichtskultur als spezifische Erinnerungskultur der Moderne verstanden werden kann. Zusätzlich diskutiere ich in diesem Kapitel die Fragen, ob die Synthese von zukünftigen Forschungsergebnissen zu einem Entwicklungsmodell der Erinnerungskulturen sinnvoll wäre und ob die Geschichtskultur der Moderne in der jüngsten Vergangenheit durch eine neue Erinnerungskultur der Postmoderne abgelöst wurde.
In diesem Zusammenhang ergab sich ein Grundproblem dieser Arbeit, das nur ansatzweise von mir gelöst werden kann. Im Kontext der Themen Geschichts- und Erinnerungskultur bestehen innerhalb der Geschichtswissenschaft eine Vielzahl von sich ergänzenden, überlagernden und widersprechenden Definitionen, Kategorien, Begriffen und Konzepten. Die vorliegende Arbeit versucht, Klarheit in die Pluralität dieses Forschungsfeld zu bringen. Eine abschließende Klärung dieser Problematik muss allerdings der weiteren Forschungsdiskussion überlassen werden.
Die drei Unterkapitel des letzten Abschnittes erarbeiten jeweils ein Potential der Thematisierung von historischer Erinnerungs- und Geschichtskultur für den Geschichtsunterricht. Die theoretisch gewonnenen Potentiale sollen jeweils kurz an Beispielen verdeutlicht werden, ohne dass eine tatsächliche didaktische Umsetzung angestrebt werden konnte. Auch für diese Überlegungen gilt, dass sie einen vorläufigen Versuch darstellen. Erst eine zukünftige Erforschung von historischen Erinnerungs- und Geschichtskulturen wird die unterrichtspragmatische Nutzung der Potentiale in ausreichendem Maße gewährleisten.
2 Geschichtsbewusstsein, Geschichtskultur und historische Geschichtskultur in der Geschichtsdidaktik
2.1 Geschichtsbewusstsein
Die Frage, warum sich Geschichtskultur zur zweiten zentralen Kategorie der Geschichtsdidaktik entwickelte, ist nicht zu beantworten, ohne das deutlich veränderte theoretische Selbstverständnis der Geschichtsdidaktik seit den späten 1970er Jahren zu betrachten.[1] Insbesondere durch die Arbeiten von Karl-Ernst Jeismann transformierte sich die Geschichtsdidaktik von einer Didaktik des Geschichtsunterrichts zu einer umfassenden Didaktik der Geschichte. Voraussetzung für diese Neuorientierung und Erweiterung war die Einführung des Begriffes Geschichtsbewusstsein, welcher relativ schnell zu der Zentralkategorie der Geschichtsdidaktik aufstieg. Anfangs definierte Jeismann Geschichtsbewusstsein relativ unspezifisch in „einem sehr allgemeinen Sinne als das Instrument der unterschiedlichsten Vorstellungen von und Einstellungen zur Vergangenheit“[2]. Er formulierte damals Grundannahmen, die für die heutige Geschichtsdidaktik noch immer maßgeblich sind. Erstens erweiterte er den Gegenstandsbereich der Geschichtsdidaktik um das „Geschichtsbewusstsein in der Gesellschaft“, „sowohl in seiner Zuständlichkeit, den vorhandenen Inhalten und Denkfiguren, wie in seinem Wandel, dem ständigen Um- und Aufbau historischer Vorstellungen, der stets sich erneuernden und verändernden Rekonstruktion des Wissens von der Vergangenheit“[3]. Zweitens traf er fundamentale Entscheidungen für die weitere Entwicklung der Geschichtsdidaktik. Geschichte konnte im Kontext von Geschichtsbewusstsein nicht mehr als Gesamtheit von „richtigem“ Wissen über die Vergangenheit verstanden werden, sondern als ein retrospektives Konstrukt:
'Geschichte' tritt uns entgegen als ein auf Überreste und Tradition gestützter Vorstellungskomplex von Vergangenheit, der durch das gegenwärtige Selbstverständnis und durch Zukunftserwartungen strukturiert und gedeutet wird. Nur in dieser Form haben wir Geschichte in unserer Vorstellung; sie ist eben nicht die reale Vergangenheit selbst oder ihr Abbild, sondern ein Bewußtseinskonstrukt, das von einfachen Slogans bis zu elaborierten, mit wissenschaftlichen Methoden gestützten Rekonstruktionen reicht.[4]
Aus diesen grundsätzlichen Überlegungen heraus entwarf Jeismann Aufgabenfelder, die die Arbeit der Geschichtsdidaktik in den folgenden Jahren und Jahrzehnten prägten. Auf der einen Seite wies er der Geschichtsdidaktik die Aufgabe zu, die Morphologie, die Genese sowie die Funktion sowohl des individuellen Geschichtsbewusstseins als auch des Geschichtsbewusstseins in der Gesellschaft theoretisch und empirisch zu untersuchen.[5] Auf der anderen Seite sollte die neue zentrale Kategorie aus unterrichtspragmatischer Perspektive zu einer Neuausrichtung der Inhalte, der Ziele und der Methoden des Geschichtsunterrichts führen.[6] Hierbei entwickelt Jeismann ein dreidimensionales Modell aus Sachanalyse, Sachurteil und Werturteil, das zur Herausbildung eines reflektierten und reflexiven Geschichtsbewusstseins geeignet sei.[7] Die Erfüllung dieser normativen Zielsetzung im Hinblick auf das Geschichtsbewusstsein von SchülerInnen[8] sowie eine umfassende Selbstaufklärung der Gesellschaft über ihre Geschichtsvorstellungen durch die Geschichtsdidaktik galten ihm als zentrale Aufgaben einer Geschichtsdidaktik, welche darauf abzielten, „die gegenwärtige Gesellschaft in ein 'bewußtes' Verhältnis zu ihrer Vergangenheit zu setzen“[9].
Die Jeismannschen Forschungen zum Geschichtsbewusstsein riefen in der Folge eine Vielzahl von theoretischen Weiterführungen und Differenzierungen sowie empirischen Analysen hervor. Insbesondere gelang es Jörn Rüsen im Rahmen seiner geschichtstheoretischen Überlegungen, das Geschichtsbewusstsein in seiner lebenspraktischen Konstitution zu verorten und dadurch historisches Denken als „allgemeine und elementare Lebensvorgänge des Menschen (Zeiterfahrungen und Zeitdeutungen)“[10] zu begreifen: „Geschichtsbewusstsein ist nun die Art und Weise, in der sich das dynamische Verhältnis zwischen Zeiterfahrung und Zeitabsicht im menschlichen Lebensprozeß realisiert.“[11] Durch die theoretische Integration des Geschichtsbewusstseins in den Lebensvollzug des Menschen[12] gelangt Rüsen zu einem umfassenderen Verständnis von historischem Denken und dessen Bedeutung für das menschliche Leben. Rüsen versteht die Leistung des Geschichtsbewusstseins als „Sinnbildung über Zeiterfahrung“[13]. Meines Erachtens ermöglichten diese theoretischen Überlegungen eine stringentere Definition von Geschichtsbewusstsein, da dieses nun begriffsadäquat so aufgefasst wird, dass man unter „Geschichtsbewußtsein den Inbegriff der mentalen Operation versteht, mit denen Menschen ihre Erfahrung vom zeitlichen Wandel ihrer Welt und ihrer selbst so deuten, daß sie ihre Lebenspraxis in der Zeit absichtsvoll orientieren können“[14]. Die Trias von Vergangenheitsbezug, gegenwärtiger Orientierung und Zukunftserwartung als die Sinnbildungsoperationen des Geschichtsbewusstseins im Rahmen von historischem Erzählen fungiert in Rüsens Theorie als die zentrale Quelle für die Herausbildung einer personal-individuellen sowie überindividuell-kollektiven Subjektivität.[15] Teilt man dieses Verständnis von Geschichtsbewusstsein, liegt die Wichtigkeit der Förderung eines reflektierten und (selbst-)reflexiven Geschichtsbewusstseins der SchülerInnen durch den Geschichtsunterricht auf der Hand: Es geht um nicht mehr und nicht weniger als die Entwicklung einer reflektierten und reflexiven Identität.
Neben dieser geschichtstheoretischen Ausdifferenzierung der Kategorie Geschichtsbewusstsein liegen innerhalb der Geschichtsdidaktik weitere Konzepte vor, die Rüsens Theorie punktuell differenzieren[16]. Hans-Jürgen Pandel entwickelte aus theoretischen und empirischen Einsichten heraus ein strukturanalytisches Modell, das sieben verschränkte Dimensionen des Geschichtsbewusstseins ausweist: Temporalbewusstsein, Wirklichkeitsbewusstsein, Wandelbewusstsein, Identitätsbewusstsein, politisches Bewusstsein, ökonomisches Bewusstsein und moralisches Bewusstsein.[17] Pandel zufolge bildet die Gesamtheit dieser Dimensionen ein idealtypisches individuelles Geschichtsbewusstsein. Obwohl das Konzept von Pandel theoretisch nicht über dasjenige von Rüsen hinausgeht, liefert es aus unterrichtspragmatischer Sicht dennoch hilfreiche Impulse. Ähnliches lässt sich über das aus empirischer Forschung hervorgegangene Modell von Bodo von Borries und Andreas Körber sagen, die Geschichtsbewusstsein als „ein System von sich in Ausgleichs- und Transformationsprozessen gleitend verschiebenden Gleichgewichtszuständen“[18] verstehen. Von Borries und Körber unterscheiden zwischen vier sich beeinflussenden Bereichen: Schichten der Codierung, Figuren der Sinnbildung, Verknüpfung der Zeitebenen und Dimensionen der Geschichtsverarbeitung.[19] Diese Differenzierung ermöglicht es besser, die individuellen Äußerungen des Geschichtsbewusstseins zu qualifizieren. Unabhängig von den feinen Unterschieden in den jeweiligen Verständnissen des Geschichtsbewusstseins existiert in der Geschichtsdidaktik ein Konsens darüber, dass dieses aufs Engste mit der zweiten zentralen Kategorie der Disziplin zusammenhängt.
2.2 Geschichtskultur
Bernd Schönemann hat zu Recht darauf hingewiesen, dass das Konzept der Geschichtskultur mit der Ausweitung der geschichtsdidaktischen Perspektive über den Geschichtsunterricht hinaus im Begriff „Geschichtsbewußtsein in der Gesellschaft“ implizit enthalten war.[20] Seit den 90er Jahren etablierte sich mit dem Begriff der Geschichtskultur innerhalb der deutschen Geschichtsdidaktik eine zweite zentrale Kategorie neben dem Geschichtsbewusstsein. Schönemann zeichnet den Aufstieg des Begriffs der Geschichtskultur zur Kategorie der Geschichtsdidaktik in zwei Phasen nach. In einer ersten Phase von 1977 bis 1990 öffnete sich die Disziplin dem Phänomen Geschichtskultur, in einer zweiten Phase von 1990 bis 1999 erfolgte die Durchsetzung als Forschungskonzept und Kategorie.[21] Schönemann erklärt die Hinwendung zur Geschichtskultur durch fachexterne wissenschaftliche Entwicklungen (Wissenssoziologie von Berger/Luckmann) und geschichtswissenschaftliche Neuerungen (narrativitätstheoretischer Konstruktivismus in der Historik und Hinwendung der Geschichtsforschung zu Phänomenen des außerwissenschaftlichen Umgangs mit Vergangenheit).[22]





























