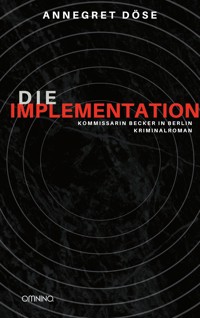
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Omnino Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Es ist der erste Berliner Fall für Sandra Becker, Leiterin einer Berliner Mordkommission, die sich aus persönlichen Gründen von Bremen nach Berlin versetzen ließ. Aus der Spree wurde eine Tote geborgen, die kurz vor ihrem Tod von seltsamen Vorgängen in einer Kinderwunschklinik erfahren hatte. In den engeren Kreis der Verdächtigen gerät der Inhaber der Klinik, der mit seiner Familiengeschichte zu kämpfen hat: Sein Großvater, ebenfalls Gynäkologe, war in der NS-Zeit in Berliner und Brandenburger Kliniken tätig. Und auch die Kommissarin hat mit inneren Dämonen aus der Vergangenheit zu kämpfen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 347
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Die Implementation
Impressum
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN: 978-3-95894-298-1 (Print)
© Copyright: Omnino Verlag, Berlin / 2024
Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen und digitalen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten.
Bei diesem Buch handelt es sich um Fiktion. Die im Roman beteiligten Personen, Organisationen und Institutionen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen, existierenden Organisationen und Institutionen und ihrer Arbeitsweise (z. B. bei der Polizei) sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Inhalt
17. Februar: Eine Tote in der Spree
17. Februar: Erste Spuren
17. Februar: In der Wohnung der Toten
17. Februar: Bei Dr. Dietzenbach
18. Februar: Bei der Mutter der Toten
18. Februar: Bei Paul Petermann
19. Februar: Ilona Petermann
19. Februar: Zähe Ermittlungen
20. Februar: In der Galerie Paradise
20. Februar: Die Kommissarin in der U-Bahn
20. Februar: Ein abendlicher Besuch
20. Februar: Die Kommissarin zu Hause
21. Februar: Team-Besprechung
21. Februar: Nicole Hausmann zu Hause
21. Februar: Ilona Petermann, ein zweites Mal
21. Februar: Emma Markward zu Hause
21. Februar: Ein Anwesen auf dem Lande
22. Februar: Neue Erkenntnisse
22. Februar: Besuch bei einer Rechtsanwältin
22. Februar: Streit unter Kollegen
22. Februar: Die Kommissarin zu Hause
22. Februar: Kommissar Richter ermittelt allein
23. Februar: Die Kommissarin beschwert sich
25. Februar: Alte Erinnerungen
25. Februar: Eine Geburtstagsfeier
25. Februar: Sigurd von Amtsberg zu Hause
25. Februar: Die Kommissarin macht einen Fund
26. Februar: Eine Beziehung verbessert sich
26. Februar: Ein Tagebuch hilft weiter
26. Februar: Nicole Hausmann im Präsidium
28. Februar: Ein Haftbefehl, zwei Durchsuchungen und ein weiteres Tagebuch
29. Februar: In der U-Haft
29. Februar: Bei einem Journalisten
29. Februar: Ein Rückfall
1. März: Recherchen auf dem Lande
1. März: Langsam kommt Licht ins Dunkel
1. März: Vermisste Dokumente
2. März: Sigurd von Amtsberg zu Hause
2. März: Auf der Suche nach Römig und Burmeister
3. März: Axel Burmeister
3. März: Volker Römig
3. März: Sigurd von Amtsberg im Präsidium
3. März: Nicole Hausmann wieder im Präsidium
Epilog: Zwölf Jahre später
Danksagung
17. Februar: Eine Tote in der Spree
Wieder derselbe Traum! Paris. Sie steht auf einer großen steinernen Brücke neben einer Reiterstatue, Matthias an ihrer Seite. Unten auf dem Fluss ziehen bunt dekorierte Schiffe vorbei, das helle Grün der Bäume leuchtet, Passanten flanieren auf den Uferwegen. Irgendwann beginnen Konturen zu verschwimmen wie bei einem Geist, der sich in Nebel auflöst. Sie möchte den Traum weiterspinnen. Doch ein wiederkehrendes störendes Geräusch holt sie zurück in die Realität. Es ist der Zarathustra-Sound aus dem Film Odyssee 2000, der Klingelton ihres Diensttelefons.
Hauptkommissarin Sandra Becker wacht mit hämmernden Kopfschmerzen auf. Sie blickt auf ihre Armbanduhr, sieben Uhr, verdammt. Schon seit zwei Stunden hat sie Rufbereitschaft. Sie tastet auf dem Nachttisch nach ihrem Handy, vergeblich. Langsam steigt die Erinnerung auf. Sie hatte am Abend zuvor zu viel getrunken. Nicht gut, sicherlich. Aber gestern gab es einen Grund dafür, es war ihr Geburtstag, der vierundvierzigste.
Der Zarathustra-Sound ertönt in Abständen immer wieder. Mühsam setzt sie sich auf den Bettrand. Ihr Blick streift durch das Zimmer und bleibt an dem Sessel vor dem Fenster hängen, auf dem ihre Kleidung vom Vorabend liegt, ganz oben die schwarze Jeans. Vielleicht ist das Handy aus der Hosentasche gefallen. Tatsächlich, da auf dem Boden liegt es. Sie steht auf, stolpert über eine leere Weinflasche, ein Rest von Rotwein läuft auf den hellen Teppichboden. Erleichtert hebt sie das Telefon auf und schafft es gerade noch, den Anruf entgegenzunehmen. Es ist ihr Kollege Hans Richter. „Ich versuche schon seit zehn Minuten, Sie zu erreichen“, sagt er, seine Stimme klingt gereizt. „Wir haben eine weibliche Leiche in Moabit am Spreeufer. Ich bin in fünf Minuten mit dem Wagen vor Ihrer Tür.“
Ausgerechnet heute. Sie geht ins Bad, streckt ihrem Bild im Spiegel mit den tiefen Ringen unter den Augen die Zunge heraus, kneift sich in die Wangen, macht ein paar gymnastische Übungen. Langsam erwachen ihre Lebensgeister. Zeit ist nur für Katzenwäsche, kaltes Wasser ins Gesicht und über die Arme, das muss reichen. Schnell schlüpft sie in die Kleidung vom Vortag, die schwarze Jeans und den neuen grünen Kaschmirpullover, der gut zu ihren roten Haaren passt, und geht in die winzige Küche. Ein Blick aus dem Fenster zeigt ihr, dass der Kollege mit dem Dienst-BMW schon unten wartet. Dann kann er auch noch eine Minute länger warten, denkt sie. Schnell noch einen doppelten Espresso aus der Maschine, ein Stück Knäckebrot aus der offenen Packung auf der Anrichte und zwei Brause-Aspirin-Tabletten.
Sie hastet aus dem vierten Stock die Treppen hinunter, der Fahrstuhl ist wieder einmal defekt, und eilt zum Wagen. Richter ist inzwischen ausgestiegen, seine hoch aufgeschossene Gestalt lehnt an der Wagentür. Er empfängt sie mit einem süffisanten Lächeln. „Ist wohl spät geworden gestern?“, sagt er mit diesem ironischen Unterton, den sie inzwischen schon kennt.
„Es hat sich so ergeben, ich habe mit Freunden ein bisschen gefeiert. Dabei habe ich wohl die Zeit vergessen, Sie wissen sicher, wie das ist.“ Im selben Moment ärgert sie sich über sich selbst. Warum muss sie sich rechtfertigen, noch dazu vor einem Menschen, den sie eher unsympathisch findet?
„Ach, Sie sind erst ein paar Wochen in Berlin und haben schon Freunde?“ Die Gereiztheit in Richters Worten ist nicht zu überhören. In der Dienststelle scheint es ein offenes Geheimnis zu sein, dass er einer der aussichtsreichsten Kandidaten für die Planstelle als „Hauptkommissar*in“ gewesen war, die sie vor einem Monat in der Abteilung für Tötungsdelikte angetreten hat. Dass sie als Externe – aus Bremen – das Rennen gemacht hat, war im Kollegenkreis nicht gerade auf Zustimmung gestoßen, das ist ihr bewusst. An ihrem ersten Arbeitstag war sie zwar von allen aus der Abteilung höflich begrüßt worden, aber eine gewisse Distanz war bei einigen von ihnen und auch bei Richter deutlich zu spüren gewesen.
„Stellen Sie sich vor“, sagt sie, „ich pflege meine Kontakte. Hier in Berlin habe ich zum Beispiel eine Freundin aus der Schulzeit wieder getroffen, die schon lange hier lebt.“
Richter grummelt etwas, das wie „aha“ klingt.
„Es soll vorkommen, dass man an Freundschaften festhält, auch wenn diese Menschen außerhalb des eigenen Geburtsortes leben“, sagt sie und fügt mit leicht spöttischem Unterton hinzu: „Während man sich in Berlin oft nicht aus seinem Kiez herausbewegt, habe ich mir sagen lassen. Sie sind doch echter Berliner, aus welchem Kiez stammen Sie denn?“
„Aus dem Wedding, da bin ich aufgewachsen, später nach Charlottenburg gezogen“, antwortet er mürrisch, so als ob ihm die Unterhaltung auf die Nerven ginge.
„Na, immerhin ein Ortswechsel“, sagt sie. Sie hat noch Kopfschmerzen, aber ihre Stimmung hat sich gebessert.
*
Das übrige Team ist schon bei der Arbeit, als die beiden am Spreeufer unter der Bärenbrücke in Moabit ankommen. Weiße Overalls beherrschen das Bild. Die Tote liegt nahe am Ufer auf dem Rasen, man hat sie auf eine Plane gelegt. Der Gerichtsmediziner Buchner kniet über ihr. Sandra hatte sich vor einigen Tagen persönlich mit ihm bekannt gemacht. Er war ihr offen und herzlich entgegengetreten, das war nicht bei allen so gewesen.
„Wer hat sie gefunden?“, fragt sie einen Polizisten der Polizeiwache Moabit, der in ihrer Nähe steht.
„Ein Obdachloser, der sein Quartier hier eingerichtet hat“, sagt er und deutet auf einen bärtigen Mann mittleren Alters mit rotem Gesicht und struppigem Bart, der einige Meter weiter unter der Brücke steht, neben seinem Schlafsack und einem mit Plastiktüten vollgepackten Einkaufswagen. „Uns wurde um 5.05 Uhr telefonisch ein Leichenfund gemeldet. Wir haben die Lage in Augenschein genommen und sofort die Mordkommission und die Feuerwehr verständigt, die die Leiche aus dem Wasser geborgen hat. Die Tote lag bäuchlings im Wasser, sie hatte sich im Ufergestrüpp verfangen.“
„Wenn sie nicht in das Gestrüpp geraten wäre, wäre sie wohl weiter den Fluss hinunter abgedriftet“, sagt der Gerichtsmediziner und begrüßt sie und Hans Richter mit einem Kopfnicken. „Der Tod ist vor etwa zwei Tagen eingetreten. Genauso lange dürfte sie im Wasser gelegen haben. Alter: schätzungsweise Anfang bis Mitte vierzig. Sie hat eine kleine Einstichstelle am Hals, wahrscheinlich von einer Injektion. Auffällig sind einige blaue Flecken an den Armen, was bedeuten könnte, dass sie sich gegen ihren Angreifer gewehrt hat. Sie hatte Schaum vor dem Mund, das deutet auf Leichen-Dumping hin.“ Der Gerichtsmediziner verspricht, nach der Obduktion so bald wie möglich Näheres mitzuteilen.
Die Kommissarin betrachtet die Tote lange, bevor sie in die Rechtsmedizin abtransportiert wird. Sie ist mit einem weißen T-Shirt und schwarzer Hose bekleidet und trägt modische Stiefeletten. Ihr Gesicht mit den geschlossenen Augen wird von dunklen halblangen Haaren umrahmt, kleine blitzende Ohrstecker betonen ihre harmonischen Gesichtszüge. Für einen kurzen Moment wird Sandra schwindelig, sie muss zur Seite treten. Mit dem Anblick des Todes konfrontiert zu werden, ist trotz aller beruflichen Routine immer wieder eine Herausforderung. Und wenn jemand im vollen Leben steht wie diese Frau in den Vierzigern, ist der Tod besonders schwer zu ertragen. Ungefähr dieses Alter hatte auch meine Mutter, als sie starb, denkt sie. Die ersten Zeilen eines Gedichts, das der Pfarrer bei der Beerdigung ihrer Mutter zitiert hatte, fallen ihr ein: „Rasch tritt der Tod den Menschen an, es ist ihm keine Frist gegeben …“
Sie geht auf die Brückenpfeiler zu, wo der Obdachlose dabei ist, seine Aussage dem jungen Kriminalkommissar Juri Rosenbaum zu Protokoll zu geben. Der Mann trägt einen dicken Parka und eine schmutzige Wollmütze, immer wieder reibt er sich die roten, von der Kälte aufgeplatzten Hände. Sandra hört eine Weile zu, wie er Rosenbaum Einzelheiten schildert: „… und weil ick nachts wach wurde und nich mehr einschlafen konnte, hab ick mir ein bisschen die Füße vertreten, und wie ick am Fluss entlang lauf, seh’ ick die da plötzlich im Wasser liegen. Mann, hab’ ick mir erschrocken!“
„Was haben Sie dann gemacht?“, fragt Kommissar Rosenbaum.
„Na, ick hab mein ollet Handy genommen und euch angerufen. Als ick neulich mal überfallen wurde und det angezeigt hab, habt ihr mir doch eure Nummer eingespeichert.“
„Weiß man schon, wer sie ist?“, unterbricht Sandra das Gespräch und wendet sich an Juri Rosenbaum.
„Nein, bisher noch nicht, sie hatte außer der Kleidung, die sie am Körper trägt, nichts dabei.“
„Erkundigen Sie sich nach den Vermisstenmeldungen der letzten Tage“, beauftragt sie ihn.
Während der Rückfahrt zur Dienststelle in der Keithstraße hält Richter vor einem Zeitschriftenladen an. Sandra sieht seiner dünnen, drahtigen Gestalt aus dem Wagenfenster nach. Durch die geöffnete Ladentür kann sie beobachten, wie er eine dunkelhaarige Frau, wahrscheinlich die Inhaberin, begrüßt, anscheinend ist er dort gut bekannt. Nach einer Weile kommt er mit zwei Bechern Kaffee und einer Tüte Pfannkuchen zurück. Du willst mir wohl zeigen, dass du auch nett sein kannst, denkt Sandra leicht belustigt. Tatsächlich erkundigt sich Richter, als sie im Auto den heißen Kaffee schlürfen und die Pfannkuchen essen, zum ersten Mal danach, ob sie sich nach ihrem Umzug schon in Berlin eingelebt hat. Aha, Tauwetter!, denkt Sandra, und bedankt sich höflich für Kaffee und Pfannkuchen: „In Bremen heißen sie Berliner, ist doch witzig, oder?“ Dann gibt sie einige Anekdoten von ihren ersten Erfahrungen mit den Berlinern und der Berliner Schnauze zum Besten. Richter lacht sogar einmal lauthals darüber. Das Lachen war echt, denkt sie, nicht nur höflich.
*
In der Dienststelle angekommen geht sie in ihr Büro und schält sich aus dem dicken Anorak, der sie vor der feuchten Kälte am Spreeufer geschützt hatte. Sie schluckt noch eine Aspirin-Tablette; obwohl ihr Magen schon rebelliert, setzt sich an ihren Schreibtisch und lässt den Kopf auf den Tisch sinken. „Konzentrier dich“, redet sie sich selbst gut zu, „keine Schwäche zeigen, du schaffst das.“
Nach einer Weile fühlt sie sich wieder einigermaßen fit und geht in das große Büro am Ende des Ganges, das mehrere Kolleginnen und Kollegen beherbergt, darunter auch Juri Rosenbaum, der nach Beendigung seiner Ausbildung zum Kriminalkommissar erst seit einigen Wochen in der Abteilung ist. Er sitzt bereits am Schreibtisch und telefoniert. Sie geht zum Tisch mit der Kaffeemaschine, die fast den ganzen Tag in Betrieb ist, und bedient sich. Während sie gierig ihren Kaffee trinkt, hört sie Juri einen Moment zu, wie er sagt: „Wir werden uns darum kümmern und Sie benachrichtigen … Machen Sie sich nicht zu viele Sorgen. Die Mehrzahl aller Vermissten taucht innerhalb von zweiundsiebzig Stunden wieder auf.“ Er macht das gut, denkt sie, er ist noch so jung, gerade mal fünfundzwanzig, aber er kann gut mit Menschen umgehen.
Juris Gesicht ist rot vor Aufregung, als er das Gespräch beendet hat. „Ich glaube, ich habe da was“, wendet er sich an Sandra. „Gestern sind zwei Vermisstenanzeigen eingegangen, die zum Opfer passen könnten. In beiden Fällen geht es um dieselbe Person. Sie heißt Mona Heuser, ist dreiundvierzig Jahre alt, Personalchefin bei einem Berliner Pharmaunternehmen, der Petermann & Berry AG mit Sitz im Wedding. Die eine Anzeige wurde von einer älteren Frau aus Bremen erstattet, die sich um ihre in Berlin lebende Tochter Sorgen macht. Ich habe gerade mit ihr telefoniert. Das Gespräch war schwierig, sie schien ziemlich schwerhörig zu sein. Frau Heuser – so heißt sie – kann ihre Tochter seit drei Tagen nicht erreichen, obwohl sie sonst fast jeden Tag miteinander telefonieren. Die Tochter lebt allein und hat außer ihr keine Verwandten. Ihre Adresse habe ich mir geben lassen. Die Mutter liegt zurzeit mit Oberschenkelhalsbruch in Bremen im Krankenhaus, könnte also nicht herkommen – für die Identifizierung“, fügt er hinzu. In seiner Stimme schwingt Stolz mit, weil er daran gedacht hatte.
„Und wer hat die zweite Vermisstenmeldung aufgegeben?“
„Ein Herr Petermann, er ist einer der Chefs des Pharma-Unternehmens Petermann & Berry im Wedding. Er hat die Personalchefin namens Mona Heuser als vermisst gemeldet, sie sei seit zwei Tagen nicht zur Arbeit gekommen. Mit ihm habe ich auch telefoniert und ihn gefragt, warum er sich solche Sorgen macht. Er hat mir gesagt, dass Frau Heuser im Allgemeinen sehr zuverlässig sei, sich aber nicht abgemeldet und nicht auf Anrufe reagiert habe. Das sei sonst gar nicht ihre Art.“
„Haben wir schon Ergebnisse von der Spurensicherung, hat man vielleicht in der Kleidung der Toten Hinweise auf ihre Identität gefunden?“
„Nichts, kein Hinweis“, schaltet sich Richter ein, der gerade den Raum betritt. „Außer der Kleidung, die sie am Körper trug, gibt es nichts, was auf ihre Identität hinweisen könnte.“
„Gut, dann fahren wir zunächst zu Petermann & Berry. Vielleicht kommen wir mit dem Foto der Toten schon weiter.“
„Kann ich auch mitkommen?“, fragt Juri erwartungsvoll. Er hätte gern einmal ein Pharmaunternehmen von innen gesehen, da seine Freundin Laborantin bei Bayer ist.
„Ich glaube, ein Großeinsatz ist zurzeit nicht nötig, wir würden uns eher unbeliebt machen.“ Sie lächelt ihm aufmunternd zu.
*
Während der Fahrt zu Petermann & Berry zeigt sich Hans Richter unerwartet gesprächig. Anscheinend gefällt es ihm, ihr den Stadtteil zu erklären, in dem er aufgewachsen ist. „Der Wedding hat sich in letzter Zeit total gewandelt“, sagt er, als sie in die Müllerstraße einbiegen. Er weist auf die vielen türkischen und arabischen Geschäfte hin. „Ursprünglich sind viele Einwanderer wegen der billigen Mieten hierher gezogen, aber in letzter Zeit gehen die Mieten hier nur noch nach oben. Und auch die Grundstückspreise steigen wie verrückt.“ Fast bedauernd fügt er hinzu: „Vor dem Krieg, in der Weimarer Zeit, da war das hier noch eine richtige Arbeitergegend.“
„Ich weiß“, sagt sie, „ich habe den Film ‚Roter Wedding‘ gesehen, ein Super-Film.“ Damit scheint sie bei ihm gepunktet zu haben, sie bemerkt so etwas wie Anerkennung in seinem Blick.
17. Februar: Erste Spuren
Bald haben die beiden Kommissare den Gewerbepark erreicht, in dem das Pharmaunternehmen seinen Sitz hat. Richter kennt sich aus, er fährt auf direktem Wege in eine Tiefgarage, die unter einem großen, mehrstöckigen Gebäudekomplex gelegen ist. Mit dem Fahrstuhl gelangen sie in den Eingangsbereich des Gebäudes im Erdgeschoss, wo eine Tafel mit der Aufschrift „Petermann & Berry Pharma AG“ anzeigt, dass sich das Unternehmen im zehnten Stock befindet. Sie steigen in einen anderen luxuriös ausgestatteten Fahrstuhl, der sie zu den Büroräumen bringt. Eine eindrucksvolle Aussicht erwartet sie, als sie das Foyer betreten. Hohe bodentiefe Fenster gewähren einen weiten Blick auf die Industrielandschaft des Wedding, moderne Betonbauten und top-renovierte klassische Gebäude aus der Gründerzeit wechseln sich ab.
Eine elegant gekleidete Dame, die sich als Frau Eberhard, Sekretärin des Juniorchefs Petermann, vorstellt, nimmt sie in Empfang und führt sie zu ihm. Petermann, ein großer schlanker Mann, schätzungsweise Ende vierzig, steht auf, begrüßt sie und stellt sich als leitender Pharmakologe und Vorstandsmitglied des Unternehmens vor. Er ist ungewöhnlich blass und hat dunkle Ringe unter den Augen. Zu viel Arbeit oder Stress, nicht gut geschlafen oder krank, denkt Sandra. Auf ihre Frage hin erklärt er bereitwillig die Gesellschaftsverhältnisse. Ja, sie hätten auf dem Schild im Eingangsbereich richtig gesehen, es gebe noch einen Petermann mit Vornamen Justus. Es handele sich um seinen Vater, der aber aus Gesundheitsgründen nicht mehr oft im Unternehmen erscheine. „Unser Unternehmen befindet sich seit mehr als hundert Jahren im Familienbesitz“, sagt er, der Stolz in seiner Stimme ist nicht zu überhören. „Allerdings hat der Konzentrationsprozess in der Pharmaindustrie auch vor unserer Firma nicht Halt gemacht. Wir hatten eine sehr herausfordernde Zeit und mussten einen ausländischen Investor beteiligen.“
Nach diesem Vorgeplänkel kommt Sandra zur Sache. „Waren Sie es, der eine Vermisstenmeldung für Ihre Personalchefin Mona Heuser aufgegeben hat?“
Petermann fährt mit der Hand durch sein volles, dunkles Haar. „Ja, wir haben uns Sorgen gemacht, nachdem sie zwei Tage nicht zur Arbeit erschienen war, ohne uns zu benachrichtigen. Das ist so gar nicht ihre Art. Wissen Sie schon etwas?“
„Es könnte sein“, sagt Sandra und zeigt ihm ein Foto der Toten aus der Spree. „Kennen Sie diese Frau?“
Es dauert eine Weile, bis Petermann antwortet. Sandra bemerkt ein leises Zittern in seiner Stimme. „Das ist Frau Heuser. Wo haben Sie sie gefunden?“
„In der Spree. Dort hat sie wahrscheinlich zwei Tage gelegen.“ Sandra lässt ihm einen Moment Zeit, dann fragt sie: „Ist Ihnen an Frau Heuser in letzter Zeit etwas aufgefallen? War sie anders als sonst?“
Petermanns Stimme klingt immer noch brüchig, als er nach einer Weile antwortet. „Ja, irgendwie schon. Sie wirkte, wie soll ich sagen, in sich gekehrt. Und vor einigen Tagen hatte sie kurzfristig um zwei Tage Urlaub gebeten, ohne zu sagen, warum. Danach ist sie nicht mehr bei der Arbeit erschienen, und ich habe nichts mehr von ihr gehört.“
„Wie war Ihr Verhältnis zur Toten?“, fragt Sandra unvermittelt.
„Gut“, sagt er nach kurzem Zögern. Sandra folgt seinem Blick, der sich auf die große Glastür zum Vorzimmer richtet, aus dem Frau Eberhard immer wieder in seine Richtung schaut.
„Können Sie morgen um zehn Uhr in das Präsidium kommen?“
„Ich bitte um Entschuldigung, aber für morgen Vormittag hat sich seit längerer Zeit eine amerikanische Delegation angemeldet.“ Er presst die Lippen aufeinander, scheint kurz zu überlegen. „Können Sie mich vielleicht morgen Abend zu Hause aufsuchen?“, fragt er und reicht ihr seine Visitenkarte, „wir könnten dort in Ruhe sprechen, ab halb sieben wäre ich verfügbar. Hier ist im Moment sehr viel los. Ich glaube, meine Sekretärin sitzt auf heißen Kohlen, sie muss das morgige Treffen mit der amerikanischen Delegation noch vorbereiten.“
„Gut“, willigt Sandra ein, „dann morgen Abend gegen halb sieben.“
Petermann begleitet die beiden Kommissare hinaus. Im Vorzimmer bleibt er einen Moment vor dem Schreibtisch seiner Sekretärin stehen. Während er mit ihr spricht, sieht sie ihren Chef lange und intensiv an, vielleicht etwas zu lange, denkt Sandra.
Draußen vor dem Fahrstuhl kann Richter nicht an sich halten. „Der Mann verschweigt doch etwas. Warum sollen wir so lange warten? Damit wir ihm den Gefallen tun, Aufsehen im Betrieb zu vermeiden?“
„Wir werden mehr von ihm erfahren, wenn wir ihm die Gelegenheit geben, unter vier Augen zu sprechen“, sagt Sandra und schlägt einen versöhnlichen Ton an. „Er war tief getroffen von ihrem Tod, das war zu sehen.“
*
In der Dienststelle wartet Juri Rosenbaum schon auf sie. „Das vorläufige Gutachten aus der Rechtsmedizin liegt vor“, sagt er und will der Kommissarin den Bericht übergeben.
„Sagen Sie uns, was drinsteht“, fordert sie ihn auf. „Sie haben es doch bestimmt schon gelesen.“
„Ja, ich war natürlich neugierig, bisher keine umwerfend neuen Ergebnisse. Der Tod ist am 14. Februar zwischen zwanzig und zweiundzwanzig Uhr eingetreten. Die Ergebnisse der Obduktion lassen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf ein Tötungsdelikt schließen. Die Frau war bereits tot, als sie ins Wasser befördert wurde. Die blauen Flecken an den Armen sind nicht alt, höchstwahrscheinlich Abwehrspuren gegen einen Angriff. Anzeichen für ein Sexualdelikt liegen nicht vor.“
*
„Ich habe lange gesucht“, sagt Rechtsmediziner Buchner, als sich Sandra und Hans Richter am Nachmittag zur Leichenschau im Institut für Rechtsmedizin in der Turmstraße einfinden. „Zunächst konnte ich keine Spuren finden, die erklären könnten, woran das Opfer gestorben ist. Die Einstichstelle am Hals rührt von einer Spritze her, die ein Betäubungsmittel enthalten hat. Das kann aber nicht tödlich gewesen sein. Erst nach längerem Suchen habe ich drei winzige Injektionsstellen am Gesäß entdeckt, die die Vermutung nahelegen, dass dem Opfer eine tödliche Substanz injiziert worden ist. Die konnten wir bisher noch nicht identifizieren, im Körper lassen sich bisher seltsamerweise auch keine Giftspuren nachweisen. Wir nehmen weitere Untersuchungen vor.“
„Haben Sie nicht einen Anhaltspunkt, eine Hypothese, die uns weiterbringen könnte?“, fragt Sandra. „Besteht vielleicht die Möglichkeit, dass sich die Tote die Substanz selbst gespritzt hat?“
Buchner räuspert sich. „Die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Tote die Injektionen selbst gegeben hat, schätze ich als äußerst gering ein. Ich denke im Moment an eine Methode der Tötung, die bisher nicht allzu oft angewendet worden ist“, sagt er, seine Worte genau abwägend, „und zwar an die Injektion einer Überdosis Insulin, was im Körper schwer nachweisbar ist.“
„Gut, dann müssen wir eben abwarten.“ Sandra seufzt. Dann wendet sie sich an Richter. „Wir sollten uns jetzt Zutritt zur Wohnung der vermissten Mona Heuser verschaffen, aller Wahrscheinlichkeit nach ist sie ja die Tote.“ Sie ruft Juri Rosenbaum an und fragt ihn nach der Adresse der vermissten Frau.
„In der Württembergischen Straße in Wilmersdorf ist eine Frau namens Mona Heuser behördlich gemeldet, es muss sich um den Wohnkomplex Rosengärten handeln“, sagt er.
„Gut, Juri, dann mobilisieren Sie das gesamte Team, wir fahren gleich von hier aus dorthin.“
17. Februar: In der Wohnung der Toten
Der Wohnkomplex Rosengärten in der Württembergischen Straße liegt im Herzen des alten West-Berlin. Es handelt sich um mehrere miteinander verbundene Gebäude mit einem einheitlichen architektonischen Stil, jedes Gebäude hat aber seinen eigenen Charakter. Keine schlechte Lage, denkt Sandra, während sie sich umsieht und Richter damit beschäftigt ist, einen Hausmeister aufzutreiben. Die von Bäumen umsäumte Straße ist ruhig, trotzdem zentral gelegen, der Ku’damm dürfte in nur wenigen Minuten zu Fuß zu erreichen sein. Ihre eigene Wohnung in der Xantener Straße ist nicht weit entfernt. Allerdings ist die Wohnqualität nicht zu vergleichen. Sie wohnt im vierten Stock eines renovierungsbedürftigen Altbaus, in dem der Fahrstuhl oft nicht funktioniert. Trotzdem ist sie froh, dass es nach ihrem Umzug so schnell geklappt hat, eine Wohnung zu finden. Heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr in Berlin.
Nach einigen Minuten schlurft ein älterer, mit Jogging-Hose und Sweat-Shirt bekleideter Mann heran. Mit mürrischem Gesicht öffnet er den beiden Kommissaren und den inzwischen eingetroffenen Mitgliedern der Spurensicherung die Tür zu der Wohnung im dritten Stock, in der Mona Heuser gemeldet ist. Durch einen schmalen Flur gelangt das Ermittlungsteam in ein großes helles Zimmer mit bodentiefen Fenstern, offensichtlich das Wohnzimmer. Es ist gemütlich eingerichtet, mit einigen Antiquitäten und kleinen Teppichen hier und da, vielen Bildern an den Wänden und gerahmten Fotos im Bücherregal und auf einer Kommode.
„Sieht nicht danach aus, als hätte die Bewohnerin die Absicht gehabt zu verreisen“, sagt Richter, „sonst hätte sie die Wohnung nicht so verlassen.“ Er deutet auf eine zusammengeknüllte Wolldecke auf dem Sofa und eine halbvolle Kaffeetasse sowie eine aufgeblätterte Tageszeitung auf dem Tisch davor.
Sandra sieht sich die Fotos an, auf einigen ist die Tote aus der Spree eindeutig zu erkennen. Ein Foto zeigt sie, wohl in jüngeren Jahren, allein auf einem Boot. Ihre dunklen Haare flattern im Wind, sie lacht der Person, die sie fotografiert hat, übermütig zu. Ein anderes Foto zeigt sie zusammen mit einer älteren Frau, die ihr ähnlich sieht, es könnte ihre Mutter sein.
Hans Richter hört währenddessen den Anrufbeantworter des Festnetz-Telefons ab. „Das klingt alles eher harmlos“, sagt er, „ein Handwerker und eine Bankangestellte haben angerufen. Vielleicht gibt es irgendwo noch ein Mobiltelefon, am Körper der Toten wurde nichts gefunden. Wir sollten danach suchen.“
Sandra sieht sich inzwischen in den übrigen Zimmern um. In der Küche steht benutztes Geschirr auf dem Ablaufbrett neben dem Spülbecken, im Schlafzimmer liegen Kleidungsstücke auf einem Sessel. Im Arbeitszimmer fällt Sandras Blick auf einen großen Schreibtisch vor dem Fenster. Auf der Schreibtischplatte befindet sich neben den üblichen Utensilien wie Hefter, Locher und einem Becher mit Kugelschreibern ein Laptop, daneben ein ungeordneter Stapel von Papieren. Beim Durchblättern stößt die Kommissarin auf das Protokoll einer Gesellschafterversammlung, die vor etwa einem Monat stattfand. Laut Geschäftsbogen firmiert die Gesellschaft unter dem Namen „Kinderwunschzentrum Gonima GmbH“, als Geschäftsführer ist ein Dr. Günter Dietzenbach ausgewiesen. Neben dem Arzt und zwei weiteren Personen nahm auch Mona Heuser als Gesellschafterin an der Versammlung teil, wie aus dem Schriftstück ersichtlich ist. „Das nehmen wir mit“, wendet sich Sandra an die Mitarbeiter des Ermittlungsteams, „auch den Laptop und alle Aktenordner mit der Aufschrift ‚Gonima GmbH‘.“
„Hier ist ein Handy“, ruft Juri Rosenbaum plötzlich aus dem Wohnzimmer, „es war in eine Sofaritze gerutscht.“ Richter nimmt ihm das Gerät aus der Hand. „Der Akku ist leer“, stellt er fest, „das muss erst aufgeladen werden.“ Zufälligerweise hat ein Mitarbeiter der KTU ein passendes Ladegerät dabei. So kann der Kommissar nach kurzer Zeit damit beginnen, die Mobilbox abzuhören. Nach einigen Minuten fasst er den Inhalt zusammen: „Am 6. Februar um acht Uhr abends hat eine Frau mit dem Namen Hausmann aus der Arztpraxis eines Dr. Dietzenbach angerufen und Frau Heuser um Rückruf gebeten. Dann – und jetzt wird es interessant – gibt es seit dem 14. Februar wiederholt Nachrichten von einem Mann, der sich mit dem Namen Paul meldet. Er klingt sehr aufgeregt, bittet immer wieder darum, dass Mona sich melden soll, er mache sich Sorgen. Bei seinem letzten Anruf um …“ – der Kommissar macht eine Kunstpause und lächelt süffisant – „… um halb zwei Uhr nachts klingt er regelrecht verzweifelt. Er sagt: ‚Wo bist du? Wenn ich bis morgen nichts von dir gehört habe, benachrichtige ich die Polizei.‘“ Richter blickt Sandra, die neben ihn getreten ist, triumphierend an. „Ich bin gespannt, was uns morgen Herr Petermann zu sagen hat, das Verhalten eines besorgten Arbeitgebers wurde hier eindeutig überstrapaziert. Oder glauben Sie, dass es noch einen weiteren Paul gibt?“
Sandra geht nicht auf seine Bemerkung ein, streckt nur den Arm nach dem Handy aus, das er ihr zögerlich reicht. Seit den ersten Tagen ihrer Berliner Tätigkeit hatte sie sich durch Richters zuweilen auftretende Anwandlungen von Sarkasmus irritiert gefühlt, sie versucht, sich daran zu gewöhnen und damit umzugehen. Sie hört die Mobilbox noch einmal ab und sieht sich das Protokoll der ausgehenden Telefonate an. „Es hat tatsächlich ein Rückruf von diesem Gerät in die Arztpraxis stattgefunden“, sagt sie, „wir lassen am besten überprüfen, wie lange es gedauert hat.“ Sie beauftragt Juri Rosenbaum, der das Kräftemessen der beiden neugierig beobachtet hat, das Nötige zu veranlassen.
Dann wendet sie sich an Richter: „Finden Sie es nicht etwas ungewöhnlich, dass aus einer Arztpraxis noch so spät angerufen wurde?“ Sie sieht auf ihre Armbanduhr. „Wir statten der Praxis Dietzenbach jetzt gleich einen Besuch ab, es ist noch früh genug, kommen Sie, Herr Kollege. Und da sich unser Verdacht in Bezug auf die Identität der Toten bestätigt hat, muss jemand die Mutter benachrichtigen. Ich werde die Bremer Kollegen um Amtshilfe bitten, meine frühere Kollegin Martens könnte es machen, sie hat das notwendige Einfühlungsvermögen.“
Richter legt seinen Kopf zur Seite und sieht sie bemüht harmlos an. „Wollen Sie nicht selbst hinfahren? Es wäre eine Gelegenheit, Ihre alte Heimat wiederzusehen, Kontakte zu pflegen …“
Sandra spürt, wie Ärger in ihr hochsteigt. Die lockere Atmosphäre, die während der Autofahrt herrschte, ist dahin. „Ich bin hier unabkömmlich, muss noch an einem anderen Fall arbeiten“, antwortet sie schroff. Gelogen ist dies nicht, allerdings verschweigt sie, dass es sich um einen älteren ungelösten Fall mit Verbindungslinien zu einem Fall in Bremen handelt, an dessen Aufklärung sie damals beteiligt war. Ab und zu wird sie, wenngleich nicht in verantwortlicher Position, zu den Arbeitssitzungen eingeladen. Doch im Moment verspürt sie keine Lust, an den Ort zurückzukehren, der lange Zeit ihre Heimat war. Man muss Erinnerungen ja nicht unnötig aufwühlen.
17. Februar: Bei Dr. Dietzenbach
Die Praxis des Gynäkologen Dr. Günter Dietzenbach befindet sich im Stadtteil Moabit im Spree-Bogen, einem hufeisenförmigen Büroneubau mit zwei Glastürmen, der mit einer Seite an die Spree angrenzt. Nach dem Fall der Mauer hatte sich auf dem Gelände, wo Ende des 19. Jahrhunderts die legendäre Bolle-Meierei gegründet worden war, ein moderner Büro- und Gewerbepark entwickelt. Im großzügig wirkenden Eingangsbereich des Gebäudes verweist ein Schild auf die gynäkologische Arztpraxis im 6. Stock. Eine Etage tiefer, im 5. Stock, befindet sich das Kinderwunschzentrum Gonima GmbH.
„Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, Sie kennen sich ja noch nicht so gut aus in Berlin, aber wir sind hier nicht allzu weit vom Fundort der Leiche entfernt“, bemerkt Richter, als sie mit dem Fahrstuhl hinauffahren.
„Okay, okay.“ Sandra versucht ruhig zu bleiben. „Ich bin zwar noch nicht lange hier, aber das hatte ich schon bemerkt.“
Der Eingangsraum der Praxis ist luxuriös ausgestattet, mit viel Kunst an den Wänden und geschickt eingesetzten Halogenstrahlern an der Decke und an den Schränken. Die hohen Fenster gewähren trotz der Dunkelheit einen beeindruckenden Blick auf die Uferpromenade der Spree und die gegenüberliegenden herrschaftlichen Gebäude der Jahrhundertwende. Hinter dem Empfangstresen sitzt eine gut aussehende blonde Frau, schätzungsweise Anfang vierzig. Etwas zu stark geschminkt, befindet Sandra. Das Namensschild auf dem weißen Kittel weist sie als Nicole Hausmann aus.
„Frau Hausmann?“, fragt sie.
Die Arzthelferin sieht erstaunt auf. „Ja, kennen wir uns?“
Sandra stellt sich und ihren Kollegen vor. „Wir würden uns gerne mit Ihrem Chef unterhalten. Vorher möchten wir mit Ihnen sprechen.“
„Mit mir? Wieso? Das ist im Moment gerade ganz schlecht.“ Ihre Stimme klingt unwillig. „Sie sehen ja, das Wartezimmer ist voll.“ Sie weist mit der Hand in den Nebenraum, in dem allerdings nur zwei Patientinnen sitzen. „Außerdem ist Herr Doktor jetzt beschäftigt. Worum geht es denn?“
„Es geht um eine Ihrer Patientinnen, Mona Heuser. Wir würden gern wissen, warum Sie sie vor etwa zehn Tagen am Abend des 6. Februar mit Ihrem privaten Smartphone angerufen haben.“
„Am 6. Februar? Ich kann mich nicht erinnern. Was ist denn überhaupt los?“
„Frau Heuser ist tot.“
Die Arzthelferin wird bleich. „Aber …“, stammelt sie, „… das ist doch nicht möglich. Sie war vor einigen Tagen doch noch hier und erschien ganz gesund.“
„Ja, und am Abend des 6. Februar haben Sie abends gegen zwanzig Uhr auf Ihren Anrufbeantworter gesprochen und um Rückruf gebeten“, schaltet Richter sich ein. „Was war der Grund Ihres Anrufs?“
„Äh… lassen Sie mich überlegen. Wahrscheinlich wollte ich ihr mitteilen, dass noch ein Termin, um den sie gebeten hatte, frei geworden ist.“
„Waren Sie denn um diese Zeit noch in der Praxis? Ist es üblich, dass Sie bis in den Abend hinein hier bleiben? Und dass Sie für Terminvereinbarungen Ihr privates Handy benutzen?“
„Ach wissen Sie, ich kenne Frau Heuser jetzt schon so lange, da hat sich ein fast freundschaftliches Verhältnis entwickelt. Sie ist ja nicht nur Patientin, sondern auch als Gesellschafterin an unserem Kinderwunschzentrum Gonima beteiligt. Jetzt erinnere ich mich: Ich wollte sie über einen frei gewordenen Termin informieren, um den sie gebeten hatte. Ich war an dem Abend länger als gewöhnlich in der Praxis, weil ich noch Tagungsunterlagen für den Chef vorbereitet habe, er sollte ein Referat auf dem Gynäkologenkongress in München halten. Zwischendurch habe ich eine Pause gemacht, da fiel mir ein, dass ich vergessen hatte, sie über den freigewordenen Termin zu informieren. Und da habe ich wohl mein Handy statt des Praxistelefons benutzt. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht mehr, warum.“
In diesem Moment erhält Sandra eine Nachricht auf ihrem Handy. Nach einem kurzen Blick darauf wendet sie sich wieder an die Arzthelferin: „Frau Heuser hat Sie dann tatsächlich zurückgerufen, das Telefongespräch hat, wie wir wissen, zwölf Minuten gedauert. Worüber haben Sie denn so lange gesprochen?“
Die Arzthelferin beginnt, in einem Papierstapel, der vor ihr auf dem Tresen liegt, zu blättern, dann dreht sie sich um, scheint in dem Regal hinter ihr etwas zu suchen. Erst als Sandra ihre Frage wiederholt, wendet sie sich wieder der Kommissarin zu und antwortet zögernd: „Ach, wir haben über dieses und jenes gesprochen. Ich sagte ja schon, dass wir uns lange kennen, da spricht man eben auch über Privates … über ihre kranke Mutter zum Beispiel, die in Bremen im Krankenhaus liegt, und dass sie sich Sorgen macht.“
„Gut. Dann würden wir jetzt gern mit Dr. Dietzenbach sprechen.“
Frau Hausmann nickt, bittet um einen Moment Geduld und verschwindet im Sprechzimmer, um ihrem Chef Bescheid zu geben. Nach einigen Minuten öffnet sich die Tür und eine Patientin verlässt den Raum. Nach ihr tritt Dr. Dietzenbach heraus, ein schlanker, auf den ersten Blick jugendlich wirkender Mann. Bei genauerem Hinsehen verraten allerdings einige scharfe Falten auf der Stirn und über den Mundwinkeln ein Alter um die fünfzig.
„Unerwarteter Besuch von der Polizei“, sagt er, „was kann ich für Sie tun?“
„Wir möchten mit Ihnen über Mona Heuser sprechen, die eine Patientin von Ihnen war.“
„War? Wieso? Ist etwas passiert?“
„Frau Heuser ist tot.“
Der Arzt zuckt zusammen. „Tot? Aber … sie war doch vor einigen Tagen noch hier. Meines Wissens war sie nicht krank.“
„Es geht nicht um Krankheit, Frau Heuser ist aller Wahrscheinlichkeit nach ermordet worden.“
„Nein!“ Dietzenbach weicht unwillkürlich einen Schritt zurück. „Wer könnte so etwas tun?“
„Das wollen wir herausfinden. Können wir bitte unter vier Augen sprechen?“
„Ja, natürlich, entschuldigen Sie.“ Der Arzt macht eine einladende Handbewegung in Richtung seines Sprechzimmers. „Bitte kommen Sie.“
„Bitte erzählen Sie uns so viel wie möglich über Ihr Verhältnis zu Frau Heuser“, leitet die Kommissarin das Gespräch ein, nachdem alle Platz genommen haben, der Arzt auf dem großen schwarzen Ledersessel hinter seinem Schreibtisch, sie und Hans Richter auf den Besucherstühlen davor. „Sie war ja nicht nur Ihre Patientin, sondern auch Gesellschafterin Ihres Kinderwunschzentrums Gonima. Sie sind doch der Geschäftsführer?“
„Woher wissen Sie das?“, entfährt es Dietzenbach.
„Die Polizei weiß vieles. Wir haben in Frau Heusers Wohnung Protokolle von Gesellschafterversammlungen der Gonima GmbH gefunden. Und wir fanden es etwas ungewöhnlich, dass eine Patientin gleichzeitig Gesellschafterin eines Unternehmens ist, dessen Geschäftsführer ihr behandelnder Arzt ist. Können Sie uns das näher erklären?“
Dietzenbach reibt sich das Kinn. „Ach so. Ja, sicher. Wo fange ich an? Mona und ich kennen uns aus der Studienzeit. Wir haben damals im selben Studentenheim gewohnt. Ich studierte, wie Sie leicht erraten können, Medizin, Mona Betriebswirtschaft. Wir haben damals in einigen ehrenamtlichen Projekten zusammengearbeitet. Daraus entwickelte sich eine echte Freundschaft. Später wurde Mona auch meine Patientin. Und als ich mein Kinderwunschzentrum gründete, vor etwa zehn Jahren, fand sie diese Initiative so gut und interessant, dass sie sich dazu entschied, das Vorhaben auch finanziell zu unterstützen. Wir gründeten eine GmbH. Ich übernahm den größten Teil des Einlagekapitals aus Eigenmitteln und Bankdarlehen und wurde Geschäftsführer und Mona übernahm als Mitgesellschafterin einen Geschäftsanteil von zwanzig Prozent. Sie hat ja in ihrem Job in der Pharmaindustrie immer gut verdient.“
„Trotzdem muss ich Sie das fragen: Verband Sie vielleicht mehr als nur Freundschaft mit Frau Heuser? Oder hat die Beteiligung etwas mit der Art ihrer Behandlung durch Sie zu tun?“
Ein kaum merkliches Lächeln überzieht das Gesicht des Arztes. „Ich kann Ihnen nur so viel über Frau Heuser erzählen, wie es mir die ärztliche Schweigepflicht gestattet, die ja über den Tod hinaus wirkt, wie Sie sicher wissen. Was mein persönliches Verhältnis zu ihr angeht, kann ich Ihnen versichern, dass es immer nur freundschaftlich war.“
„Worum ging es denn beim letzten Besuch von Frau Heuser in Ihrer Praxis? Und wann hat dieser stattgefunden?“, übernimmt Richter die Befragung.
„Das war … lassen Sie mich nachdenken. Ich muss Frau Hausmann fragen.“ Er drückt den Knopf der Sprechanlage. „Frau Hausmann, sehen Sie bitte im Kalender nach, wann Frau Heuser das letzte Mal hier war.“ Es dauert eine Weile, bis die Arzthelferin sich meldet. „Das war am 7. Februar um 18.30 Uhr.“
„Also eine Woche vor ihrem Tod. Und was war der Grund für den Besuch?“
„Es gab keinen medizinischen Grund. Der Besuch war rein geschäftlicher Natur, es ging um die Vorbereitung einer bevorstehenden Gesellschafterversammlung der Gonima GmbH. Wir wollten vor der offiziellen Zusammenkunft mit den anderen beiden Gesellschaftern gewisse Absprachen treffen.“
Sandra blickt den Arzt prüfend an. „Ich wundere mich ein wenig darüber, dass Sie zu diesem Zeitpunkt eine Gesellschafterversammlung ins Auge gefasst haben. Wir wissen aus einem Protokoll der Gonima GmbH, dass die letzte Versammlung erst vor einem Monat stattgefunden hat. Die nächste ordentliche Gesellschafterversammlung würde, wenn ich es richtig sehe, erst wieder nach einem Jahr fällig sein.“
Der Arzt zögert einen Moment. „Es hätte sich um eine außerordentliche Versammlung gehandelt“, sagt er, „wir hatten gewisse Probleme in der Gesellschaft.“ Wieder zögert er einen Moment, dann spricht er schnell weiter. „Jetzt ist wegen Monas Tod ohnehin nichts zu machen. Sie werden verstehen, dass deswegen einige Probleme auf unsere Gesellschaft zukommen werden. Was wird zum Beispiel mit Monas Gesellschaftsanteil? Zunächst müssen wohl die Erbschaftsverhältnisse geklärt werden. Soweit ich weiß, hatte sie außer ihrer Mutter keine leiblichen Angehörigen.“
„Gut, dann lassen Sie uns jetzt über die medizinische Seite der jahrelangen Behandlung von Frau Heuser durch Sie sprechen. Hatte die Art der Behandlung, die sie bei Ihnen suchte, vielleicht mit einem unerfüllten Kinderwunsch zu tun?“, hakt Sandra nach.
„Ja, aber mehr kann ich Ihnen dazu wirklich nicht sagen.“
„Dann sagen Sie uns bitte noch, wo Sie am 14. Februar zwischen zwanzig und zweiundzwanzig Uhr waren.“
„Lassen Sie mich nachdenken …“ Dietzenbach reibt sein Kinn. „Am 15. Februar hatte meine Frau Geburtstag. Am 14. Februar, also am Vorabend, habe ich die Praxis etwa gegen Viertel nach sieben verlassen, soweit ich mich erinnere, zusammen mit meiner Mitarbeiterin Frau Hausmann … Ja, so war es, wir sind zusammen mit dem Fahrstuhl in die Tiefgarage gefahren, jeder ging zu seinem Auto. Ich bin dann zum Ku’damm gefahren, weil ich mich bei Juwelier Seelmann nach einem Geschenk für meine Frau umsehen wollte. Das Geschäft hatte aber schon geschlossen. Ich bin dann anschließend gleich nach Hause gefahren.“
„Nach Hause ist wo?“, schaltet sich Richter mit barschem Ton ein.
„In der Trabener Straße, in der Nähe der S-Bahn-Station Grunewald.“
„Wann waren Sie zu Hause? Ihre Frau kann das sicher bezeugen.“
„Äh…“, der Arzt tippt mit seinen Fingern auf der Tischplatte herum, „es ist mir ein bisschen unangenehm … meine Frau ist vor kurzem ausgezogen, wir leben vorübergehend getrennt. Ich muss gegen halb neun zu Hause gewesen sein und habe den Abend mit Musikhören und Lesen verbracht. Irgendwann habe ich versucht, meine Frau anzurufen. Ich wollte sie fragen, ob ich sie am folgenden Tag besuchen könnte, um ein Geschenk vorbeizubringen – ich hätte das Geschenk dann am nächsten Tag besorgt. Sie ging aber nicht an den Apparat, deshalb habe ich nur auf den Anrufbeantworter gesprochen.“
Beim Hinausgehen fragt Richter die Arzthelferin, ob sie sich erinnern könne, wann sie am Abend des 14. Februar die Praxis verlassen habe. „Warten Sie, ich sehe im Kalender nach“, sagt sie. „Die letzte Patientin hatte einen Termin um achtzehn Uhr dreißig. Gegen neunzehn Uhr hat sie wahrscheinlich die Praxis verlassen. Ich bin dann etwas später, mit dem Chef zusammen, es muss gegen neunzehn Uhr fünfzehn gewesen sein, zur Tiefgarage hinuntergefahren, und jeder ist in sein Auto gestiegen.“
„Und anschließend?“
„Anschließend, lassen Sie mich überlegen, bin ich ins Kino gegangen.“
„Allein?“
„Ja, allein, ich wollte mich eigentlich mit meiner Freundin Emma Markward treffen. Sie hat aber wegen einer starken Erkältung kurzfristig abgesagt. Sie können das gern überprüfen, ich gebe Ihnen ihre Telefonnummer.“
18. Februar: Bei der Mutter der Toten
Sandra hat sich entschieden, doch selbst nach Bremen zu fahren. Da sie ohnehin demnächst dort als Zeugin in einem Strafprozess geladen ist, in einem Fall, an dem sie früher in verantwortlicher Position gearbeitet hat, kann sie zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Sie kann ihrer alten Dienststelle einen Besuch abstatten und ihren Nachfolger über ihre Aussage informieren, und sie kann selbst mit der Frau sprechen, die vermutlich die Mutter der Toten ist. Auf keinen Fall aber will sie in Bremen übernachten, sie hat dort keine Bleibe mehr. Und, wenn sie ehrlich mit sich selbst ist, will sie die Zeit dort nicht unnötig in die Länge ziehen.
Früh am nächsten Morgen nimmt sie den ICE und erreicht nach einem Umstieg in Hannover nach knapp vier Stunden den Bremer Hauptbahnhof. Während der Zugfahrt hatte sie überlegt, ob sie Frau Heuser in ihrem sicherlich geschwächten Gesundheitszustand das Foto der Toten zeigen sollte, um letzte Gewissheit über deren Identität
zu erlangen. Am besten, sie würde es von der augenblicklichen Situation abhängig machen und spontan entscheiden.
Am Bahnhof weht ein eisiger Wind. Sie gönnt sich ein Taxi und lässt sich zum Klinikum Bremen-Mitte fahren, einem schwer überschaubaren Komplex von Gebäuden unterschiedlicher Stilrichtungen. Das in rotem Ziegelstein gehaltene Hauptgebäude wirkt streng und aus der Zeit gefallen. Bis sie sich orientiert und zum Zimmer von Frau Heuser durchgefragt hat, das in einem Anbau liegt, dauert es eine Weile, sie muss lange Gänge passieren. Als sie schließlich die Tür zum Krankenzimmer öffnet, wird sie bereits erwartet. Eine ältere Frau, die mit Gipsverband im Bett liegt, sieht sie mit weit aufgerissenen Augen an. Eine Beamtin der Bremer Kriminalpolizei hatte sie bereits am Vorabend darüber informiert, dass aus dem Fluss eine Tote geborgen wurde, auf die die Beschreibung ihrer Tochter passen könnte.
„Welche Nachrichten bringen Sie mir?“, fragt Frau Heuser, ihre Stimme ist sehr schwach.





























