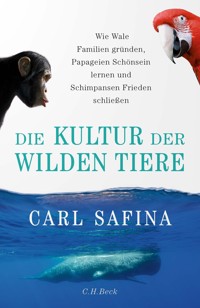12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Was geht im Inneren von Tieren vor? Können wir wissen, wie sie fühlen und denken? Carl Safina nimmt uns mit auf abenteuerliche Entdeckungsreisen in die unbekannte Welt der Elefanten, Wölfe und Orcas. Sein spannend zu lesendes Buch erzählt außergewöhnliche Geschichten von Freude, Trauer, Eifersucht, Angst und Liebe und ist voll von erstaunlichen Einsichten in die Persönlichkeiten der Tiere. Der vielfach ausgezeichnete Naturschriftsteller und Ökologe Carl Safina begegnet den von ihm beobachteten wilden Tieren mit Liebe, Respekt und umfassenden Kenntnissen. Sein Wissen ist genauso groß wie sein Einfühlungsvermögen; er versteht es meisterhaft, neueste wissenschaftliche Erkenntnisse mit wundervollen Erzählungen zu verweben. Die verblüffende Ähnlichkeit von menschlichem und nichtmenschlichem Bewusstsein, Selbstbewusstsein und Mitgefühl fordert uns dazu auf, unser Verhältnis zu anderen Arten zu überdenken - und auch das Verhältnis zu uns selbst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
CARL SAFINA
DIEINTELLIGENZDER TIERE
Wie Tiere fühlen und denken
Aus dem Englischen von Sigrid Schmid und Gabriele Würdinger
C.H.BECK
Zum Buch
Jenseits von Wörtern
«Wir müssen unsere Vorstellungen darüber, wie Tiere mit uns Menschen kommunizieren, grundsätzlich revidieren. Ein absolut faszinierendes Buch.»
Josef H. Reichholf
«Safinas Buch hat das Potenzial, unser Verhältnis zur natürlichen Welt zu verändern.»
Tim Flannery, The New York Review of Books
Was geht im Inneren von Tieren vor? Können wir wissen, wie und was sie denken und fühlen? Carl Safina nimmt seine Leser auf abenteuerliche Entdeckungsreisen in die unbekannte Welt der Elefanten, Wölfe und Orcas mit und erzählt außergewöhnliche Geschichten von tierischer Freude, Trauer, Eifersucht, Angst und Liebe. Safina begegnet den von ihm beobachteten wilden Tieren mit Liebe, Respekt und umfassenden Kenntnissen. Sein Wissen ist genauso groß wie sein Einfühlungsvermögen; er versteht es meisterhaft, neueste wissenschaftliche Erkenntnisse mit wundervollen Erzählungen zu verweben. Die verblüffende Ähnlichkeit von menschlichem und nichtmenschlichem Bewusstsein, Selbstbewusstsein und Mitgefühl fordert uns dazu auf, unser Verhältnis zu anderen Arten zu überdenken – und nicht zuletzt zu uns selbst als Menschen.
Über den Autor
Carl Safina ist Meeresbiologe und einer der bekanntesten Naturschriftsteller weltweit. Sein Werk umfasst bislang sieben Bücher, darunter den internationalen Bestseller Song for the Blue Ocean, und ist vielfach ausgezeichnet worden. Safina ist Gründungsdirektor des Blue Ocean Institute und hat die Stiftungsprofessur für Natur und Humanität der Stony Brook University im US-Bundesstaat New York inne. Er ist Autor von Fernsehdokumentationen und schreibt regelmäßig für die New York Times und National Geographic.
Inhalt
VORWORT
Auf dünnem Eis
I.: Das Trompeten der Elefanten
Die große Frage
Das gleiche Gehirn
Ist der Mensch wirklich einzigartig?
Erbe aus der Urzeit
Familienbande
Mutterfreuden
Lieben Elefanten ihre Babys?
Elefantenempathie
Tiefe Trauer
Ich weiß nicht, wie ich Wiedersehen sagen soll
Ich sage Hallo!
Festhalten und Gehenlassen
Seelen in Not
Ebony and Ivory
Wo die Elefantenbabys herkommen
II.: Das Heulen der Wölfe
Eiszeit
Ein perfekter Wolf
Rudelbildung und -auflösung
Die Wölfin namens Sechs
Gebrochene Versprechen
Waffenstillstand
Herrliche Ausgestoßene
Auf der Spur der Wolfsvögel
Wolfsmusik
Der Jäger ist ein einsames Herz
Überlebenswille
Dienstboten
Zwei Enden derselben Leine
III.: Jaulen und Ärgernisse
Von wegen Theory of Mind
Sex, Lügen und gedemütigte Seevögel
Arroganz und Täuschung
Was zum Lachen und schrullige Ideen
Spieglein, Spieglein
Apropos Neuronen
Ein uraltes Volk
IV.: Der Gesang der Wale
See-Rex
Ein komplexer Killer
Einfach sehr sexuell
Innenansichten
Ungleiche Denker
Was heißt hier intelligent?
Das soziale Gehirn
Wunschdenken
Helfen und sich helfen lassen
Bitte nicht stören
Besitzen und bewahren
Mit Persönlichkeit ist zu rechnen
Eine mächtige und wahre Vision
NACHWORT
Ein letzter Gedanke
Danksagung
ANHANG
Auswahlbibliographie
Anmerkungen
Das Trompeten der Elefanten
Das Heulen der Wölfe
Jaulen und Ärgernisse
Der Gesang der Wale
Nachweis der Abbildungen und Karten
Dieses Buch ist all jenen Menschen auf den folgenden Seitengewidmet, die genau hinsehen und hinhören.Die uns erzählen, was sie aus den Stimmen und dem Schweigenderer heraushören, die mit uns auf dieser Erde leben.
Ich dachte an die lange vergangenen Zeiten, während welcher die aufeinander folgenden Generationen dieses kleinen Geschöpfes ihre Entwicklung durchliefen … ohne dass ein intelligentes Auge ihre Lieblichkeit erspähte – eine üppige Verschwendung von Schönheit … Diese Betrachtung muss uns doch lehren, dass alle lebenden Wesen nicht für den Menschen geschaffen wurden … Ihr Glück und ihre Freude, ihr Lieben und ihr Hassen, ihre Kämpfe ums Dasein, ihre von Leben geschwellte Existenz und ihr früher Tod erscheinen unmittelbar als auf ihr eigenes Wohlsein und ihre eigene Erhaltung allein sich beziehend …
Alfred Russel Wallace, Der Malayische Archipel, 1869
Wir beschützen sie wegen ihrer Unvollkommenheit, wegen ihres tragischen Schicksals, eine Gestalt angenommen zu haben, die weit weniger entwickelt ist, als unsere. Und darin irren wir uns, wir irren uns sogar gewaltig. Für die Tiere gelten nicht die Maßstäbe des Menschen. In einer Welt, die älter und vollständiger als unsere ist, sind sie vollkommene Wesen, deren scharfe Sinne wir Menschen verloren haben oder vielleicht auch niemals hatten, Wesen, deren Stimmen wir niemals hören werden. Sie sind nicht unsere Brüder und auch nicht unsere Untergebenen. Sie gehören fremden Nationen an, die, wie wir, im Netz des Lebens und der Zeit gefangen sind, Gefängnisgenossen, die mit uns die Herrlichkeit und die Mühen auf Erden teilen.
Henry Beston, The Outermost House, 1928
VORWORT
Auf dünnem Eis
Frage doch das Vieh, das wird dich’s lehren, und die Vögel unter dem Himmel, die werden dir’s sagen, oder die Sträucher der Erde, die werden dich’s lehren, und die Fische im Meer werden dir’s erzählen.
Hiob, 12,7–8
Eine große Delfingruppe war neben unserem Boot aufgetaucht. Während sie neben uns hersprangen, tauschten sie sich über geheimnisvolle Zurufe aus, quiekend und pfeifend, wie es ihre Art ist. Auch einige Jungtiere flitzten Seite an Seite mit ihren Müttern durch das Wasser. In diesem Moment wurde mir klar, dass ich mich nicht länger damit zufriedengeben wollte, diese tiefgründigen und wunderschönen Wesen nur oberflächlich zu begreifen. Ich wollte wissen, wie sie die Welt erlebten, warum sie für uns Menschen so faszinierend sind und wir uns ihnen so nahe fühlen. Zum ersten Mal erlaubte ich mir, ihnen die streng verbotene Frage zu stellen: Wer seid ihr? Üblicherweise vermeidet die Wissenschaft konsequent die Frage nach dem Seelenleben von Tieren. Zwar gesteht man auch ihnen irgendeine Art von Gefühlswelt zu. Doch ähnlich wie Kinder als unhöflich getadelt werden, wenn sie unverblümte Fragen stellen, wird jungen Wissenschaftlern von Anfang an eingetrichtert, dass die Psyche eines Tieres – sollte es sie überhaupt geben – jenseits der menschlichen Erkenntnis liegt. Erlaubt sind nur «Es-Fragen»: Wo lebt es, was frisst es, wie reagiert es bei drohender Gefahr, wie pflanzt es sich fort? Doch die eine Frage, die niemals gestellt werden darf, obwohl sie uns vielleicht ganz neue Erkenntnisse bringen könnte, ist: Wer?
Es gibt Gründe, warum man sich an dieses Forschungsgebiet nicht herangewagt hat. Doch was wir dabei übersehen, ist, dass die Trennlinie zwischen Mensch und Tier eine künstliche ist, da der Mensch ein Tier ist. Und als ich die Delfine beobachtete, hatte ich keine Lust mehr, mich an diesen starren Kodex zu halten. Ich wollte den Dingen auf den Grund gehen, eine neue Nähe schaffen. Ich hatte das Gefühl, dass die Zeit für beide, Mensch und Tier, bald ablaufen würde und ich wollte nicht riskieren, «Wiedersehen» sagen zu müssen, wo ich doch noch nicht einmal wirklich «Hallo» gesagt habe. Während des Segeltörns las ich viel über Elefanten. Ihre Gedankenwelt beherrschte die meine, als ich über die Delfine nachdachte und beobachtete, wie sie sich ungezwungen und frei in ihrem Lebensraum bewegten. Wenn ein Wilderer einen Elefanten tötet, löscht er nicht nur das Leben dieses einen Elefanten aus. Die Herde verliert damit womöglich auch den unverzichtbaren, überlebenswichtigen Erfahrungsschatz ihrer Matriarchin, die weiß, wo es auch in harten Dürreperioden genügend Nahrung und Wasser gibt. So kann eine einzige Patronenkugel noch Jahre später weitere Leben kosten. Als ich die Delfine beobachtete und dabei gleichzeitig über die Elefanten nachdachte, wurde mir klar: Wenn Individuen ihresgleichen wiedererkennen und von ihnen abhängig sind, wenn der Tod eines Einzelnen für das Überleben der anderen entscheidend ist, wenn es unsere Beziehungen sind, die uns ausmachen, dann haben wir in der stammesgeschichtlichen Entwicklung eine fließende Grenze überschritten – «es» ist zu «jemand» geworden.
«Jemand»-Tiere wissen, wer sie sind. Sie wissen wer zu ihrer Familie und zu ihren Freunden gehört. Sie wissen, wer ihr Feind ist. Sie gehen strategische Verbindungen ein und arrangieren sich mit den ständigen Konkurrenzkämpfen. Ihr Ziel ist es, in der Rangordnung aufzusteigen, und sie warten nur darauf, die bestehende Ordnung zu hinterfragen. Ihre Stellung wirkt sich auf die Zukunftsaussichten ihrer Nachkommen aus. Zeitlebens durchlaufen sie die verschiedenen Etappen einer Karriereleiter. Persönliche Beziehungen machen sie aus. Das kommt Ihnen bekannt vor? Sicherlich. «Sie» schließt uns mit ein. Nicht nur wir Menschen führen ein vielschichtiges Leben.
Naturgemäß haben wir eine exklusiv menschliche Sicht auf die Welt. Doch da wir diese nur durch unsere Brille betrachten, ist unser Blick eingeschränkt. Dieses Buch nimmt die Außenperspektive ein, also die der Welt, die uns umgibt. Eine Welt, in welcher der Mensch nicht das Maß aller Dinge und nur eine Spezies unter vielen ist. Da wir uns immer weiter von der Natur entfremden, haben wir vergessen, dass wir Teil einer großen Lebensgemeinschaft sind und können uns in die Erfahrungswelt anderer Tiere nicht mehr einfühlen. Weil aber alle Belange des Lebens auf einer breit gefächerten Skala erscheinen, fällt es leichter, uns menschliche Tiere zu verstehen, wenn wir uns im Kontext mit den anderen sehen und erkennen, dass unsere Lebensfäden Teil eines eng gewobenen Netzes sind, das aus einer Vielzahl weiterer Fäden besteht.
Ich wollte dieses Buch zum Anlass nehmen, mein langjähriges Hauptanliegen, den Naturschutz, zugunsten meines Lieblingsthemas in den Hintergrund treten zu lassen: Ich wollte beobachten, was Tiere machen, und nach dem Grund ihres Handelns fragen. Ich unternahm Reisen, um mich mit einigen der meist geschützten Tierarten zu beschäftigen – den Elefanten im Amboseli-Nationalpark in Kenia, den Wölfen im Yellowstone-Nationalpark in den Vereinigten Staaten und den Killerwalen im nordwestlichen Pazifik. Doch wurden alle drei Arten durch den Menschen in einer Art und Weise behelligt, die sich direkt auf ihr Handeln, ihren Lebensraum, ihre Wanderrouten und ihre Lebensdauer auswirkten. Daher gewährt uns dieses Buch nicht nur einen Blick in das Seelenleben der Tiere, sondern schärft darüber hinaus unser Bewusstsein für ihre Bedürfnisse. In dieser Geschichte, die sich selbst erzählt, geht es nicht nur darum, was auf dem Spiel steht, sondern wer.
Meine tiefste Einsicht ist, dass das Leben ein großes Ganzes ist. Ich war sieben Jahre alt, als mein Vater und ich in unserem Garten in Brooklyn einen kleinen Schuppen bauten, in dem wir ein paar Brieftauben hielten. Als ich sah, wie sie in den kleinen Kämmerchen nisteten, sich umwarben und um ihren Nachwuchs kümmerten, wegflogen und voller Zuversicht wieder zurückkamen, als ich sah, dass sie Futter, Wasser, ein Zuhause und einander brauchten, wurde mir klar, dass sie in ihren Wohnungen ein Leben wie wir führten. Wie wir, nur auf andere Weise. Mein ganzes Leben lang habe ich mit vielen verschiedenen Tieren zusammengelebt und sie in meiner und deren Welt studiert. Dies hat meinen Eindruck, dass unsere Leben miteinander verwoben sind, verstärkt und immer wieder bestätigt. Und diese Erfahrung ist es, die ich auf den kommenden Seiten gerne mit Ihnen teilen möchte.
I.
Das Trompeten der Elefanten
Zart und mächtig, ehrfurchtgebietend undverzaubert, die Stille verkörpernd,die gewöhnlich den Berggipfeln, großen Brändenund dem Meer vorbehalten ist.
Peter Matthiessen,Der Baum der Schöpfung
Und da sah ich, dass der Erdboden sich erhoben hatte, dass dieses von der Sonnenhitze durchgebackene Land sich in etwas Riesiges, Lebendiges verwandelt hatte, das ständig in Bewegung ist. Das Land marschierte in mannigfaltigen Gestalten, mit schier zahllosen Schritten, die der Ursprung des allgegenwärtigen Staubs zu sein schienen. Die Wolke hüllte uns ein, drang in jede Pore, legte sich wie ein Film über unsere Zähne und drang bis in unsere Gedanken vor. In übertragenem und wörtlichem Sinn. Überwältigend.
Und da tauchten ihre Köpfe auf, wie die Schilde von Kriegern. Lange Atemzüge, die ein- und ausströmen und in ihren Lungen nachschwingen. Ihre Haut, abgetragen und faltig, bekommt im Lauf der Zeit ein Muster, so als zierten zerknitterte Landkarten ihre Haut. So ziehen sie über das Land und durch die Zeit. Ihre Haut, die, wenn sie gehen, wie Kordsamt raschelt, ist rau, und doch spürt sie die leichteste Berührung. Mit ihren pflastersteinartigen Backenzähnen zermahlen sie Grasbüschel für Grasbüschel, Bissen für Bissen, als würden sie sich so die Welt erobern. Und die ganze Zeit über raunen sie sich ihre Erinnerungen zu, damit sie nicht verloren gehen. Ihr Kollern ist wie Donner, der langsam näher rollt, es lässt den hügeligen Boden vibrieren und die Wurzeln der Bäume. Es trommelt Familienmitglieder und Freunde vom Flussufer und von den Hügeln zusammen, versendet Grüße und Reiseberichte. Uns Menschen deutet es an, was bald geschehen wird.
Ein Gedanke setzt einen Berg aus Muskeln und Knochen in Bewegung, braune Augen erleuchten die Landschaft, und eine Elefantin trottet herbei. Jetzt sieht man ihre flache Stirn und gewundene Blutgefäße, die sich durch ihre Haut schlängeln. Mit ihrem Trompeten kündigt sie sich an und applaudiert sich selbst mit ihren flatternden Ohren. Sie beeindruckt uns als ein zeitloses und erhabenes Wesen, aufmerksam und bedächtig, friedfertig und umsichtig – und wenn es sein muss, auch tödlich gefährlich. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten ist sie weise, wie wir. Und verletzlich. So wie wir.
Schau. Hör einfach zu. Mit uns werden sie nicht reden, aber einander haben sie viel zu sagen. Manches davon können wir hören. Alles andere liegt jenseits von Worten. Ich will genau hinhören und mich für das Mögliche öffnen.
Überdimensionierte Ohren schlagen. Die Schlammkruste auf der Haut stört dabei nicht. Bizarr vorstehende Zähne flankieren die wohl phallischste Nase der Welt. Eine solch wasserspeiende Fratze sollte uns abgrundtief hässlich vorkommen. Doch betört sie uns mit ihrer diffusen Schönheit, die uns manchmal überwältigt. Wir empfinden viel mehr, viel intensiver. Wir können fühlen, dass ihr Marsch über das Land ein Ziel hat. Es hat keinen Zweck, es zu leugnen. Sie haben eine konkrete Vorstellung von dem Ort, an den sie wandern.
Genau da wollen sie jetzt hin.
Die große Frage
«Es war das schlimmste Jahr meines Lebens», erzählt Cynthia Moss beim Frühstück. «Alle Elefanten über fünfzig Jahre starben, außer Barbara und Deborah. Auch die meisten über vierzig überlebten nicht. Deswegen grenzt es an ein Wunder, dass Alison, Agatha und Amelia es geschafft haben.»
Alison, inzwischen einundfünfzig Jahre alt, ist ganz in der Nähe, in dem Palmenhain da drüben. Vor vierzig Jahren kam Cynthia Moss nach Kenia, mit dem Ziel, das Leben der Elefanten zu erforschen. Die erste Elefantenfamilie, auf die sie stieß, nannte sie die «AA»-Familie und taufte eines der Mitglieder Alison. Unmittelbar vor unseren Augen verdrückt Alison gerade eine Palmfrucht nach der anderen. Erstaunlich.
Mit einer großen Portion Glück und ausreichend Regen könnte sie weitere zehn Jahre überleben. Da drüben ist Agatha, sie ist vierundvierzig Jahre alt. Und hier kommt Amelia, ebenfalls vierundvierzig.
Amelia nähert sich bedrohlich und baut sich in voller Größe direkt vor unserem Wagen auf. Reflexartig ducke ich mich weg. Cynthia dagegen lehnt sich aus dem Fenster und redet besänftigend auf sie ein. Jetzt steht die Riesin so gut wie neben uns, zermalmt Palmwedel, kollert sanft und blinzelt.
Im dottergelben Licht der untergehenden Sonne wirkt die Landschaft wie ein unerschöpflicher Ozean aus Gras. Er erstreckt sich bis zum Fuß von Afrikas höchstem Berg, dessen blauer, schneegekrönter Kopf in Wolken gehüllt ist. Die Schmelzwasserbäche des Kilimandscharo, eines gigantischen Wasserspenders, sammeln sich hier in bis zu drei Kilometer langen Sumpfgebieten, welche sowohl Wildtiere als auch Viehhirten magisch anziehen. Der Name des Amboseli-Nationalparks stammt von der Bezeichnung der Massai für den vorzeitlichen, seichten See, der etwa die Hälfte des Nationalparks ausmacht, und nur zeitweise feucht im Sonnenlicht glitzert. Die Größe der Sumpfgebiete hängt von der Ergiebigkeit der Regenfälle ab. Wenn der Regen ausbleibt, verwandelt sich das Moor in eine Staubwüste. Dann ist alles möglich. Vor vier Jahren erschütterte eine extreme Dürre die Region bis ins Mark.
Über Jahrzehnte sind Cynthia und die drei Elefanten hiergeblieben und haben sich dieser Landschaft gestellt – in Zeiten des Überflusses wie in Zeiten großer Entbehrungen. Bei der unerwartet komplexen Aufgabe, das wesenseigene Verhalten der Elefanten zu beobachten, leistete Cynthia bahnbrechende Arbeit. Noch nie hat ein Mensch über einen so langen Zeitraum eine Gruppe von Elefanten auf ihrem persönlichen Lebensweg begleitet.
Ich hatte mich darauf eingestellt, dass die berühmte Forscherin nach über vier Jahrzehnten ein wenig kampfesmüde geworden sein könnte. Doch lernte ich Cynthia Moss, mit ihren strahlend blauen Augen, als überraschend alerte, jugendfrische Frau Anfang siebzig kennen, der durchaus der Schalk im Nacken sitzt. In den 1960er Jahren schrieb sie für das Nachrichtenmagazin Newsweek, entschied sich aber nach ihrer ersten Afrikareise, New York und ihr altes Leben hinter sich zu lassen. Sie hatte sich unsterblich in Amboseli verliebt. Warum, ist leicht nachvollziehbar.
Vielleicht sogar zu leicht. Der Anblick der schimmernden Luftspiegelungen über der glühenden Ebene erweckt den trügerischen Anschein, der Amboseli-Nationalpark sei groß. In Wirklichkeit ist er zu klein. Mit dem Auto lässt er sich in weniger als einer Stunde durchqueren. Amboseli ist eine Postkarte, die sich Afrika einst selbst zugeschickt hat und nun in einer Schublade unter «Nationalparks und Reservate» verstaut. Der Kilimandscharo liegt bereits in einem anderen Staat, an der imaginären Grenze zu einem Gebiet, das Tansania heißt. Der Berg und die Elefanten wissen, dass es sich in Wirklichkeit um ein und dasselbe Land handelt. Doch ist es der Nationalpark, der mit seinen 390 Quadratkilometern als wichtigste Wasserstelle im Umkreis von 7770 Quadratkilometern herhalten muss. Die Amboseli-Elefanten nutzen eine Fläche, die ungefähr zwanzigmal[1] so groß ist wie der Nationalpark. Dies gilt auch für das Volk der Massai, das von der Rinder- und Ziegenzucht lebt. Aber nur in Amboseli gibt es ganzjährig Wasser. Das umliegende Land ist zu trocken, um alle mit Wasser zu versorgen und Amboseli ist zu klein, um alle zu ernähren.
«Die Elefantenfamilien versuchten es mit unterschiedlichen Überlebensstrategien», erklärt Cynthia. «Einige blieben in der Nähe des Sumpfs, doch als dieser austrocknete, erging es ihnen schlecht. Andere wanderten weit in den Norden, teils zum ersten Mal in ihrem Leben. Sie hatten damit mehr Glück. Von achtundfünfzig Familien hat nur eine einzige kein Mitglied verloren.» Eine Familie verlor sieben erwachsene weibliche Tiere und dreizehn Jungtiere. «Wenn ein Elefant zu Boden geht, versammeln sich normalerweise die anderen um ihn herum und versuchen, ihm wieder auf die Beine zu helfen. Während der Dürre hatten sie dazu keine Kraft. Mit ansehen zu müssen, wie sie sterben, wie sie im Todeskampf auf der Erde lagen …»
Einer von vier Amboseli-Elefanten starb. Das entspricht 400 Tieren bei einer Gesamtpopulation von 1600. Fast jedes Elefantenkalb ging ein. Ungefähr achtzig Prozent der Zebras und Gnus sowie fast alle Rinder der Massai überlebten die Dürre nicht; sogar Menschen kamen ums Leben.
Nach einer schweren Dürre ein Babyboom. Für einige Jahre bleiben die heranwachsenden Elefanten in Berührungsnähe ihrer Mütter.
Als es wieder regnete, wurden die Elefantenkühe, die ihre Babys verloren hatten, alle ungefähr zum gleichen Zeitpunkt brunftig. Das Ergebnis war der größte Babyboom, den Cynthia in vierzig Jahren erlebt hatte. Innerhalb der letzten zwei Jahre wurden zweihundertfünfzig Elefantenbabys geboren, und es gibt wohl keinen besseren Zeitpunkt, um in Amboseli als Elefant zur Welt zu kommen. Üppiger Pflanzenwuchs, jede Menge Gras – und kaum Konkurrenz. Wasser macht, dass es Elefanten gibt. Und Wasser macht Elefanten glücklich.
Eine fröhliche Elefantengruppe watet durch eine smaragdgrüne Wasserstelle, Palmen spenden großzügig Schatten. Es ist ein kleines Paradies. Mit ihren wuseligen, biegsamen, kleinen Rüsseln sind die Elefantenbabys der Inbegriff vollkommener Unschuld.
«Wie kugelrund dieses Kleine ist», staune ich. Mit seinen fünfzehn Monaten ist es ein wahrer Wonneproppen. Vier erwachsene Elefanten und drei junge Kälber suhlen sich in einem Schlammbecken und spritzen sich mit ihren Rüsseln Wasser auf den Rücken. Danach machen sie es sich am Ufer gemütlich. Eines der Elefantenbabys schmilzt vor Vergnügen förmlich dahin und ich beobachte, wie sich die Muskeln rund um seinen Rüssel langsam entspannen und ihm die Augen zufallen. Auch eines der älteren Tiere namens Alfre legt sich hin. Doch drei junge Draufgänger drängeln sich dazu und trampeln auf Alfres Ohr. Und wie. Nach und nach kehrt Ruhe ein. Die Babys schlafen auf der Seite liegend, die Erwachsenen stehen eng aneinandergeschmiegt schützend um sie herum, während auch sie ein Nickerchen halten. Sie wissen, dass ihre Familie hier in Sicherheit ist. Ihre Ruhe ist ansteckend. Alleine sie zu beobachten, wirkt schon besänftigend.
Viele Leute träumen davon, im Fall eines Lottogewinns ihren Job hinzuschmeißen und sich nur noch den schönen Dingen des Lebens zu widmen: Freizeit, Spiel, Familie, Elternschaft und zwischendurch aufregendem Sex. Sie würden essen, wenn sie Hunger hätten, und schlafen, wenn sie müde wären. Viele Leute lebten, würden sie über Nacht reich, genauso wie Elefanten.
Die Elefanten scheinen glücklich zu sein. Doch stimmt diese Vermutung auch? Sind sie wirklich glücklich? Der Wissenschaftler in mir fordert Beweise.
«Elefanten erleben Freude»,[2] meint Cynthia. «Mag sein, dass es sich nicht um die Freude handelt, die wir Menschen verspüren, aber es ist definitiv Freude.»
Elefanten verhalten sich in Situationen freudvoll, in denen auch wir tiefe Zufriedenheit empfinden: im vertrauten Zusammensein mit «Freunden» und Familie, bei üppigem Vorhandensein von Essen und Trinken. Wir nehmen an, dass sie auf dieselbe Art und Weise Glück verspüren wie wir. Doch Vorsicht bei Spekulationen! Seit Jahrhunderten reißen sie nicht ab und reichen vom Verdacht, dass Tiere uns verhexen können, bis zu der These, dass sie keinerlei Bewusstsein haben und nicht in der Lage sind, Schmerz zu verspüren. Zwar geben Wissenschaftler durchaus den Rat, das Handeln von Tieren zu beobachten, doch gelten Vermutungen über deren Psyche als sinnlos und reine Zeitverschwendung.
Mutmaßungen über die Gefühlswelt und das Denkvermögen von Tieren sind aber das Hauptthema dieses Buchs. Die knifflige Aufgabe besteht darin, nur Behauptungen aufzustellen, die sich empirisch beweisen lassen und logisch sind – und dabei keine Fehler zu machen.
Wasser und Matsch machen Elefanten glücklich.
Cynthias wild lebende Freunde scheinen weise zu sein. Außerdem jung und verspielt. Mächtig, würdevoll. Und unschuldig. Das alles trifft auf sie zu. Außerdem wirken sie friedfertig. Doch von allen Tieren sind sie auch diejenigen, die zähen Widerstand gegen die Verfolgung durch uns Menschen leisten und sogar töten, um sich selbst zu verteidigen. Sie versuchen, zu überleben und ihren Nachwuchs zu schützen. Ich denke, dass ich hier bin, weil ich offen für Neues bin, weil ich den Dingen auf den Grund gehen und wissen will: Inwiefern sind sie wie wir? Was lehren sie uns über uns selbst? Was ich allerdings nicht ahnen kann: Ich stelle die falschen Fragen.
Am wohlsten fühlt sich Cynthia Moss in ihrem gemütlichen, von Palmen umgebenen Zeltlager im Amboseli-Nationalpark. In einer kleinen Baracke befindet sich die Küche und jedes der sechs großen Zelte ist mit einem richtigen Bett und ein paar Möbeln ausgestattet. Kürzlich war morgens der Tee noch nicht fertig. Eine Forscherin zog den Reißverschluss ihres Zelts auf, um nachzusehen, was los ist, und entdeckte auf der Schwelle zur Küche einen dösenden Löwen. Der Koch hinter der Küchentür hingegen war in hellem Aufruhr.
Heute frühstücken wir pünktlich und endlich komme ich dazu, Cynthia die für mich alles entscheidende Frage zu stellen: «Dein ganzes Leben lang beobachtest du nun Elefanten. Was hast du dabei über das Menschsein gelernt?» Verstohlen schiele ich auf mein Diktiergerät, um sicherzugehen, dass ich es auch angestellt habe. Dann lehne ich mich zurück. Seit vierzig Jahren sammelt Cynthia dazu Erkenntnisse; sie hat bestimmt die Antwort.
Doch Cynthia Moss umgeht meine Frage elegant. «Ich betrachte sie immer als das, was sie sind, nämlich Elefanten», antwortet sie. «Mein ganzes Interesse gilt den Elefanten. Den Vergleich zwischen Elefanten und Menschen finde ich nicht besonders hilfreich. Der Versuch, ein Tier als Tier zu verstehen, ist in meinen Augen viel interessanter. Wie kann ein Vogel, etwa eine Krähe, mit einem solch kleinen Gehirn derart erstaunliche Entscheidungen treffen? Die Krähe neben ein dreijähriges Kind zu halten – das ist nicht mein Ding.»
Cynthias sanfter Einwand auf meine Frage kommt so unerwartet, dass ich ihn zunächst überhaupt nicht verstehe. Dann bin ich überwältigt.
Seit ich denken kann, erforsche ich das Verhalten von Tieren. Schon vor langer Zeit kam ich zu dem Schluss, dass viele soziale Tiere – besonders Vögel und Säugetiere – in wesentlichen Punkten wie wir Menschen sind. Ich war mit dem Ziel nach Afrika gereist, herausfinden, inwiefern Elefanten «wie wir» sind, um dann genau darüber ein Buch zu schreiben. Doch eben gab es eine entscheidende Kursänderung. Ich habe einen Moment – genauer gesagt Tage – gebraucht, aber Tropfen für Tropfen, wie eine Infusion, sickerte die Erkenntnis in mich.
Cynthias kleine, durchschlagende Bemerkung bedeutete, dass der Mensch nicht das Maß aller Dinge ist. Und damit verfolgte sie den einzig richtigen Denkansatz.
Ihr Kommentar warf alles über den Haufen, nicht nur meine Fragestellung, sondern auch meine ganze Denkweise. Ich war davon ausgegangen, dass meine Aufgabe darin bestand, den Tieren die Möglichkeit zu geben, zu zeigen, wie sehr sie uns Menschen ähneln. Nun war die Angelegenheit schwieriger und komplexer geworden: Ich musste erforschen, wer sie sind – wie wir oder auch nicht.
Die Elefanten, die wir beobachten, rupfen mit ihren Rüsseln behände Gras und Gestrüpp aus. Kontinuierlich stopfen sie sich große Büschel in ihre Backentaschen und zermahlen sie mit ihren riesigen, kräftigen Backenzähnen. Egal ob Dornen, die Autoreifen zerstechen könnten, Palmfrüchte oder Gras – ihnen schmeckt alles. Ich hatte einmal die Gelegenheit, die Zunge eines Elefanten in Gefangenschaft zu streicheln. Sie war unglaublich weich. Es geht mir nicht in den Kopf, wie ihre Zungen und Mägen mit diesen spitzen Dornen zurechtkommen.
Alles, was ich sehe, sind fressende Elefanten. Doch mit unseren Worten können wir Menschen die Realität nur vage beschreiben. Ja, wir beobachten hier «Elefanten», doch stelle ich verwirrt fest, dass ich über ihr Leben überhaupt nichts weiß.
Cynthia aber hat mehr Ahnung. «Wenn du eine Gruppe von Tieren beobachtest, egal ob Löwen, Zebras oder Elefanten, siehst du zunächst immer nur ein zweidimensionales Bild. Doch wenn du ihre verschiedenen Persönlichkeiten kennenlernst, wenn du weißt, wer ihre Mutter war, wer ihre Kinder sind, dann gewinnt das Bild an Tiefe.» Eine Elefantenfamilie versammelt ganz unterschiedliche Charaktere: Sie können würdevoll und sanft, scheu, zurückhaltend oder besonders verspielt wirken. Vielleicht ist auch einer dabei, der äußerst dominant und bei Futtermangel sogar aggressiv auftritt.
«Ich habe rund zwanzig Jahre gebraucht, bis mir klar wurde, wie komplex diese Tiere sind», fährt Cynthia fort. «In der Zeit, in der wir Echos Familie gefolgt sind – damals war sie ungefähr fünfundvierzig Jahre alt –, bemerkte ich, dass sich Enid ihr gegenüber sehr loyal verhielt, Eliot eher verspielt war, Eudora unverbindlich, Edwina unbeliebt und so weiter. Langsam konnte ich voraussagen, was als Nächstes passieren würde, weil ich die Hinweise darauf direkt von Echo bekam. Ich begann – wie ein Mitglied der Elefantenfamilie – Echos Handeln als Anführerin zu verstehen.»
Ich blicke zu den Elefanten.
Cynthia erzählt weiter: «Jetzt merkte ich auch, wie überaus bewusst sie sich unseres Tuns sind.»
Überaus bewusst? Sie wirken so selbstvergessen.
«Elefanten wirken so, als würden sie Einzelheiten überhaupt nicht wahrnehmen», erklärt Cynthia, «bis sich Vertrautes ändert.» Eines Tages legte sich ein Kameramann, der mit Cynthia zusammenarbeitete, unter das Forschungsfahrzeug, um aus einem anderen Winkel filmen zu können. Normalerweise trotteten die Elefanten einfach an dem Fahrzeug vorbei, doch jetzt bemerkten sie sofort, dass etwas anders war, blieben wie angewurzelt stehen und starrten. Warum versteckte sich da ein Mensch unter dem Auto? Ein Elefantenbulle namens Mr. Nick ließ tastend seinen Rüssel daruntergleiten, um das Ganze zu erforschen. Er war nicht angriffslustig und versuchte auch nicht, den Mann unter dem Fahrzeug herauszuziehen; er war einfach nur neugierig. Ein anderes Mal, als das Fahrzeug mit einer Luke für Filmarbeiten ausgestattet worden war, untersuchten die Elefanten die Neuerung und betasteten sie mit ihren Rüsseln.
Der Rüssel der Elefanten ist uns eigenartig vertraut und doch so fremd. Einerseits ist er sehr feinfühlig, andererseits von enormer Schlagkraft. Mit ihm kann ein Elefant ein Ei[3] auflesen, ohne es zu zerbrechen – oder einen Menschen mit einem einzigen Schlag töten. Am Ende des Rüssels befinden sich zwei fingerartige Ausbuchtungen, wie eine Hand in einem Fäustling. Es ist die Art und Weise, wie Elefanten ihre Rüssel benutzen, die sie uns so vertraut erscheinen lässt. Sie muten an wie einarmige Menschen, die erfolglos versuchen, ihre hässliche Nase zu verbergen und dabei deren Verwandlung vortäuschen.
Wird uns ihre fremdartige Herrlichkeit, ihre wunderbare Schönheit jemals kaltlassen? Ein Elefantenrüssel ist strukturiert wie der Stamm einer Palme und multifunktional wie ein Schweizer Messer. Mit ihrer abgerundeten Außenkante und glatten Innenseite kann diese riesige raupenartige Nase in großer Reichweite den immensen Durst stillen, Wasser spritzen, Schlamm herumschleudern, Staub verwirbeln, Witterung aufnehmen, Nahrung sammeln, Freunde begrüßen, Elefantenkinder retten und beruhigen. Oria Douglas-Hamilton schrieb: «Im Rüssel befinden sich zwei Schläuche, um Wasser einzusaugen und wieder auszuspritzen.» Die Journalistin Caitrin Nicol ergänzt, dass ein Rüssel all das kann, «wozu der Mensch eine Kombination aus Augen, Nase, Händen und einer Maschine bräuchte».[4] Yoshihito Niimura von der Universität Tokio meint: «Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Nase auf Ihrer Handfläche und jedes Mal, wenn Sie etwas berühren, riechen Sie es auch.»[5]
Elefanten begrüßen sich häufig, indem sie mit ihrem Rüssel das Maul des anderen berühren, eine Art Kombination aus Händeschütteln, Umarmung und Kuss.
Mit kräftigem Griff umwickeln die Dickhäuter mit ihren erstaunlichen Nasen Grasbüschel und reißen sie aus. Wenn die Ballen sich nicht gleich aus der Erde lösen lassen, geben sie ihnen einen kleinen Tritt, damit sie zerbröselt. So holen sie sich ihre Nahrung aus dem Boden. Manchmal schütteln sie auch die Erde von den Wurzeln. Ihre Art zu essen ist ruhig und entspannt. Oft schwingen sie ihren Rüssel leicht hin und her, um sich den nächsten Happen mit ein wenig Schwung in ihr dreieckiges Maul zu stecken. Manchmal halten sie für einen Moment inne, als würden sie einem Gedanken nachhängen. Vielleicht aber lauschen sie auch nur, um sich zu vergewissern, dass es ihren Kindern gut geht, ihre Familie in Sicherheit ist und keine Gefahr droht.
Ich würde so gerne wissen, wie groß in diesem Moment die Schnittmenge zwischen meiner Wahrnehmung und der eines Elefanten in meiner unmittelbaren Nähe ist. Unsere «Eingangskanäle» sind ähnlich: Sehen, Riechen, Hören, Tasten, Schmecken; was wir mit Hilfe dieser Sinne registrieren, müsste sich größtenteils überschneiden. Wir können beispielsweise die gleichen Hyänen wie die Elefanten sehen oder die gleichen Löwen. Als Primaten haben wir Menschen jedoch einen sehr ausgeprägten Sehsinn. Elefanten hingegen haben, wie die meisten anderen Säugetiere, einen hochentwickelten Geruchssinn. Außerdem hören sie äußerst gut.
Ich bin sicher, dass die Elefanten viel mehr mitbekommen als ich; hier sind sie zu Hause, hier haben sie ihre Wurzeln. Ich habe keine Ahnung, was in ihren Köpfen vorgeht. Auch weiß ich nicht, was Cynthia denkt, während sie ruhig und aufmerksam ihre Schützlinge beobachtet.
Das gleiche Gehirn
Vier wohlgenährte Elefantenbabys folgen ihren imposanten Müttern durch eine ausgedehnte, süß riechende Graslandschaft. Als wären sie verabredet, schreiten die ausgewachsenen Tiere zielstrebig in Richtung des großen Sumpfgebiets, wo sich bereits Hunderte ihrer Artgenossen tummeln. Die Familien pendeln täglich zwischen ihren Schlafplätzen in den dichtbewachsenen Hügeln und dem Moor. Hin und zurück kommen sie dabei nicht selten auf fünfzehn Kilometer. Auf ihren langen, täglichen Wanderungen kann eine Menge passieren.
Unsere Aufgabe ist es, die Elefanten morgens aufzuspüren und zu überprüfen, an welchem Ort sich die einzelnen Tiere aufhalten. Man möchte meinen, dass dies nicht so schwer sein kann, doch handelt es sich um Dutzende von Familien, Hunderte von Elefanten.
«Man muss sich jeden einprägen. Ja, wirklich!», sagt Katito Sayialel. Ihr trällernder Akzent klingt so klar und leicht wie ein afrikanischer Morgen. Katito ist eine Massai, hochgewachsen und tüchtig. Seit über zwei Jahrzehnten studiert sie zusammen mit Cynthia Moss Elefanten in freier Wildbahn.
Wie viele meinst du, wenn du «jeden» sagst?
«Ich erkenne alle ausgewachsenen weiblichen Tiere wieder, also neunhundert bis tausend Elefanten. Ja, das dürfte hinkommen», schätzt Katito.
Aber wie ist es möglich, Hunderte von Elefanten voneinander zu unterscheiden? Manche prägt sich Katito anhand individueller Erkennungszeichen ein, wie etwa eines Lochs im Ohr. Doch bei manchen reicht schon ein Blick, wie bei einem vertrauten Freund.
Wenn sie alle zusammenstehen, kann man es sich nicht erlauben, zu sagen: «Sekunde, wer war das gleich nochmal?» Auch die Elefanten können Hunderte von Artgenossen auseinanderhalten. Sie leben in riesigen sozialen Netzwerken, die aus Familienmitgliedern und Freunden bestehen. Daher sind sie auch so berühmt für ihr gutes Gedächtnis. Mit Sicherheit erkennen sie Katito wieder.
«Als ich hier zum ersten Mal auftauchte, hörten sie meine Stimme und merkten, dass ich neu war. Sie kamen näher, um sich meinen Geruch einzuprägen, und inzwischen wissen sie, wer ich bin.»
Auch Vicki Fishlock lebt hier. Die blauäugige Britin, Anfang dreißig, erforschte Gorillas und Elefanten in der Republik Kongo. Nach ihrer Promotion kam sie nach Kenia, um mit Cynthia zusammenzuarbeiten. Inzwischen sind ein paar Jahre vergangen und Vicki denkt nicht einmal im Traum daran, Amboseli zu verlassen. Normalerweise schaut Katito nach, welche Elefanten da sind, und fährt dann weiter. Vicki bleibt und beobachtet sie. Heute machen wir einen kleinen Ausflug.
Abseits des hohen «Elefantengrases» rupfen fünf ausgewachsene Tiere und vier Babys kurze, spärlich wachsende Halme. Das bedeutet mehr Arbeit, doch scheinen sie viel besser zu schmecken. Sie haben keine Abhandlungen über den Nährstoffgehalt von Gras gelesen. In gewissem Sinne teilt ihnen ihr Unterbewusstsein mit, was zu tun ist, indem es sie mit Genuss dafür belohnt, das reichhaltigere Gras zu wählen. Bei uns funktioniert das ganz genau so – deswegen schmecken uns Fett und Zucker so gut.
Die grasenden Elefanten werden von etlichen Reihern und einem Schwarm wild herumflatternder Schwalben verfolgt. Wenn sich die Dickhäuter wie große graue Schiffe durch den Ozean aus Gras pflügen, scheuchen sie die darin lebenden Insekten für die Vögel auf. Wechselnde Schattierungen auf ihren sanft geschwungenen Rücken, gleich Wellen im Sonnenlicht. Elefantengeräusche. Gras, das mit einem Ruck aus der Erde gerissen wird, Malmen und Kauen. Ohrenflattern. Mist, der zu Boden plumpst. Das Summen von Fliegen und Elefantenschwänzen, die zischend nach ihnen schlagen. Die Ruhe dieser riesigen Tiere. Ohne Worte erzählen sie von einer Zeit, lange bevor es den Menschen gab. Sie existieren weiter, ohne uns Beachtung zu schenken.
«Nein, sie ignorieren uns nicht», verbessert mich Vicki. Sie erwarten von uns, dass wir uns ihnen gegenüber höflich verhalten, und wir entsprechen diesem Wunsch. Daher besteht für sie auch kein Grund, uns weiter zu beachten.
«Sie haben sich mir gegenüber nicht immer so gegeben», ergänzt Vicki. «Als ich anfing, hier zu arbeiten, waren sie daran gewöhnt, dass Autos vorbeikamen, aus denen ein paar Fotos geschossen wurden, um sogleich weiterzufahren.» Über jemanden, der hier herumsaß und sie über einen längeren Zeitraum beobachtete, waren sie alles andere als glücklich. Sie gehen davon aus, dass wir ein bestimmtes Verhalten an den Tag legen. Weichen wir davon ab, lassen sie uns wissen, dass sie dies sehr wohl bemerken. Doch nicht auf feindselige Art und Weise. Etwa, indem sie den Kopf schütteln und uns einen Blick zuwerfen, der sagen will: «Was ist dein Problem?»
Wir fahren gemächlich durch das hügelige Buschland. Eine Elefantenkuh namens Tecla trottet rechter Hand nur ein paar Meter vorneweg, als sie plötzlich kehrtmacht und protestierend zu trompeten beginnt. Ein Elefantenjunges zu unserer Linken läuft im Kreis und schreit.
«Es tut mir schrecklich leid!», beschwichtigt Katito Tecla. Abrupt bleibt sie stehen und stellt den Motor ab. Mir scheint, als hätten wir aus Versehen Tecla von ihrem Jungen getrennt. Doch Tecla ist überhaupt nicht die Mutter. Eine andere Elefantenkuh, deren Gesäuge prall gefüllt mit Milch ist, rennt auf uns zu und bleibt unmittelbar vor uns stehen. Sie ist die Mutter. Tecla war es, die ihr mitgeteilt hat: «Die Menschen haben sich zwischen dich und dein Baby gedrängt, komm sofort her und tu etwas!»
«Elefanten sind wie wir Menschen», meint Katito. «Sehr intelligent. Ich mag die Art wie sie sich verhalten, ihre Familie zusammenhalten und beschützen. Ja, das mag ich.»
Wie wir Menschen? In einigen grundsätzlichen Dingen scheinen wir – sind wir – uns unglaublich ähnlich. Doch vor meinem inneren Auge sehe ich Cynthia mahnend den Zeigefinder heben und mich daran erinnern, dass Elefanten nicht wie wir sind, sondern sie selbst.
Mutter und Baby sind wieder vereint, die Ordnung ist wieder hergestellt. Langsam fahren wir weiter. Wenn ein Individuum weiß, in welcher Beziehung ein weiteres zu einem dritten steht, spricht man vom «Verständnis der Beziehung Dritter».[6] Auch Primaten verstehen die Beziehung Dritter, genauso wie Wölfe, Hyänen, Delfine, Vögel aus der Krähenfamilie sowie einige Papageien.[7] Ein Papagei etwa kann eifersüchtig auf die Frau seines Halters sein.[8] Wenn Grüne Meerkatzen die Angstschreie eines Babys aus ihrer Sippe hören, beginnen sie sofort nach seiner Mutter Ausschau zu halten.[9] Sie wissen genau, wer sie und wer die anderen sind. Außerdem sind sie sich im Klaren darüber, wer für wen wichtig ist. Wenn Delfinmütter in freier Wildbahn wollen, dass ihre Jungen aufhören, mit Menschen zu interagieren, erteilen sie dem Menschen, der gerade die Aufmerksamkeit ihres Kleinen genießt, einen Schlag mit der Schwanzflosse, um ihm zu signalisieren: «Genug gespielt, jetzt soll mein Kind wieder auf mich achten». Wenn die Jungtiere trödeln und lieber mit den wissenschaftlichen Hilfskräften der Forscherin Denise Herzing spielen, kann es passieren, dass sich die «Verwarnungen» der Delfinmütter direkt an Dr. Herzing richten.[10] Dies beweist, dass die Delfine wissen, dass sie die Chefin der Menschengruppe im Wasser ist. Die Tatsache, dass wildlebende Tiere die Rangordnung in einer Gruppe von Menschen durchschauen, ist einfach nur erstaunlich.
«Am faszinierendsten finde ich, dass wir wirklich in der Lage sind, einander zu verstehen», fasst Vicki zusammen. «Man findet mit der Zeit heraus, wo die unsichtbaren Grenzen eines Elefanten liegen. Irgendwann spürt man, wann es Zeit ist zu sagen: ‹Ich will sie nicht unter Druck setzen›. Begriffe wie ‹verwirrt›, ‹glücklich›, ‹traurig› oder ‹angespannt› – sie alle beschreiben tatsächlich den Gemütszustand des jeweiligen Elefanten. Unsere Erfahrungsbereiche überschneiden sich, weil», an dieser Stelle zwinkert mir Vicki zu, «wir alle das gleiche Gehirn haben».
Ich schaue hinüber zu den Elefanten, die sich angesichts unserer Präsenz so ungerührt geben, dass sie nur wenige Schritte von unserem Wagen entfernt entlangtrotten. «Eines unserer größten Privilegien ist es, Elefanten begleiten zu dürfen, die damit einverstanden sind, dass wir hier sind», erklärt Vicki. «Sie wollen nach Tansania, wo es von Wilderern nur so wimmelt. Hier hingegen –.» Vickis Tonfall ist ruhig und sanft, wenn sie ihnen Dinge zuflüstert wie, «Hallo, mein Schatz» oder «Du bist aber eine Schöne». Vicki erinnert sich, dass Echos Familie nach deren tragischem Tod unter Führung ihrer Tochter Enid das Gebiet für drei Monate verließ. «Als sie zurückkehrten, sagte ich Sätze wie ‹Hallo, ich habe dich vermisst›. Da hob Enid mit einem Ruck den Kopf und gab dieses langgezogene Kollern von sich; sie flatterte mit den Ohren und alle Familienmitglieder scharten sich um mich herum, so nahe, dass ich sie hätte streicheln können. In ihren Gesichtern konnte ich lesen, was sie fühlten. Das ist Vertrauen. Es war, als würden mich die Elefanten in den Arm nehmen.»
Elefantenbabys ruhen sich häufig im Schatten aus, während die Erwachsenen aufpassen.
Vor einiger Zeit war ich zusammen mit einem Wissenschaftler in einem anderen afrikanischen Reservat unterwegs. Mehrere Elefanten dösten mit ihren Jungen im Schatten einer Palme; sie wedelten mit den Ohren, um sich abzukühlen. Der Wissenschaftler vertrat die Meinung, dass sich die Elefanten «ausschließlich abhängig von der Temperaturentwicklung bewegen und ansonsten nichts wahrnehmen». Dabei erklärte er: «Ich habe keine Möglichkeit, festzustellen, ob dieser Elefant mehr mitbekommt, als der Strauch da drüben.»
Keine Möglichkeit, dies festzustellen? Zunächst einmal unterscheidet sich das Verhalten eines Strauchs von dem eines Elefanten in wesentlichen Punkten. Bei einem Strauch sind keine psychischen Reaktionen nachweisbar: Er zeigt keine Gefühle, trifft keine Entscheidungen und verteidigt nicht seinen Nachwuchs. Demgegenüber verfügen Mensch und Elefant über nahezu identische Nerven- und Hormonsysteme, Sinnesorgane und Milch, um ihre Babys zu ernähren. Beide zeigen in bestimmten Situationen Angst und Aggression.
Die These, dass ein Elefant ebenso wenig bemerkt wie ein Strauch, erklärt das Verhalten der Elefanten nicht besser als die Antithese, dass ein Elefant sehr wohl seine Umwelt wahrnimmt. Mein Kollege hielt sich für einen objektiven Wissenschaftler. Doch genau das Gegenteil war der Fall: Er zwang sich dazu, Beweise zu ignorieren, und dies ist alles andere als wissenschaftlich, da eine wissenschaftliche Aussage auf Beweisen basiert.
Zur Debatte steht: Mit wem leben wir hier zusammen? Wie sieht es in der Seele derjenigen aus, die auf dieser Welt leben?
Dies herauszufinden, ist ein schwieriges Unterfangen. Ich werde nicht einfach annehmen oder ausschließen, dass andere Tiere über ein Bewusstsein verfügen, sondern stattdessen nach Beweisen suchen und meine Schlüsse daraus ziehen. Wir machen es uns zu leicht, wenn wir falsche Hypothesen aufstellen und Jahrhunderte lang daran festhalten.
Im 5. Jahrhundert v. Chr. erklärte der griechische Philosoph Protagoras: «Der Mensch ist das Maß aller Dinge.» Anders formuliert, wir fühlen uns berechtigt, die Welt zu fragen: «Wie kannst du mir von Nutzen sein?» Wir gehen davon aus, dass wir mustergültig sind und der Rest der Welt sich nach uns richten soll. Doch diese Einstellung trübt unseren Blick. «Typisch menschliche» Eigenschaften, wie Empathie-, Trauer- und Kommunikationsfähigkeit, die Benutzung von Werkzeug und vieles mehr, finden sich in unterschiedlicher Ausprägung auch bei anderen Wesen auf dieser Erde. Wirbeltiere (Fische, Amphibien, Reptilien, Vögel und Säugetiere) verfügen über grundsätzliche Gemeinsamkeiten, was Skelett, Organe, Nervensystem, Hormonhaushalt und Verhaltensweisen anbelangt. Verglichen mit Autos haben wir alle einen Motor, einen Antriebsstrang, vier Räder, Türen und Sitze, nur dass der Mensch in puncto Design und Feineinstellung ein wenig abweicht. Doch wie ahnungslosen Autokäufern fällt den meisten Menschen nur das andersartige Äußere der Tiere ins Auge.
Wir sagen «Mensch und Tier», als ob es nur diese zwei Kategorien gäbe: uns und den Rest. Dabei haben wir Elefanten beigebracht, für uns Baumstämme aus den Wäldern zu ziehen, haben in Laboren Ratten durch Labyrinthe geschickt, um mehr über das Lernverhalten zu erfahren; haben Tauben auf Scheiben picken lassen, um die Grundlagen der Psychologie zu erforschen; haben Fliegen als Versuchsobjekte genommen, um die Funktionsweise unserer DNA zu entschlüsseln, und Affen mit Krankheitserregern infiziert, um Heilmittel für uns selbst zu gewinnen. Blinde sind auf die Hilfe ihrer treuen, vierbeinigen Begleiter angewiesen. Doch trotz dieser großen Nähe wollen wir nicht von dieser vagen Haltung abrücken, dass «Tiere» nicht wie wir sind – obwohl wir doch selbst Tiere sind. Es gibt wohl kaum eine andere Beziehung, die derart fehlgedeutet wird.
Um die Elefanten verstehen zu können, müssen wir uns eingehend mit Themen wie Bewusstsein, Wahrnehmung, Intelligenz und Emotionen auseinandersetzen. Bedauerlicherweise gibt es keine Standarddefinitionen, was bedeutet, dass ein und derselbe Begriff unterschiedliche Bedeutungen haben kann. Wie im Gleichnis von den blinden Männern und dem Elefanten liefern Philosophen, Psychologen, Ökologen und Neurologen keine allgemeingültigen Erklärungen, sondern betasten und beschreiben sozusagen jeweils nur einen Körperteil des Elefanten. Das Gute daran ist, dass diese vorherrschende Uneinigkeit es uns erlaubt, die akademischen Zankereien beiseitezulassen und uns eigene Gedanken zu machen.
Zunächst wollen wir den Begriff «Bewusstsein» wie folgt definieren: Bewusstsein ist das, was sich nach etwas anfühlt.[11] Diese einfache Begriffsklärung stammt von Christof Koch, dem Leiter des Allen Institute for Brain Science in Seattle. Eine Schnittverletzung am Bein ist zunächst ein rein physisches Ereignis. Wenn diese Verletzung schmerzt, ist man sich darüber bewusst. Das Wissen darüber, dass eine Schnittverletzung weh tut, liefert unser Verstand. Die Fähigkeit, etwas zu fühlen, nennt man Empfindungsvermögen. Das Empfindungsvermögen von Menschen, Elefanten, Käfern, Muscheln, Quallen und Bäumen rangiert auf einer breit gefächerten Skala. Beim Menschen ist es sehr differenziert, wohingegen es bei Pflanzen nicht zu existieren scheint. Erkenntnisvermögen meint die Fähigkeit, Wissen aufzunehmen und zu verstehen. Überlegt man etwas, das man zuvor wahrgenommen hat, spricht man von Denkvermögen. Im Vergleich unterschiedlicher Lebewesen miteinander stellt man auch in Bezug auf ihr Denkvermögen sehr unterschiedliche Ausprägungen fest. Ein Jaguar, der genau taxiert, wie er ein wachsames Nabelschwein am besten von hinten angreift, zeigt Denkvermögen, ebenso wie ein Bogenschütze, der sein Ziel anvisiert oder jemand, der über einen Heiratsantrag nachdenkt. Bei Lebewesen mit Bewusstsein handelt es sich beim Empfindungs-, Erkenntnis- und Denkvermögen um sich überschneidende Fähigkeiten.
Dem Bewusstsein wird dabei generell zu viel Bedeutung beigemessen, denn viele Abläufe finden ohne Beteiligung des Bewusstseins statt: Herzschlag, Atmung, Verdauung, Stoffwechsel, Immunantwort, Heilungsprozesse, Biorhythmus, Monatszyklus, Schwangerschaft, Wachstum. Auch in Vollnarkose sind wir quicklebendig, wenngleich nicht bei Bewusstsein. Während wir schlafen, wird in unseren unbewusst funktionierenden Gehirnregionen hart gearbeitet: gesäubert, sortiert und erneuert. In Ihrem Körper ist sehr fähiges Personal am Werk und das schon lange, bevor das Bewusstsein in die Belegschaft aufgenommen wurde. Zu schade, dass Sie Ihr Team niemals persönlich kennenlernen werden.
Das Bewusstsein können wir uns als einen Computerbildschirm vorstellen, den wir sehen und mit dem wir interagieren. Dieser wird von unsichtbaren Software-Codes betrieben, von denen wir keine Ahnung haben. Die meisten Abläufe im Gehirn finden unbemerkt statt. Der Wissenschaftsjournalist und ehemalige Herausgeber des Magazins Rolling Stone, Timothy Ferris, schrieb: «Was in unserem Gehirn vorgeht, können wir mit unserem Verstand größtenteils weder kontrollieren noch verstehen.»[12]
Wozu ist das Bewusstsein gut? Bäume und Quallen kommen auch ohne gut zurecht. Unser Bewusstsein brauchen wir, um Dinge beurteilen zu können, Pläne zu machen und Entscheidungen zu treffen.
Wie kann aus dem unübersichtlichen Brei aus Nervenzellen, dem Netz aus elektrischen Impulsen und chemischen Prozessen – seien es die von Elefanten, Menschen oder wem auch immer – ein Bewusstsein entstehen?
Wie produziert das Gehirn den Verstand? Niemand weiß, wie Nervenzellen, auch Neuronen genannt, das Bewusstsein schaffen. Doch so viel ist sicher: Das Bewusstsein wird bei Schädigung des Gehirns beeinträchtigt. Daraus folgt, dass das Bewusstsein im Gehirn sitzt. Der Neurowissenschaftler und Nobelpreisträger Eric R. Kandel schrieb im Jahr 2013: «Unser Verstand besteht aus einer Reihe von Abläufen, die unser Gehirn durchführt.»[13] Das Bewusstsein scheint also durch die Vernetzung von Neuronen zu entstehen.
Wie viele Nervenzellen müssen dafür vernetzt sein? Keiner kann sagen, wo sich die einfachsten Bewusstseinsformen verbergen, doch verfügen vermutlich weder Quallen noch Würmer über ein Bewusstsein. Mit ihren knapp einer Million Hirnzellen können sich Honigbienen Muster, Geruch und Farben verschiedener Blüten sowie deren Standort einprägen. Ihr «Schwänzeltanz» verrät ihren Stockgenossinnen Richtung, Entfernung und Reichhaltigkeit der gefundenen Nektarquelle. Bienen «weisen eine ausgeprägte Kompetenz auf»[14], behauptet der renommierte Neurologe Oliver Sacks. Wenn die Bienen an demselben Nektarfundort eine Gefahrenquelle, wie etwa eine Spinne, ausfindig machen, unterbinden sie den Schwänzeltanz ihrer Kolleginnen.[15] Werden Bienen im wissenschaftlichen Versuch mit einem Angriff konfrontiert, stellen Forscher «die gleichen Kennzeichen negativer Gefühle, wie sie der Menschen aufweist»[16] fest. Noch erstaunlicher ist, dass sich im Gehirn von Bienen die gleichen «Nervenkitzelhormone»[17] wie bei jenen Menschen finden, die ständig auf der Suche nach einem neuen Kick sind. Wenn diese Hormone den Bienen tatsächlich zu einem prickelndem Vergnügen oder einem Motivationsschub verhelfen, bedeutet dies, dass sie ein Bewusstsein haben. Bestimmte Wespenarten mit einem komplexen Sozialverhalten können Individuen anhand ihres Gesichts erkennen.[18] Vor dieser Erkenntnis hatte man diese Fähigkeit nur einigen wenigen Säugetieren zugeschrieben. «Es liegt auf der Hand, dass Insekten auf vielfältige und verblüffende Weise erinnern, lernen, denken, und kommunizieren können»,[19] stellt Sacks fest.
Ist es möglich, dass Elefanten, Insekten und andere Lebewesen über ein Bewusstsein verfügen, obwohl sie nicht mit der riesigen, in sich gefalteten Großhirnrinde ausgestattet sind, in der menschliches Denken stattfindet? Die Antwort ist ja und trifft sogar auf den Menschen zu: Der dreißigjährige Roger verlor aufgrund einer Hirninfektion rund fünfundneunzig Prozent seines Kortex.[20] An die Zeit vor der Infektion kann er sich nicht erinnern, Geruchs- und Geschmackssinn hat er verloren, außerdem hat er große Schwierigkeiten, neue Erinnerungen zu bilden. Doch weiß er genau, wer er ist, erkennt sich selbst im Spiegel sowie auf Fotos und verhält sich im Zusammensein mit anderen Personen normal. Roger hat Sinn für Humor und empfindet Scham. Und das alles mit einem Gehirn, das keine Ähnlichkeit mehr mit dem eines Menschen hat.
Die gewöhnliche Vorstellung, dass nur der Mensch ein Bewusstsein hat, ist rückständig. Im Lauf der Zivilisation sind die Sinne des Menschen immer mehr abgestumpft. Viele Tiere dagegen haben übermenschlich feine Antennen, – denken Sie nur an das Verhalten von Elefanten, wenn sich Kleinigkeiten in ihrem Umfeld ändern – ihr Wahrnehmungsrüstzeug ist so hochentwickelt, dass sie selbst den leisesten Hauch einer Gefahr sofort erkennen. Im Jahr 2012 formulierten Wissenschaftler in der Cambridge Declaration on Consciousness, dass «alle Säugetiere und Vögel, sowie viele andere Lebewesen, wie etwa Kraken» Nervensysteme haben, die den Zustand des Bewusstseins ermöglichen. (Kraken benutzen Werkzeuge und lösen Probleme genauso geschickt wie die meisten Affenarten – dabei sind sie Weichtiere.) Die Wissenschaft bestätigt das Offensichtliche: Andere Tiere hören, sehen und riechen mit ihren Ohren, Augen und Nasen; sie haben Angst, wenn sie einen Grund dafür haben und sind glücklich, wenn sie glücklich wirken.
Christof Koch schreibt: «Was auch immer Bewusstsein ist, wie auch immer es mit dem Gehirn verknüpft sein mag – Hunde, Vögel und Legionen anderer Tiere haben es. Wie ich … dargelegt … habe, ist das Bewusstsein von Hunden nicht dasselbe wie das unsrige …, aber ohne Frage erleben sie ebenfalls ihr Leben.»[21]
Mein Hund Jude lag einmal schlafend auf dem Teppich. Seine Hinterläufe zuckten, offenbar träumte er davon, zu rennen. Plötzlich stieß er ein langes, schaurig-dumpfes Jaulen aus. Chula, mein anderer Hund, stand sofort auf und lief zu ihm. Jude schreckte hoch, erhob sich und begann laut zu bellen, wie ein Mensch, der, noch in seinem Albtraum gefangen, schreiend aufwacht und ein paar Minuten braucht, um sich zurechtzufinden.
Wir versuchen klare Grenzen zu ziehen, wie etwa die zwischen den Elefanten und dem Menschen, doch die Natur hat diese Grenzen durch die tiefen Beziehungen, die zwischen uns gewachsen sind, längst verwischt. Doch wie sieht es mit Lebewesen aus, die kein Nervensystem haben? Hier befindet sich definitiv eine Trennlinie – oder?
Pflanzen verfügen über kein Nervensystem, produzieren aber die gleichen Chemikalien, etwa Serotonin, Dopamin und Glutamat, die als Neurotransmitter dienen und bei Tieren, einschließlich des Menschen, für die Stimmungslage verantwortlich sind. Auch bei Pflanzen finden sich Signalsysteme, die grundsätzlich genauso arbeiten wie bei Tieren, wenn auch langsamer. Michael Pollan drückt es bildlich aus: «Die Pflanzen sprechen mit chemischen Wörtern, die wir weder direkt vernehmen noch verstehen können.»[22] Dies bedeutet nicht zwangsläufig, dass Pflanzen zu Sinneswahrnehmungen fähig sind, doch sind sie zu anderen, wirklich verblüffenden Dingen in Lage. Der Mensch nimmt chemische Stoffe über den Geruchs- und Geschmackssinn wahr. Pflanzen reagieren auf Chemikalien in der Luft, dem Boden und an ihnen selbst. Pflanzen biegen ihre Blätter, um das Sonnenlicht optimal aufnehmen zu können. Wenn ihre Wurzeln auf ein Hindernis oder Giftstoffe stoßen, ändern sie ihre Wuchsrichtung, noch bevor sie damit in Kontakt kommen. Berichten zufolge reagieren Pflanzen auf Tonbandaufzeichnungen des Kaugeräuschs von Raupen, indem sie Abwehrstoffe produzieren. Pflanzen, die von Insekten oder Pflanzenfressern angegriffen werden, sondern «Stress»-Chemikalien aus, die angrenzende Blätter und Pflanzen dazu anregen, mehr Abwehrstoffe zu produzieren sowie Insekten fressende Wespen anzulocken, welche den Angriff abmildern sollen. Durch die Blütenbildung teilen Pflanzen Bienen und anderen Bestäubern mit, dass der Nektar bereit zur Ernte ist.
Doch abgesehen von fleischfressenden und berührungsempfindlichen Arten agieren die meisten Pflanzen so langsam, dass es für das menschliche Auge nicht wahrnehmbar ist. Beim Anblick einer Blumenwiese könne er sich das unsichtbare, chemische Geschwätz um ihn herum, eingeschlossen die Angstschreie, nur schwer vorstellen, schreibt Pollan. Doch schon Charles Darwin ließ sein Buch Das Bewegungsvermögen der Pflanzen mit dem Satz enden: «Es ist kaum eine Übertreibung, wenn man sagt, dass die in dieser Weise ausgerüstete Spitze des Würzelchens … gleich dem Gehirn eines der niedere Thiere wirkt; das Gehirn … erhält Eindrücke von den Sinnesorganen und leitet die verschiedenen Bewegungen.»
Zugegeben, hier betreten wir unsicheres Terrain und die Gefahr von Fehldeutungen ist groß. Ähnlich wie Cynthia Moss in Bezug auf die Elefanten war auch der Botaniker Tim Plowman nicht an einem Vergleich zwischen Pflanze und Mensch interessiert. Seine Wertschätzung galt den Pflanzen. «Sie können Licht essen», sagte er, «reicht das nicht?»
Der Grund, warum ich bei den Pflanzen ein wenig ausführlicher geworden bin, ist schlicht folgender: Verglichen mit ihrer Fremdartigkeit und den großen Unterschieden zwischen Pflanzen und Tieren ist eine Elefantenkuh, die ihr Baby säugt, uns Menschen so ähnlich, dass sie auch meine Schwester sein könnte.
Ist der Mensch wirklich einzigartig?
In einem grasbewachsenen, lichtdurchfluteten Hain versuchen kleine Elefantenbabys ihre widerspenstigen Rüssel unter Kontrolle zu bringen, um danach eine kleine Trinkpause an den Zitzen ihrer Mütter einzulegen.
«Wie nett diese beiden Familien miteinander umgehen», sagt Vicki. «Elin wollte dichter ans Wasser, Eloise war einverstanden und wartete, bis die ganze Gruppe aufgerückt war. Offensichtlich haben sie beschlossen, den Tag heute gemeinsam zu verbringen.»
Warum schließen Elefanten Freundschaften? Einige der jüngeren mögen die gleichen Spiele und hängen ständig zusammen. Manche der Erwachsenen haben einfach dieselbe «Wellenlänge» in Bezug auf Fress- und Schlafrhythmus sowie auf bevorzugte Schlafplätze und Nahrung.
Dieselbe Wellenlänge. Interessant. Die ist schon bei Menschen nicht leicht zu finden.
Die beste Antwort auf die Frage: «Haben Elefanten ein Bewusstsein?» ist: Alle Beweise sprechen dafür, dass sie über ein umfassendes Bewusstsein verfügen. Nun stellt sich eine neue, spannende Frage: Was bedeutet das Vorhandensein eines Bewusstseins bei Tieren? Für Tierliebhaber liegt die Antwort auf der Hand, doch kann ich die Zwischenrufe der Zweifler förmlich hören: «Nicht so schnell!» Viele Forscher und Wissenschaftsautoren bestehen darauf, dass wir keinen Zugang zur Seelenwelt eines Tieres haben. Mir ist klar, warum sie dies behaupten, doch glaube ich, dass sie falsch liegen. Weil wir heute mehr darüber wissen als früher.
Tierverhalten ist eine junge Wissenschaft. Erst in den 1920er Jahren entdeckte man, dass es unter Hühnern eine «Hackordnung» gibt. Die Erkenntnis von Margaret Morse, dass Singvögel ihr Revier verteidigen – und dass dies der Hauptgrund für ihren Gesang ist –, fällt ebenfalls in diesen Zeitraum. Mitte des 20. Jahrhunderts hatten Pioniere der Verhaltenswissenschaft wie Konrad Lorenz, Niko Tinbergen und Karl von Frisch viel damit zu tun, ihr Forschungsgebiet von uraltem Aberglauben, Ammenmärchen (Eulen prophezeien den Tod, Wölfe sind die Komplizen des Teufels) und Fabeln zu entrümpeln, in denen Tieren menschliche Eigenschaften zugeordnet sind (Heuschrecken sind faul, Schildkröten beharrlich, Füchse hinterlistig).
Diese Wissenschaftler waren hervorragende Beobachter. Sie schafften es, viele Tierarten von verkrusteten metaphorischen Projektionen freizulegen. Ihr Vorgehen ist schnell beschrieben: Beschreibe nur das, was du siehst. Die Forscher mussten erst den Beweis erbringen, dass das Beobachten von Tieren ein objektiver Ansatz war. Es gelang ihnen. Für ihre Studien über die Tanzsprache der Honigbienen, das Balzverhalten von Fischen und die Prägung frisch geschlüpfter Junggänse auf das, was sie zuerst sehen, erhielten Frisch, Tinbergen und Lorenz den Nobelpreis. Für die drei wissbegierigen Naturforscher muss dies ein tolles Erfolgserlebnis gewesen sein.
Doch gab es keine wissenschaftliche Herangehensweise an Fragen wie «Was fühlt eine Elefantenkuh, wenn sie ihr Baby säugt?» Hier schien eine Grenze erreicht zu sein. Niemand hatte bisher freilebende Tiere in ihrem natürlichen Umfeld beobachtet. Die Hirnforschung steckte noch in den Kinderschuhen. Daher mussten sich Vermutungen über ihre Gefühlswelt auf die unsrige stützen – doch mit diesem Ansatz drehte man sich im Kreis. Die neue Wissenschaftlerriege beharrte darauf, ihre Erkenntnisse nur durch Beobachtung zu gewinnen. Spekulationen und Ratespiele vermied sie strikt. Wir können beobachten, was ein Elefant macht. Wie sich das Tier dabei fühlt, bleibt uns verschlossen. Konkret bedeutet dies etwa, zu schauen, wie viele Minuten die Elefantenkuh ihren Nachwuchs trinken lässt. Selbst die renommierte Expertin für Elefantenkommunikation, Joyce Poole, erklärte: «Ich war darin geschult, bei der Beobachtung nichtmenschlicher Tiere nicht zwangsläufig bewusstes Denken vorauszusetzen».[23]
Auch ich bekam am Anfang meiner Ausbildung die allgemeingültige Anweisung: Übertrage nicht das, was sich in der Psyche des Menschen abspielt – Gedanken oder Gefühle – auf Tiere (diese Übertragung nennt sich «Anthropomorphismus»). Grundsätzlich begrüße ich diesen Ansatz. Wir sollten nicht davon ausgehen, dass Tiere (oder, wenn wir schon dabei sind, Geliebte, Ehefrauen, Kinder oder Eltern) «bestimmt» genauso denken und fühlen würden wie wir. Sie sind nicht wir.
Die Frage nach der Gedanken- und Gefühlswelt der Tiere scheiterte aber nicht an der dünnen Datenlage; der gesamte Forschungsbereich wurde als verboten erklärt. Die Methode der Beobachtung wurde zu einer einengenden gedanklichen Zwangsjacke. Verhaltensforscher durften nur beschreiben, was sie sahen. Punktum. Beschreibung – und nur Beschreibung – wurde zur «einzig richtigen» Methode, wenn es um die Erforschung von Tierverhalten ging. Die Frage, welche Gefühle oder Gedanken einzelnen Verhaltensakten zugrunde liegen, war absolut tabu. Man durfte sagen: «Die Elefantenkuh stellte sich zwischen ihr Junges und die Hyäne.» Doch mit dem Satz «Das Muttertier brachte sich in Stellung, um ihr Junges vor der Hyäne zu schützen» hätte man schon die Regeln gebrochen; er wurde als anthropomorph erachtet, da wir keinen Zugang zu den Absichten des Muttertiers haben. Die Frage danach wurde im Keim erstickt.
Bei der Etablierung der Erforschung des Tierverhaltens als Wissenschaft war es anfangs sicherlich hilfreich, dass mit der Bezeichnung «Anthropomorphismus» eine rote Flagge gehisst wurde. Doch als kleinere Geister den Nobelpreisträgern folgten, wurde der Begriff «Anthropomorphismus» zu einer Piratenflagge. Sobald der Begriff gefallen war, stand der Angriff unmittelbar bevor. Seine wissenschaftliche Arbeit veröffentlicht zu bekommen, war dann ein Ding der Unmöglichkeit. Und gemäß dem Motto des Wissenschaftsbetriebs «publish or perish» stand schnell der Job auf dem Spiel.
Selbst noch so fundierte, logische Rückschlüsse über die Motivation, die Gefühle oder das Bewusstsein von Tieren konnten das berufliche Aus bedeuten. Die bloße Frage danach reichte schon aus. In den 1970er Jahren verursachte ein Buch mit dem vorsichtig formulierten Titel The Question of Animal Awareness einen solchen Aufruhr, dass der Autor, Donald Griffin, von seinen Kollegen als Verhaltensforscher an den Rand der Bedeutungslosigkeit gedrängt wurde. Dabei war Griffin kein Anfänger. Er galt schon seit vielen Jahren als renommierte Größe seines Fachs, da es ihm gelungen war, das Geheimnis zu lüften, wie Fledermäuse Ultraschall zur Orientierung benutzen. Man könnte ihn auch als Genie bezeichnen. Doch diese eine Frage zu stellen, war für viele seiner orthodoxen Kollegen einfach zu viel. Die Vermutung, dass Tiere in der Lage sind, irgendetwas zu fühlen, war ein sicherer Gesprächskiller – schlimmer noch, es war ein Karrierekiller. Im Jahr 1992 warnte ein Wissenschaftsautor des hoch angesehenen Magazins Science seine Leser, dass die Beschäftigung mit den Empfindungen von Tieren «kein Forschungsgegenstand ist, den ich irgendjemandem ohne unkündbare Festanstellung empfehlen würde».[24] Er meinte das nicht als Witz.
Durch das Verbot aller Themen, die als anthropomorph galten, stellten die Verhaltensforscher den Irrglauben ans Gegenteil auf Dauerbetrieb. Sie sorgten für die Institutionalisierung der Auffassung von der Exklusivität des Menschen, dass nur er über ein Bewusstsein verfügt oder überhaupt etwas fühlt. (Der Ansatz, dass sich alles nur um uns Menschen dreht, nennt sich Anthropozentrismus.) Sicherlich führt die Übertragung von Gefühlen auf andere Tiere zu einer Fehlinterpretation von deren Beweggründen. Doch wenn wir ihnen jeglichen geistigen Antrieb absprechen, missverstehen wir sie garantiert.
Sich von der bloßen Annahme zu distanzieren, dass Tiere fühlen und denken können, war ein guter Start für eine neue Wissenschaft. Doch auf der Negierung dieser Fähigkeiten zu bestehen, war unwissenschaftlich. Sonderbarerweise zogen es viele Verhaltensforscher – die auch Biologen sind – vor, einen elementaren biologischen Prozess zu negieren: Jede Neuerung stellt eine kleine Verbesserung des Vorherigen dar. Alles, was der Mensch heute macht oder besitzt, hat seinen Ursprung in der Vergangenheit. Bevor er «zusammengebaut» werden konnte, musste die Evolution alle Bauteile parat haben und diese wurden für Vorläufermodelle entwickelt. Der heutige Mensch hat sie übernommen.
Nehmen wir beispielsweise die Entwicklung der Gliedmaßen: vom Gliederfüßer über den Vierbeiner bis zum zweibeinigen Menschen. Beim oberen Teil der Hintergliedmaßen handelt es sich bei Fröschen, Hühnern und Menschen um einen Oberschenkelknochen. So lässt sich die Transformation von einer Amphibie über einen Vogel bis zu einem menschlichen Triathleten nachzeichnen. Ungeachtet der jeweiligen Art gibt es Phänomene wie Schlaf oder Niesen, die bei allen gleich sind. Die Arten unterscheiden sich – sind aber gar nicht so unterschiedlich. Nur der Mensch hat eine menschliche Psyche. Doch daraus zu folgern, dass nur er eine Psyche hat, entspräche dem Trugschluss, dass ausschließlich der Mensch über ein Skelett verfügt, weil nur bei ihm ein menschliches Skelett vorliegt. Die Skelette von Elefanten können wir sogar mit unseren eigenen Augen sehen. Ihre Psyche hingegen nicht. Für uns sichtbar aber ist ihr Nervensystem und anhand ihrer Verhaltensweisen können wir bei ihnen psychische Prozesse beobachten. Egal ob Skelett oder Gehirn, das Prinzip ist das gleiche und wenn wir eine These aufstellen sollen, dann wohl diese, dass man sich das Vorhandensein einer Psyche auf einer abgestuften Skala vorstellen muss.
Doch dies geschah nicht. Die Verhaltensforscher zogen eine klare Trennlinie zwischen dem Nervensystem des gesamten Tierreichs und ihrer eigenen Spezies: dem des Menschen. Das Leugnen der schieren Möglichkeit, dass andere Tiere Gedanken oder Gefühle haben könnten, verstärkte genau das, was alle Welt hören wollte: Wir sind etwas Besonderes. Wir sind völlig anders. Besser. Die Besten. (Stichwort Projektion!)
Jahrzehntelang ernteten Wissenschaftler, die über den Tellerrand hinausblickten, den Hohn ihrer Kollegen. Einige Umstürzler, die keine ausgebildeten Verhaltensforscher waren – Jane Goodall war wahrscheinlich die Erste –, mussten diese Erfahrung machen. Goodall beschreibt die Situation, als sie sich nach ihren ersten Studien mit Schimpansen als Doktorandin in Cambridge immatrikulierte: «Es war ein Schock für mich zu hören, dass ich alles falsch gemacht hatte. Wirklich alles. Ich hätte ihnen keine Namen geben dürfen. Ich hätte nicht über ihre Persönlichkeiten, ihre Seele, ihre Gefühle sprechen dürfen. Dabei sind sie doch einzigartig.»[25]
Bis heute ist die «Anthropo»-Phobie unter Verhaltensforschern und Wissenschaftsautoren weitverbreitet, wobei sie mit ihrer längst überholten, übertriebenen Vorsicht in der Tradition ihrer orthodoxen Lehrer stehen. Wir dürfen anderen Tieren keine menschlichen Gefühle zusprechen, bestärken sich die Orthodoxen gegenseitig und beten es ihren Schülern vor. Diese plappern es ihnen nach und denken, sich dadurch besonders professionell zu verhalten.
Was aber versteht man unter einem «menschlichen» Gefühl? Wenn behauptet wird, dass man menschliche Empfindungen nicht auf Tiere übertragen dürfe, wird dabei vergessen, dass es sich bei menschlichen Gefühlen um animalische Gefühle handelt. Übernommene, ererbte Gefühle, die ein ererbtes Nervensystem benutzen.