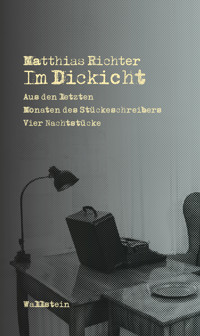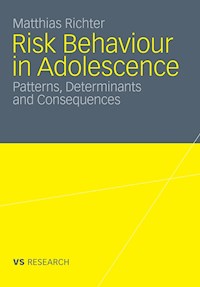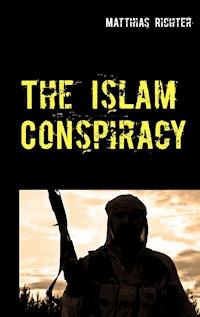Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Islamische Staat ist auf dem Höhepunkt seiner Macht. Als ein deutscher Journalist enttarnt wird und ihm die Todesstrafe droht, schickt die deutsche Regierung den Geheimdienstler Paulsen und seinen Begleiter Chris, um den Gefangenen freizukaufen. Auf dem Weg nach Mossul werden Chris und Paulsen Zeuge von einigen Dingen, die der IS gerne verheimlichen würde. Sie stellen sich daher immer wieder die Frage: Können wir dem Kalifen vertrauen? Zeitgleich ereignet sich in Miami ein Anschlag durch einen islamistischen Terroristen. Adriana Borrero ist als Gerichtspsychiaterin damit betraut, ein Gutachten über den Attentäter zu erstellen. Doch mit der Zeit stößt sie auf Ungereimtheiten und geht der Sache mit ihrem Kollegen auf den Grund. Schnell stellt sich heraus, dass der IS eine Erfindung der CIA ist, die unzählige Menschenleben opfert. Adriana läuft die Zeit davon, um die Menschen, die in Gefahr sind, zu retten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 339
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Vorwort
Der sogenannte Islamische Staat, der wie eine Welle über den mittleren Osten geschwappt ist, scheint mittlerweile besiegt zu sein. Die Kurden haben dabei einen maßgeblichen Anteil geleistet und fordern jetzt zurecht eine Belohnung in Form eines unabhängigen Kurdistans. Doch wie konnte sich dieser Haufen von jungen, wilden Männern so lange gegen gestandene Armeen halten?
Wie aus dem DIA Report des Pentagons aus den Jahre 2012 hervorgeht, hatten die USA unzweifelhaft Kenntnis davon, dass Al Quaida die Opposition gegen Assad anführte und dass ihr Ziel ein Kalifat salafistischer Ausprägung war. Gleichzeitig geht auch aus dem Dokument hervor, dass der Westen die »gemäßigte« Opposition unterstützte. Ist es denkbar, dass der IS von gewissen Gruppen der USA Hilfe bekam?
Nur eine naive Person kann glauben, dass man im Krieg eine Unterscheidung zwischen radikalen und gemäßigten Kräften machen kann. Die gemäßigte FSA hat genauso die Köpfe ihrer gefangenen Gegner abgeschlagen wie der IS.
Und wieso sollte in diesem Krieg nicht das alte Sprichwort gelten: Der Feind meines Feindes ist mein Freund?
Genau wie die USA im Kalten Krieg die Mudschahedin gegen die Russen aufgerüstet und ausgebildet haben - und damit in Kauf genommen haben, dass diese radikalen Islamisten al Quaida gründeten, genauso haben gewisse kriminellen Elemente der Geheimdienste den IS gegen Assad unterstützt und damit ein Kalifat in Kauf genommen.
Gleichzeitig hat man damit auch die Zerstörung einer ganzen Region und die unweigerliche Flüchtlingswelle in Kauf genommen.
Aber die deutsche Regierung hat damit zum Glück nichts zu tun. Bis auf die Rüstungsexporte an Saudi Arabien….
Reality is wrong. Drams are real.
Tupac Shakur
Believe nothing
no matter where you read it
or who has said it, not even if I have said it
unless it agrees with your own reason
and your own common sense
Buddha
Love comes naturally, hate is learned
unknown
Kapitel 1
Boba Fett trat an den Schalter des Kinos am Sunset Drive und löste zwei Tickets. In gespannter Vorfreude erwartete die Star Wars Gemeinde die Neuauflage der beliebten Trilogie. Wie die meisten Fans, die keine VIP Karten besaßen, hatte Andrew die letzte Nacht vor dem Kino in der Schlange verbracht. Für seine Prinzessin Lea nahm er aber es gerne in Kauf. »Habe ich dir zu viel versprochen?« Stolz deutete er in die Menge. In der Empfangshalle sah es aus wie auf einem Faschingsball: Stormtroopers, Jawas und Chewbaccas wuselten herum, um sich mit Snacks einzudecken und dann schnell zu ihren Plätzen zu eilen. »Es sollte verboten sein, etwas was 18,50 Dollar kostet, einen Snack zu nennen!«, beschwerte sich Andrew. »Du bist verrückt!« Sandy lachte und gab ihm einen Klaps auf die Schulter. Sie gingen in die gleiche Klasse der Miami High School. Sie mochte seine intelligente Art, die so anders war als die der meisten. Er mochte ihren Humor und die langen, tiefen Gespräche, die er nur mit ihr führen konnte. Ungeachtet der klischeehaften Schubladen, in die ihre spießigen Mitschüler sie stecken mochten – Sandy »die Schöne« und Andrew »der Nerd« – waren die beiden bald gute Freunde geworden. Ein ungleiches Paar. Mit ihren Snacks bewaffnet, gingen sie zu ihren Plätzen. Zum Glück hatte Andrew Plätze der Kategorie A ergattert, also zentral im hinteren Bereich. Denn einen steifen Nacken konnte er nicht gebrauchen. »Hast du dein Smartphone ausgeschaltet?«, fragte er Sandy vorsichtshalber. »Es geht los.«
Als der Film begann, waren die meisten Münder weit aufgesperrt und keiner wagte es mehr, mit Popcorn zu rascheln oder an seiner Cola zu schlürfen. Doch einen Idioten muss es ja immer geben! Ungläubig fluchte Andrew, als das Smartphone seines Nachbarn vibrierte und auch noch hell aufleuchtete. »Was sind das bloß für Leute?«, fluchte er leise, als der Mann tatsächlich so dreist war, mitten im Film aufzustehen und sich durch die Reihen zu drängen. Andrew war so irritiert, dass er den Mann mit den Augen verfolgte. Er ging zum Telefonieren nicht wie die meisten einfach nach hinten zu den Toiletten, sondern die Treppe hinunter zum Notausgang. »So ein Vollpfosten!« Er sah die Beleuchtung im Gang durchblitzen, als der Mann durch die Tür schlüpfte. Einige Minuten später wurde er erneut durch die Beleuchtung im Gang gestört. »Natürlich, hereinspaziert!«
Der Mann sah jetzt anders aus und er bewegte sich auch anders. Dann ging alles blitzschnell. Mit drei Schritten trat die Gestalt vor die Leinwand. Er warf eine Rauchgranate in den Saal und schrie: »Allahu akbar!« Wahllos begann er auf die Zuschauer zu feuern. Es brach ein Inferno los: Geschrei, Panik und Blut. Totales Chaos. Zunächst war Andrew wie gelähmt. Er klammerte sich an den Gedanken, dass alles Teil des Entertainments im Kino war. Doch dann sah er, wie ein kleines Mädchen von einem Schuss getroffen und zurück in den Sessel geworfen wurde. Blut spritzte. Echtes Blut. Echte Angst. Mittlerweile war das Licht angegangen und eine Notdurchsage ertönte: »Homicide in Theatre 1! Homicide in Theatre 1!« Andrew packte Sandy an der Hand und schüttelte sie: »Los, wir müssen hier raus. Schnell.« Sie stiegen über die Sitzreihen zum rechten hinteren Ausgang und duckten sich, sobald sie im Gang waren. Es platzten immer noch weitere Schüsse durch die Luft. Andrew wusste gar nicht woher. Es war ein riesiges Gedränge am Ausgang entstanden, aber Andrew ließ Sandys Hand nicht los. Als sie die Tür erreichten, drehte er sich noch einmal um und warf einen flüchtigen Blick zurück in den Saal. Im Bruchteil einer Sekunde registrierte er leblose Körper in unnatürlichen Positionen. Blutende Körper, schmerzverzerrte, panische und verzweifelte Gesichter. Das Bild brannte sich in sein Gedächtnis ein.
In der Eingangshalle kamen ihnen bereits Polizeibeamte und ganz in Schwarz gekleidete Männer eines Sondereinsatzkommandos entgegen. Im Hintergrund heulten Sirenen. Überall Blaulicht. Das Kino verwandelte sich zu einem Tatort. Erschöpft und völlig aufgelöst setzten sich Andrew und Sandy auf eine Treppenstufe. »Hast du das Kind gesehen?«, bibberte Sandy im Schock. »Das Mädchen, sie wurde direkt in den Kopf getroffen. Das ganze Blut...!« Sie brach in Tränen aus. Andrew versuchte, sie zu beruhigen, obwohl er selbst am liebsten losgeweint hätte. »Ist ja gut, ist ja gut.« Er streichelte ihr Haar. Ihm wurde bewusst, wie hohl seine Worte klangen und er beließ es dabei, Sandy in den Arm zu nehmen und sie wie ein kleines Kind zu trösten.
Ohne richtig fassen zu können, was passiert war, beobachteten sie die Rettungsleute, die die Schwerverletzten versorgten und die leicht Verletzten nach draußen brachten. Kinder weinten wegen ihrer toten Eltern und Väter hielten ihre leblosen Kinder in den Armen.
Kapitel 2
Um Punkt 10 Uhr leuchtete das Display auf und sanfte hinduistische Klänge füllten den Raum, um schließlich mit einem fröhlichen Namaste zu einem neuen Tag einzuladen. Die Rollläden schoben sich nach oben. Das Sonnenlicht kitzelte die Augen und ermunterte zum Aufstehen. Normalerweise jedenfalls. Doch diese Nacht war für Chris ein einziger Albtraum gewesen und er wäre lieber im Bett geblieben. Schlaflos und mit kaltem Schweiß auf dem Rücken hatte er die Nacht mit einem einzigen Gedanken verbracht: »Da hast du dich ganz allein reingebracht. Jetzt musst du es auch durchziehen!« Er konnte nicht einfach wieder abspringen, das wusste er.
Nach seinem Journalismus Studium hatte der Berliner einige Anlaufschwierigkeiten gehabt, eine Anstellung zu finden. Fast ein Jahr hatte er Bewerbungen geschrieben. Faul herumgehangen, sagte sein Vater. Ohne finanzielle Unterstützung seiner Eltern, sah er sich zuletzt sogar wieder gezwungen, als Personal Trainer zu arbeiten, hauptsächlich für ältere Damen. Aber von seinem Traum als erfolgreicher Journalist war er meilenweit entfernt und er wurde jeden Tag nervöser. Es brauchte eine Geschichte, die so sensationell war, dass die Medienvertreter sie nicht ignorieren konnten. Und er setzte alles daran, diese zu finden. Er war zu allem bereit.
Er suchte daher regelmäßig das »Cafe Borchardt« auf, wo sich viele Politiker aufhielten und versuchte, Kontakte zu knüpfen. Nach einiger Zeit hatte er eine junge Abgeordnete der Grünen kennengelernt, die in einem Untersuchungsausschuss über den Islamischen Staat war. »Die deutsche Regierung setzt bei Geiselnahmen deutscher Staatsbürger durch Terrororganisationen oft sogenannte Springer ein«, erzählte sie ihm über einem Glas Wein. »Diese Springer sollen Kontakt mit der Organisation aufnehmen und, wenn möglich, ein Lösegeld aushandeln, um den Staatsbürger zu befreien. Denn offiziell verhandelt man ja nicht mit Terroristen. Aber dieses Mittel ist die ultima ratio. Also es kommt erst dann in Betracht, wenn alle sonstigen Aktionen gescheitert oder zu riskant sind.« Sie erzählte ihm auch, dass ein solcher Sprung zum IS geplant sei. »Der Springer ist ein erfahrener Agent namens Paulsen.« Sie hielt kurz inne und betrachtete Chris. »Wenn du willst, kann ich versuchen, dich ihm vorzustellen, damit er dich mitnimmt?«
Er hatte schon einige leere Versprechungen von Politikern bekommen und hatte sich daher nicht viel erhofft. Aber dieses Mal war es anders. Nach nur zwei Tagen erhielt er eine kurze und prägnante Nachricht von Paulsen: »Treffen wir uns.«
Sie trafen sich tags darauf in einer kleinen Kneipe. Nachdem Paulsen Chris eingehend gemustert hatte, begann er. »Du willst also eine Chance auf die große Story? Wie du wahrscheinlich weißt, hat der Islamische Staat in diesem Jahr bereits zwei deutsche Journalisten brutal hingerichtet. Von den Anhängern des IS werden diese Videos im Internet gefeiert. Jetzt wurde erneut ein deutscher Journalist enttarnt und in Gefangenschaft genommen. Auch er wartet auf seine Hinrichtung. Er heißt Koletzki.« Mit jedem Wort vertiefte sich die Stirnfalte von Chris. Paulsen fuhr fort. »Die Bundesregierung ist der Meinung, dass man dem IS einen solchen Propagandaerfolg nicht zugestehen darf. Auch eine Befreiungsaktion ist zu riskant. Daher ist es Zeit für einen Springer. Kannst du mir folgen?«
Chris nickte nachdenklich.
»Wir planen bereits seit Längerem bei einem solchen Einsatz im Kerngebiet des IS eine Person mitzunehmen, die die Reise dokumentiert und ein extra Auge für das Detail hat. Unsere gemeinsame Freundin hat in den höchsten Tönen von dir gesprochen.« Sie sagte, du bist mutig und hast einen schnellen Verstand.« Er sah Chris abfällig an. »Wahrscheinlich hast du mit ihr geschlafen, damit sie das sagt. Aber wie auch immer… Ich brauche so jemanden auf dieser Reise, der hungrig und furchtlos ist. Bist du das?« Chris erwiderte seinen Blick und nickte eifrig mit dem Kopf. »Ja, ich bin der richtige Mann für diese Mission.« Paulsen nicke ebenfalls entschieden. »Also gut, dann begleitest du mich ins Kalifat.«
Es war 18:00 Uhr abends, als die Maerst Alabama im King Fahad Industrial Port Yanbu anlegte. Miller stand an der Reling und rauchte. Er war erst vor Kurzem mit dem Helikopter auf dem Frachter angekommen. Bei hochkarätigen Kunden war es gängige Praxis der Firma, dass der Verkäufer bei der Lieferung mit an Bord kam, um das Produkt persönlich zu übergeben. Eine extra Dienstleistung für den Kunden. Miller war jedes Mal wieder beeindruckt, mit dem 155 m langen und 25 m breiten US-Frachter zu fahren. Eine Stadt auf dem Wasser. Als der Anker gesetzt und die Taue festgemacht waren, erblickte er seinen Geschäftspartner Sheikh al-Walid, der ihn mit seiner Entourage am Kai erwartete. Die beiden verband eine lange Zusammenarbeit, die von gegenseitigem Respekt und Vertrauen geprägt war.
»Willkommen auf der Arabischen Halbinsel«, grüßte ihn der Sheikh und reichte Miller freundschaftlich die Hand, als er die Treppe heruntergestiegen war. »Schön, Sie wieder zu sehen«, antwortete dieser ebenso herzlich. Der Sheikh konnte seine Neugier nicht zurückhalten. »Haben Sie eine schöne Fracht mitgebracht?« »Ja, mein Freund. Das ist wirklich High-Tech-Ware erster Güte. Ich bin sicher, Sie werden sie lieben.«
Kapitel 3
Chris saß in der Economy Class von Turkish Airways, blickte in die Wolken und sinnierte über seine Mission. Das Phänomen und der Aufstieg des Islamischen Staates zu einem Global Player hatte die ganze Welt kalt erwischt. Keiner hatte diesen Ableger von al-Quaida, der in den Wirren des Arabischen Frühlings in Irak und Syrien entstanden war, wirklich ernst genommen. DAESH wurde der IS anfangs von seinen Gegnern geschimpft. Doch mittlerweile war der herablassende Ton staunender Fassungslosigkeit gewichen. Was den Gotteskriegern an militärischer Ausbildung fehlte, glichen sie durch ihren unvergleichlichen Todeseifer aus. Sie sehnten sich nach dem Tod im Kampf, denn so glaubten sie als Shaheed ins Paradies zu kommen. Chris erinnerte sich an eine alte Geschichte, die er in seinem Crashkurs gehört hatte. Sie handelte von einem alten islamistischen Krieger, der am ganzen Körper von Narben übersät war und der in jedem Kampf nur ein Ziel hatte: Für Allah sterben. Aber er überlebte. Immer und immer wieder. Als er aus Altersgründen in seinem Totenbett lag, trauerte er um die Tatsache, dass ihm nie die Ehre eines Märtyrers zuteil werden würde. Dieser Fanatismus, dachte sich Chris. Dieser Fanatismus war in den Mudschahedin wieder zum Leben erweckt worden. Er brachte sie in die Lage, jede gegnerische Armee in der Region aufzureiben. Innerhalb weniger Jahre hatte sich die Landkarte im Nahen Osten maßgeblich verändert.
Die Stimme einer Stewardess von Turkish Airways brachte ihn in die Realität zurück: »Chili con Carne oder Pasta, Sir?« Als er aufblickte verschlug es ihm für einen Moment die Sprache angesichts der hübschen jungen Frau, die ihn mit ihren großen dunklen Augen anlachte. Ein Blick auf ihre Hand verriet, dass sie nicht verheiratet war. »Chili con Carne in einem Flugzeug mit über 200 Passagieren? Welcher Terrorist hat sich denn das Menü ausgedacht?«, raunte er ihr scherzend zu und setzte sein George Clooney Lächeln auf. »Also ich nehme einmal Pasta und einmal Ihr Parfum.« Sie musterte ihn kurz, lachte dann aber und gab ihm eine Box. »Sie sitzen wenigstens am Notausgang. Für den Fall, dass es zu stickig wird...«, sagte sie und zwinkerte ihm zu.
Nach dem Essen schlief Chris wieder ein. Erst durch die Landedurchsage des Piloten wurde er geweckt und sah aus dem Fenster. »Konstantinopel!« Er musste unwillkürlich an die Hauptstadt des Byzantinischen Reiches denken. Eine riesige Megastadt mit über 12 Millionen Einwohnern. Häuser und Straßen soweit das Auge reicht. Zugleich die Frontlinie des Westens vor dem heranstürmenden Islamischen Staat, der begonnen hatte, seine Kräfte gen Westen zu richten.
In der Lobby des Four Seasons von Istanbul traf Chris auf seinen Reisebegleiter Andre Paulsen. Dieser war schon einige Tage zuvor angereist, um noch einige letzte Vorkehrungen zu treffen. Bei einem Glas Jack Daniels begrüßten sich die beiden Männer, die von nun an aufeinander angewiesen waren. »Na wenigstens siehst du nicht mehr aus wie ein Berliner Fashion Victim!«, war der erste Satz, den Paulsen ihm entgegenschleuderte, nachdem er ihn gemustert hatte. Der Bart in Chris Gesicht war dick und lang geworden und verlieh seinem dunklen Teint eine orientalische Note. Ihm war schon vorher mit Wohlwollen aufgefallen, dass der Taxifahrer ihn auf türkisch angesprochen hatte. Paulsen dagegen war im Vergleich eher blass und schmächtig. Aber er hatte ein Gesicht, dem man seine Lebenserfahrung ansah. Außerdem strahlte er eine Souveränität aus, die im ganzen Raum spürbar war. »Da wir kein Aufsehen erregen wollen, nehmen wir die gleiche Route wie alle Personen, die in den Islamischen Staat einreisen wollen. Über Schleuserbanden.
Wir fliegen nach Gaziantep und halten uns bereit, bis wir kontaktiert werden«, beendete Paulsen seinen Vortrag. »Dann gibt es kein Zurück mehr.« In bekannter Manier leerte er sein Glas mit einem Zug.
Adriana Borrero saß am Frühstückstisch und hatte den Miami Herald vor sich aufgeschlagen. »Darth Vader attacks!«, stand in dicken Lettern auf der Titelseite. Das ganze Wochenende gab es kein anderes Gesprächsthema in der Stadt: In den Medien, in den Wohnzimmern und auf der Straße. Die Leute schüttelten verständnislos den Kopf, bekundeten ihr Mitleid mit den Opfern und ihre Wut gegenüber dem Täter. In der Vergangenheit hatten Amokläufe in den USA bereits eine traurige Tradition erlangt, aber dies war eine neue Entwicklung. Innerhalb von 10 Monaten der siebte religiös motivierte Anschlag. Und das war mit Abstand der Schlimmste.
Adriana starrte fassungslos auf die Zahlen, die zu diesem Zeitpunkt jeder in Miami kannte: 17 Tote, 4 Schwerverletzte und 21 Verletzte. Man nannte den Täter daher den Black Jack Killer, oder einfach Black Jack.
Ihr kleiner Sohn Santo fing an zu quengeln. Sie nahm ihn vom Kindersitz und setzte ihn auf ihren Schoß. »Mi Hijo, der Brei schmeckt doch soo gut, sabroso.« Sie nahm einen Löffel und aß genüsslich von der Pampe. Adriana war Psychiaterin und erstellte für die Gerichte Gutachten in Strafverfahren. Sie war bereits am Samstag darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass sie ein Gutachten über Black Jack erstellen sollte. Die alleinerziehende Mutter hatte schon etliche Mörder in ihren Praxisräumen beim City Jail begutachtet, aber noch nie einen Massenmörder dieser Kategorie. Sie fühlte daher eine ungewohnte Anspannung.
Ihre Mutter kam die Treppe herunter und setzte sich an den Frühstückstisch. »Buenos dias, mi hija y mi hijo.« Sie gab ihr und Santo einen Kuss auf die Stirn. Nachdem sie etwas zu essen vorbereitet hatte, machten sie und Santo sich fertig und stiegen ins Auto.
Es war die tägliche Routine im Hause Borrero: Ihre Mutter fuhr sie morgens zur Arbeit, erledigte dann die Einkäufe mit dem Auto und passte tagsüber auf den Kleinen auf.
»Hast du gut geschlafen Mamita?«, fragte sie ihre Mutter, sobald der Wagen die Ausfahrt verließ. »Que terrible es?«, fing ihre Mutter an. »So viele Tote durch diesen Black Jack. Se ha vuelto peligroso. Wir leben in gefährlichen Zeiten, mi hija.« Adriana hatte keine Lust auf eine Tirade, aber sie wusste, was kommen würde. Ihre Mutter fuhr in alarmiertem Tonfall fort. »Diese Islamis sollte man alle ins Gefängnis stecken. Man ist ja nirgends mehr vor ihnen sicher. Im Supermarkt, in der U-Bahn, auf der Straße – puede pasar por doquier!« Adriana hatte damit gerechnet. Auch bei den letzten Attentaten war ihre Mutter zwei Wochen lang verängstigt zu Hause geblieben und hatte sich nur aus dem Haus gewagt, wenn es unumgänglich war. »Denk daran Mamita, dass dein Sohn Luis, mein lieber Bruder, auch ein Muslim geworden ist. Es sind also nicht alle Muslime Terroristen.« Sie bereute im selben Moment, dass sie das Thema angeschnitten hatte. Ihre Mutter entgegnete fluchend. »Was war das wieder für eine wirre Idee von Luis? Er hat so viel mit dem Islam zu tun wie ich mit dem Ku-Klux-Klan. Wenn er wirklich seine Wurzeln entdecken wollte, hätte er die Santeria entdeckt.«
Die Santeria - Das Anbeten der Heiligen - war eine religiöse Praxis, die nach der Einführung der Religionsfreiheit in Kuba großen Anhang gefunden hatte. Sie war in den afrikanischen Sklavengemeinden der Zuckerplantagen im Kuba des 18. Jahrhunderts entstanden und eine Mischung aus spanischem Katholizismus und dem Glauben der gekidnappten afrikanischen Ureinwohner.
»Aber nein! Luis muss wieder anders sein und seinen dicken Sturkopf durchsetzen«, zeterte sie weiter. Adriana konnte es nicht ertragen, wenn ihre Mutter über ihren Bruder schimpfte. Sie waren immer wie Pech und Schwefel gewesen und hielten auch heute noch stets zusammen. »Du darfst ihn nicht wegen allem kritisieren. Sonst blockiert er nur. Versuch ihn zu verstehen und er wird auch auf dich zugehen. Das solltest du doch mittlerweile wissen.« Bevor über ihren Bruder geschimpft wurde, lenkte sie das Gespräch doch lieber wieder in Richtung Terroranschlag. »Aber was das Attentat betrifft, werde ich schon bald herausfinden, welche Motive der Täter hatte.« Ihre Mutter nahm den Faden auf. »Wie kann es eigentlich sein, dass ein junger Mann so leicht so viele Waffen erwerben kann? Das muss doch verboten werden.« Damit sprach sie aus, was viele Politiker immer vehementer forderten: Ein Waffenverbot in den USA. Und die Argumente ließen sich angesichts der steigenden Anschläge nicht von der Hand weisen. »Armas, para que?«, fragte ihre Mutter theatralisch, »wofür brauchen die Bürger Waffen? In Kuba hat Castro auch ein Waffenverbot eingeführt.« Sie schüttelte den Kopf. »Es war nicht alles schlecht, was Castro gemacht hat.«
Adriana war erleichtert, als sie am Ende der Straße die weiße Fassade des Gebäudekomplexes sah, der ihren Arbeitsplatz beherbergte. Sie verabschiedete sich mit einem Kuss von ihrer Mutter und Santo.
Kurz darauf betrat sie das Pre-Trial Detention Center. Es umfasste 1712 Betten für männliche Insassen und gehörte zum Miami Dade County Corrections System. Sie legte ihre Akten auf dem Schreibtisch ab und warf einen flüchtigen Blick an die dahinterliegende Wand. Bilder und Urkunden, die, als persönliche Accessoires und geschichtliche Artefakte des Heilens, dem Ort eine Aura des persönlichen Wirkens verleihen sollten. Unauffällig vertrauensstiftend. In den weiteren Sitzungen würden die Angeklagten dann auf der flauschigen Couch in der Mitte des Raums sitzen. Die Wand dahinter hatte sie in Orange streichen lassen. Orange schaffe eine heitere und gelöste Atmosphäre und gäbe dem Raum Wärme. Um Sicherheit, Ruhe und Geborgenheit zu verstärken, standen viele grüne Pflanzen im Zimmer. Genau das Richtige für die Angeklagten, die aus ihrem grauen Knastalltag gerissen wurden.
In all den Jahren hatte Adriana schon einige der übelsten Kreaturen in der Plüsch-Welt ihrer Praxis sitzen. Triebtäter, Drogenabhängige, Mafiosi oder Gangster. Meistens mit der gleichen Absicht. Alle beriefen sich auf ihre Schuldunfähigkeit. Und ihr Job war es, herauszufinden, ob tatsächlich eine psychische Störung in dem Ausmaß vorlag, die eine strafrechtliche Verantwortlichkeit ausschloss.
Um Punkt 11 Uhr klopften die Beamten an ihre Tür und brachten den Gefangenen herein. »Hi Carl. Hi Sam«, grüßte Adriana ihre beiden Kollegen, die in ihrer Mitte Black Jack durch die Tür schoben. Black Jack trug einen beigen Zwangsanzug, bei dem die Ärmel vor dem Körper verbunden und zugeknotet waren. Er war schmächtig und blass wie ein Blatt Papier. Der hagere Mann blickte sie unter seinen dunkelbraunen Haaren mit weit aufgerissenen Augen an. Die Beamten setzten ihn auf den Sessel vor ihrem Schreibtisch und bezogen vor der Tür Stellung. Adriana holte tief Luft, als die Tür hinter ihr zufiel. Sie schlug die Akte auf: »Yusuf Zaidi, 24 Jahre, gebürtiger Marokkaner, in den USA aufgewachsen.«
Sheikh al-Walid ließ sich die Ware im Hafen zeigen. Er hatte auf einer Ausstellung in Dubai eine Kaufoption erworben. Aber er war immer noch kritisch. Denn für sein Geld wollte er auch die beste Ware haben. An einem abgetrennten Teil des Hafens stand die Gruppe vor drei Army Geländewagen der Firma Oshkosh.
Miller erklärte ihm nochmal die technischen Neuheiten der Geländewagen. »Der JLTV ist eine Weiterentwicklung des M-ATV. Er ist 6,30 Meter lang und 11 Tonnen schwer.«
Sie gingen um den Wagen. »Sein Caterpillar-Motor ist 375 PS stark, was eine Geschwindigkeit von 110 km/h bedeutet. Rückwärts kann er bis zu 13 km/h schnell fahren. Er verfügt über ein elektronisch gesteuertes Fahrwerk und hat einen 50 cm langen Federweg.« Miller bemerkte, dass der Sheikh die Stelle des Humvees beäugte, an der Waffen montiert werden konnten.. Er kannte ihn gut genug, um zu wissen, was ihn interessierte. »Der JLTV kann verschiedene Leicht- und Mittelkaliber Waffen tragen und darüber hinaus bis zu vier Rauchgranatenhalter.« Der Blick des Sheikhs hellte sich auf. »Das Fahrzeug ist wirklich gewaltig. Genau das, was ich benötige.« Er klopfte Miller gut gelaunt auf die Schulter und deutete seinen Leuten an, dass sie die Fahrzeuge mitnehmen konnten. »Wie immer haben Sie nicht zu viel versprochen.«
Kapitel 4
Bereits der erste Atemzug auf dem Rollfeld von Gaziantep verhieß nichts Gutes: Der Geruch von Verbranntem stieg ihnen in die Nase. Und auch in den Straßen lag der Geruch in der Luft. »Das liegt wahrscheinlich an den Autos ohne Katalysator und den Diesel-Generatoren«, mutmaßte Paulsen. Auf jeden Fall kein gutes Omen.
Die ländliche Gegend war geprägt von Landwirtschaft und Ackerbau und die weite triste Landschaft versetzte den reizüberfluteten Berliner in einen Zustand der Melancholie: »Kein Wunder, dass die Leute hier kreativ werden mit ihren Ziegen?«, träumte er vor sich hin, während Paulsen die Karte studierte. Der schüttelte nur den Kopf und erklärte. »Gaziantep ist die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz in Südostanatolien und etwa 50 km von der syrischen Grenze entfernt. Die Schlepper arbeiten von hier aus, um den Kontrollen der türkischen Polizei zu entgehen«, murmelte er in seinen grauen Bart und weckte Chris aus seinem Halbschlaf. In der Stadt angekommen, bot sich ein Bild, wie es gegensätzlicher nicht hätte sein können. In der Gegend, in der auch ihre Unterkunft gelegen war, stießen massive Hotelkomplexe mit ihrer grellen Beleuchtung wie Ungetüme aus dem Boden. Die Hauptstadt der Provinz lockte augenscheinlich die Industrie und das Geld an. Die normale Bevölkerung jedoch lebte in sehr einfachen Verhältnissen.
Die Stadt hatte sich durch die Schleuserbanden und die ausländischen Möchtegern-Krieger einen fragwürdigen Ruf erworben. In der Hotellobby saßen Geschäftsleute, die ihr Geld auf legalem oder illegalem Weg verdienten. Entsprechend argwöhnisch wurden Chris und Paulsen von den wenigen anwesenden Gästen beäugt.
Am nächsten Tag waren beide in Bereitschaft. Doch als sie bis Nachmittags keinen Anruf erhielten, beschlossen sie, sich die Altstadt des Ortes anzusehen. Auf dem Markt war es, als würde man in eine andere Welt eintauchen: Ein Gewusel aus Stimmen, Hämmern und Hupen. »Hier gibt es ja noch richtige Handwerkskunst«, staunte Chris, als er einem Mann dabei zusah, wie er verschnörkelte Muster in Messingschalen einhämmerte. Als frischer Vegetarier war das Angebot an Nüssen und Früchten am beeindruckendsten. Für ein paar Scheinchen mixte er sich eine riesige Tüte aus prallen Pekannüssen, Cashewkernen und gelben und schwarzen Rosinen. Gut gelaunt fuhren sie ins Hotel zurück und Chris besuchte den hoteleigenen Hamam. »Was für ein angenehmer Trip!«, dachte Chris mit einem Grinsen im erhitzten Gesicht, als er sich abends mit Paulsen in der Lobby traf.
Doch der holte ihn sogleich von seinem Höhenflug herunter. »Damit du nicht denkst, dass wir hier in unseren Flitterwochen sind, fangen wir gleich damit an, dich aus deiner Komfortzone herauszuholen.« Er klopfte Chris kumpelhaft auf die Schulter und fuhr in ernstem Ton fort: »Wir müssen uns an das örtliche Essen gewöhnen, denn in diesen Gegenden gibt es Bakterien im Essen, die so manchem Westler schwer auf den Magen schlagen. Und wir wollen nicht, dass du während den Verhandlungen ständig aufs Klo musst.« Chris konnte sich ein Lachen nicht verkneifen. »Mir knurrt jetzt schon der Magen.« Sie fuhren in das älteste Kebab-Haus im Ort und bestellten Shish-Kebab. Es wurde ein Salatteller serviert, mit Fladenbrot, einer Schale Humus, scharfen Paprikas und gegrilltem Fleisch. Der Vegetarier Chris ließ keinen Zweifel daran, dass er sich für die Mission opferte, als er das Fleisch aß. »Wenigstens stammen die Tiere nicht aus industrieller Massenhaltung, sondern werden wie Familienmitglieder behandelt«, beruhigte er sein Gewissen, während er sich noch einen Teller von dem leckeren Hühnchen-Kebab bestellte. »Verdammte Flexitarier!«, brummte Paulsen genervt und schüttelte verächtlich den Kopf. »Flexiwas?«, fragte Chris mit gerunzelter Stirn nach. »Du bist doch einer von diesen Teilzeit-Vegetariern, die nicht den Mumm haben, ganz auf Fleisch zu verzichten und dann ihr Gewissen beruhigen müssen«, stieß Paulsen spöttisch aus und lachte. Damit hatte er einen wunden Punkt bei Chris erwischt, der nun beschämt auf seinen Fleischteller blickte und sich sichtlich unwohl fühlte. Aber auf dieser Mission war es unmöglich, Vegetarier zu bleiben. Er konnte beim IS auch keine Ansprüche auf vegetarisches Essen stellen.
Paulsen taute während des Essens immer mehr auf und wurde – für seine Verhältnisse – richtig gesprächig. Er erzählte Chris von einem Einsatz bei den pakistanischen Taliban, bei dem er fünf gefangene Deutsche freigekauft hatte. »Ich hatte meine langjährigen Ansprechpartner bei den Taliban und konnte auf deren Zusagen vertrauen. Es war fast ein kollegialer Umgang miteinander. Das hört sich erst einmal seltsam an, wenn man bedenkt, wie grausam und dogmatisch verdreht sie doch waren. Aber sie waren in diesem Punkt rationale Leute und standen stets zu ihrem Wort«, erinnerte er sich. »Bei dem Islamischen Staat ist das jedoch anders. Es gibt keine Kontakte, denen wir vertrauen können. Es ist der erste Einsatz bei dieser Organisation und sie sind unberechenbar. Zwar hat das Büro des Kalifen unsere Sicherheit garantiert. Doch sie haben uns schon so oft mit ihrer Auslegung des Korans überrascht, sodass ich meine Zweifel nicht ganz ablegen kann. Wir betreten auf jeden Fall ganz dünnes Eis.« Er zog eine Kopie des Schreibens aus seiner Manteltasche und gab sie Chris. »Diesen Zettel musst du immer und überall bei dir tragen. Aber wir benutzen ihn nur, wenn es unbedingt nötig ist.« Auf dem Papier waren arabische Schriftzeichen und ein dicker Stempel zu erkennen. »Vom Büro des Kalifen?«, fragte Chris unsicher. »Konnte er das nicht persönlich unterzeichnen? Das hätte mich mehr beruhigt.« Er seufzte und steckte den Brief ein. Paulsen entgegnete: »Der Kalif Abu Bakr al Bagdadi ist bisher nur einmal in der Öffentlichkeit in Erscheinung getreten. Aber man weiß, dass er noch lebt und die Staatsgeschäfte im Hintergrund leitet. Die Sicherheitsgarantie ist echt. Eine andere Frage ist, ob sie ernst gemeint ist«, klärte er Chris auf. »Du musst wissen«, fuhr er fort, »dass der IS für uns nicht die einzige Gefahr ist. Da unsere Mission streng geheim ist, weiß niemand davon. Damit meine ich NIEMAND. Also auch nicht unsere Freunde. Die USA und ihre Alliierten werden weiter Drohnen einsetzen und Luftangriffe fliegen. Es kann also auf jedem Marktplatz einschlagen und uns treffen. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass wir mit führenden Leuten des IS zusammen sein werden. Die Gefahr aus der Luft schätze ich daher noch höher ein, als die vom Boden. Aber ich will dich nicht beunruhigen.« Er winkte dem Kellner und verlangte nach der Rechnung.
Zurück im Hotel ließen Chris diese besorgniserregenden Gedanken nicht los. Er schaltete den Fernseher ein - es kamen Nachrichten auf CNN: 40 Tote bei Bombenangriffen im Irak, 10 Zivilisten in Syrien entführt. Mit verkrampften Fingern schaltete er den Fernseher schnell wieder aus und seufzte nachdenklich. Er dachte an seine Familie und stellte sich vor, wie sie reagieren würden, wenn er nicht zurückkommen würde. Obwohl er es sich nicht eingestand, ertappte er sich immer wieder dabei, wie er über einen Ausweg aus der Situation grübelte. Aber er wusste, dass er es sich niemals verzeihen könnte, wenn alles gut gehen würde und er diese Gelegenheit ausgelassen hätte. Nein, er musste es riskieren. Ihm fiel ein, dass er auf seinem Laptop eine Staffel von seiner Lieblingsserie »The Newsroom« hatte und schaute es bis er einschlief.
Am nächsten Morgen wachte Chris auf und hastete auf die Toilette. Tatsächlich war eingetreten, wovor Paulsen gewarnt hatte. Der Salat oder das Gemüse oder beides hatten ihm einen gehörigen Durchfall beschert. Daher verbrachte er diesen Tag nicht wie geplant wieder im Hamam sondern auf dem Lokus. »Hoffentlich kommt der Anruf heute nicht«, dachte Chris mit bleichem Gesicht. Und er hatte Glück. Wieder meldete sich ihr Kontaktmann nicht.
Als sie am nächsten Tag über den Markt schlenderten, klingelte auf einmal das Smartphone von Paulsen. Der Anrufer am anderen Ende der Leitung erklärte, dass alles für den nächsten Tag vorbereitet sei. Die Stimme des jungen Mannes klang freundlich. Er entschuldigte sich für die Verspätung: »Wir sind halt im Krieg. Da dauern die Sachen nun mal etwas länger.« Als Paulsen ihm mitteilte, dass er von einem zweiten Unterhändler begleitet wurde, und sich Chris das erste Mal zu Wort meldete, hatte der Gesprächspartner, der sich Abu Masala nannte, keinerlei Einwände.
Kapitel 5
»Mr. Zaidi. Ich will, dass Sie wissen, dass alles, was wir hier innerhalb dieser orangen Wände besprechen, vertraulich ist und nicht gegen Sie verwendet wird. Mich interessiert lediglich die Frage, ob Sie schuldfähig sind. Alle anderen Erkenntnisse aus unseren Gesprächen sind vor Gericht nicht verwertbar«, begann Adriana ihre Standardfloskel. Zaidi blickte sie verstört an, nickte dann aber. »Fühlen Sie sich in der Lage, ein paar Fragen zu beantworten?« Zaidi nickte erneut. Ihr fiel auf, dass er müde und erschöpft wirkte, aber seine Pupillen waren groß wie Murmeln und beobachteten den Raum wie ein in die Enge getriebenes Tier. »Wie waren die letzten zwei Tage für Sie?« Zaidi wollte offenbar seine Hände bewegen, merkte aber sogleich, dass er durch die Zwangsjacke daran gehindert wurde. »Ich habe unglaubliche Angstattacken und höre manchmal Stimmen«, hauchte er mit weicher Stimme. Sein Blick schweifte zur Pinnwand hinter Adriana ab, dann blinzelte er und fuhr fort: »Es war anfangs ganz schlimm. Aber es geht mir heute besser.«
»Sie sind jetzt in Isolationshaft. Konnten sie etwas schlafen?«, wollte Adriana wissen. Zaidi seufzte: »Ich mache die ganze Zeit nichts anderes. Mich hat eine bleierne Müdigkeit befallen. Aber das ist wahrscheinlich normal nach dem, was vorgefallen ist.« Adriana fiel auf, dass ihr Gegenüber ein ungewöhnlich großes Maß an Verwirrtheit an den Tag legte. Sie studierte sein Gesicht, während sie weiter harmlosen Smalltalk betrieb. Das war eine Standardmethode, um herauszufinden, wie der Gesprächspartner seine Augen bewegt, wenn er bei harmlosen Fragen die Wahrheit sagt. Wenn es bei den richtigen Fragen dann Abweichungen vom Muster gab, hatte man einen Anhaltspunkt. Dann log er vermutlich. Zugleich war es ein Mittel, um die Abwehr des Täters abzubauen und ihn in Sicherheit zu wiegen. »Das ist ganz normal. All die neuen Eindrücke, die vorgeschriebenen Schlafzeiten, die festen Mahlzeiten. Das wird sich aber mit der Zeit geben. Machen Sie sich da keine Gedanken.« Sie nahm die Akte zur Hand, die ihr der Staatsanwalt hatte zukommen lassen. »Bevor wir mit dem Screening beginnen, fangen wir erst einmal mit ein paar allgemeinen Fragen an. Antworten Sie bitte mit Ja oder Nein. Sie heißen Yusuf Zaidi.« »Ja.« »Sie sind am 3. März 1993 in Miami geboren?« »Ja.« »Sie haben an der Miami State ihren Abschluss in Neurowissenschaften gemacht?« »Ja.« »Sie sind Moslem?« Zaidi hielt inne. Adriana sah ihn überrascht an. Zaidi hob den Zeigefinger und sprudelte hervor. »Es gibt keinen Gott außer Gott. Und Mohammed ist sein Bote. Der Islam ist die einzig wahre Religion, so wie sie der Kalif uns lehrt.« Adriana legte die Akte zur Seite und machte sich eine Notiz. »Ich nehme an, man hat sie bereits vernommen? Haben Sie sich zu den Vorwürfen geäußert?« Zaidi blickte aus dem Fenster. »Was gibt es dazu noch zu sagen. Es ist alles auf dem Video zu sehen, das die mir gezeigt haben.«
»Sie haben die Tat also gestanden?«, fragte Adriana erstaunt, obwohl sie es aus der Akte wusste. Zaidi nickte. »Dann sind Sie bereit, über das Geschehene mit mir zu sprechen? Ich würde gerne wissen, aus welchem Grund Sie die Leute in dem Kino erschossen haben.« Zaidi ballte die Fäuste unter der Zwangsjacke: »Alle Feinde des Islams müssen sterben, das ist unsere Pflicht als gläubige Muslime«, erklärte er vehement. Ohne es sich anmerken zu lassen, überraschte Adriana die plötzliche Gemütsänderung. »Wollen Sie mir mehr über Ihre Vorgehensweise erzählen? Nur um es zu verstehen«, bat Adriana mit fester Stimme. Zaidi wirkte genervt, aber schien seine Fassung wieder gefunden zu haben. »Ich bin aus dem Kino gelaufen, habe die Waffe aus dem Kofferraum meines Autos geholt und bin zurück in den Saal gegangen. Dann habe ich den Kufar das Fürchten gelehrt, wie es mein Emir befohlen hat.« Adriana sah ihm fest in die Augen: »Können Sie mir auch sagen, wo Sie die Waffen, die AK-47, die Shotgun und die Pistolen erworben haben?« Zaidi reagierte gereizt und schrie: »Nein, das kann ich nicht, weil es Sie einen Scheißdreck angeht!« Er drehte sein Gesicht weg und machte deutlich, dass für ihn die Sitzung beendet war und er nicht mehr bereit war, zu reden. Adriana konnte jedoch nicht zulassen, dass der Patient die Regeln bestimmte. Sie saßen sich daher noch weitere 15 Minuten schweigend gegenüber, während Adriana ihre Notizen durchging. Als es Zeit war, öffnete sie die Tür und entließ Zaidi. Mit einem mulmigen Gefühl im Bauch sah sie ihm hinterher, wie er abgeführt wurde.
»Schuldunfähig ist ein Täter bei einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung. Darunter versteht man eine Trübung oder Einengung des Bewusstseins, die im Verlust des intellektuellen Wissens über die Beziehungen zur Umwelt, aber auch in einer tiefgreifenden Störung des Gefühlslebens und Störung der Selbstbestimmung liegen kann.« Adriana kannte die Definition auswendig und wiederholte sie oft mantraartig, wenn sie sich über einen Patienten Gedanken machte. So auch jetzt, als sie zu Hause angekommen war und mit ihrem Santo spielte. Sein Lieblingsspielzeug war ein Schaukelpferd, das Adriana auf einem Trödelmarkt ergattert hatte. Die Farbe war schon etwas abgeblättert gewesen, aber nachdem sie es lackiert hatte, sah es aus wie neu. Santo gluckste sie fröhlich an. Wenn er lachte, hatte er die gleichen blauen Augen und die gleichen Grübchen wie sein Vater Jason. In diesen Momenten wurde sie unwillkürlich an ihren verstorbenen Mann erinnert. Ohne es zu wollen. Sie hatte lange genug getrauert und es war Zeit für einen neuen Partner, und eine Vaterfigur für Santo. »Ein Junge braucht einen Vater.« Das hatte sie aus leidlicher Erfahrung gelernt. Ihre Mutter hatte es damals nicht geschafft, ihren verzweifelten und aufsässigen Bruder zurechtzuweisen und ihn von der Straße fernzuhalten. Und auch wenn sie stärker war als ihre Mutter, sie wollte eine richtige Familie. Sie seufzte.
Bei dem Gedanken an ihren Bruder fiel ihr ein, dass sie ihn mal wieder besuchen musste. Sie wählte seine Nummer und hinterließ ihm eine Nachricht: »Hallo, Luis. Ich wollte nur wissen, wie es dir geht. Ich komme nächste Woche bei dir vorbei. Sieh zu, dass die Wohnung sauber ist!«
Kapitel 6
Mit gepackten Koffern saßen Chris und Paulsen am nächsten Morgen in der Hotellobby. Chris saß vor seinem letzten Glas Whiskey Cola – hoffentlich nicht sein Allerletztes – und rieb sich nervös die Hände. Auch Pausen knackte nervös seine Knöchel. Dann klingelte sein Handy. Sie erhielten die Anweisung, in ein Taxi zu steigen und dem Fahrer das Smartphone zu geben. Diesem würde dann erklärt, wo er hinfahren sollte.
Das Taxi fuhr etwa 15 Minuten stadtauswärts. Dann hielt es neben einem Kleinbus an. Sie bezahlten und wurden vom neuen Fahrer zügig in den Bus geführt. Dort stieß ihnen der Geruch von Schweiß und Angst in die Nase. Die drei jungen Männer, die sich im Bus befanden, hatten wohl schon eine längere Reise hinter sich. Sie unterhielten sich alle mit einem breiten Lächeln - immerhin waren sie alle Glaubensbrüder. Chris machte sich ein Bild von den Mitfahrern: Die drei Jungs trugen alte Trainingsanzüge mit Unterhemden und abgelatschte Turnschuhe. Ein Blick in die Gesichter verriet, dass Körperhygiene nicht ganz oben auf der To-do-Liste stand. Besonders die Nase eines Jungen fiel Chris auf. Sie musste mehrmals gebrochen sein, denn sie war so sichelartig gebogen, dass sie seinen Blick anzog. Wie ein Unfall, bei dem man nicht wegsehen kann.
Auf Nachfrage erfuhr er, dass ein Junge aus Aserbaidschan, die anderen zwei aus Kasachstan kamen und alle zwischen 23 und 27 Jahre alt waren. »Ganz klare Verlierertypen«. fuhr es Chris durch den Kopf. Ihm drängte sich der Eindruck auf, dass keiner eine wirkliche Perspektive im Leben, Erfolg bei Frauen oder in irgendeinem anderen Bereich hatte. Für sie bedeutete die Reise in den Islamischen Staat einen neue Chance. Immerhin konnten IS-Kämpfer viel Geld verdienen. Zur Kriegsbeute zählten auch Frauen und Kinder der eroberten Gebiete, denn diese wurden meistens versklavt. »So haben auch die drei eine reelle Chance auf eine Frau...«. dachte Chris angewidert. Sie fuhren ein Stückchen und nahmen dann eine weitere Person auf. Es war eine etwa 35-jährige Deutsche aus Berlin. Chris erfuhr, dass die deutschen Behörden ihr wegen einer Reise nach Mekka das Kind weggenommen hätten. Verdacht auf terroristische Aktivitäten. Dabei war sie nur eine fromme Muslima, wie sie behaupete. Diskriminiert und ohne ihr Kind suchte sie den Weg zum IS. Ein trauriges Schicksal für eine Mutter. Aber auch sie passte in die Kategorie der Enttäuschten. Alle drei Jungs waren sehr nervös und hingen die ganze Zeit an ihren Smartphones. Als sich Chris von hinten mit der Berlinerin unterhielt, unterbrach ihn der Junge aus Baku plötzlich. »You! Intelligence? Hä? Or Journalist?« Chris versuchte die Spannung zu lösen, indem er scherzte: »Yes, I am intelligent and you?« Doch dieser Witz kam überhaupt nicht an und er erntete von Paulsen einen bösen Blick. Von diesem Moment an redeten die Jungs noch erregter miteinander und telefonierten dabei mit ihrem Kontaktmann. Paulsen zischte ihn an: »Toll gemacht! Wegen deiner Fragerei denken die jetzt, dass wir Reporter oder Geheimdienstler sind. Und du weißt ja, was sie mit solchen Leuten machen!« Als einer der drei mit der Sensengeste zu verstehen gab, dass man nach der Grenze nochmal darüber sprechen werde, wurde Chris doch nervös. »Ich schätze wir sollten das Missverständnis noch vor der Grenze aufklären«. drängte er Paulsen. Dieser sah das genauso. Er telefonierte mit dem Kontaktmann, der ihnen für die gesamte Überfahrt zur Verfügung stand und erklärte ihm die Situation. Dieser hatte von oben nur mitgeteilt bekommen, dass die zwei Deutschen wichtige Gäste des Kalifen waren. Er ließ sich den Jungen aus Aserbaidschan geben und redete etwa eine Minute auf ihn ein. Man konnte förmlich sehen, wie sich kurz darauf seine Gesichtszüge entspannten und in Erleichterung umschwenkten. Er nickte Chris mit erhobenem Daumen zu und erklärte seinen Kumpanen etwas auf ihrer Sprache. Diese verstanden und zeigten die gleiche Erleichterung. »Oh. Das sind Gäste des Kalifen«. schienen sie unter sich zu tuscheln.