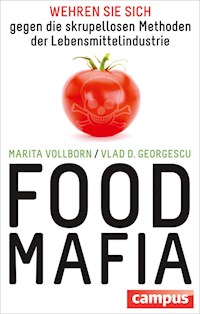9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Campus Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2006
Die Lebensmittelbranche ist eine gigantische Industrie. Im Milliardengeschäft mit den Lebensmitteln wird gelogen, betrogen und mit der Gesundheit der Verbraucher gespielt. Dieses Buch zeigt, wie die Lebensmittelindustrie funktioniert, und stellt die Akteure vor:Wer steckt eigentlich hinter dem Geschäft mit unserem Essen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
LESEPROBE
Vollborn, Marita; Georgescu, Vlad D.
Die Joghurt-Lüge
Die unappetitlichen Geschäfte der Lebensmittelindustrie
LESEPROBE
www.campus.de
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Copyright © 2006. Campus Verlag GmbH
Besuchen Sie uns im Internet: www.campus.de
E-Book ISBN: 978-3-593-40219-2
|7|Einführung
Die Umsätze sind gigantisch, die Zahl der Beschäftigten ist enorm. Mehr als 130 Milliarden Euro erwirtschaftet die Lebensmittelbranche hierzulande jedes Jahr, über 550000 Menschen hält sie in Lohn und Brot. Produziert wird rund um die Uhr, die Verkäufe laufen an sieben Tagen die Woche, bundesweit.
Die Zahlen variieren: Zwischen 50000 und 70000 Lebensmittelgeschäfte sorgen dafür, dass der Verbraucher alles bekommt, was sein Herz begehrt: Erdbeeren im Dezember, Äpfel aus Chile oder Weintrauben aus Südafrika sind ebenso selbstverständlich wie die tiefgekühlte Pizza, tiefgekühltes Gemüse oder Joghurt für Fitnessfanatiker – bar jedweder Fette und mit möglichst wenig Kalorien. Fleisch in allen Variationen ist ebenso normal wie Victoria-Barsch oder Pazifik-Fisch. Und das Sortiment im Kühlregal reicht von Fitnessdrinks bis hin zu Functional Food. Moderne Lebensmittel sollen uns gesund halten, schmecken und für wenig Geld zu haben sein. So jedenfalls lautet die globale Message einer Industrie, die mit Milliardenaufwand über Werbung, PR-Kampagnen und Sponsoringaktionen die Konsumenten vom Segen der New-Food-Ära zu überzeugen versucht. Ein wohl kalkulierter und gezielt unters Volk gebrachter Trugschluss, wie unser Buch dokumentiert.
Denn die meisten modernen Lebensmittel fordern in Wirklichkeit ihren Tribut – und gefährden Gesundheit und Psyche der Verbraucher massiv. Dabei geht es nicht um Schadstoffbelastungen, Hygieneskandale oder Zusatzstoffe allein. Vielmehr löst die gigantische Marketingmaschinerie der großen Dominatoren am Lebensmittelfirmament eine Verhaltensänderung bei den Verbrauchern aus. Wissenschaftlich fundierte Untersuchungen belegen, dass diese |8|Mechanismen existieren und deren Folgen gravierend sind: »Immer dümmer« würden Menschen, weil der Konsum bestimmter Lebensmittel einen wahren Teufelskreis auslöse. Erst übergewichtig, dann träge und am Ende nur noch vor dem Fernsehapparat – das sei etwa der vorgezeichnete Weg bei vielen Jugendlichen, konstatieren Wissenschaftler der Universität Erlangen und stützen sich dabei auf IQ-Messungen bei Kindern und Teens, deren Essgewohnheiten genau unter die Lupe genommen wurden.
Die Lebensmittelindustrie kennt die fatalen Auswirkungen ihrer Marketingstrategien, hält aber ungehindert daran fest. Todesfälle unter den Verbrauchern als Folge des gesteuerten Nahrungsmittelkonsums sind mittlerweile keine Seltenheit mehr. Über 300000 Menschen sterben jedes Jahr allein in den USA, weil sie den Verlockungen der Lebensmittelindustrie nicht widerstehen konnten. Weltweit sind gar mehr als drei Millionen Menschenleben zu beklagen, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) attestiert. Der übermäßige Konsum von Süßigkeiten, zuckerhaltigen Getränken oder Chips & Co. verursacht auch hierzulande volkswirtschaftliche Schäden in Milliardenhöhe und belastet die gesetzliche Krankenversicherung enorm.
Was noch vor einigen Jahrzehnten undenkbar schien, ist mittlerweile traurige Realität geworden: Kinder erkranken an Adipositas oder »Alters«-Diabetes, Asthma und Allergien, und das nur, weil sie Lebensmittel und eine Werbelandschaft vorfinden, die unsere Essgewohnheiten auf subtile Weise steuern. Wer glaubt, nur Kinder und Jugendliche seien der Lebensmittelmaschinerie ausgesetzt, irrt. Bei Erwachsenen beobachten Mediziner brüchige Arterien, eine höhere Neigung zur Demenz und registrieren den vorzeitigen Herztod ihrer Patienten als Folge des veränderten Nahrungsmittelkonsums. Die Folgen des uneingeschränkten Geschäfts mit Lebensmitteln sind dramatisch: eine deutlich höhere Morbidität im Alter und eine sinkende Lebenserwartung der Bevölkerung.
Zwar soll eine ganze Reihe von Gesetzen dafür sorgen, dass Lebensmittel nur dann in den Verkehr gelangen, wenn sie sicher sind. Doch in der Praxis erweisen sich die Regelungen und Gesetzestexte als Makulatur. Das einst sehr strenge deutsche Lebensmittelrecht hat längst |9|den Platz für verwässerte Verordnungen, sinnlose Reglements und unverständliche Deklarationen frei gemacht. Juristen, nicht Lebensmittelchemiker, bestimmen daher die Marktstrategien der großen Lebensmittelmultis. Durch findige Angaben zu den Inhaltsstoffen suggerieren die Hersteller die Unbedenklichkeit der Ware – wohl wissend, dass das nicht immer stimmt. So kommt es in regelmäßigen Abständen zu Rückrufaktionen und Warnmeldungen durch das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR). Nur: Kaum ein Verbraucher nimmt davon Notiz, und nicht immer verschwinden die Produkte aus dem Supermarktregal.
Selbst das vom Bundestag am 29. Juni 2006 verabschiedete Verbraucherinformationsgesetz (VIG) ist nicht geeignet, die Machenschaften der Lebensmittelindustrie zu stoppen. In seiner jetzigen Form und ohne gravierende Nachbesserungen ist das VIG wertlos, kritisiert die vom ehemaligen Greenpeace-Geschäftsführer Thilo Bode im Jahr 2002 gegründete Nichtregierungsorganisation foodwatch. Zwar sollen Behörden die Öffentlichkeit bei Gesundheitsgefahren informieren, sie müssen es aber nicht. Der Verbraucher hat nach wie vor kein einklagbares Recht auf Aufklärung, wer Etiketten fälscht oder Gammelfleisch vertreibt. Außerdem gestehen Ausnahmeregelungen den Unternehmen zu, Betriebsgeheimnissen vergleichbare oder vertraulich erhobene Informationen für sich zu behalten.
Was die Großen der Branche professionell können, ahmen auf ganz anderer Ebene die Kleinen nach. Profit um jeden Preis lautet die Devise in der Landwirtschaft – nur wer billig produziert, hat eine Chance, dem Druck des Handels standzuhalten. Der wiederum bestimmt längst die Preise. Aldi, Lidl oder Wal-Mart, nicht wie einst das Wechselspiel von Angebot und Nachfrage, geben vor, zu welchen Konditionen die Rohstoffe für unsere Nahrungsmittel zu haben sind – die Produzenten fügen sich dem Druck und bieten zum Discountpreis daher auch das an, was eigentlich teurer sein müsste.
Was aber billig ist, soll dennoch schmecken, lauten die internen Anweisungen der Marketingabteilungen der großen Lebensmittelkonzerne. Ein Ziel, das sich nur noch mit chemischer Schützenhilfe realisieren lässt. Geschmacksverstärker, künstliche Aromen und eine wahre Armada an weiteren Zusatzstoffen gehören zum Aufgebot der multimilliardenschweren Lebensmittelindustrie.
|10|Dabei belegen zahlreiche unabhängige wissenschaftliche Untersuchungen, dass nicht nur die Menge der eingesetzten Zusatzstoffe massive Auswirkungen auf die Gesundheit der Verbraucher haben kann. Auch die chemische Zusammensetzung einzelner Substanzen vermag Allergien, Asthma oder Stoffwechselstörungen auszulösen.
Im Wirrwarr der Deklarationsgesetze aber sind die Käufer schlichtweg überfordert. Was sich hinter den zahllosen E-Nummern verbirgt, wissen nur wenige Experten.
Beispiel E 620: Der Geschmacksverstärker gehört zur chemischen Klasse der Glutamate und wird aus pflanzlichen und tierischen Rohstoffen mithilfe enzymatischer Verfahren gewonnen. E 620 kann auch gentechnisch hergestellt werden. Er steht im Verdacht, Migräne, Allergien und Asthma auszulösen. Die Glutaminsäure (E 620) und deren Salze (E 621–625) sind in reiner Form ein weißes, wasserlösliches Kristallpulver, das keinen eigenen Geschmack besitzt. Erst über die Sensibilisierung der Geschmackspapillen im Mund verstärkt es den Geschmack und hebt diesen hervor. Ein Glücksfall für die Hersteller, denn über die Überlistung der körpereigenen Geschmacksnerven lassen sich in der Produktion wertvolle Rohstoffe einsparen – und auf diese Weise die Preise discountmäßig gestalten.
Für die Verbraucher ein undurchsichtiges Geschäft. Denn die klare und verständliche Deklaration ist nicht mehr möglich, wie Lebensmittelchemiker und -juristen attestieren. Ob Antioxidantien, Konservierungsstoffe oder Süßungsmittel – die Liste der Substanzen liest sich wie ein Wörterbuch der Laborchemie. Nebenwirkungen und Risiken sind inbegriffen, aber nie erwähnt. Dabei gäbe die Fachliteratur einen erschreckenden Aufschluss über das Ausmaß der potenziellen Gefahren – doch wer soll das alles wissen?
Welches wirtschaftliche Potenzial hinter dem Geschäft mit dem Geschmack des Kunden steckt, demonstriert ein Beispiel eindrucksvoll: Drei Unternehmen dominieren das Geschehen weltweit. Givauden, International Flavors & Fragrances und Quest International sind auf diesem Gebiet die globalen Player, allein der Europamarkt für Geschmacksstoffe umfasst ein Volumen von 1,29 Milliarden US-Dollar, wie ein Papier der Unternehmensberatung Frost & Sullivan dokumentiert.
|11|In der perfekten Strategie der Lebensmittelbranche haben die Verbraucher letztlich kaum eine Chance. Sie lassen sich manipulieren, steuern und sogar zu Verhaltensänderungen bewegen, die auf Dauer ihre Gesundheit, ihre Intelligenz und sogar ihr Leben gefährden. Die Ahnungslosigkeit der Konsumenten bildet die Basis für das perfekte Milliardengeschäft der Lebensmittelindustrie.
Beispiel Fettzufuhr: Trotz der zunehmenden Zahl Übergewichtiger können die wenigsten Deutschen so genannte gute von schlechten Fetten unterscheiden, wie eine Umfrage des Emnid-Instituts zeigt. Nur ein Drittel der Deutschen (34 Prozent) achtet aus gesundheitlichen Gründen auf das Fett in ihrem Essen. »Fett ist aber nicht gleich Fett; es kommt nicht nur auf die Menge an, sondern auch auf die Art der Fette«, sagt Prof. Eberhard Windler, Fettstoffwechselexperte am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Ganz ohne Fett könnte der Mensch nämlich nicht leben, weil die Vitamine A, D, E und K fettlöslich sind und daher ohne Fett nicht vom Körper aufgenommen werden können. Eine extrem fettreduzierte Lebensweise wirkt sich daher sogar negativ auf die Gesundheit aus. Werden hingegen die richtigen Fette verwendet, können diese helfen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorzubeugen. Die Emnid-Umfrage ergab, dass nur 26 Prozent der Deutschen den Unterschied zwischen gesättigten und ungesättigten Fettsäuren richtig erklären können. 58 Prozent davon haben schon einmal von dem Unterschied gehört, wissen aber nicht, in welchen Nahrungsmitteln welche Fettsäuren vorkommen.
Unwissen aber bietet den Nährboden für manipulierten Lebensmittelkonsum, selbst dann, wenn es eigentlich nichts Neues zu verkaufen gibt. Besonders sarkastisch: Mittels Werbung und über millionenschwere PR-Kampagnen soll den Menschen ausgerechnet der gesundheitliche Nutzen der neuen Lebensmittel suggeriert werden. »Functional Food« sei an dieser Stelle als ein Beispiel genannt, wie mithilfe fragwürdiger Studien und wissenschaftlich nicht haltbarer Methoden sogar eine therapeutische Wirkung der Produkte suggeriert wird.
Ein Trend, den die Industrie geschickt zu nutzen weiß. Wie das gehen kann, erfuhr man per Pressemitteilung Ende 2005 in Frankreich. Gleich zwei große Joghurthersteller schlossen mit französischen Krankenversicherern Abkommen ganz besonderer Art. Danach |12|könnten in der französischen Republik Käufer von bestimmten Functional-Food-Joghurts bei Vorlage der Quittung einen Teil der Ausgaben von ihrer Krankenversicherung zurückerhalten – der Joghurt auf Rezept rückt in greifbare Nähe.
Dass Geld im Mittelpunkt aller Entscheidungen zu stehen scheint, dokumentiert am eindrucksvollsten das Beispiel BSE. Die von Menschen geschaffene Erkrankung beschäftigt Mediziner und Forscher nach wie vor – auf politischer Ebene und vor allem gegenüber der Öffentlichkeit aber gilt das Problem de facto als gelöst. Rindfleisch wird wieder en masse verkauft, kaum ein Verbraucher misstraut »seinem« Schlachter. In Wirklichkeit jedoch sind nach wie vor weder die Folgen noch die potenziellen Auswirkungen der Prionenerkrankung bekannt. BSE-Rinder können immer noch in den Handel kommen. Während sich die Republik über die »Fleischskandale« des Jahres 2005 erregte, zeigt das Beispiel BSE die wahren Lücken im Kontrollsystem – und macht deutlich, dass allein ökonomische Überlegungen die politischen Entscheidungen in Sachen Verbraucherschutz zu bestimmen scheinen. »Verschlusssache BSE« nannten wir daher ein Kapitel dieses Buches, das exemplarisch die Strukturen und Schwächen im gigantischen Geschäft mit unserem Fleisch aufdeckt.
Nicht minder riskant scheint aus unserer Sicht der heimliche Einzug der Gentechnik in unsere Lebensmittel. Obwohl Verbraucher gentechnisch veränderte Pflanzen und Nahrungsmittel mehrheitlich nicht wollen, konsumieren sie diese doch: in Form von Zusätzen der verschiedensten Art, als Aromen oder als Würze. Neue Kennzeichnungsregelungen entpuppen sich bei näherer Betrachtung als unzulänglich. So dürfen Landwirte ihre Kühe mit Gentech-Futter versorgen, aber die Milch müssen sie dennoch nicht als gentechnisch verändert deklarieren. Und das, obwohl keinesfalls gesichert ist, ob und wie jene nachweisbaren Gentech-Erbfragmente in der Milch im Organismus der Verbraucher wirken. Während die Pharmaindustrie zu jedem neuen Medikament klinische Studien vorlegen muss, die sich eingehend mit den Nebenwirkungen und Risiken der Wirkstoffe befassen, fehlen entsprechende aufwändige Prüfverfahren nach dem Muster der klinischen Studien der Phasen I bis III bei der Zulassung des Gentech-Food.
|13|Trotzdem entscheidet die EU-Kommission ganz im Sinne der Hersteller. Im März 2006 ließ sie den gentechnisch veränderten Mais »1507« von Pioneer Hi-Bred, einer Tochtergesellschaft von DuPont, zur Verwendung als Lebensmittel zu. Der Mais war bereits im November 2005 für den Import und zur Verwendung als Futtermittel zugelassen worden. Trotz fehlender Langzeitstudien an großen Probandenkohorten nach dem Vorbild der Pharmabranche gelangte somit das auf den europäischen Markt, was hierzulande gleich mehreren Umfragen zufolge kaum ein Verbraucher haben will. Die Hersteller freilich durften sich freuen: »Zusammen mit dieser Entscheidung wird der Weg für den Import von Getreideprodukten und Produkten mit der 1507-Eigenschaft in alle 25 Länder der EU geebnet«, ließ Pioneer Hi-Bred über eine Pressemitteilung1 verkünden.
Noch ungesicherter als die Langzeitfolgen des Genfood-Konsums sind Erkenntnisse über »Nanofood«, bei dem Zusatzstoffe in winzigster Form vollkommen neue Eigenschaften der Produkte versprechen. Diese Lebensmittel sollen schon in wenigen Jahren auf den Markt gelangen – sie erscheinen für die Hersteller als Tor zu einem neuen Milliardenmarkt. Nur: Langzeitstudien über die Risiken und Folgen gibt es nicht, noch weniger existiert dazu ein gesetzliches Regelwerk, das dem Verbraucher die nötige Sicherheit bieten würde. Trotzdem gehen die Konzerne offensiv daran, »Nanofood« schon bald zu vermarkten – wohl wissend, dass ihnen niemand Einhalt gebieten wird.
Wer seine Gesundheit langfristig nicht aufs Spiel setzen will, muss daher wissen, was er isst – oder eben auch lieber nicht. Das Buch will nicht eine ganze Branche diskreditieren und im Vergleich zu vielen anderen kritischen Werken zum Thema Lebensmittel auch keine Anleitung zum Umstieg auf Bioprodukte sein – obwohl wir als Autoren im Laufe der Recherchen für dieses Buch und nach Abwägung aller Aspekte letzten Endes überzeugte Bioprodukt-Käufer geworden sind.
Unser Buch will die Mechanismen der Industrie offen legen und den Einblick ins »Eingemachte« erlauben – am Ende wird jeder Leser für sich entscheiden können, was er in Zukunft glauben und vor allem essen kann.
|15|Kapitel 1
Die Strategien der Giganten in der Nahrungsmittelbranche
Der PfanniMan kämpft sich durch ein Feldlabyrinth und vertilgt reihenweise Qualitätskartoffeln. Wer ihn schnell zu steuern weiß, überwindet alle Hürden – von der faulen Knolle bis zum gefräßigen Kartoffelkäfer. Das Online-Spiel des Lebensmittelgiganten Unilever, dem PC-Klassiker PacMan nachempfunden, soll Spaß machen – und Appetit auf Knödel & Co.
Dass Kundenbindung über die reine Produktvermarktung hinausgeht, ist kein Geheimnis. Der Verbraucher gilt als sensibles und konservativ entscheidendes Wesen, dessen Geschmack, Preisvorstellung und Hang zur Bequemlichkeit ebenso befriedigt werden müssen wie seine Schwäche für Unterhaltung. Jeder Vorsprung zählt, jedes Extra, jedes Sahnehäubchen, das ihm die Ware schmackhaft machen soll. Heftig umkämpft ist der 130 Milliarden schwere Markt für Lebensmittel: Schätzungsweise 2000 neue Produkte fügt die Branche dem bereits bestehenden Überangebot pro Jahr hinzu – mit dem Ergebnis, dass der größte Teil davon innerhalb kürzester Zeit wieder aus den Regalen verschwindet1 (siehe dazu auch Kapitel »Functional Food«). Auf dem Schlachtfeld der Kost tummeln sich mehr als 5000 Unternehmen, doch schneiden sich weniger als ein Dutzend die größten Stücke vom Kuchen ab.
Das Marketing beherrscht den Alltag des Verbrauchers. Die Lust an der Speise wird als Lust am Leben verkauft. Modernes Essen ist Sex für den Magen: eine möglichst umgehende Bedürfnisbefriedigung, die mit einem Augenflirt beginnt und mit dem Löffel in der Fünf-Minuten-Terrine endet. Das »magische Trend-Dreieck« Wellness–Convenience–Genuss verspricht der Branche, endlich das Langweilerimage loszuwerden. Die Gesellschaft für |16|Konsumforschung (GfK) und die Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE) haben anlässlich der internationalen Ernährungsmesse Anuga 2005 eine aktuelle Studie2 vorgestellt, die überproportionales Wachstum und Wertschöpfung einzelner Sortimente in Aussicht stellt. Wellness, Convenience und Genuss werden die Megatrends sein, von denen Industrie und Handel neue Impulse für ihr Geschäft erwarten können, verspricht die Studie. Bereits heute geben Konsumenten in Deutschland für Produkte dieser Kategorie 60 Milliarden Euro pro Jahr aus. Die Stunden von »Otto-Normalverbraucher« scheinen gezählt. Einkaufspräferenzen richten sich nach individuellen Vorstellungen, nach Geldbeutel und Lebenssituation und verschieben sich immer wieder. Längst lassen sich Märkte nicht mehr nach Kriterien wie Einkommen oder Haushaltsgröße erfassen. Marketing mit Hammer und Meißel zu betreiben, rechnet sich nicht mehr; heute ist das Sezierbesteck gefragt, um Produkte zielgerichtet platzieren zu können.
Mehr als 185000 Vollerwerbsbetriebe und 245000 Nebenerwerbsbetriebe in der Landwirtschaft versorgen den Agrarhandel, zu dem Ökonomen rund 1200 Primärgenossenschaften, acht Zentralgenossenschaften und knapp 1000 Landhändler zählen. Von da aus gelangen die Rohstoffe – Obst, Gemüse, Getreide, Fleisch oder Milch – in die 73000 Unternehmen der Verarbeitungsindustrie, die, nach Herstellung der Endprodukte, den Lebensmitteleinzelhandel beliefert, der sich unter anderem aus Supermärkten, Discountläden und Warenhäusern zusammensetzt. Über 51000 Verkaufsstellen des Lebensmitteleinzelhandels gibt es mittlerweile in der Bundesrepublik.
Dominiert wird die Ernährungsindustrie seit Jahren, allerdings in wechselnder Positionierung in der Rankingliste, von nur zehn Konzernen:3
|17|Tabelle 1: Die großen Konzerne der deutschen Ernährungsindustrie
Bei den Handelsunternehmen der Lebensmittelbranche (LEH) verhält es sich ähnlich:4
Tabelle 2: Die Großen im Lebensmittelhandel
Der Lebensmittelfluss
Die Big Player im Handel dominieren die Branche
Der Lebensmittelhandel ist jener Bereich des Handels, in den das meiste Geld für Werbung gesteckt wird. Das verwundert nicht, zumal es an Supermärkten in Stadt und Land nur so wimmelt: In Deutschland kommen auf eine Million Einwohner fast 250 Lebensmittel-Einzelhandelsfilialen |18|mit einer Verkaufsfläche von mehr als 400 Quadratmetern. Der Vergleich mit Großbritannien führt vor Augen, wie hart der Kampf um Kunden und Marktanteile hierzulande geführt wird: In Großbritannien kommen auf eine Million Einwohner 110 Geschäfte; damit stehen jedem deutschen Einwohner doppelt so viele Quadratmeter Einkaufsfläche zur Verfügung wie einem Briten. Die Überkapazitäten und die jahrelange Dressur des Kunden zum Schnäppchenjäger schlagen sich auf die Ertragssituation des Einzelhandels nieder. Während die Konkurrenten in Großbritannien mit 5 bis 7 Prozent Umsatzrendite rechnen dürfen, kommen deutsche Lebensmittelhändler auf 0,5 bis 2 Prozent. Insgesamt klagt der Einzelhandel über die Kaufzurückhaltung seiner Kundschaft. Allein in Baden-Württemberg meldete die Hälfte aller Geschäfte für Januar bis Juli 2005 ein Umsatzminus, im Durchschnitt generierten die Händler 4 Prozent weniger Umsatz als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Etwa 1000 Geschäfte im Schwabenland meldeten Insolvenz an. Seit etwa 1992 oszilliert der Umsatzzuwachs des Lebensmitteleinzelhandels um den Nullpunkt. Das allein auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und eine gedrückte Konsumlaune zurückführen zu wollen, trifft nicht den Kern. Die hohe Arbeitslosigkeit, die Angst vor Arbeitsplatzverlust und die schrumpfende Zahl kaufkräftiger Erwerbstätiger mögen ihren Anteil daran haben. Verbraucher sind zwar kluge Rechner – aber grundsätzlich konsumfreudig. Aber die Probleme das Lebensmitteleinzelhandels sind in viel stärkerem Maße hausgemacht: Flächenexpansion und Verdrängungswettbewerb bestimmen seit Jahren die Entwicklung. Auf diese Weise gewinnen die Großen, was die Kleinen verlieren.
Beherrscht wird der Handel, vom Kunden selten bemerkt, von den Big Playern, die sich Konzentration auf die Fahnen geschrieben haben. Wer zum Beispiel seine Tiefkühlpizza bei Lidl einkauft und die Apfelschorle über das Laufband von Kaufland schickt, lässt die Kasse eines einzigen Großunternehmens klingeln: die der Schwarz-Gruppe. Dass das Entstehen von Handelsmultis an der Tagesordnung ist, zeigt auch das Beispiel Edeka. Im Jahr 2005 bewilligte das Bundeskartellamt die Übernahme der Spar Handels AG und des Discounters Netto Süd durch die Edekazentrale ebenso wie |19|die Finanzbeteiligung an Netto Nord. »Wir freuen uns über die Entscheidung der Kartellbehörde«, kommentierte daraufhin der Edeka-Vorstandsvorsitzende Alfons Frenk, »sie stärkt die Wettbewerbsfähigkeit des von Unternehmern geführten Lebensmitteleinzelhandels.«5 Bereits Ende der 1990er Jahre zählten 11 Prozent aller Lebensmittelgeschäfte zu den Verbrauchermärkten mit mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche – die etwa 45 Prozent des Umsatzes generieren. Die Verbreitung preisgünstiger Handelsmarken in Verbrauchermärkten und Discountern verdrängte in den vergangenen Jahren klassische Markenprodukte und erhöhte dadurch den Druck auf den traditionellen Lebensmitteleinzelhandel weiter. Es waren auch Handelsmarken – und nicht Herstellermarken – die bei den Quality Food & Drink Awards 2006 in Großbritannien die meisten Preise abräumten. Die Veranstaltung, auf der aus über 500 Handelsmarken- und Herstellermarkenprodukten im Bereich Lebensmittel und Getränke ausgewählt wurde, würdigte insgesamt 22-mal die Innovationskraft des Handels, aber nur fünfmal die der Hersteller.
Der Trend ist international. In der weltweit angelegten Studie The Power of Private Label 2005 wurden 14 Produktbereiche mit insgesamt 80 Kategorien in 38 Ländermärkten untersucht. Das Marktforschungsinstitut ACNielsen zeigt darin, dass der Anteil der Handelsmarken im Konsumgütermarkt weiter ungebrochen zunimmt. Europa ist nach wie vor führend. Mit einem Handelsmarkenanteil von 30 Prozent liegt Deutschland nach der Schweiz, deren Handelsmarkenanteil 45 Prozent ausmacht, auf Platz 2 (siehe Tabelle 3).
Wer die Macht hat, bestimmt den Preis. Die Marktführer des Handels diktieren, was in den Regalen stehen und wie teuer es sein darf. Wer einem Discounter die Lieferung zu dessen Konditionen verweigert, riskiert den Ausschluss seiner Ware auch aus den anderen Ketten des Mutterkonzerns. Immerhin bringen es die Top Ten des Lebensmitteleinzelhandels auf über 80 Prozent des Branchenumsatzes. Die meisten Verbraucher interessieren diese Verflechtungen und ökonomischen Zusammenhänge wenig. Günstige Preise und die »gefühlte« gute Qualität der Produkte entscheiden über |20|Kauf oder Ablehnung. Das wissen die Multis, und sie richten sich danach.
Tabelle 3: Handelsmarken nach Marktanteil und Zuwachsrate
Quelle: ACNielsen SA, Buchrain6
Jahrzehntelang ging die Hauptsache-billig-Strategie der Branche auf. Längst ist unvorstellbar geworden, dass die Menschen früher 60 Prozent ihrer Privatausgaben für Lebensmittel aufwenden mussten; heute sind es nur noch 14 Prozent.7 Noch in jüngerer Vergangenheit forcierten auch Lebensmittelhändler die von der Hamburger Werbeagentur Jung von Matt getextete und von der Fachmarktkette Saturn losgetretene »Geiz ist geil«-Lawine, symptomatisch für den Zeitgeist, für Billigangebote, Rabattschlachten und preisaggressive Werbung.
Während der allgemeine Preisindex der Lebenshaltung seit 1995 um rund 12 Prozent anstieg, scheint bei Nahrungsmitteln und alkoholfreien Getränken das Ende der Fahnenstange erreicht. Seit 2000 verzeichnet die Statistik keine nennenswerte Steigerung des Preisindex |21|bei Nahrungsmitteln, ohnehin verteuerten sich diese von 1995 bis heute im Durchschnitt lediglich um rund 6 Prozent. Das einst visionäre Ziel vom billigen Essen auf Lebenszeit war damit in greifbare Nähe gerückt. Doch der Schein trügt. Was im Handel wenig kostet, fordert an anderer Stelle seinen Tribut.
Zum einen subventioniert die Allgemeinheit nicht nur seit vielen Jahren die marode Landwirtschaft, sondern auch die wirtschaftlich gesunde Nahrungsmittelindustrie mit Steuergeldern. Etwa 40 Milliarden Euro geben Europas Steuerzahler alljährlich nur für Agrarsubventionen aus. Das entspricht rund der Hälfte des gesamten Etats der Europäischen Union. Allein die Milchwirtschaft wird mit 16 Milliarden Euro gestützt, das sind umgerechnet 2 Euro Subventionen pro Kuh und Tag. Informationen über die Empfänger der immensen Finanzspritzen sind für Politiker zu heikel, um sie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Nicht ohne Grund: Wenn dann und wann doch einmal publik wird, was niemand wissen soll, folgt ein Aufschrei der Entrüstung. So empörten sich die Leser der in Frankreich erscheinenden La Tribune, nachdem die Zeitung veröffentlicht hatte, dass die zwölf größten französischen Agrarbetriebe den Löwenanteil, rund 500000 Euro pro Jahr und pro Betrieb erhalten; die beiden Giganten unter ihnen dürfen sich über zusammen 1,7 Millionen Euro Subventionen freuen. Laut einer Analyse der Nichtregierungsorganisation Oxfam bekommen in Spanien 303 »goldene Namen« knapp 400 Millionen Euro, mehr als 1,3 Millionen Euro pro Betrieb. Darunter befinden sich die sieben Spitzenverdiener mit 14,5 Millionen Euro – das ist genauso viel, wie die 12700 kleinsten landwirtschaftlichen Betriebe zusammen erhalten. In anderen Ländern verläuft die Verteilung nicht gerechter – wer Agrarland besitzt oder einen Betrieb unterhält, profitiert von den öffentlichen Geldspritzen, egal, welchen Beruf er sonst ausübt:
|22|Bis 2005 erhielt das finanzstärkste Molkereiunternehmen Deutschlands, Müllermilch (Jahresumsatz zirka 2 Milliarden Euro), aus EU-, Bundes- und sächsischen Landesmitteln über 70 Millionen Euro, um das größte Milchwerk Europas in Sachsen zu errichten. Nach Zusage der Millionenhilfe schloss Müller zwei andere Werke in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, 165 Arbeitsplätze gingen verloren, am neuen Standort kamen nur 148 dazu.8
In Dänemark werden vier Minister der Regierung, mehrere Parlamentsabgeordnete und sogar die dänische EU-Kommissarin mit Zahlungen unterstützt, die in die Millionen gehen.
Adlige gehören zu den größten Nutznießern. Die britische Queen (geschätztes Vermögen: zwischen 5 und 15 Milliarden Euro) wird mit 800000 Euro unterstützt, Monacos Regent Fürst Albert mit 300000 Euro, der Herzog von Westminster (geschätztes Vermögen: 7 Milliarden Euro) mit 260000 Euro, der Herzog von Marlborough (geschätztes Vermögen: 1,4 Milliarden Euro) mit rund 300000 Euro, Prinz Charles mit 330000 Euro.9
In Großbritannien wird der Zuckergigant Tate & Lyle (Umsatz: 3,6 Milliarden Euro) kräftig subventioniert.
In den Niederlanden erhielt Landwirtschaftsminister Cees Veerman 150000 Euro an Subventionen. Subventionsspitzenverdiener waren zwischen 1999 und 2003 der niederländische Zweig des Nahrungsmittelkonzerns Mars Incorporated, der Bierkonzern Heineken NV und der US-Tabakhersteller Philip Morris.
Zu den Top-Begünstigten in der Slowakei zählte 2003 und 2004 Landwirtschaftsminister Zsolt Simon mit 1,3 Millionen Euro.
In Belgien gehörten die Bank Crédit Agricole, die BASF (Umsatz 2004: 37 Milliarden Euro), das größte Chemieunternehmen der Welt, Campina, eines der größten Milchverarbeitungsunternehmen (1996 aus der ehemaligen Südmilch AG entstanden, 2004 rund 3,6 Millionen Euro Umsatz, rund 1,5 Milliarden Liter Milchverbrauch pro Jahr) sowie der größte Lebensmittelkonzern der Welt, Nestlé, zu den am kräftigsten subventionierten Unternehmen.10
|23|Solche Zahlen erhellen nur punktuell die missliche EU-Subventionspolitik, die in allen Mitgliedsstaaten Fuß gefasst hat und wettbewerbsverzerrende Auswüchse treibt. Weil die EU ihre Gelder fast ausschließlich nach der Größe der Anbaufläche verteilt (jeder Hektar bringt rund 300 Euro pro Jahr ein), mehren die steuerfinanzierten Subventionen das Vermögen von Großbetrieben und Großgrundbesitzern. Insgesamt 44 Milliarden Euro hat Brüssel 2005 an landwirtschaftliche Betriebe überwiesen, davon kamen 53 Prozent den Großen zugute, die gerade 6 Prozent aller Höfe ausmachen. Auf diese Weise wird jeder Steuerzahler durch die Hintertür gleich mehrfach zur Kasse gebeten. Er subventioniert den Anbau, die Verarbeitung und den Export von Produkten. Und weil Drittweltländer kaum eine Chance haben, ihre Waren loszuwerden, zahlt er auch noch Entwicklungshilfe. Nicht mitgerechnet sind die Millionen an Forschungsgeldern auf nationaler Ebene, mit denen die Landesregierungen über Jahre hinweg umsatzstarke Unternehmen bei der Stange halten.
Für klassische und kleinere Landwirtschaftsbetriebe bedeuten die derzeitige Subventionsmanier und immer niedrigere Abnahmepreise einen Tod auf Raten. Bauern, einst wichtigste Nahrungsmittellieferanten, sind zu Produzenten von Rohstoffen zum Discounttarif für die Lebensmittelindustrie mutiert. Die Statistik spricht Bände. Derzeit liegt die durchschnittliche Fläche eines Vollerwerbsbetriebs in Westdeutschland bei knapp unter 50 Hektar – 1980 waren es noch 25 Hektar. Während ein Landwirt 1950 noch zehn Menschen ernährte, sind es derzeit 108. Ein Ende der fatalen Entwicklung ist nicht abzusehen. Also heißt es für bäuerliche Betriebe auch in Zukunft: entweder wachsen oder weichen.
Wie desolat die Lage vieler Landwirte ist, erfuhr die Öffentlichkeit im Jahr 2004, als Tausende Milchbauern gegen die Preispolitik von Aldi auf die Straße zogen. Hintergrund war die Ankündigung des Discounters, für Milch noch weniger zu bezahlen als bislang. Ohnehin schon erhielten Bauern damals für einen Liter Milch im |24|Schnitt 27,7 Cent, also 4,3 Cent weniger im Jahr 2001.11 Auch Lidl und andere Discounter drohten nachzuziehen. Nur zwei Jahre später, Anfang 2006, sahen sich auch die Produzenten der »Weißen Linie« mit der Dumping-Preispolitik der Lebensmittelhändler konfrontiert: Zwar verkaufte der Handel rund 2,4 Millionen Tonnen Joghurt, Quark und andere Milchprodukte mehr als im Vorjahr, doch der Herstellerumsatz in diesem Segment fiel um 19 Millionen (0,4 Prozent) auf 4,36 Milliarden Euro. Fallende Preise gelten als Kundenmagnet, die Entwicklung der vergangenen Jahre führt das deutlich vor Augen. Allein die Preise für Quark gaben 2005 im vierten Jahr nacheinander nach, mit einer Trendwende rechnet niemand. »Die unter dem Druck der EU-Politik planmäßig sinkenden Erzeugerpreise machen Preiserhöhungen vonseiten der Industrie weiterhin nur sehr schwer durchsetzbar«, konstatierte die Lebensmittel Zeitung im Februar 2006.12 Mit massiver Kritik bedenken zwar Bauernverbände Aktionen wie die der zum Metro-Konzern gehörenden Real-Kette, die einen Tag lang pro Liter Vollmilch unglaubliche 33 Cent verlangte. Doch weil es sich nur um eine Ein-Tages-Kampagne handelte, konnte das umgehend informierte Kartellamt keinen Grund zum Einschreiten entdecken. Die Aktion allerdings sensibilisierte die Verbraucher nachhaltig für »billige Milch«. Warum 90 Cent bezahlen, wenn man den Liter für nur 33 Cent bekommen kann? Dauerhaft niedrige Preise im Supermarkt oder beim Discounter lassen Kunden strömen und helfen dem Absatz auf die Sprünge.
Wer sich dem Billigpreisdiktat der Handelsgiganten nicht fügt, hat schlechte Karten. Der Kampf um jeden Zentimeter Regal ist hart, entsprechend niedrige Einkaufspreise kann der Discounter mit dem Produzenten aushandeln. Derzeit liegen die Konditionsvorteile der großen gegenüber den mittelgroßen Handelsunternehmen beim Einkauf im zweistelligen Prozentbereich. Mit den großen Billiganbietern ins Geschäft zu kommen, ist für kleinere Produktionsfirmen schwierig. Häufig bleibt diesen nur ein Weg: das Konkurrenzprodukt im favorisierten Supermarkt kaufen, analysieren, einen Vergleichstest mit der eigenen Ware anstellen und versuchen, es billiger herzustellen. Um ihr Produkt zu platzieren, müssen Hersteller in der Regel ein »Hochzeitsgeld« entrichten, eine Art Eintrittsgebühr. In der Regel beträgt |25|dieses Listungsgeld 5 bis 10 Prozent des möglichen Umsatzes im ersten Jahr. Dieses Geld kassiert der Handel zusätzlich zur Differenz zwischen Einkaufs- und Verkaufspreis. Wirbt der Discounter dann noch auf Faltblättern, in Postwurfsendungen oder Anzeigen mit diesem Produkt, muss der Hersteller weitere Prozente zuschießen. Verlierer dieser marktüblichen Methoden sind kleine Hersteller und vor allem diejenigen, die ganz am Anfang der Produktionskette stehen: die Landwirte. Denn was durch Produktniedrigpreise an Gewinn verloren geht, versucht die Industrie mit dem Kauf möglichst billiger Rohstoffe wieder wettzumachen. Da erstaunt es nicht, dass dem dramatischen Höfesterben wachsende Umsätze der Lebensmittelindustrie- und Handelsgiganten gegenüberstehen. Während pro Jahr schätzungsweise 20000 Höfe ihren Betrieb aufgeben, dürfen sich die Branchengrößen über respektable Bilanzen freuen. Beispielsweise stieg der Umsatz des Geschäftsbereichs Nahrungsmittel der Dr.-Oetker-Gruppe 2004 um 18,4 Prozent auf rund 1,7 Millionen Euro (Vorjahr: 1,4 Millionen Euro); der des Discountriesen Lidl 2005 um über 11 Prozent. Selbst im Durchschnitt aller Betriebsgrößen schreibt die Lebensmittelbranche schwarze Zahlen: Anlässlich der Grünen Woche in Berlin 2005 meldete die Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE) ein Umsatzplus von 3,3 Prozent auf insgesamt 134,5 Milliarden Euro und florierende Exportgeschäfte. Lebensmittel »made in Germany« im Wert von 29,7 Milliarden Euro eroberten das Ausland – 7,2 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Die Ernährungswirtschaft im »Agrarland Deutschland« (so der damalige Bundeslandwirtschaftsminister Karl-Heinz Funke 2000 auf der Expo in Hannover) ist ein Herzstück der europäischen Exportaktivität. Schon heute ist die EU internationaler Spitzenreiter im Lebensmittelexport. Damit sie das auch bleiben kann, setzt sie auf eine Überschussproduktion: Ein Zuviel an Milch, Butter und Fleisch drückt die Preise, und wer zu niedrigen Preisen anbietet, behauptet sich auf dem Weltmarkt. Leidtragende sind die Bauern sowohl im Inland als auch in den Entwicklungsländern, sodass sich auch in Deutschland immer mehr ein »Kasten-Dasein« herausgebildet hat. Auf der einen Seite stehen Bauern mit mittleren Betrieben sowie Kleinbauern, die oftmals Pächter des von ihnen bewirtschafteten Landes sind, auf der |26|anderen Seite agrarindustrielle Großbetriebe und die Nahrungsmittelindustrie, deren Macht ungebrochen wächst.
Welche Kategorien der Lebensmittel- und Getränkeindustrie die höchsten Zuwachsraten aufweisen, wollten Analysten des Marketing-Informationsunternehmens ACNielsen wissen. Die im Jahr 2004 weltweit durchgeführte Studie13 ergab, dass gleich sieben Kategorien innerhalb der internationalen Lebensmittel- und Getränkeindustrie zweistellige Zuwachsraten aufwiesen. Fünf der Blockbuster warben mit Gesundheitsvorteilen oder schlankheitsfördernden Eigenschaften. An der Spitze lagen Sojadrinks und Trinkjoghurts mit Umsatzsteigerungen von 31 beziehungsweise 19 Prozent.
Diese Produktgruppen waren bereits 2002 aufgefallen, weil sie schon damals ein überdurchschnittliches Wachstum aufwiesen. Für die Konzerne der Lebensmittelbranche kommt das Wissen über die Präferenzen ihrer Kunden einer Lizenz zum Gelddrucken gleich: »Die Analyse zeigt, dass Ernährung und Gesundheit bei Verbrauchern weltweit einen hohen Stellenwert haben. Dieser Trend wird unterstützt durch zahlreiche Medienberichte zu Themen wie Fettleibigkeit und Diabetes.«14 Für die Etablierung neuer Trends greift die Branche tief in die Tasche. Über 1,66 Milliarden Euro investierten Lebensmittelunternehmen im Jahr 2005 in Werbung. Bezieht man auch die Getränkehersteller mit ein, kommen weitere 895 Millionen Euro hinzu.15 Der Einsatz lohnt. 655 Millionen Euro mehr als im Vorjahr setzte die Branche zum Beispiel weltweit mit Trinkjoghurts um, eine Steigerung von 19 Prozent. Keine andere Produktgruppe konnte einen derartigen Erfolg verbuchen, und selbst Sojadrinks, die mit einer Wachstumsrate von 31 Prozent offiziell die Hitliste der globalen Bestseller anführen, ließen lediglich 244 Millionen Euro mehr in die Kassen der Unternehmen fließen als im Vorjahreszeitraum. Kunden lieben Produkte, die ihnen Gesundheit, Wohlbefinden und Fitness versprechen, und sie reagieren auf das werbende Dauerfeuer mit dem Griff ins Kühlregal. Laut ACNielsen verbinden Verbraucher 12 der |27|17 gefragtesten Lebensmittelkategorien mit den Begriffen »gesund« oder »Wellness«, ein Trend, den die Industrie geschickt zu nutzen weiß. Selbst eine Liaison mit Institutionen und Unternehmen aus der Gesundheitsbranche ist nicht mehr undenkbar, wie unsere französischen Nachbarn demonstrieren. Denn im Land der Gaumenfreuden scheint schon heute eine neue Ära angebrochen: die des Essens auf Rezept.
Seit 2006 können sich französische Verbraucher ihre Kosten für den Joghurt- und Margarineeinkauf von ihren Krankenversicherern erstatten lassen – wenn es sich dabei um cholesterinsenkende Produkte der Firmen Danone und Unilever handelt. Ende 2005 hatten Unilever und die auf Zusatzkrankenversicherungen spezialisierte Maaf Santé ein Abkommen geschlossen, wonach Maaf seinen Mitgliedern bis zu 40 Euro jährlich erstatten will, wenn diese den Kassenbon über die gekaufte cholesterinsenkende Margarine der Marke Fruit d’Or vorlegen. Unilever war bereits Anfang des Jahres eine ähnliche Partnerschaft mit dem niederländischen Versicherer VGZ eingegangen. Mit Erfolg: Der Verkauf der Produkte schnellte um 25 Prozent in die Höhe. Konkurrent Danone will nun nachziehen und mit der Allianz-Tochter AGF eine ähnliche Vereinbarung für seine Marke Danacol treffen. Mit »Danacol«, einem Joghurtdrink mit Phytostanol-/Phytosterin-Zusatz, will die weltweite Nummer eins für Milchfrischprodukte den explodierenden Markt cholesterinsenkender Getränke erobern, der allein 2004 in Großbritannien um mehr als 500 Prozent zugelegt hatte. Danone erwartet für »Danacol« einen ähnlichen Siegeszug, wie er mit dem probiotischen Joghurt-Drink »Actimel« gelungen war. Verbraucherschützer halten solche Deals nicht zu Unrecht für skandalös. Denn Unilever und Danone haben den Weg frei gemacht für eine Instrumentalisierung der Gesundheit zu Marketingzwecken – eine opake Mixtur aus Fakten und Faktoren, die sich am Maximalgewinn orientiert. Und das zum Therapeutikum aufgepeppte Lebensmittel muss seine Potenz und Unbedenklichkeit nicht einmal in strengen klinischen Studien unter Beweis stellen, wie das bei Arzneimitteln der Fall ist. Im Gegensatz zu jenen dürfen Verbraucher »Medi-Kost« blindlings, in unbegrenzter Menge und auf Dauer schlucken (siehe Kapitel »Functional Food«). Diese |28|Klippe umschifft und dann noch Neuland betreten zu haben, ist ein marketingtechnisches Meisterstück.
Subventionen: Hohe Kosten für billige Lebensmittel
Verlierer sind die kleinen Landwirte
Essen auf Rezept: Die Joghurt-Lüge
Forschungsgelder vom Staat
Die Alimentierung vornehmlich von Großprojekten und Großunternehmen ist seit Jahrzehnten Bestandteil der nationalen Wirtschaftspolitik – obwohl die Branchenriesen im Gegensatz zu jungen Technologiefirmen gar nicht auf staatliche Unterstützung angewiesen sind. In einem solchen Umfeld geglätteten Wettbewerbs zugunsten der Großen kann sich Neues nur schlecht entwickeln, wirkt sich die staatliche Förderung letztlich kontraproduktiv und innovationshemmend aus. Überhaupt stellt sich die Frage, wozu den Champions der Lebensmittelindustrie öffentliche Gelder zugebilligt werden – zumal sie sich, im Gegensatz zu Firmen, die sich beispielsweise der Medizintechnik, der Nanotechnologie, der Mikrosystemtechnik, erneuerbaren Energien oder Materialforschung verschrieben haben, vornehmlich mit konservativen Problemen wie der Prozessoptimierung, der Produktionsflexibilität oder mittechnologischen Verbesserungen befassen. Die Umsetzung von Ideen in Produkte, wie das bei Functional Food der Fall ist, zahlt sich vornehmlich für die Konzerne aus; fragwürdig, weil nicht ausreichend erforscht, ist indes der Gesundheitsnutzen für die Verbraucher. So bezuschusst der Bund die Innovationsstufe in einem besonders sensiblen Bereich, die Folge- oder Sicherheitsforschung dagegen bleibt auf der Strecke. Was bleibt, ist der schale Beigeschmack, mit Steuergeldern Konkurrenzkraft und Kapitalmacht der Giganten zu stärken.
Zwar hat sich der Staat seit Mitte der 1990er Jahre sukzessive und kontinuierlich aus der Finanzierung von Forschung und Entwicklung in Deutschland zurückgezogen – nur 10 Prozent der F&E-Aktivitäten in den Unternehmen werden noch öffentlich finanziert. Auch hat sich der Anteil der kleinen und mittelständischen Unternehmen an der Forschungsförderung insgesamt erhöht. Doch den Löwenanteil von zwei Dritteln aller aufgewendeten Gelder streichen nach wie vor Großunternehmen ein. Auf europäischer Ebene ist das Verhältnis |29|ähnlich: Während 16 Prozent der Anträge von Kleinunternehmern und Mittelständlern Erfolg haben, sind es 24 Prozent bei Großunternehmen.16 Einer der Gründe mag sein, dass Großunternehmen im Laufe der Jahre komplexe Netzwerke aufbauen konnten, über »gewachsene Beziehungen« zu öffentlichen Einrichtungen und Universitäten verfügen und viele verschiedene Funktionen integrieren oder gezielt delegieren können. Im Vergleich dazu verlassen kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) ungern ausgetretene Pfade: Während Großunternehmen neben den öffentlichen alle denkbaren Finanzierungsquellen anzuzapfen wissen, lassen sich KMU noch immer vorrangig von Banken kreditieren, obwohl sie dort schlechtere Konditionen aushandeln können als ihre großen Konkurrenten.17 Besonders schwer fällt Markt-Newcomern der Zugang zu Geldern, aber auch etablierte Firmen haben Schwierigkeiten. Die oft hohen bürokratischen Hürden einer Antragstellung in Verbindung mit administrativen Lasten überfordern nicht selten Budget und Business-Kompetenz der KMU.
Dass neben den Geldern der EU beträchtliche Mittel aus der Bundeskasse an Großunternehmen fließen, belegen die Daten des öffentlich zugänglichen Förderkatalogs des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). Tabelle 4 gibt einen Überblick über ausgewählte Beispiele.
Unilever Bestfoods Deutschland GmbH ließ sich die Arbeit im Rahmen des Verbundprojekts »Naturstoffe als neue funktionelle Salz- und Süßstoffe zur Gesundheitsprophylaxe« mit 354446 Euro und 44 Cent vergüten, für drei weitere Forschungsvorhaben flossen insgesamt mehr als 450000 Euro an öffentlichen Mitteln in die Kassen des Konzerns. Und selbst der Lebensmitteleinzelhandel profitierte von der Freigebigkeit des Bundes. So erhielt die Coop AG 1987 und 1998 jeweils mehr als 366000 Euro für die »Gestaltung des Warenflusses im Lebensmittel-Einzelhandel als Dienstleistung für Läden und Märkte unter dem Gesichtspunkt der Humanisierung des Arbeitslebens«. Die Liste der Beispiele ließe sich fortsetzen, und immer wieder tauchen bekannte Namen auf. Warum der Bund Unternehmen unterstützt, die weltweit operieren und hierzulande oft nur eine Tochtergesellschaft betreiben, bleibt allerdings unverständlich.
Möchten Sie mehr lesen?
Den vollständigen Text gibt es als eBook bei Ihrem Online-Händler.
|31|Beispiel Unilever: Gigant mit Forschungstruppe
Möchten Sie mehr lesen?
Den vollständigen Text gibt es als eBook bei Ihrem Online-Händler.
Kein Einzelfall in Sachen findiger Marketingstrategien. Die Idee, die Dachmarke Freixenet um einen spritzigen Vino de Aguja – also Perlwein – zu erweitern, entpuppte sich für den Sekthersteller beispielsweise als Erfolg. Und Dr. Oetker erweiterte das Premiumsortiment seiner Backmischungen (»Nach Großmutters Back-Idee«) um kleine Kuchen für Kleinsthaushalte. Kühne wiederum setzte mit Salatfix Joghurt & Co. auf den allgemeinen Wunsch nach einer gesundheitsbewussten, leichten Ernährung.
Dass der Fantasie keine Grenzen gesetzt sind und Lebensmittel dabei sogar in den Nonfood-Bereich vordringen können, demonstriert auf skurrile Weise Schwarzkopf & Henkel. Dem Unternehmen gelang sie mit Fa Duschpflege Joghurt »einer in die Jahre gekommenen Marke frisches Leben einzuhauchen«, wie die Lebensmittel |35|Praxis in einer Pressemitteilung zu ihrer Umfrage »Produkte des Jahres 2006«22 konstatierte. Nachdem die Warengruppe Duschgele ein Jahr zuvor noch um 3,8 Prozent rückläufig war, trug die mit Joghurt geschönte Variante nun zum Wachstum der Kategorie bei.
Langfristig denkende Manager der Lebensmittelbranche haben eine vollkommen neue Esskultur im Visier. Der weltweit größte Nahrungsmittelkonzern, Nestlé, beschäftigt unter seinen rund 250000 Mitarbeitern weltweit eine rund 650-köpfige Forschereinheit im Nestlé Research Centre bei Lausanne. Die legendäre Einrichtung begründete nicht nur die Anfänge der Probiotik-Ära im Kühlregal, indem sie den mittlerweile etablierten Joghurt LC1 aus der Taufe hob. Sie zeichnet auch für die Erforschung neuartiger, funktioneller Lebensmittel verantwortlich, die laut einer Studie des Fraunhofer-Instituts für Systemtechnik und Innovationsforschung in Karlsruhe ein Marktpotenzial von 28 Milliarden Euro haben. Auf den Verkaufserfolg dieser Produkte zu setzen hat für den Schweizer Konzern Tradition. Der in den 1990er Jahren auf den Markt gebrachte Joghurt LC1 entpuppte sich damals als Blockbuster. Inzwischen jedoch hat die französische Konkurrenz Danone mit der Einführung von Actimel aufgeholt. Der durch LC1 sensibilisierte Handel nahm das Danone-Produkt mit dem probiotischen Bakterienstamm L. casei defensis umgehend an; ein überzeugender Werbebotschafter Kachelmann machte es dem Fernsehvolk schmackhaft. Mittlerweile hat sich Actimel in Deutschland einen Marktanteil von 62 Prozent erkämpft.
Marketing-Meals statt schlichter Mahlzeiten
Zucker als Milliardengeschäft
Möchten Sie mehr lesen?
Den vollständigen Text gibt es als eBook bei Ihrem Online-Händler.
|40|Kapitel 2
Functional Food
Möchten Sie mehr lesen?
Den vollständigen Text gibt es als eBook bei Ihrem Online-Händler.
Weil die Grenze zwischen Medikamenten und Nahrung zunehmend verschwimmt, ist es nicht leicht, eine klare Trennlinie zu konventionellen Nahrungs- und Genussmitteln, Nahrungsergänzungsmitteln, Naturheilstoffen und Therapeutika zu ziehen. Wissenschaftler und Ernährungsfachleute tun sich schwer mit dem Begriff Functional Food. Die Definition des Bundesinstitutes für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (BgVV), bei funktionellen Lebensmitteln handele es sich um solche Verzehrgüter, »die über ihre Ernährungsfunktion hinaus gesundheitlich bedeutsame, physiologische Parameter langfristig und gezielt beeinflussen sollen«1 , bleibt vage; die Synonyme »Designer-Lebensmittel« oder »Nutraceuticals« verwirren den Verbraucher eher, als dass sie Klarheit fördern. Eine einheitliche Produktgruppe wie zum Beispiel Teigwaren, Tiefkühlkost oder Milcherzeugnisse bietet Functional Food nämlich nicht. Wenn sich der Glaube in den kommenden Jahren durchsetzt, nicht die Änderung des Lebensstils entscheide über Fitness und Widerstandskraft, sondern der gezielte Griff ins Supermarktregal, kann im Prinzip jedes beliebige Lebens- und Genussmittel zu Functional Food aufgepeppt werden.
Gegenwärtig verfolgen die Unternehmen der Lebensmittelbranche verschiedene Strategien bei der Herstellung von Functional Food:
Als negativ bewertete Bestandteile werden durch positiv bewertete ersetzt. Das bedeutet nicht zwingend, dass die als negativ bewerteten Bestandteile per se ungesund sind.
Stoffe, die üblicherweise nicht im Lebensmittel vorkommen, werden zugesetzt.
Bestandteile, die unerwünschte Effekte haben, werden entfernt.
Die Konzentration von Substanzen, denen ein positiver Effekt zugeschrieben wird und die das Lebensmittel natürlicherweise enthält, wird erhöht.
Die Bioverfügbarkeit bestimmter Bestandteile wird verbessert.
Zu den bedeutsamsten Gruppen unter den Functional Foods zählen probiotische und prebiotische Produkte sowie mit Vitaminen, Mineralstoffen |42|und sekundären Pflanzenstoffen angereicherte Lebensmittel.
Sie zählen bereits zu den Urahnen der Functional Foods: Getränke mit hoch dosierten Vitaminzusätzen. Am gebräuchlichsten ist nach wie vor die Kombination der Vitamine C und E mit dem Provitamin A (Beta-Carotin). Untersuchungen hatten gezeigt, dass Menschen, die viel davon im Blut haben, seltener an Krebs oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen leiden. Mitverantwortlich für den Ausbruch solcher Krankheiten sind so genannte freie Radikale, aggressive Sauerstoffteilchen, die durch UV-Strahlen, Umweltgifte, Zigaretten oder Alkohol entstehen und die als »Oxidantien« im Körper die Zellhüllen, Eiweiße und die Erbsubstanz angreifen. Das können sie nicht mehr, wenn sie unschädlich gemacht werden – beispielsweise durch die antioxidativ wirkenden Vitamine A, C und E. Außer ACE setzen Hersteller mittlerweile noch andere Vitamine zu, unter anderem der B-Gruppe, Biotin, Niacin sowie Mineralstoffe wie Magnesium, Eisen und Selen.
Probiotische Lebensmittel sollen die Darmflora verbessern. Die in solchen Lebensmitteln enthaltenen Mikroorganismen sind besonders widerstandsfähig gegenüber Verdauungssäften und überstehen in wesentlich größeren Mengen die Passage durch den Magen als herkömmliche. Als Probiotika in Gebrauch sind derzeit Hefen und Milchsäurebakterien.
Indem probiotische Milchsäurebakterien regelmäßig zugeführt werden, verdrängen sie zahlenmäßig die im Darm vorhandenen unerwünschten Mikroorganismen wie Clostridien oder Fusobakterien und sollen so die Darmflora im Gleichgewicht halten. Die gesundheitsfördernden |43|Eigenschaften sind abhängig davon, welchem Stamm die Milchsäurebakterien angehören, da diese unterschiedliche Eigenschaften aufweisen. Als relativ gesichert gilt, dass probiotische Bakterienstämme gegen Durchfall helfen und dass sie die Verdauung von Milchzucker ankurbeln. Noch nicht gesichert ist, ob sie das Immunsystem stärken, vor (Darm-)Krebs schützen oder den Cholesterinspiegel senken können. Bekanntestes Produkt ist Trinkjoghurt, beispielsweise der Marke LC1 mit dem Stamm Lactobacillus johnsonnii La1 (Hersteller: Nestlé) oder Actimel mit dem Stamm Lactobacillus casei defensis (Hersteller: Danone).
Prebiotische Lebensmittel enthalten kurzkettige Kohlenhydrate, die im Dünndarm nicht verdaut werden und daher unverändert den Dickdarm erreichen. Dort stehen sie bestimmten Darmbakterien, vor allem Bifidobakterien, als Nährboden zur Verfügung. Während ihres Abbaus entsteht mehr Wasser im Darm – der Stuhl wird weicher, die Entleerung klappt besser. Außerdem sinkt der ph-Wert im Stuhl, was die Aufnahme von Kalzium, einem wichtigen Mineral, im Darm erleichtert.
Prebiotika kommen natürlicherweise in vielen Nahrungspflanzen vor, zum Beispiel in Zwiebeln, Artischocken, Chicorée oder Spargel, in Bananen, Roggen und Weizen. Für funktionelle Lebensmittel bedeutsam sind bislang vor allem Oligosaccharide und Inulin. Der Anwendungsbereich für prebiotische Zusätze ist praktisch unbegrenzt.
Synbiotika sind Kombinationen von Pro- und Prebiotika, die deren Vorteile in sich vereinigen sollen.
|41|Was ist Functional Food?
I. Mit Vitaminen und Mineralstoffen angereicherte Lebensmittel
II. Probiotische Lebensmittel
III. Prebiotische Lebensmittel
IV. Mit sekundären Pflanzenstoffen ( SPS ) angereicherte Lebensmittel
Möchten Sie mehr lesen?
Den vollständigen Text gibt es als eBook bei Ihrem Online-Händler.
Die »Medizin auf dem Teller«, wie Kritiker mäkeln, erfordert vom Verbraucher ein gehöriges Maß an Vertrauen. Denn die gesundheitlichen Wirkungen, wie sie Werbung und Hersteller Glauben machen wollen, sind vielfach nicht gut abgesichert, der tatsächliche Nutzen der Produkte ist nur schwer zu beurteilen. Viele Fragen bleiben noch offen, zum Beispiel: Wie viel Functional Food sollte ein Gesunder |46|konsumieren, damit die Substanzen wirken? Vertragen die beiden Geschlechter die gleiche Menge? Muss der Verzehr an individuelle Lebenssituationen wie Krankheit, Schwangerschaft und Stillzeit, körperlicher Höchstleistung oder Alter angepasst werden? Von welcher Menge an sind die Verbindungen schädlich? Welche Wechselwirkungen treten mit anderen Stoffen ein?
Obwohl Jahr für Jahr ungezählte Publikationen zum Thema Ernährung erscheinen, kann bislang niemand die Zweifel ausräumen. Die meisten Veröffentlichungen beschäftigen sich mit äußerst spezifischen Fragen und nur für diese enge Thematik ist, wenn überhaupt, eine eindeutige Antwort möglich. Verallgemeinerungen aber können fatale Auswirkungen haben, wie am Beispiel der Antioxidantien deutlich wird.
Noch in den 1980er Jahren galten die Vitamine A, C und E als Lebensversicherung, hielt man sie doch für mächtige Radikalenkiller, für die perfekte Barriere gegen Infekte und Krebs. Doch im Laufe der Jahre machte die Euphorie der Ernüchterung Platz. Verschiedene Untersuchungen hatten gezeigt, dass die als harmlos geltenden Vitamine, in hohen Dosen konsumiert, entweder nicht wie erhofft wirken oder sogar Schäden anrichten können.
Die erste große Enttäuschung erlebten die Wissenschaftler, als sie in Europa und den USA neun Studien zur Wirkung antioxidativer Vitamine auswerteten, während derer insgesamt rund 110000 Männer und Frauen regelmäßig die Vitamine A, C, E und Beta-Carotin oder Gemische zu sich nehmen mussten. Die Studien, die über drei bis zwölf Jahre gedauert hatten, zeigten jedoch keine eindeutig positiven Ergebnisse.3 Der Mythos, Vitamine könne man nie genug bekommen, fiel Mitte der 1990er Jahre mit drei groß angelegten Interventionsstudien zu Beta-Carotin. In der so genannten Finnland-Studie4 nahmen 30000 rauchende Männer fünf bis acht Jahre lang täglich entweder 50 Milligramm Vitamin E, 20 Milligramm Beta-Carotin, beides oder ein Placebo ein. Während Vitamin E das Risiko |47|nicht erhöhte, stieg die Lungenkrebsrate in der Beta-Carotin-Gruppe bereits nach 18 Monaten beträchtlich. Am Ende erkrankten weniger Männer an Krebs, die »nur« geraucht, aber kein Beta-Carotin zu sich genommen hatten. Die Physicians Health Study5 , die mit insgesamt 22000 Probanden durchgeführt wurde, ergab keinerlei Nutzen für zusätzliches Beta-Carotin. Die dritte, die so genannte CARET-Studie6 untermauerte die Erkenntnisse der Finnland-Studie: Hier hatten 18000 Raucher und Asbestarbeiter durchschnittlich vier Jahre lang täglich 30 Milligramm Beta-Carotin und 25000 IU Vitamin A beziehungsweise ein Placebo geschluckt. Letztlich stieg die Lungenkrebsrate durch die Vitaminpräparate um 28 Prozent, die Sterblichkeitsrate sogar um 46 Prozent. Aufgrund solch alarmierender Zwischenergebnisse mussten die Forscher die Studie 21 Monate vor ihrem geplanten Ende abbrechen.
Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) hält die Resultate der Untersuchungen für so besorgniserregend, dass es sogar vor Lebensmitteln warnt, die mit Carotinoiden versetzt sind – beispielsweise Fruchtsaftgetränken. Lebensmittel des allgemeinen und täglichen Verzehrs sollten, so die Behörde 2004, eigentlich gar nicht mit Beta-Carotin angereichert werden. Zudem weiß man mittlerweile, dass nicht allein Beta-Carotin in seinem natürlichen »Domizil«, in Gemüse und Obst wie Paprika, Möhre, Mango oder Aprikose, antikanzerogene Effekte aufweist: Mehr als 40 andere Verbindungen aus der Gruppe der Carotinoide wirken protektiv – in welcher Menge und Zusammensetzung, ist allerdings unbekannt.
Auch deutsche Wissenschaftler teilen die Skepsis gegenüber Getränken und Nahrungsmitteln, denen Vitamine in großen Mengen zugesetzt wurden. Eine Reihe von Untersuchungen bestätigt, dass viel nicht immer viel hilft, vor allem nicht bei Risikogruppen. Meist sind die Lebensmittel in ihrer natürlichen Nährstoffzusammensetzung den industriellen mit überbordenden Gehalten an Vitaminen überlegen. So wiesen Wissenschaftler der Universität Bonn im Laborversuch nach, dass ACE-Säfte zellschädigende Sauerstoffradikale weniger gut abfingen als schlichter roter Traubensaft. Noch besser wirkte Saft aus schwarzen Johannisbeeren.
Nach heutigem Wissensstand stellt die Überdosierung das größte |48|Problem im Umgang mit künstlich zugesetzten Vitaminen dar. Während ein Normalköstler kaum ein Übermaß an Vitaminen und Mineralstoffen aufnehmen kann (es sei denn, er vertilgt extreme Mengen der Vitamin-A-Bombe Leber), kann das bei den Essern, die gerne und häufig zu funktionellen Lebensmitteln und zu Vitaminpillen greifen, ganz anders aussehen. Eine im Herbst 2005 publizierte Metaanalyse7 mit 130000 Teilnehmern zeigte, dass die regelmäßige Einnahme von hohen Mengen Vitamin E (mehr als 400 IU/Tag) bei älteren Menschen langfristig das Sterberisiko erhöht. Die Studie ist so bemerkenswert, weil gerade Vitamin E einen hervorragenden Ruf als Jungbrunnen genießt; es soll die geistige Leistungsfähigkeit ankurbeln und vor Krebs, Morbus Alzheimer und Herzerkrankungen schützen. Diese Auffassung mag auch gerechtfertigt sein – allerdings nur in der empfohlenen Menge. Die Überschreitung des Schwellenbereiches kann, wie die Beispiele zeigen, empfindliche gesundheitliche Konsequenzen verschulden.
Die Tabelle 6 zeigt die möglichen Nebenwirkungen, die durch Überdosierung, also bei enorm erhöhten Tagesdosen ausgewählter Vitamine und Mineralstoffe auftreten können. In der Regel halten sich die Hersteller zwar an die Empfehlungen der Fachgesellschaften. In der Summe der Lebensmittel jedoch, die ein Functional-Food-Fan pro Tag zu sich nimmt, kann diese empfohlene Höchstmenge mehrfach überschritten werden. Schon das Beispiel der Lebensmittel für Kinder führt den Trend vor Augen. Das Angebot von Kinderlebensmitteln umfasste laut Forschungsinstitut für Kinderernährung Dortmund (FKE) 2001 bereits 308 Produkte (gegenüber 130 Produkten 1996). 40 Prozent dieser Kinderlebensmittel sind mit Vitaminen angereichert. Zum Frühstück verspeist ein Schulanfänger mit einer Portion Flakes bis zu drei Vierteln des Tagesbedarfs an bestimmten Vitaminen.8 Kommen dann noch Fruchtzwerg Multivitamin oder Käpt’n Kuck, Lachgummi und Nimm 2, Nesquick Zauberkekse, Choco Krispies Müsliriegel, Capri-Sonne Multivitamin, Fruchttiger & Co. dazu, mausert sich der Sprössling zum wandelnden Vitaminagglomerat. Mögen die Produkte im Einzelnen, falls selten genug auf dem Speiseplan akzeptiert, auch kein Risiko bergen – in der Summe katapultieren sie die Vitaminmenge in den Grenzwertbereich und |49|darüber hinaus. Verfechter von Vitamindrinks & Co. versichern zwar, ein Zuviel könne nicht schaden, weil gerade die wasserlöslichen Vitamine, falls im Überschuss vorhanden, über Harn und Stuhl ausgeschieden werden. Obwohl sie der Körper tatsächlich nicht speichern kann, scheint eine generelle Verharmlosung wenig angebracht, denn sowohl Langzeitwirkung als auch die Einzelheiten spontaner Wechselwirkungen im Stoffwechsel sind nicht bekannt. So weiß man nur, dass eine 1 000fache Tagesdosis von Vitamin B1 einen Schock verursachen kann, dass zu viel Vitamin B6 im Tierversuch die Lebern von Ratten schädigte, dass zu viel Niacin kurzfristig zu Übelkeit führt, dass zu viel Vitamin C eine Magenschleimhautentzündung nach sich ziehen kann und zu viel Vitamin B6 möglicherweise Unruhezustände zur Folge haben kann. Auch ist bekannt, dass eine Überdosierung bestimmter Vitamine zu einem erhöhten Bedarf an anderen Vitaminen führen kann – wodurch letztlich sogar eine Mangelsituation auftreten kann. Zudem unterscheiden sich die Vitamine hinsichtlich der tolerierten Überdosierung. Bei Thiamin, Riboflavin, Pantothensäure, Biotin, Cobalamin und Ascorbinsäure sowie beim fettlöslichen Vitamin E scheint auch das Hundertfache der Tagesdosis unbedenklich zu sein. Bei den Vitaminen Pyridoxin und Niacin sollte die Dosierung allerdings niedriger liegen (um das 50fache), vor allem bei einer dauerhaften zu hohen Aufnahme. Fettlösliche Vitamine wie A und D haben einen viel engeren Sicherheitsbereich, maximal bis zum Fünffachen der empfohlenen Tagesdosis.
Dabei ist es so einfach, seinem Körper über die herkömmliche Nahrung alles zu geben, was er braucht. Nur einige Beispiele: Um ihn mit ausreichend Vitamin A zu versorgen, genügen pro Tag entweder zwei Gläser Milch mit einem Fettanteil von 3,5 Prozent, eine Portion Grünkohl oder zwei bis drei mittelgroße Möhren, gekocht mit etwas Öl. Menschen mit einem höheren Vitamin-A-Bedarf, wie Jugendliche und Schwangere, benötigen das Doppelte dieser Mengen.
Auch Vitamin C muss dem Körper nicht in rauen Mengen zugemutet werden. Der Bedarf liegt bei 100 Milligramm pro Tag. Enthält der Speiseplan jeweils eine rohe Paprika, eine Apfelsine, ein Glas Orangensaft (100 Prozent Saft) oder 50 Gramm schwarze Johannisbeeren, wird es dem Organismus nicht an Vitamin C mangeln.
|50|Tabelle 6: Mögliche Nebenwirkungen durch Überdosierung (Vitamine und Mineralstoffe)
Quelle: Deutsche Gesellschaft für Ernährung, NOVAfeel9
|51|Schwangere, Stillende, körperlich schwer Arbeitende, Rekonvaleszente oder Kranke müssen rund 25 Prozent mehr verzehren.
Der Körper braucht etwa 12 Milligramm Vitamin E pro Tag – durch eine normale Mischkost nimmt der Bundesbürger bereits 25 Milligramm auf.
Aus Vitamin-D-Vorstufen, die mit der Nahrung aufgenommen werden, kann der Körper unter Sonneneinstrahlung Vitamin D selbst bilden. Zehn Minuten Aufenthalt an frischer Luft pro Tag genügen. Fisch, Hartkäse, Milch und Eier sind gute Vitamin-D-Lieferanten. Beispielsweise deckt eine Portion Fisch à 100 Gramm bereits 20 Prozent des Tagesbedarfs; ein Liter Milch liefert einer Schwangeren die benötigte Vitamin-D-Menge.
Kein Unbedenklichkeitsbonus für Functional Food
Vitamine und Mineralstoffe: Viel hilft viel?
Heißes Eisen: Frühstücksflocken
Möchten Sie mehr lesen?
Den vollständigen Text gibt es als eBook bei Ihrem Online-Händler.
Probiotika sind die Renner unter den funktionellen Lebensmitteln und gelten als ökonomische Selbstläufer. Seit ihrer Einführung im Jahr 1995 sind sie enorm erfolgreich. Allein 1997 betrug der Umsatz mit Probiotika in Deutschland 150 Millionen Euro, ein Jahr später hatten bereits 20 Prozent der deutschen Haushalte die neuen Joghurts probiert. Fast 11 Prozent ihres Lebensmittelbudgets, das sind 2,3 Milliarden Euro, gaben die Bundesbürger für Milchgetränke aus. Zwischen 1996 und 2004 stieg der Umsatz mit probiotischen Milchfrischerzeugnissen von 75 Millionen auf 485 Millionen Euro, errechnete die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK). Neben probiotischen Functional Foods sind auch entsprechende Nahrungsergänzungsmittel, so genannte Supplements, sowie pharmazeutische Spezialerzeugnisse auf dem Markt.
Das Gros der Produkte enthält Milchsäurebakterien, einige auch andere als probiotisch ausgelobte Mikroorganismen. Am weitesten verbreitet sind Stämme aus den Gattungen Bifidobakterium, Enterococcus, Lactobacillus, Lactococcus und Streptococcus, neuerdings noch weitere Gattungen. Probiotische Milchsäurebakterien können allerdings nur dann wirken, wenn eine ausreichende Menge von ihnen den Darm lebend erreicht. Das Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (BgVV) spricht von mindestens einer Million Milchsäurebakterien pro Gramm. Dass einige Joghurts diese Konzentration bei weitem nicht enthalten, stellte die Zeitschrift Ökotest bereits 1999 fest. Sie monierte, dass von den relativ wenigen, die überhaupt vorhanden waren, lediglich 40 Prozent das Bad in Magensäure und Galle unbeschadet überstehen könnten, |55|die meisten also gar nicht erst im Darm ankämen. Um sich anschließend im Darm ansiedeln zu können, sollten sie sich an der Darmschleimhaut anheften. Dort ist es allerdings schon ganz schön voll: Rund 100 Billionen Mikroorganismen aus bis zu 600 Bakterienarten und -stämmen haben sich hier eingenistet.
Probiotische Produkte als Umsatzgaranten
Wann Probiotika helfen
Möchten Sie mehr lesen?
Den vollständigen Text gibt es als eBook bei Ihrem Online-Händler.
|61|Prebiotische Nahrung mit Inulin und Oligofructose
Möchten Sie mehr lesen?
Den vollständigen Text gibt es als eBook bei Ihrem Online-Händler.
Sekundäre Pflanzenstoffe dienen eigentlich der Pflanze selbst. Sie produziert sie nicht vorrangig, um zu wachsen, sondern um sich zu schützen: vor Insektenfraß, Pilzbefall oder schädlicher UV-Strahlung. Die Stoffe, die dabei entstehen, werden also nicht im Primärstoffwechsel gebildet, sondern im sekundären. Daher haben sie auch ihren Namen.
Bis vor wenigen Jahren galten SPS – ähnlich wie Ballaststoffe – als unbedeutend für die menschliche Ernährung und Gesundheit, ja sogar als giftig. Mittlerweile hat sich diese Meinung ins Gegenteil verkehrt, haben epidemiologische Untersuchungen und Interventionsstudien doch viele Hinweise auf den Nutzen von sekundären Pflanzenstoffen belegt. Je nachdem, um welche SPS es sich handelt, wirken sie
antikarzinogen (das Krebsrisiko senkend),
antimikrobiell (vor Mikroben wie Bakterien, Viren, Pilzen schützend),
antioxidativ (als Radikalfänger)
und stärkend auf das Immunsystem.
Zum Beispiel hemmt Phytinsäure, die in den Randschichten des Getreidekorns vorkommt, die Bildung von Sauerstoffradikalen, die für die Entstehung von Dickdarmkrebs mitverantwortlich gemacht werden. Anderen Verbindungen, wie der großen Gruppe der Polyphenole, werden vielfältige positive Eigenschaften zugesprochen. |65|Zu diesen Substanzen gehören die Flavonoide, die sich wiederum in verschiedene Gruppen gliedern (siehe Tabelle 7). Die zugehörigen Flavonole und Anthocyane sind natürliche Farbstoffe. Sie färben Auberginen violett, Kirschen und Preiselbeeren rot, Sellerie und Paprika gelb. Ungefähr 5000 Flavonoide erschweren die Überschaubarkeit; andererseits sind die meisten von ihnen in bestimmten Kombinationen in den verschiedenen Obst- und Gemüsearten immer wieder anzutreffen. Als Radikalfänger sind Anthocyane sogar den Vitaminen C, E und Beta-Carotin überlegen. Darüber hinaus sind sie in der Lage, Entzündungen einzudämmen. Eine Hand voll dunkelroter Kirschen, Heidelbeeren oder Preiselbeeren muss deshalb den Vergleich mit einem hoch dosierten Vitamin-E-Präparat nicht scheuen. Preiselbeeren helfen auch bei Harnwegsinfekten, weil sie neben den entzündungshemmenden Anthocyanen antibakteriell wirkende Proanthocyanidine enthalten; Heidelbeeren verhindern Proteinveränderungen in der Linsenflüssigkeit des Auges, die durch den eiweißschädigenden Einfluss freier Radikale hervorgerufen werden und gehäuft im Alter auftreten.27 Tierexperimente bestätigen die These, dass Flavonoide, zum Beispiel Quercetin, antimutagen und antikarzinogen wirken. Epidemiologische Untersuchungen am Menschen bestätigten diesen Befund: Wer mehr polyphenolreiches Obst und Gemüse konsumiert, ist besser gegen bösartige Tumoren und vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen geschützt.28
Tabelle 7: Vorkommen von Flavonoiden ( Beispiele)
Quelle: Ernährungs-Umschau 48 (2001), Heft 12
|66|Tabelle 8: Vorkommen und Wirkung sekundärer Pflanzenstoffe
Eindrucksvoll ist auch das Beispiel der Glucosinolate, bestimmter Geschmacksstoffe, wie sie in Kohlarten vorkommen. Schon beim Kauen oder Zerkleinern der Pflanzenteile werden Glucosinolate in kleinere Einheiten, so genannte Derivate gespalten, die als die stärksten antikarzinogen wirkenden sekundären Pflanzenstoffe gelten: Isothiocyanate. Tierexperimente aus den 1960er Jahren und spätere Verzehrstudien untermauerten diese Annahme. Demnach genügen zwei Portionen Kohlgemüse täglich, um das Krebsrisiko für bestimmte Tumore um die Hälfte zu verringern. Glucosinolatderivate hemmen |67|die Krebsentstehung vor allem in der Brust, in der Speiseröhre, der Leber, der Lunge und im Magen.
Auch die positiven Eigenschaften der anderen sekundären Pflanzenstoffe, wie sie in der Tabelle zusammengefasst sind, wurden in vielen Tests bestätigt – für Gemüse und Obst. Ob diese Aussage für zugesetzte sekundäre Pflanzenstoffe gleichermaßen gilt, ist fraglich, weil es an Wissen über Einzelheiten wie Verstoffwechselung, optimale Zusammensetzung, Wechselwirkung mit anderen Substanzen und vielen anderen Parametern mangelt.
Fleischlastige Ernährung, körperliche Inaktivität, hoher Blutdruck, überbordende Cholesterinwerte – solcher Faktoren bedarf es in der Regel, um als Herzinfarktpatient auf der Intensivstation zu landen. Weil der durchschnittliche deutsche Esser konservativ tafelt, hat er ein Problem: Das Zuviel an tierischen Fetten trägt dazu bei, dass seine Blutgefäße verstopfen und sein Herz außer Takt kommt. Kampagnen wie die der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) »Fünf am Tag« können ihn dennoch nicht überzeugen, mehr Obst und Gemüse auf seinem Teller zu dulden, wohl aber die Verheißungen des Food-Giganten Unilever. Mit seiner Margarine »Becel pro-activ« verspricht er Genuss ohne Reue mit gesundheitlichem Nebeneffekt. Die enthaltenen Phytosterine sind so potent, dass sie den Anteil an schädlichem Cholesterin im Blut, dem LDL, um 10 bis 15 Prozent senken können; um das zu erreichen, müsse man täglich zwischen 20 und 25 Gramm davon verzehren – das sind vier mit Becel pro-activ bestrichene Scheiben Brot. Über die normale Ernährung ist das nicht zu schaffen. Ein durchschnittlicher Esser nimmt pro Tag lediglich 360 Milligramm an Phytosterinen auf; Menschen, die häufiger Sesamsamen, Sonnenblumenkerne und Nüsse knabbern, etwas mehr.
Die Wirksamkeit von Phytosterinen ist unbestritten. Phytosterine werden so gut wie nicht verstoffwechselt, sie gelangen über die Blutbahn |68|in die Leber und von dort mit dem Gallensaft in den Dünndarm. Dort verdrängen sie das Cholesterin aus den Mizellen, kleinen zusammengeballten Teilchen aus Fettverbindungen. Auf diese Weise nimmt der Körper weniger Cholesterin auf und wird zur vermehrten Eigensynthese angeregt. Trotz erhöhter Cholesterinproduktion sinkt der Cholesterinspiegel im Blut ab. Dieser Effekt ist so eindrucksvoll, dass das National Cholesterol Education Programm Expert Panel (NCEP, der US-Gesundheitsbehörde zugeordnet) die Verwendung ausdrücklich empfiehlt.
Was die Werbung allerdings verschleiert: Die Empfehlungen konzentrieren sich derzeit ausschließlich auf Erwachsene mit Hypercholesterinämie zur Senkung des Gesamt- und LDL-Cholesterins und auf den Einsatz in der Sekundärprävention nach einem durch Arterienverkalkung (Arteriosklerose) hervorgerufenen Krankheitsbild wie Schlaganfall, Herzinfarkt oder Verstopfungen in den Beinschlagadern (»Schaufensterkrankheit«).29 Auf seiner Internetseite30 wirbt Unilever dagegen: »Becel pro-activ ist ein neuartiges Lebensmittel für alle, die ihren Cholesterinspiegel aktiv senken möchten.« Hier findet sich kein Wort darüber, dass die Pharmamargarine nicht für alle gleichermaßen zuträglich ist. Erst das Etikett schränkt ein: Für Schwangere, Stillende und Kinder bis fünf Jahre sei sie »unter Umständen nicht zweckmäßig«. Auch Verwender cholesterinsenkender Medikamente, so der Hinweis, sollten sie mit Bedacht konsumieren. Der Grund: Verspeist ein Patient die »Pille aufs Brot« und nimmt zusätzlich entsprechende Medikamente, sinkt sein Cholesterinspiegel möglicherweise zu stark ab.
Was dem Verbraucher verborgen bleibt, ist die Tatsache, dass Phytosterine negativen Einfluss auf andere Stoffwechselvorgänge haben können, beispielsweise auf den Gehalt fettlöslicher Vitamine im Blutplasma. Mit Phytosterinen angereicherte Margarine kann zwar nach heutigen Erkenntnissen Vitamin K, das in Tomaten enthaltene starke Antioxidans aus der Carotinoid-Familie, Lykopin, oder Vitamin E nicht beeinträchtigen. Dagegen scheint sie den Beta-Carotin-Gehalt in Mitleidenschaft zu ziehen, wie vermutlich auch andere fettlösliche Vitamine. Die American Heart Association rät deshalb zu weiteren Studien, vor allem auch bei Schwangeren und |69|Kindern. Weil noch nicht feststeht, ob und wie sich die Senkung des Beta-Carotins auf den Organismus auf Dauer auswirkt, und angesichts der Tatsache, dass immer mehr Functional Food auf den Markt kommt, raten Forscher dazu, »ein effektives Post-Marketing-Sicherheitsnetz«31 zu etablieren. Wie das im Einzelnen aussehen könnte, bleibt offen.
Phytosterine haben längst ihren Siegeszug in der gesamten EU angetreten. Während in Deutschland derzeit (2006) lediglich zwei Margarinen auf dem Markt sind, finden sich in den Supermärkten unserer europäischen Nachbarn mit Phytosterinen versetzte andere Produkte des täglichen Bedarfs wie Joghurt, Milch-, Frucht- und Sojagetränke, Gewürz- und Salatsoßen. Seit die EU im November 2004 das In-Verkehr-Bringen von entsprechenden Milchprodukten erlaubt hat, kann der Verbraucher seit kurzem auch in Deutschland angereicherten Joghurt und Milchgetränke kaufen.32 Damit Verbraucher mit Phytosterinen oder Phytostanolen versetzte Lebensmittel von anderen unterscheiden können, müssen diese laut EU-Verordnung 608/2004 besonders gekennzeichnet sein. In der Nähe des Namens muss der Hinweis »mit Pflanzensterin-/Pflanzenstanolzusatz« stehen; eine Mengenangabe auf dem Produkt ist ebenfalls vorgeschrieben.
Doch wie soll der Verbraucher einschätzen, wie viel gut, wie viel schlecht für ihn ist, wenn sich selbst Wissenschaftler noch den Kopf über Wechselwirkungen zwischen Medikamenten und ihren gebratenen, gebackenen und gekochten Functional-Food-Pendants zerbrechen?
In großen Mengen aufgenommen, gelten viele andere sekundäre Pflanzenstoffe nicht gerade als unbedenklich. Einige Nebenwirkungen haben sich in Tierstudien und Reagenzglasversuchen gezeigt, über andere diskutieren die Fachleute noch. Hier vier Beispiele für die vermuteten Folgen einer Überdosierung:33
|70|Saponine könnten die Durchlässigkeit des Darmes beispielsweise für giftige Substanzen erhöhen und die Darmzellen schädigen. Das Saponin Glycyrrhizin erhöht den Blutdruck; Ernährungsmediziner fordern deshalb einen Grenzwert für Lakritz, der pro 100 Gramm 2000 Milligramm Glycyrrhizin enthält.
Sulfide