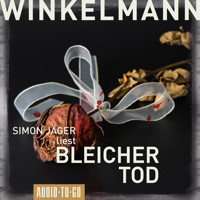9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Kerner und Oswald
- Sprache: Deutsch
Der neue Thriller des Bestsellerautors. Er gehört zu deinem Training wie die Schuhe und der Soundtrack: Dein Fitness-Tracker, der deine Laufstrecke online teilt. Jeder weiß, wo du warst - und wieder sein wirst. Doch damit inspirierst du jemanden zu einem ganz besonderen Kunstwerk, den du besser nicht auf dich aufmerksam gemacht hättest. Er trackt deine Initialen in eine digitale Karte. Sein Zeichen, dass du die Nächste sein wirst ... Lauf, so schnell du kannst - es wird dir nichts nützen. Er erwartet dich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 435
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Andreas Winkelmann
Die Karte
Thriller
Über dieses Buch
Als ihre Freundin Eva abends wie so oft noch laufen geht, macht sich die Ärztin Laura Windmüller zunächst keine Gedanken. Doch dann bekommt sie eine Nachricht, abgesetzt von Evas Handy: «Ihr läuft die Zeit davon.» Wenig später wird die junge Frau brutal stranguliert in Hafennähe gefunden. Hauptkommissar Jens Kerner war einer der letzten Menschen, der mit Eva gesprochen hatte – denn vor ihrem Haus wurde am gleichen Tag ein Mann niedergestochen. Wie hängen die Taten zusammen? Als weitere junge Läuferinnen ermordet werden, suchen Kerner und seine Kollegin Rebecca Oswald fieberhaft nach einer Verbindung zwischen den Opfern. Aber es scheint keine zu geben – außer dass alle ihre Laufstrecken öffentlich posteten …
Vita
Andreas Winkelmann, geboren 1968 in Niedersachsen, ist verheiratet und hat eine Tochter. Er lebt mit seiner Familie in einem einsamen Haus am Waldrand nahe Bremen. Wenn er nicht gerade in menschliche Abgründe abtaucht, überquert er zu Fuß die Alpen, steigt dort auf die höchsten Berge oder fischt und jagt mit Pfeil und Bogen in der Wildnis Kanadas.
Sie möchten regelmäßig über Neuerscheinungen, Veranstaltungen und aktuelle Gewinnspiele von Andreas Winkelmann informiert werden? Dann abonnieren Sie den Newsletter unter www.rowohlt.de/andreas, besuchen die Website www.andreaswinkelmann.com oder folgen dem Autor auf www.facebook.com/andreas.winkelmann.schriftsteller oder www.instagram.com/winkelmann.andreas.autor.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juli 2021
Copyright © 2021 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Covergestaltung Hafen Werbeagentur, Hamburg
Coverabbildung Maxger/iStock
ISBN 978-3-644-00310-1
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
«O Zeit, du gehst dahin
und eilst mit solcher Macht
gradaus durch Tag und Nacht,
dass ich voll Grausen bin.
Ob ich vermein zu stehn,
du reißest mich hinweg:
Wo ich kaum war, den Fleck
kann ich schon nicht mehr sehn.
Und bist dabei so still:
Es wäre mir wahrhaft Not,
woran ich dich vom Tod
noch unterscheiden will.»
(Richard von Schaukal)
Prolog
Sie nimmt mir die Luft zum Atmen.
Sie alle tun das – aber bei ihr ist es besonders schlimm. Seit sie in meinem Leben auftauchte, schnürt es mir jeden Tag mehr die Kehle zu, aber niemand bemerkt es, niemand nimmt Notiz davon. Vollkommen allein stehe ich da mit meiner Not und meinen Sorgen, mit meinen Albträumen und Angstattacken, die mich nachts aus dem Schlaf schrecken lassen. Schweißgebadet wache ich auf und ringe um Luft, meine Lungen fühlen sich an wie trockene Schwämme, tot und hart warten sie auf einen Tropfen Feuchtigkeit, doch wenn er dann kommt, ist es immer zu wenig, niemals genug.
Ich kann das nicht mehr ertragen.
Und ich weiß, es gibt nur einen Ausweg.
Sie ist die Klammer um meinen Hals, also muss sie weg.
Solange sie da ist, werde ich niemals ein freies Leben führen können, werde ich niemals die Aufmerksamkeit und den Respekt bekommen, der mir zusteht, sondern auf immer und ewig in ihrem Schatten dahinvegetieren.
Das kann ich nicht zulassen.
Ich brauche Sonne und Wärme, ich brauche das Lob und den Applaus, das ist es, was mir Kraft und Zuversicht gibt. Bekomme ich nichts davon, setzt sich das Böse durch. Ich kann spüren, wie es sich in meinem Inneren entfaltet. Dieses feine Kitzeln an einer Stelle, die unerreichbar erscheint, macht mich verrückt, und ich weiß, es gibt nur diese eine einzige Möglichkeit, mich dort zu kratzen.
Gezögert und gezaudert habe ich lange genug, heute ist der Tag gekommen, um zu handeln.
Natürlich ahnt sie nichts. Ich bin immer nett zu ihr gewesen, so wie die Gesellschaft es von mir erwartet, und so denkt sie, ich bin ein guter Junge, ein bisschen verschlossen und mitunter merkwürdig vielleicht, aber im Grunde doch eine freundliche Seele, die nichts Böses im Schilde führt.
Schon früh habe ich gelernt, welche Macht in einem Lächeln steckt. Wenn es ehrlich und warm ist, wenn die Augen mitlächeln, vertrauen die Menschen dir und tun beinahe alles für dich. Sie können nicht begreifen, dass ich dieses Lächeln als Schild einsetze, um mich gegen die Ungerechtigkeit zu schützen, können nicht sehen, wie es mein anderes Ich überdeckt. Dieses andere Ich war schon immer da, nur besänftigt durch das, was ich aus anderen Menschen gewinne: Liebe, Aufmerksamkeit, Lob, Anerkennung.
Sie hat mir all das genommen.
Dafür werde ich sie töten.
Wie sie lacht und sich freut, als ich die Griffe des Rollstuhls fester packe und sie schwungvoll die Steigung hinaufschiebe. Dort oben ist ihr Lieblingsplatz, und wahrscheinlich erwartet sie ein großes Abenteuer, einen besonderen Moment. Auf dem unbefestigten Weg muss ich mit aller Kraft gegen ihr Körpergewicht ankämpfen, zusätzlich versinken die dünnen Räder im weichen Sand. Aber allein der Blick auf ihren Hinterkopf, auf dieses wunderschöne Haar, um das sie so oft beneidet wird, wohingegen niemand über mein Aussehen spricht, stachelt die Wut in mir an, und das verleiht mir zusätzliche Kraft.
Wie sehr ich sie doch hasse!
Die Temperatur liegt bei knapp fünfzehn Grad, und es geht ein schwacher Wind, ideale Bedingungen für einen Spaziergang also. Trotzdem bin ich am Rücken und unter den Armen verschwitzt, als wir die Kuppe des Hügels erreichen. Ich verabscheue Schweiß, bei mir ebenso wie bei anderen Menschen, und ich weiß, in diesem Fall ist es Angstschweiß, das macht es nur noch schlimmer. Es ist natürlich ihre Schuld, aber ich lache mit ihr, damit sie keinen Verdacht schöpft.
Ich schiebe den Rollstuhl neben die Holzbank und arretiere die Bremsen. Bevor ich mich setzen kann, muss ich die Vogelkacke von der Bank entfernen. Dazu nehme ich den langen Baumwollschal, der in der Tasche an der Rückenlehne des Rollstuhls steckt – und behalte ihn gleich in der Hand. Es ist ihr Lieblingsschal, sie hat ihn zum Geburtstag geschenkt bekommen.
Meine Finger verkrampfen sich im weichen Stoff. Plötzlich fühle ich mich schwach und hilflos und weiß, ich benötige noch einen Moment, um mich auf das Unausweichliche vorzubereiten.
Mit einem tiefen inneren Seufzer sinke ich gegen die Rückenlehne der Bank und lasse den Blick gleiten. Ich mag diesen Ort genauso wie sie. Obwohl der Hügel kaum mehr als fünfzig Meter hoch ist, kommt es mir vor, als thronte ich über allem anderen. In einiger Entfernung kann ich die Ladekräne des Containerhafens sehen, doch der Lärm der Stadt kommt hier nicht an. Einige Greifvögel ziehen hoch oben ihre Kreise.
Ihre Hände liegen ruhig auf den schwarzen Kunststoffarmlehnen des Rollstuhls, auch sie genießt den Ausblick. Der leichte Wind hier lässt mich frieren, weil ich verschwitzt bin, und nach kurzer Zeit beginnt auch sie zu zittern.
Damit habe ich gerechnet.
«Warte, ich habe einen Schal für dich mitgebracht.»
Ich lege ihn ihr um den Hals, um diesen schmalen, grazilen Hals, und sie hebt sogar das Kinn dafür, lächelt, freut sich über diese Aufmerksamkeit des Menschen, den sie liebt. Zumindest glaube ich, dass sie mich liebt.
Mit einem schnellen Blick in die Runde überzeuge ich mich davon, dass wir nach wie vor allein sind.
Dann ziehe ich den Schal mit einem kräftigen Ruck straff.
Sofort bäumt sie sich auf, reißt die Hände an den Hals, um sich von der Schlinge zu befreien, doch es gelingt ihr nicht.
«So fühlt sich das an!», schreie ich in ihr Ohr. «So fühlt es sich an, wenn man keine Luft bekommt. Das ist es, was du mir antust. Warum tust du mir das immer wieder an!»
Mit meinen Worten stachele ich meine Wut an, und sie verleiht mir zusätzliche Kraft. Derart stark ziehe ich an dem Schal, dass ich befürchte, ihn zu zerreißen. Tief gräbt er sich in ihren Hals, schnürt Atmung und Leben ab.
Sie kämpft.
Ich zähle die Sekunden, wie man es bei einem Gewitter tut.
«Einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig …»
Die Zeit ist gegen mich. Im Angesicht des Todes will sie einfach nicht vergehen. Endlos ziehen sich die Sekunden dahin, selbst der Himmel scheint eingefroren zu sein, die Wolken ziehen nicht weiter, die Greifvögel verharren.
Schließlich sinken ihre Arme hinab.
Bei einhundertvierzig ist es endlich zu Ende.
Und ihr letzter Atemzug ist mein erster.
Kapitel 1
1
Wohin nur mit der Wut?
Dieser heiß brennenden Wut, unter deren Diktatur Lennart Wolff einfach nicht mehr funktionierte wie ein normaler Mensch. Das war schon immer so gewesen. Wenn die Wut ihn packte, fusionierten in der Kernschmelze in seinem Inneren Gedanken und Gefühle und verklumpten sein Blut. Mit Wucht presste sein Herz die breiige Masse weiterhin durch die Adern, aber er spürte, wie die Blutbahnen von innen gegen die Haut drückten, als wollten sie sie sprengen. Und auch er selbst wollte dann einfach nur noch raus aus dieser Haut, die nicht mehr länger seine zu sein schien, sondern die eines Wahnsinnigen.
Lennart Wolff schnappte sich den vollen Plastikbeutel aus dem Mülleimer, der in der Küche zwischen Kühlschrank und Wand stand. Der Müll musste ohnehin noch raus, sonst würde bei dem schwülwarmen Wetter bald die ganze Wohnung danach stinken, und dann wäre der nächste Streit vorprogrammiert.
Dabei hatte er schon jetzt mehr als genug von dieser dauernden Streiterei! Mittlerweile verging keine Woche, in der sie nicht mindestens einmal aneinandergerieten, und auch wenn es nicht jedes Mal so heftig war wie heute, fühlte Lennart sich am Tag danach ausgelaugt und müde und war unkonzentriert.
Sie raubte ihm seine Kraft, diese Wut.
Er litt darunter.
Sogar seine Arbeit litt darunter.
Wie hatte es nur so weit kommen können?
Mit dem nackten Fuß stieß Lennart die Fliegengittertür zur Terrasse auf. Die Rückholfeder quietschte erbärmlich. Das war auch so etwas, was ihm seine Frau seit Wochen vorwarf – noch war er nicht dazu gekommen, sie zu erneuern.
«Wohin gehst du jetzt noch? Haust mal wieder ab, was? Typisch!», keifte Agnes von oben.
Vor ein paar Minuten hatte sie sich ins Schlafzimmer im Obergeschoss zurückgezogen, was ein kluger Schachzug war, denn während des Streits hatte Lennart einen Punkt erreicht, an dem er für nichts mehr die Garantie übernehmen konnte. Vielleicht wäre ihm die Hand ausgerutscht, vielleicht hätte er mit irgendeinem Gegenstand nach ihr geworfen. Es wäre das erste Mal gewesen in den acht Jahren, die sie verheiratet waren.
«Den Scheiß-Müll rausbringen!», brüllte er, bevor die Fliegengittertür mit lautem Scheppern gegen den Türrahmen krachte.
Draußen wie drinnen hatte es in der vergangenen halben Stunde gewittert, und die abziehenden Wolken hinterließen tiefe Schwärze. Der Regen verdampfte auf den von der Hitze des Tages aufgeheizten Straßen und Gehwegen, brütend-dumpfe Regenwaldluft schlug Lennart Wolff entgegen. Sie fühlte sich an wie eine feste Masse, in der all die negative menschliche Energie des vergangenen Tages kumulierte.
Hätte er ohne dieses belastende Wetter gelassener auf Agnes’ Sticheleien reagiert? Wahrscheinlich nicht. Denn wenn seine Frau eines wirklich gut konnte, dann dieses Herumreiten auf Kleinigkeiten. Unablässig stieß sie ihm die Sporen in die Seiten, bis er blutete, ließ nicht locker, trieb ihn vor sich her …
Lennart Wolff trat mit dem Müllbeutel in der Hand in die dampfende Sommernacht hinaus und atmete tief ein und aus. Obwohl sie es nicht war, kam ihm diese Luft klar und rein vor, wie geschaffen, um einen klaren Kopf zu bekommen – und der war bitter nötig. Er musste sich unbedingt wieder in den Griff bekommen und herunterfahren, sonst würde er noch jemanden umbringen.
Da morgen der Abfuhrtermin war, stand die Mülltonne bereits vorn an der Zufahrt zu ihrem Grundstück. Barfuß lief Lennart über die gepflasterte Hofeinfahrt des neuen Hauses, das sie vor vier Jahren bezogen hatten. Ihr Heim, ihr Nest, auf das sie sich so gefreut hatten. Irre teuer war das alles gewesen, und sie hatten die Hypothek in dieser Größenordnung nur bekommen, weil er als Systemadministrator bei der Bank arbeitete.
Was, wenn sie sich trennten?
Das wäre eine finanzielle Katastrophe, gar nicht auszudenken!
Lennart öffnete die Fußgängerpforte, ging zu der Mülltonne hinüber und stopfte den Plastikbeutel in die ohnehin schon volle Tonne. Dazu musste er kräftig drücken und pressen. Der Beutel platzte auf, und eine Mischung aus Ketchup und Gorgonzola-Soße vom gestrigen Abendessen spritzte ihm gegen den Bauch und kleckerte auf die graue Jogginghose hinunter. «Verdammt noch mal, so eine Sch…»
Lennart unterbrach sich selbst, weil er spürte, dass er nahe dran war, vollends die Kontrolle zu verlieren.
Er sah sich um.
Einundzwanzig Uhr.
Niemand war in diesem ruhigen, fast schon gediegenen Wohnviertel um diese Zeit noch unterwegs. Es spielte keine Rolle, ob er bekleckert war oder sauber, ob er Schuhe trug oder nicht. Die Nachbarn würden ihn nicht sehen.
Lennart entspannte sich etwas, klaubte die Zigarette und das Feuerzeug aus der linken Tasche seiner Jogginghose – beides hatte er auf der Flucht aus dem Haus rasch eingesteckt – und zündete sich die Zigarette an.
Wie herrlich, den Geschmack von Tabak einzuatmen! Wie schön, damit etwas zu tun, was Agnes missfiel! Im Haus durfte er natürlich nicht rauchen, und sie küsste ihn auch nicht, wenn er es gerade getan hatte, aber verbieten lassen wollte Lennart es sich nicht.
Nach dem ersten tiefen Zug ging er nach rechts die Straße hinunter. Einfach nur ein bisschen umhergehen, den Kopf freibekommen, die Wut loswerden und hoffen, dass Agnes schon schlief, wenn er zurückkehrte. Heute wollte er ihr auf keinen Fall mehr über den Weg laufen. Wahrscheinlich würde er ohnehin auf der Couch schlafen. Wäre ja nicht das erste Mal.
Hundert Meter weiter, in Nummer 14, brannte noch Licht.
Sein Blick fiel immer dorthin, sobald Lennart das Grundstück verließ. Die beiden Lesben hatten wirklich ein cooles Haus, sehr stylisch und reduziert, mit vielen großen Glasflächen, aber das war nicht der wahre Grund für seine Neugier.
Lennart ging langsamer und versuchte, einen Blick ins Innere des Hauses zu erhaschen. Vielleicht lief eine seiner Nachbarinnen in Unterwäsche herum. Beide hatten echte Traumkörper und scheuten sich nicht, sich zu zeigen. Schon oft hatte Lennart sich vorgestellt, wie es wohl wäre, aufs Grundstück zu schleichen, ganz aus der Nähe durch eines der Fenster zu schauen und die beiden dabei zu beobachten, wie sie es sich besorgten.
Allein der Gedanke erregte ihn.
An einer dunklen Stelle nahe einer hohen Buchenhecke blieb er stehen, beobachtete das Haus und gab sich seiner Phantasie hin. Stellte sich die nackten Lesben ineinander verschlungen im Bett vor. Seine Wut war noch nicht wirklich verschwunden, es strömte noch genügend Adrenalin durch seine Adern, um sich heute näher heranzutrauen. Dann wäre dieser Abend wenigstens nicht komplett für den Arsch!
Die Bewegung in der Dunkelheit hielt er im ersten Moment für eine Täuschung. Doch dann wiederholte sie sich, und Lennart erkannte, dass da drüben unter den Bäumen noch jemand stand und das Haus beobachtete.
Was für ein perverser Spanner!
Augenblicklich kochte die Wut in Lennart wieder hoch. Er musste an die Einbrüche denken, die es in diesem Wohngebiet immer wieder gegeben hatte. Ertappte er gerade einen dieser Typen beim Ausspionieren des nächsten Tatorts? Immer wenn in der Presse von einem Einbruch berichtet worden war, hatte Lennart zu Agnes gesagt, dass er sich wünsche, zu Hause zu sein, wenn bei ihnen jemand einstieg. Agnes glaubte ja nicht, dass er mit so einem Typen fertig werden würde, aber Lennart hatte in seiner Jugend geboxt und war immer noch fit genug, lief dreimal die Woche und ging am Wochenende ins Gym.
Lennart zog ein letztes Mal an der Zigarette, warf sie auf den nassen Asphalt und betrat die Straße.
«Hey du, was machst du da!»
Die Gestalt erschrak und fuhr herum. Sie war in ein feucht glänzendes, schwarzes Regencape gehüllt. Mit der Kapuze über dem Kopf und einer dieser Corona-Masken, die man hin und wieder noch sah, ebenfalls in Schwarz, war das Gesicht nicht zu erkennen. Einen Moment verharrte die Gestalt noch, dann lief sie in die entgegengesetzte Richtung die Straße hinunter. So wie ein Hund auf einen flüchtenden Hasen reagierte, reagiert auch Lennart: Er dachte nicht, wägte nicht ab, folgte einfach nur seinem durch massenhaft ausgeschüttetes Adrenalin aufgeputschten Instinkt.
Rannte hinterher.
Seine nackten Füße klatschten auf den nassen Asphalt.
«Bleib stehen!», rief er dem Flüchtenden hinterher.
Doch der dachte gar nicht daran, rannte weiter. Er war schnell, und sein Laufstil verriet Lennart, dass er es mit einem geübten Läufer zu tun hatte. Auf schnurgeradem Weg sprintete der Spanner die Straße hinunter und zog das Tempo sogar noch an. Lennart wusste, diese Geschwindigkeit würde er nicht allzu lange durchhalten können, und nach fünfzig Metern rechnete er schon nicht mehr damit, den Flüchtenden wirklich einholen zu können.
Vielleicht war es auch besser so. Man wusste ja nie. Nachher war es ein Verrückter, dem er da hinterherlief.
Lennart fiel auf, dass der Mann beim Laufen merkwürdige Geräusche machte. Es klackte irgendwie bei jedem Schritt.
Als sie sich der T-Kreuzung Malerstraße und Langenstraße näherten, knickte der Mann an der Kante eines Schlaglochs um und begann zu humpeln.
Lennart holte auf, als etwas Unvorhergesehenes geschah. Der Mann blieb plötzlich stehen und drehte sich um. Lennart konnte nicht schnell genug stoppen und auch nicht einfach ausweichen, ohne Gefahr zu laufen, auszurutschen und hinzufallen. Er ahnte, er würde den Mann umrennen und unter sich begraben.
Doch dazu kam es nicht. In einer fließenden Bewegung hob der schwarz gekleidete Fremde den rechten Arm, und noch ehe Lennart begriff, was passierte, spürte er einen kurzen, heftigen Druck auf seinem linken Auge, dann einen grell aufzuckenden Schmerz im Schädel. Sofort lief warme Flüssigkeit an seinem Gesicht herab.
Der Fremde wich geschickt aus, und Lennart Wolff ging mitten auf der Straße zu Boden. Dabei rutschte er ein Stück über den Asphalt, schürfte sich Handflächen und Knie auf, spürte davon aber nichts, weil der Schmerz in seinem Gesicht alles andere überdeckte.
Auf den Knien hockend hob Lennart eine Hand, um vorsichtig sein Gesicht zu betasten. Seine Finger berührten einen harten Gegenstand, der aus seinem linken Auge ragte. Diese sanfte Berührung reichte, um den Schmerz noch einmal zu steigern, und Lennart Wolff schrie sich die Seele aus dem Leib.
2
Es gab sie immer mal wieder, diese Tage, an denen Rebecca Oswald sich wünschte, ihre Beine benutzen zu können, laufen zu können. Mehr als fünfzehn Jahre lag der Unfall zurück, der zu einem Leben im Rollstuhl geführt hatte, das war mehr als genug Zeit, um sich daran zu gewöhnen, aber Rebecca wartete immer noch auf diese Gewöhnung.
Besonders in Momenten wie diesem.
Was sie gerade beobachtet hatte, konnte nicht sein!
Sie musste sich bei der Entfernung und dem schlechten Licht getäuscht haben.
Rebecca hatte das reinigende Gewitter abgewartet, um danach noch einmal hinauszufahren und nach diesem drückend warmen Tag die frischere Luft zu genießen. Außerdem mochte sie es, wie die Straßen im Sommer nach einem Gewitterschauer rochen, wenn der Wasserdampf vom warmen Asphalt aufstieg.
Von ihrer Wohnung waren es nur zehn Minuten bis in den nächsten Park, aber es war eindeutig nicht die beste Entscheidung gewesen, dorthin zu fahren. Die Wege waren nicht gepflastert, sondern lediglich geschottert, und überall standen tiefe Pfützen, zwischen denen sie Slalom fahren musste. Immer wieder sanken die Reifen ein, zudem spritzten Feuchtigkeit und Dreck an die Greifringe, weil sie versuchte, so schnell wie möglich vorwärtszukommen.
Im Park gab es ein paar Straßenlaternen, die aber weit auseinanderstanden, sodass sich helle und dunkle Bereiche abwechselten, und als die Erscheinung zum ersten Mal durch den hellen Bereich einer Laterne huschte, glaubte Becca noch an eine Täuschung.
Im Laufe des Abends hatte sie zwei Gläser Rotwein getrunken, was normalerweise keine großen Auswirkungen auf sie hatte, aber vielleicht trug ja das Wetter dazu bei, dass sie doch ein bisschen angetüddelt war. Anders war eigentlich nicht zu erklären, was sie gerade zu sehen geglaubt hatte.
Ein Mann auf einem Fahrrad mit einer Rolle aus Zeitungspapier auf dem Gepäckträger, aus der ein menschlicher Fuß herausragte?
Becca war sich absolut sicher, einen nackten Fuß gesehen zu haben, bevor die Erscheinung wieder in der Dunkelheit verschwand.
Aus einem ersten Reflex heraus versuchte sie, den Fahrradfahrer zu verfolgen, was ihr vielleicht sogar gelungen wäre, wenn die Wege nicht so aufgeweicht gewesen wären. Ihre Behinderung behinderte sie wieder einmal spürbar, und das ärgerte sie, die sie ihr Leben lang eine Sportlerin gewesen war.
Schwer atmend stoppte Becca ihren Rolli, den sie nach einem billigen Ikea-Stuhl Ivar nannte. Sie befand sich jetzt in einem der dunklen Bereiche des Parks. Dichtes Buschwerk schirmte sie von der Stadt ab – und von anderen Menschen. Hier war niemand außer ihr, und als Becca das bewusst wurde, lief ihr ein Schauer den Rücken hinab.
Aufmerksam sah sie sich um.
Büsche, gebeugt von der schweren Last des Regenwassers, wirkten wie verwunschene Gestalten, umhüllt von einer glitzernden, perlend nassen Dunkelheit. Die Stille war auf eindringliche Art unheimlich. Wo waren die pulsierenden Geräusche der Stadt, die ihr sonst immer das Gefühl der Sicherheit gaben? Becca hatte das Gefühl, in einem postapokalyptischen Film gelandet zu sein; die einzige Überlebende eines unheimlichen Virus vielleicht.
Sie lauschte in die nasse Dunkelheit. Beklommenheit ergriff Besitz von ihr, und Becca bereute es, allein in die Nacht hinausgefahren zu sein. Sie arbeitete bei der Polizei und sollte es eigentlich besser wissen. Wenn tatsächlich einer von fünfundzwanzig Menschen per definitionem ein Psychopath war, war die Chance, in dieser Stadt einem zu begegnen, groß genug.
Von irgendwoher schob sich ein leises Quietschen in die Stille. Zunächst noch verhalten, wurde es schnell lauter und lauter.
Er kommt zurück, schoss es Becca durch den Kopf.
Sie griff zum Handy – es steckte in der schwarzen Bauchtasche, die sie um den Körper trug –, zögerte aber noch, Jens Kerner anzurufen. Sie wusste, er hatte Dienst an diesem Abend, aber was sollte sie ihm sagen? Dass sie glaubte, einen Mann auf einem Fahrrad gesehen zu haben, der mit einem menschlichen Fuß auf den Gepäckträger geklemmt durch den Park fuhr?
Jens würde sie zuallererst fragen, ob sie etwas getrunken hatte. Was ja auch stimmte.
Unterdessen kam das Quietschen immer näher.
Ein hohes, langgezogenes Geräusch, ein gleichmäßig wiederkehrender Rhythmus. Suchend wandte Becca den Kopf hin und her – und dann sah sie ihn plötzlich wieder.
Gegenüber, auf der anderen Seite der runden Rasenfläche, fuhr er durch das Licht der Laterne, in dem er für einen Moment sichtbar wurde, bevor er wieder in der Dunkelheit verschwand und nur dieses jämmerlich quietschende Geräusch von seiner Existenz zeugte.
Keine Täuschung aufgrund ihres Alkoholkonsums.
Da fuhr jemand durch den Park, einen menschlichen Fuß auf den Gepäckträger geklemmt – und wie es aussah, war er in ihre Richtung unterwegs.
Hastig wählte Becca Jens’ Nummer.
3
Jens Kerner rannte.
Dabei hatte er es gar nicht so mit dem Rennen. Mit Sport im Allgemeinen nicht. Daher rührte auch sein leichtes Übergewicht, das er einfach nicht loswurde. Seine Schritte waren nicht gerade federnd, ganz im Gegenteil, er kam mit jedem Schritt hart mit der Ferse auf und spürte die Erschütterung im ganzen Körper. Das war alles andere als angenehm, aber wenn er den vermeintlichen Mörder nicht aus den Augen verlieren wollte, blieb ihm nichts anderes übrig, als Gas zu geben.
Jens nahm sich fest vor, an seiner körperlichen Verfassung etwas zu ändern. Ein Ziel, das er schon häufiger anvisiert, aber bisher nicht erreicht hatte.
Diesmal würde er Ernst machen!
Der Mann auf dem Fahrrad hatte einen Vorsprung von drei- bis vierhundert Metern, fuhr aber nicht besonders schnell. Er wusste ja auch nicht, dass er verfolgt wurde, ebenso, wie er nicht wusste, dass er von Becca dabei beobachtet worden war, wie er den abgetrennten Fuß eines Menschen auf dem Gepäckträger seines Fahrrads durch den Park spazieren fuhr.
Beccas Anruf hatte Jens während der Spätschicht im 33. Kommissariat am Wiesendamm in Hamburg aus dem Halbschlaf gerissen. Nicht, dass er nichts zu tun gehabt hätte! Berichte mussten verfasst, Recherchen eingeholt, Zeugenaussagen gelesen werden. Aber für diesen Schreibkram hatte Jens seit jeher nicht viel übrig, noch weniger als für Sport, und er überließ ihn gern Becca, die darin viel besser war als er.
Darin, und in den meisten anderen Dingen auch.
Es hatte stark geregnet. Ein Gewitterschauer, kurz, aber heftig, und überall auf den Straßen staute sich das Wasser an den überfluteten Gullys. Als Jens durch einen dieser flachen Teiche lief, spritzte ihm das Wasser bis ins Gesicht. Becca, die sich noch immer im Park aufhielt, versteckt zwischen irgendwelchen Büschen, hatte ihm per Handy durchgegeben, dass der Radfahrer nach einigen Rundfahrten um die zentrale Rasenfläche den Park in Richtung Westen verlassen wollte. Als Jens den Ausgang erreicht hatte, bog der Radler gerade auf die Straße ab.
Er bot ein merkwürdiges Bild.
Der Mann trug eine graue Regenjacke mit der Kapuze über dem Kopf, ansonsten aber nichts. Seine Beine waren nackt, er war barfüßig, und es war nicht zu erkennen, ob er überhaupt eine Hose unter der Jacke trug. Er fuhr ein altes Damenrad im Stil eines Hollandrads mit Weidenkorb am Lenkrad und einem ausladenden Gepäckträger. Irgendwas an dem Rad quietschte bei jeder Umdrehung der Pedale jämmerlich, und das Geräusch hallte in der stillen Nacht zwischen den Häusern wider. Das Rücklicht flackerte wie ein sterbendes Auge, und der Mann war nicht in der Lage, eine gerade Spur zu halten. Immer wieder taumelte er in Richtung Bordsteinkante, und es war wohl nur eine Frage der Zeit, bis er dagegenfahren und umkippen würde.
Wahrscheinlich war er betrunken oder stand unter Drogen. Oder beides zugleich. Warum sonst sollte jemand spätabends einen menschlichen Fuß auf seinem Gepäckträger herumkutschieren? Kurioser ging es kaum noch, dachte Jens, der schon einiges an Kuriositäten erlebt hatte.
Der Radfahrer näherte sich einer Kreuzung und drosselte das Tempo. Schließlich holte Jens weit genug auf, um das mit Zeitungspapier umwickelte Stück Fleisch auf dem Gepäckträger genauer erkennen zu können. Bis zu diesem Moment hatte er noch gehofft, es handele sich um einen Scherzartikel, aber diese Hoffnung erfüllte sich nicht.
Die schmutzige Fußsohle mit den einzelnen Zehen daran war überaus real.
«Polizei!», rief Jens. «Halten Sie an. Polizei!»
Er war höchstens drei Minuten gerannt, pfiff aber schon auf dem letzten Loch und spürte allzu deutlich, wie wenig fit er war.
Der Radfahrer wurde wieder schneller und schaffte es jetzt sogar, die Spur zu halten. Der Rhythmus des Quietschens wurde im gleichen Maße schneller, wie er in die Pedale trat.
Verdammt!
Jens hätte sich nicht so früh zu erkennen geben sollen.
Den Versuch, ebenfalls das Tempo anzuziehen, quittierte sein Körper mit einem netten kleinen Krampf in der rechten Wade.
Laut fluchend fiel Jens Kerner zurück.
Als er sich schon damit abfinden wollte, dass der Flüchtende ihm entkommen würde, schoss plötzlich von links ein Streifenwagen auf die Kreuzung und schnitt dem Radler den Weg ab. Um Haaresbreite gab es keinen Zusammenstoß, aber der Radler musste hart bremsen, verlor die Kontrolle über sein quietschendes Hollandrad, kippte um und blieb auf der nassen Straße liegen.
Voller hanseatischer Gelassenheit stieg Rolf Hagenah aus dem Streifenwagen, zog gemächlich seinen Hosenbund hoch, richtete den Gürtel mit Waffenholster und Pfefferspray, umrundete die Motorhaube und baute sich in seiner ganzen imposanten Größe vor dem am Boden liegenden Mann auf.
«Hier ist Endstation für dich», sagte er.
Jens Kerner humpelte auf einer Wade heran, die sich wie ein Metallimplantat anfühlte. Der Schmerz war nicht ohne, aber Jens verzog keine Miene, weil er sich vor Hagenah keine Blöße geben wollte. Sein alter Freund und Kollege ging bald in den Ruhestand, war also mehr als zehn Jahre älter als Jens. Und doch machte er immer noch einen fitten Eindruck.
«Das Rad hat nicht einmal Gangschaltung», bemerkte Hagenah. «Hast du dich zwischendrin auf eine Bank gesetzt, oder was?»
Jens überging die Bemerkung und kümmerte sich um den Fahrradfahrer. Er packte ihn am Schlafittchen, drehte ihn auf den Rücken – und erschrak.
Vor sich hatte er einen Mann von mindestens siebzig Jahren, wahrscheinlich war er sogar noch älter. Ängstlich schaute der alte Mann zu Jens auf, schnappte mit offenem Mund nach Luft und gab sich den Anschein, als würde er gleich sterben.
«Brauchen Sie einen Arzt?», fragte Jens.
Der Oldie schien ihn nicht zu verstehen.
«Ruf mal die Rettung», wies Jens seinen Kollegen Hagenah an, der rasch in den Streifenwagen abtauchte und das Funkgerät zur Hand nahm.
Jens wollte sich zu dem Oldie hinunterbeugen, doch die versteinerte Wade machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Er musste sich auf die Knie sacken lassen. Dabei fiel sein Blick auf das Fahrrad, das dicht neben ihm auf der Straße lag. Zwischen den Metallstreben des Gepäckträgers klemmte der Fuß. Wenn er die Länge der Zeitungsrolle richtig einschätzte, handelte es sich um einen kompletten Unterschenkel, der unter dem Kniegelenk abgetrennt worden war.
«Was machen Sie für einen Scheiß?», fragte er den alten Mann.
Doch der befand sich in einer ganz anderen Welt. Seine Augen irrlichterten umher, Speichel lief ihm aus dem Mund, seine Hände zitterten stark. Jens erkannte, dass er aus dem Mann nichts herausbekommen würde, es sogar fahrlässig wäre, ihn in diesem Zustand zu verhören. Es blieb ihnen nichts anderes übrig, als auf den Rettungswagen zu warten.
Hagenah trat neben ihn. «Da kam gerade noch eine merkwürdige Meldung rein», sagte er.
«Sag nicht, noch ein Fahrradfahrer, der das andere Bein auf dem Gepäckträger hat.»
«Nee. Jemandem wurde auf offener Straße ins Auge gestochen. Der Tatort ist keine fünf Minuten von hier entfernt. Malerstraße, Ecke Langenstraße. Die Zentrale hat angefragt, ob einer von uns das übernehmen kann. Alle anderen sind im Einsatz. Was für eine verrückte Nacht!»
Jens kam auf die Beine und vermied es, vor Schmerzen aufzustöhnen.
«Ich fahr rüber», sagte er gepresst. «Bleib du hier und fahr mit dem Rettungswagen mit. Ich hole dich dann später aus dem Krankenhaus ab.»
4
«Na, Frau Doktor, wie sieht es mit einem kleinen Abendlauf aus?»
Eva Probst schlang ihrer großen Liebe Laura Windmüller, die mal wieder noch vor dem PC hockte, von hinten die Arme um den Hals und flüsterte ihr die Worte leise ins Ohr.
Laura hatte noch nicht geduscht, seit sie vor einer Stunde nach ihrer Schicht im Krankenhaus nach Hause gekommen war. Sie wusste, nach diesem schwülwarmen Tag roch sie nicht besonders gut, wahrscheinlich nach einer Mischung aus Desinfektion und Schweiß, aber das schien Eva nicht zu stören.
«Es gewittert», sagte Laura ebenso leise.
«Seit einer halben Stunde nicht mehr, und es fängt auch nicht wieder an. Ich habe gerade die Lauf-App gecheckt.»
«Ja, aber es ist fast zweiundzwanzig Uhr und längst dunkel.»
«Im Winter laufen wir dauernd im Dunkeln.»
Auf dieses Argument erwiderte Laura Windmüller nichts mehr, legte stattdessen ihren Kopf sanft gegen den ihrer Freundin, schloss die Augen und atmete tief ein und aus. Sie konnte spüren, wie mit der Atemluft die Anspannung des Tages ihren Körper verließ. Aber leider nicht genug. Es war immer zu viel, und jeden Tag kam neuer Ballast dazu.
«Komm schon, es wird dich entspannen», redete ihre Freundin ihr gut zu.
Laura seufzte und streichelte Evas Unterarme. Die makellos glatte Haut, die feinen blonden Härchen, die feingliedrigen, sensiblen Hände, das Tattoo in Form eines Paragraphenzeichens auf der Innenseite des linken Arms.
«Ich muss diese drei Seiten noch durchsehen. Das dauert sicher noch eine halbe Stunde. Magst du nicht allein laufen gehen, und wir entspannen uns später, wenn wir beide geduscht sind, auf andere Weise?»
«Auf welche Weise?»
«Du weißt schon.»
«Ja, aber ich will es aus deinem Mund hören. Nur wenn du es sagst, musst du nicht mit mir laufen gehen.»
«Lass uns beim Sex entspannen», flüsterte Laura ihr ins Ohr, und ihr selbst lief ein Schauer der Erregung den Rücken hinab. Bevor sie Eva kennengelernt hatte, hatte sie solche Worte nie in den Mund genommen und nicht gewusst, welche Wirkung sie auf sie selbst haben konnten.
«Okay», sagte Eva. «Du darfst weiter hier hocken bleiben, während ich die tolle Abendluft nach einem reinigenden Gewitter genieße. Und wenn ich wiederkomme, will ich dich geduscht und nackt in unserem Bett vorfinden.»
«Ich werde auf dich warten.»
«Aber nicht wieder einschlafen, hörst du!»
«Versprochen.»
Es war Laura unangenehm, darauf angesprochen zu werden. In den letzten Monaten war es einfach zu häufig passiert, was natürlich viel mit der erhöhten Arbeitsbelastung durch die Corona-Pandemie zu tun hatte. Trotzdem sollte sie als erst fünfunddreißigjährige Frau nicht jeden Abend wie eine Leiche ins Bett fallen. Eva hatte in der Kanzlei, in der sie als angestellte Rechtsanwältin arbeitete, auch stressige Tage, war abends aber meistens noch fit für ihr Lauftraining – und andere Dinge.
«Was machst du da eigentlich?», fragte Eva und löste sich von ihr.
«Das Übliche. Doktorarbeiten überprüfen.»
«Immer auf der Suche nach jemandem, der nur abgeschrieben hat, was?»
«Schon, aber die hier ist richtig gut. Sonst hätte ich sie nach diesem anstrengenden Tag auch längst in die Ecke geworfen.»
«Warum macht dein Prof das nicht selbst?»
«Weil er Professor ist und dafür seine Sklavin hat. Ich hasse den Typen, aber noch ist er mein Chef.»
«Ich hoffe, ich lerne ihn nie kennen», sagte Eva und lief zwei Stufen auf einmal die freitragende Betontreppe ins Obergeschoss hinauf. Es dauerte nur wenige Minuten, bis sie in kurzen, engen Laufshorts wieder herunterkam, dazu trug sie ein pinkfarbenes Trägerhemd und Laufschuhe in der passenden Farbe. Eva gab Unsummen für ihre Sportkleidung aus und war beim Sport immer perfekt gestylt.
Ihr langes blondes Haar hatte sie zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden, der keck hin und her schwang, und machte auf dem glatten weißen Fliesenboden ihre Dehnübungen. Sie sah dabei einfach zum Anbeißen aus.
«Machst du das extra?», fragte Laura.
«Nein, mit Absicht. Du sollst dich schließlich auf später freuen.»
Sie kam zu Laura an den Esstisch, an dem sie ihre Arbeit zu erledigen pflegte, und küsste sie. Auf eine Art und Weise, die keinen Zweifel daran ließ, wie sehr sie sich auf später freute.
Dann ging sie zur Tür.
Die Klinke schon in der Hand, drehte sie sich noch einmal um und verharrte.
«Was ist?», fragte Laura.
«Weißt du eigentlich, wie sehr ich dich liebe?»
«Ich denke schon. Und das beruht auf Gegenseitigkeit.»
Eva lächelte versonnen und wollte das Haus verlassen, als Laura noch etwas einfiel.
«Hast du die Begleit-App aktiviert?»
Ihre Freundin trug beim Laufen ihr Handy in einer durchsichtigen Tasche am Oberarm, was etwas merkwürdig aussah, wie Laura fand, dazu eine Fitness-Uhr, die ihre Vitalfunktionen sekündlich überwachte – überflüssig, weil sie fit war wie der sprichwörtliche Turnschuh.
Eva nahm das Handy hervor und aktivierte die App.
«Bis gleich», rief sie und verschwand.
Plötzlich hatte Laura das überwältigende Verlangen, ihr hinterherzulaufen und sie darum zu bitten, daheim zu bleiben. Nicht allein hinaus in die Nacht zu gehen, weil sie sie sonst nie wiedersehen würde. Woher auch immer dieses irrationale Gefühl kam.
«Sei nicht so verdammt besitzergreifend», sagte sie zu sich selbst, denn sie wusste, diese hässliche Seite hatte sie von ihrer Mutter geerbt.
5
Die Fahrt zu der Adresse, die Hagenah ihm genannt hatte, dauerte vier Minuten, und als Jens in die Langenstraße einbog, sah er den Menschenauflauf schon von weitem. Ein Rettungswagen war allerdings noch nicht da. Keine Überraschung! Auch die Jungs und Mädels von der Rettung hatten in dieser ungewöhnlichen Nacht alle Hände voll zu tun und kamen gar nicht hinterher. Es schien, als machte die schwüle Luft, die seit gestern wie eine Glocke über der Stadt lag, die Menschen verrückt.
Vielleicht hatte aber auch einfach niemand aus dem Menschenpulk daran gedacht, die 112 zu wählen. Wäre ja nicht das erste Mal. Da standen sie, hielten ihre Handys hoch für sensationelle Fotos und Videos, mit denen sie die Leere der Menschen füllen konnten, die auf Social Media unterwegs waren, kamen aber nicht auf die Idee, das Telefon für den Zweck zu benutzen, für den es ursprünglich einmal erfunden worden war.
Jens parkte den Wagen schräg auf der Straße, schaltete das Blaulicht ein, rief in der Zentrale an und erfuhr, dass sehr wohl schon ein Rettungswagen unterwegs war. Dann stieg er aus und ging zu der Menschenansammlung. Aufgeregtes Getuschel drang ihm entgegen. Leiber in kurzen Hosen, Flip-Flops und Trägershirts drängten sich eng aneinander, als hätte es nie eine Corona-Pandemie gegeben.
«Polizei, machen Sie bitte Platz», stieß Jens aus, ohne sich die Mühe zu machen, freundlich zu klingen. Gaffer reagierten nicht auf Freundlichkeit, sondern nur auf klare Ansagen oder schmerzhafte Geldstrafen.
Der äußere Ring der Neugierigen drehte sich zu ihm um, und er konnte in ihren Gesichtern sehen, wie sie überlegten, ob es sich lohnte, sich für den guten Platz mit ihm anzulegen.
Lohnt sich nicht, ließ Jens sie mit seinem Blick wissen, und sie wichen zur Seite.
Er schob sich durch den mittleren und inneren Ring und erreichte schließlich die Ringmitte. Dort lag ein Mann rücklings auf der Straße. Er trug eine graue, blutbefleckte Jogginghose, ein weißes, ebenfalls besudeltes Shirt und war barfuß. Über ihn beugte sich ein weiterer Mann, der beruhigend auf den Liegenden einredete.
Erst als Jens sich einen anderen Blickwinkel verschaffte, sah er, dass aus dem linken Auge des Liegenden ein hölzerner Griff herausragte – wahrscheinlich von einem Messer. Um diesen Griff herum hatte jemand Mullverband gewickelt, sodass das verletzte Auge nicht zu sehen war. Der Mullverband war vom Blut des Mannes und einer gelblichen Flüssigkeit getränkt.
«Hauptkommissar Kerner», stellte Jens sich vor. «Was ist hier passiert?»
Der Mann, der die Arme des Verletzten an den Handgelenken festhielt, zuckte mit den Schultern. «Ich weiß es nicht. Ich kam zufällig vorbei. Ich bin Arzt …»
«Sie haben den Verband angelegt?»
Der Mann nickte. «Damit kein Schmutz in die Wunde gelangt. Mehr kann ich hier nicht machen, aber der Rettungswagen müsste gleich eintreffen, ich hab angerufen.»
«Ist das ein Messer?», fragte Jens und deutete mit dem Kinn auf den Holzgriff.
Der Mann nickte. «Das darf erst im Krankenhaus entfernt werden. Steckt ziemlich tief drin.»
«Ist der Angreifer flüchtig?»
«Nehme ich an», antwortete der Mann.
«Haben Sie den Messergriff angefasst?»
«Nein, auf keinen Fall, das wäre viel zu gefährlich. Aber ich befürchte, der Verletzte selbst hat ihn angefasst. Er wollte versuchen, das Messer herauszuziehen … würde es auch wieder versuchen, deshalb halte ich seine Arme fest.»
Jens nickte und wandte sich an den Verletzten.
«Können Sie mich hören? Wie ist Ihr Name?»
Der Brustkorb des Mannes hob und senkte sich in schnellem Rhythmus. «Wolff … Lennart Wolff», stieß er mühsam hervor.
«Mein Name ist Jens Kerner, ich bin Polizist im 33. Kommissariat. Können Sie mir sagen, was passiert ist?»
Das unverletzte Auge des Mannes zuckte nervös hin und her, die Pupille war geweitet.
«Verfolgt … ich habe ihn verfolgt … ein Einbrecher …»
«Sie haben jemanden verfolgt, und der hat Ihnen das angetan?»
Der Verletzte wollte nicken, beließ es aber bei dem Versuch und verzog vor Schmerz das Gesicht.
«Nicht bewegen!», mahnte der Mann.
«Haben Sie ihn gesehen? Können Sie ihn später beschreiben?», fragte Jens.
«… meine Frau … wo ist meine Frau?»
«Hat jemand seine Frau informiert?», fragte Jens den Mann, doch der zuckte nur mit den Schultern.
«Hat jemand seine Frau informiert?», wiederholte Jens seine Frage in die Runde, erntete aber nur verständnislose Blicke.
«Wohnen Sie in der Nähe?», fragte Jens den Verletzten. So, wie er angezogen war, lag das eigentlich auf der Hand.
«Malerstraße … 21 … meine Frau …», antwortete er.
«Ich hole Ihre Frau her, keine Angst, das wird schon wieder.»
«Passen Sie auf ihn auf», sagte Jens zu dem Mann, klopfte ihm anerkennend auf die Schulter und meinte das auch ehrlich. Es gab nicht mehr viele Menschen, die so umsichtig handelten wie dieser Mann.
Ein Handy blitzte auf. Jemand schoss ein Foto. Gleichzeitig bog der Rettungswagen um die Ecke. Jens drehte sich zu demjenigen um, der das Foto geschossen hatte, doch der verdrückte sich schnell durch die Menge hinweg nach hinten und verschwand. Jens konnte nur noch erkennen, dass er dunkle Regenkleidung trug.
«Wenn hier noch einer fotografiert, nehme ich ihm das Handy weg», schnauzte Jens die Leute an.
In seinem Rücken blitzte es wieder auf. Jens fuhr in dem Moment herum, als der Mann, der fotografiert hatte, sein Handy gerade wegstecken wollte. So ein asoziales Verhalten! In Jens kochte die Wut hoch. Er packte zu, bekam das Handgelenk des Mannes zu fassen und knickte es nach hinten ab.
Der Mann schrie vor Schmerzen auf.
Ein anderer brüllte etwas von Polizeigewalt.
Jens schnappte sich das Handy.
«Ey, gib das sofort wieder her!», schnauzte der Mann und rieb sich das Handgelenk.
«Nach Paragraph 201a Strafgesetzbuch steht das Fotografieren von lebenden Unfallopfern unter Strafe. Ich darf in diesem Fall das Handy beschlagnahmen, um die Persönlichkeitsrechte des Opfers zu schützen und die Fotos löschen zu lassen.»
«Ich will mein Handy zurück!»
«Können Sie sich auf dem 33. abholen, dauert aber eine Weile, bis die Fotos gelöscht sind.»
«Ich mach’s gleich hier, vor Ihren Augen», bot der Mann an.
«No way», sagte Jens und steckte das Handy in seine Tasche.
Der Mann, viel kleiner als Jens und dickbäuchig, kam Jens gefährlich nahe. Wut blitzte in seinen Augen auf. «Sind wir hier in einem Polizeistaat, oder was!»
«Du landest gleich auch auf dem 33., wenn du jetzt nicht die Fresse hältst», sagte Jens gefährlich leise. Er wusste, dass die anderen Gaffer ihn wahrscheinlich gerade filmten, aber das war ihm egal. Er wandte sich ab und rief laut und deutlich: «Okay, ich brauche von allen Anwesenden Namen, Adresse und Telefonnummer.»
Wie erwartet, begann sich die Menge zu zerstreuen.
Der Notarzt kam mit seiner Tasche herbeigelaufen und ging neben dem Verletzten auf die Knie.
«Wohin bringen Sie ihn?», fragte Jens.
«UKE.»
Während der Notarzt sich um den Verletzten kümmerte, ging Jens die Malerstraße hinunter, sah sich nach den Hausnummern um und suchte nach Nummer 21. Dabei telefonierte er mit der Einsatzzentrale des 33., erklärte die Situation und bat um Unterstützung, die sich nach einem flüchtigen Täter umschauen sollte. Das ergab zwar nicht viel Sinn, da der Angreifer sicher längst über alle Berge oder in einem Versteck verschwunden war. Es nicht zu tun, wäre aber fahrlässig gewesen.
Er fand das Haus schnell, da es tatsächlich keine drei Minuten vom Tatort entfernt lag. Jens wunderte sich, warum die Ehefrau des Verletzten nicht von allein gekommen war. Sie musste doch bemerkt haben, dass ihr Mann einen vermeintlichen Einbrecher verfolgen wollte.
Jens schob die Pforte auf, ging die Auffahrt hinauf bis zur Haustür und drückte auf den Klingelknopf. Um die Dringlichkeit zu unterstreichen, tat er es viermal kurz hintereinander.
Im Flur flammte Licht auf. Jemand kam die Treppe hinunter, das konnte Jens durch die Milchglasscheibe der Tür sehen.
«Nimm gefälligst deinen Scheiß-Schlüssel mit, wenn du rauchen willst, sonst kannst du das nächste Mal die Nacht draußen verbringen», keifte hinter der Tür eine weibliche Stimme.
«Polizei. Ihr Mann hatte einen Unfall, können Sie bitte öffnen!»
«Moment … was … Lenn … Lenn, bist du da?»
Die Frau rief nach ihrem Mann. Vernünftig, dachte Jens. Sofort die Tür zu öffnen, nur weil jemand behauptete, er sei von der Polizei, wäre leichtsinnig gewesen. Einem Einbrecher hinterherzulaufen war es im Übrigen auch.
Die Frau öffnete schließlich doch die Tür. Sie trug kurze blaue Shorts zu einem weißen Shirt und sah Jens aus großen, ängstlichen Augen an.
Was ihr gerade passierte, war die Horrorvorstellung schlechthin: Spätabends klingelte die Polizei, um eine Nachricht zu überbringen. Diese Szene kannte man aus unzähligen Krimis im Fernsehen, und die Polizisten waren niemals Überbringer guter Nachrichten.
Jens erklärte der Frau in kurzen Sätzen, was vorgefallen war und dass es ihrem Mann zwar nicht gutgehe, er aber wohl nicht in Lebensgefahr schwebe.
«Ziehen Sie sich etwas an, beeilen Sie sich, dann können Sie vielleicht noch im Rettungswagen mitfahren.»
Sie zog sich nicht um, schnappte sich lediglich einen Hausschlüssel, schloss ab und verließ zusammen mit Jens das Grundstück. Kaum hatten sie die Straße betreten, konnten sie den Widerschein der Blaulichter am Himmel sehen.
«Oh Gott!», stieß Agnes Wolff aus. «Was ist denn nur passiert? Lennart wollte doch nur den Müll rausbringen.»
«Es sieht so aus, als hätte ihr Mann einen Einbrecher überrascht und ihn verfolgt. Haben Sie das nicht mitbekommen?»
«Einen Einbrecher? Bei uns? Nein, ich … wir … wir hatten einen Streit.»
Das erklärte so einiges, zumindest für Jens, der nach zwei gescheiterten Ehen ein großer Kenner ehelichen Streits war.
Sie erreichten den Tatort. Mittlerweile waren zwei weitere Streifenwagen eingetroffen. Um den immer noch am Boden liegenden Lennart Wolff hatte sich mittlerweile eine dichte Mauer aus Rettungssanitätern und Polizisten gebildet. Während die Sanitäter den Mann behandelten, schirmten die Polizisten ihn ab. Andere waren damit beschäftigt, auch noch die allerletzten, hartnäckigen Gaffer zu vertreiben.
Jens übergab die Ehefrau an einen der Rettungssanitäter. Der führte sie zu ihrem Mann, und das Letzte, was Jens von Agnes Wolff hörte, war ein entsetzlicher Aufschrei. Jens hielt sich nicht für zartbesaitet oder besonders emotional, aber dieser Schrei fuhr ihm durch Mark und Bein.
Einmal mehr fragte er sich, wohin es ging mit dieser Gesellschaft, in der Brutalität keine Ausnahme mehr war, sondern Alltag – zumindest für ihn und seine Kollegen. Was würde das auf Dauer mit ihm machen?
Wie hart musste man sein, um heutzutage noch durchzukommen, und wie abgestumpft durfte man höchstens werden, um sich noch ein wenig Menschlichkeit zu bewahren?
Warum stach jemand einem anderen ein Auge aus, statt ihn einfach nur niederzuschlagen?
Warum transportierte man einen abgetrennten menschlichen Unterschenkel auf dem Fahrradgepäckträger durch die Stadt?
Jens winkte einen der uniformierten Kollegen zu sich heran. Er bat ihn darum, sich bei den Anwohnern der Straße umzuhören, ob jemand etwas gesehen hatte. Außerdem sollten er und seine Kollegen herausfinden, ob es in dieser Siedlung andere auffällige Aktivitäten gegeben hatte. Einen Einbruchsversuch zum Beispiel oder verdächtige Personen, die sich hier herumgetrieben hatten.
Jens ging den Weg zurück, den Lennart Wolff von seinem Haus aus gekommen sein musste. Eben, als er die Ehefrau geholt hatte, war er mit ihr beschäftigt gewesen und hatte keine Zeit gehabt, sich genauer umzuschauen. Das holte er jetzt nach. Er sah sich nach den Häusern rechts und links der Straße um. Alles neue, teuer aussehende Einfamilienhäuser auf kleinen Grundstücken, auf den ersten Blick ein gefundenes Fressen für professionelle Einbrecherbanden. Die Häuser standen zwar dicht beieinander, aber man hatte sich abgeschirmt gegen allzu neugierige Blicke der Nachbarn. Zäune, Mauern, Büsche, Bäume, Bambushecken. Viele Möglichkeiten, sich zu verstecken.
In einigen Häusern brannte Licht. Jens sah Gesichter hinter Scheiben, besonders neugierige Anwohner standen im Garten und schauten zu den Blaulichtern hinüber.
Eine Joggerin trat von links aus einem Grundstück und kam Jens entgegen.
Sie trug enge Shorts, dazu ein Träger-Oberteil in Pink und Laufschuhe in der passenden Farbe. Am nackten linken Oberarm war an einem Gurt ein Handy befestigt, in ihren Ohren steckten Ohrhörer. Von ihrer Stirn strahlten ihm die blendend hellen Leuchtdioden einer Stirnlampe entgegen.
Als sie Jens erreichte, stoppte die junge Frau und zog die Stöpsel aus ihren Ohren.
«Was ist da denn passiert?», fragte sie.
Jens nutzte die Gelegenheit, zeigte seine Dienstmarke und fragte, ob sie etwas Ungewöhnliches bemerkt habe.
Ohne den Blick von den Blaulichtern zu nehmen, die ein Stück die Straße hinunter den nachtschwarzen Himmel erleuchteten, schüttelte sie den Kopf.
«Nein, nichts … aber was ist denn passiert?»
«Ein verhinderter Einbruch mit einem Verletzten. Wollen Sie jetzt wirklich noch laufen gehen?»
Die Frau nickte. «Ich weiß, es ist eigentlich schon zu spät, aber ich musste das Gewitter abwarten, und ohne meine tägliche Laufeinheit schlafe ich nicht gut.»
Jens betrachtete die Frau genauer. Sie war dünn und drahtig, in ihrem ebenmäßigen Gesicht traten Wangenknochen und Kinn deutlich hervor. Sie schien sich jedes Gramm Fett wegtrainiert zu haben. Ihre Beine schienen nur aus Muskeln und Bändern zu bestehen, glatt, braun gebrannt und mit Waden, die wie Reliefs aus der Haut hervortraten und sich sicher niemals verkrampfen würden.
Schmerzhaft erinnerte Jens sich an seine Wade, die sich noch immer wie ein Brett anfühlte.
«Ich würde es begrüßen, wenn Sie wieder ins Haus gingen und das Laufen für heute sein ließen», bemerkte Jens.
Die Frau sah ihn an.
«Warum?»
«Weil der oder die Einbrecher wahrscheinlich noch in dieser Gegend unterwegs sind.»
«Ach, und die schwenken jetzt schnell um auf Vergewaltigung, oder wie?» Das klang jetzt ein wenig bissig. Jens wusste nicht, was er falsch gemacht hatte.
«Das vielleicht nicht, aber …»
«Oder haben Sie sich noch nicht daran gewöhnt, dass die Corona-Ausgangssperren Geschichte sind?», fuhr die Frau fort, schenkte Jens ein Lächeln, das ein wenig überheblich wirkte, steckte sich die Stöpsel in die Ohren und lief davon.
Jens sah ihr nach. Sah den blonden Pferdeschwanz dynamisch von einer Seite zur anderen schwingen und die Beine arbeiten wie die Kolben einer Maschine.
Mit ein wenig Neid im Herzen wandte Jens sich ab.
6
Mein Atem rast. Mein Herz dehnt sich in hoher Geschwindigkeit aus, zieht sich wieder zusammen, dehnt sich noch machtvoller aus, als wollte es explodieren. Ich spüre mein Blut durch den Körper schießen und Adrenalin in großen Mengen bis in die letzten Nervenzellen transportieren, genieße dieses hellwache, aufputschende Gefühl. Beinahe ist es, als würde ich schweben. Nur ein bisschen mehr Nervenkitzel noch, und ich könnte fliegen. Eines Tages wird es so weit sein, ich stehe ja erst am Anfang meiner Geschichte, am Anfang meiner Kunst, die ich zwar nicht erfunden habe, aber in neue Sphären führen und der ganzen Welt zeigen werde. Kunst, wie sie größer und realistischer nicht sein kann. Kunst, die zugleich ihren stärksten Ausdruck in der digitalen Welt findet.
Niemand vor mir ist je auf diese Idee gekommen.
Heutzutage in irgendwas führend zu sein, ist schon eine Kunst an sich. Schon immer habe ich das gewollt. Dass es anders gekommen ist, ist nicht meine Schuld.
Immer wieder wirft mir jemand Hindernisse in den Weg.
So wie dieser neugierige Nachbar.
Ihm das Auge auszustechen, war nicht vorgesehen und hat Zeit gekostet. Dass ich meinem Opfer nun trotzdem noch auflauern kann, habe ich einzig und allein meiner akribischen Vorarbeit zu verdanken. Ich weiß ganz genau, welche Wege sie einschlägt, und auch wenn sie sie hin und wieder wechselt, sind es doch nur vier verschiedene Routen. Nur eine davon ist kurz, eine Strecke, die sie meist spätabends läuft, wenn die Zeit knapp ist.
Ich steige die Treppenstufen empor, die von den Landungsbrücken zum Hotel Hafen Hamburg hinaufführen. Um diese Zeit ist hier nicht mehr viel los, und auch wenn im Hotelrestaurant noch Betrieb ist, ist diese Stelle auf halber Höhe der Treppe bestens geeignet. Sie könnte ebenso gut in einem Park oder Wald liegen.
Ein Abschnitt Einsamkeit mitten in der Stadt, der als solcher nicht wahrgenommen wird.
Ich drücke mich an der metallenen Absperrung vorbei und verschwinde nach zwei Schritten im dicht belaubten Dickicht des Hanges. Nach dem starken Regen muss ich aufpassen, auf dem nassen Gras nicht abzurutschen. Meine speziellen Schuhe haben nicht die richtigen Sohlen für diesen Untergrund, darüber sollte ich mir beim nächsten Mal vorher Gedanken machen. Schräg gegen den steilen Hang gelehnt und mit einer Hand an einem Baumstamm abgestützt, geht es aber.
Mitten in Hamburg, an einem der touristischen Hotspots, bin ich plötzlich unsichtbar.
Wenn man sie später hier findet, wird das Entsetzen riesig sein und der Aufschrei lange nachhallen. Lange genug, um dann vom nächsten Aufschrei abgelöst zu werden. Und vom nächsten und nächsten und nächsten …
Aus der Dunkelheit heraus kann ich den Fuß der Treppe sehr gut einsehen. Ich weiß, dass sie von unten kommen wird, denn sie kommt immer von dort.
Geduld, nur Geduld. Mein Atem beruhigt sich, mein Herz schlägt wieder normal, das Adrenalin zieht sich aus den Blutbahnen zurück. Ich werde ruhiger und ruhiger.
Vor meinem geistigen Auge sehe ich Greifvögel am Himmel, erstarrt, so als legte die Zeit eine Pause ein.
Nach wenigen Minuten höre ich Stimmen.
Ein Pärchen kommt von oben die Treppen hinunter. Noch kann ich es nicht sehen, nur hören. Der Mann spricht laut und selbstbewusst.
«… ist mir vollkommen egal, was er davon hält. Wenn er den Preis nicht bezahlen will, ziehen wir eben weiter.»
«Ich dachte, er wäre dein Freund.»
«Beim Geld hört die Freundschaft auf.»
Jetzt erreicht das Pärchen meine Höhe. Beide sind schick gekleidet, er trägt einen dunklen Anzug mit weißem Hemd, sie ein Kleid, dazu hochhackige Schuhe, auf denen sie so schlecht laufen kann, dass sie sich an ihrem Begleiter festhalten muss.
In kaum zwei Metern Entfernung gehen sie an mir vorbei und steigen die Treppe zu den Landungsbrücken hinunter. Ich kann ihr Parfum und seinen Schweiß riechen. Bald verhallen ihre Stimmen, und es wird wieder still – bis unten auf der Straße ein Rettungswagen mit Blaulicht und Einsatzhorn entlangrast.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: