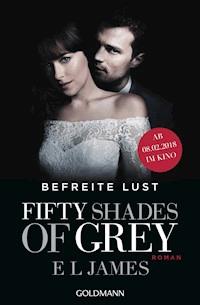Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: blue panther books
- Kategorie: Erotik
- Serie: Erotik Romane
- Sprache: Deutsch
Dieses E-Book entspricht 200 Taschenbuchseiten ... Eine Hure aus Passion, ein smarter Agent und ein tödlicher Auftrag ... Sie verführt ihre Opfer mit Sex, Schönheit und Raffinesse. Tauchen Sie ein in eine Welt voller Intrigen, Adrenalin, Erotik, Liebe und unerwarteter Wendungen. Diese Ausgabe ist vollständig, unzensiert und enthält keine gekürzten erotischen Szenen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 260
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum:
Die KillerHure | Erotik-Thriller
von Henry Nolan
Henry Nolan liebt die Frauen und hat einen Hang zum Agenten-Genre. Seine regelmäßigen Besuche in den Bordellen seiner Heimatstadt Köln ließen in ihm eines Tages den Drang immer stärker werden, diese beiden Leidenschaften in einer Romanhandlung miteinander zu verschmelzen. Fortan nutzte er die anregenden und befriedigenden Besuche bei den Damen als Inspiration. Jeder Höhepunkt bereitete ihm nun einen zusätzlichen Kick, da er sich vorstellte, wie Carmen oder Tiffany ihm nach dem Akt das Leben nehmen. Er ging in dieser Rolle vollständig auf, wodurch er das Gefühl hatte, noch besseren Sex zu erleben. Heute sieht er die käuflichen Damen mit anderen Augen und genießt die gemeinsamen Stunden mit ihnen umso mehr. Ab und an kommen seine thrillerhaften Gedanken noch zum Vorschein, jedoch kann er sich auch ohne sie jedem Blowjob und jedem Stoß hingeben.
Lektorat: Nicola Heubach
Originalausgabe
© 2023 by blue panther books, Hamburg
All rights reserved
Cover: © lekcej @ 123RF.com
Umschlaggestaltung: MT Design
ISBN 9783756121939
www.blue-panther-books.de
Kapitel 1 - Dienstag, 05.08.08, 15:45 Uhr
Ein billiges Hotelzimmer in der Nähe des Hauptbahnhofes von Amsterdam. Ich sitze auf dem Bett. Nackt. Durch die herabgelassenen Jalousien dringen das Licht und der Lärm dieses Nachmittags nur gedämpft herein. Das entfernte, dumpfe Dröhnen der Straßenbahnen lässt in regelmäßigen Abständen die bunten Glasschirmchen der beiden Nachttischlampen klirren.
Zwischen meinen bleichen Knien liegt ein großes Foto, über das ich mich beuge. Links und rechts wird es eingerahmt von meinen herabhängenden Haarsträhnen, die von der Dusche noch feucht und dunkel sind, glatte Fransen in der Farbe von Ebenholz. Der Vorhang hilft, alles außer dem Gesicht auf dem Foto auszublenden.
Georg van Brueggen. 40 Jahre alt. Deutsch-Niederländer. Zweifacher Vater. Inhaber einer Softwarefirma, die auf Sicherheitstechnik spezialisiert ist und unter anderem den deutschen Bundesgrenzschutz, den Bundesnachrichtendienst und das Innenministerium berät, ebenso wie die entsprechenden Behörden eines halben Dutzend weiterer EU-Staaten. Das steht auf der Website des Unternehmens. Auf der Homepage nicht genannt sind Regierungen, Geheimdienste und andere, dunklere Organisationen aus verschiedenen Drittweltländern. Laut »Financial Times online« verwenden auch diese mit Vorliebe GVBU-Software. Ich nehme an, dass aus diesen Reihen auch der Auftrag kommt, der mich jetzt über seinem Foto meditieren lässt.
Mein Name ist Jana Walker. Das ist natürlich nicht mein richtiger Name. Der geht keinen etwas an. Aber als Jana Walker bin ich an der University of London für Wirtschaftspolitik, Geschichte und Journalistik immatrikuliert. Ebenso wie ich als Austauschstudentin und Gasthörerin an der »Universiteit van Amsterdam« und der »Universidad de Sevilla« eingeschrieben bin.
Die Professoren, und speziell die International Officers im akademischen Mittelbau, lieben mich, den Prototyp der neuen weltoffenen, global ausgerichteten Studentin, die sich ihr eigenes, höchst persönliches Studienprogramm zimmert – und nebenbei noch so lecker aussieht! Die Mitarbeiter in den Studentensekretariaten und den Prüfungsämtern verfluchen mich: Ich falle aus dem Rahmen und verursache laufend neue Präzedenzfälle und andere bürokratische Katastrophen. Aber was Prüfungsordnungen und Hochschulregularien betrifft, kann ich es inzwischen spielend mit Fachanwälten für öffentliches Recht aufnehmen. Ich bin sehr geübt darin, mir meine Nischen selbst zu schaffen.
In den Vorlesungen bin ich sehr selten zu finden. Aber dieser Studentenstatus ist eine einwandfreie Tarnung. Man kann überall hinreisen, recherchieren, forschen und schnüffeln, und immer alles mit Studienarbeiten oder Prüfungsvorbereitungen oder der Suche nach weiteren Austauschmöglichkeiten mit irgendeiner Hochschule begründen. Außerdem wundert es keinen, wenn man irgendwo auf der Welt auftaucht und eine Weile bleibt. Studenten haben schließlich Zeit genug, oder?
Georg van Brueggen starrt mich aus leicht zusammengekniffenen Augen an. Er sieht gut aus, keine Frage. Scharf geschnittene Gesichtszüge. Gerade Nase. Ein kantiges Kinn – damit könnte er in jedem Western mitspielen. Kurze, dunkelblonde Haare, Van-Dyke-Bärtchen und natürlich diese forschenden, leicht stechenden dunklen Augen. Sicher kein Mensch, der sich als »Opfer« sieht, sondern als »Täter«. Als Gestalter seiner Welt, als Schaffender, als Kreativer. Diese Selfmade-Unternehmertypen sind alle so. Wenn sie dann auf einen Täter treffen, der sie zum Opfer macht, verstehen sie die Welt nicht mehr. Aber das ist ein sehr vorübergehender Zustand. Gleich darauf brauchen sie auch nichts mehr zu verstehen.
Methodisch lasse ich mir alle Informationen durch den Kopf gehen, die ich in den letzten zwei Wochen über meinen neuen Klienten gesammelt habe. Sein Wohnort: eine Villa in der nobelsten Ecke von Utrecht. Sicherheitstechnisch hochgerüstet bis zum Gehtnichtmehr. Seine Familie: die hübsche Frau und die zwei halbwüchsigen Jungs. Seine Firma: in Hafennähe, umschlossen von vier Meter hohem Stacheldraht. Hm …
Meine Order besagt, dass es aussehen sollte wie ein Unfall oder ein tragisches Geschehen, jedenfalls nicht wie ein Auftragsmord. Ich vermute, dass ein anderer, willfähriger Kopf an die Spitze der Company gehievt werden soll. Oder sonst ein verwinkeltes Manöver eines Dienstes. Aber das interessiert mich eigentlich nicht. Die Frage ist vielmehr: Wie lockt man jemanden aus seiner Deckung, aus seiner Höhle, wenn er dort alles hat, was er will und braucht?
Einerseits macht so eine Situation die Dinge kompliziert. Kein einfacher Schuss aus bequemer Entfernung, bei dem man den roten Nebel nur kurz durch das Zielfernrohr sieht. Kein schneller, simpler Hinterhalt in einer dunklen Seitenstraße, ein geleertes Magazin und Schalldämpfer. Kein harmloses Pülverchen in einem Weinglas.
Andererseits ist so eine Herausforderung viel interessanter. Jeder Depp kann andere Menschen töten, das beweisen die jährlichen Amokläufer in den Schulen. Die sind sogar noch jünger als ich mit meinen vierundzwanzig Jahren. Aber das Ganze entweder unter verschärften Bedingungen durchführen – beispielsweise mit einem bewachten Ziel, oder so, dass es nach etwas völlig anderem aussieht – das ist den Spezialisten vorbehalten. Also mir und meinen Kollegen. Nur dafür werden dann auch vernünftige Gagen bezahlt. Die Preise für simple Morde sind dagegen seit Jahren so in den Keller gegangen, dass es sich angesichts des Risikos eigentlich nicht mehr lohnt. Das machen dann verzweifelte Amateure aus Osteuropa.
Mit einer fließenden Bewegung gleite ich vom Bett und absolviere einige Lockerungsübungen. Meine Brüste hüpfen etwas mehr als sonst. Sie sind noch ein wenig gewachsen in den letzten ein, zwei Jahren. Außerdem erwarte ich für morgen meine Periode, dann füllen sie die B-Körbchen meines für heute bereitliegenden BHs halbwegs aus, sonst tut es meist ein A. Ich empfinde das als Vorteil, denn ich komme durchaus in Situationen, in denen hüpfende Brüste hinderlich sein können. Und kleine Brüste scheinen kein Thema zu sein, wenn es um Männer geht. Jedenfalls war es noch nie ein Problem für mich, das Interesse von Vertretern des anderen Geschlechts auf mich zu ziehen. Abgesehen davon, würden große Möpse gar nicht zu meiner schlanken, sportlichen Figur passen.
Beim systematischen Durchgehen einiger Katas denke ich weiter über mein Vorgehen nach. Ich werde sehr nahe an meinen Klienten herangehen müssen. Das macht einen Auftrag immer gefährlich, denn man hinterlässt Spuren, ob man will oder nicht.
Nach Möglichkeit vermeide ich das. So wie bei meinem letzten Auftrag in Zürich. Da fuhr ich meinen Klienten – einen ziemlich alten Knacker – mit einem riesigen Geländewagen über den Haufen. Den hatte ich kurz zuvor einigen Jugendlichen abgenommen, die ihn aufgebrochen hatten und damit eine Spritztour unternehmen wollten. Natürlich fand die Polizei nur deren Fingerabdrücke im Auto. Fall geklärt, Fall abgeschlossen.
Es gibt aber auch noch andere Gründe für mich, Georg van Brueggen nahezukommen. Als Mann gefällt er mir ganz gut. Ich stehe halt auf diese maskulinen Typen. Wie meinen Stiefvater zum Beispiel.
Aber daran will ich jetzt nicht denken. Lieber an Georg.
Wie er sich wohl anfühlen wird.
An mir, auf mir.
In mir.
Wohlige Wärme läuft in meinem Bauch zusammen und stört die makellose Konzentration meiner Übungen.
Kapitel 2 - Freitag, 08.08.08, 12:30 Uhr
»Mr van Brueggen, dürfte ich Ihnen einige Fragen stellen?«
Georg dreht sich überrascht um, als er gerade den Hoteltresen im »Karel V« erreicht hat. An dem leichten Weiten seiner Pupillen erkenne ich, dass ihm gefällt, was er sieht. Für meine Rolle habe ich mich auch sehr in Schale geworfen und trage ein anthrazitgraues Business-Kostüm in Konfektionsgröße vierunddreißig und eine eisblaue Bluse, die gut zu meiner Haut passt. Ich bin ein Winter-Typ, das erleichtert die Auswahl von formalen Klamotten ungemein. Meine Schuhe sind etwas zu sportlich, damit signalisiere ich, dass ich kein geschliffenes Business-Weib bin, sondern mich extra für ihn so herausgeputzt habe. Die mangelnde Übung ist auch an meiner etwas ungeschickt aufgetragenen Schminke zu erkennen. Schließlich mein Alter. Vor einem jungen Mädchen hat niemand große Angst.
»Ja bitte?«, fragt er distanziert, aber nicht unfreundlich. In seinem klaren Englisch schwingt deutlich der niederländische Akzent mit. Er beobachtet mich, schätzt mich ein, prüfend, sondierend. Hinter seinen Augen scheint ein Feuer zu brennen, das er sorgfältig verschlossen hält. Ein leichter Kitzel rieselt durch meinen Hals. Er sieht wirklich gut aus!
»Bitte entschuldigen Sie, dass ich Ihnen hier so auflauere, Mr van Brueggen, aber Ihr Sekretariat wollte mich nicht durchstellen, deshalb bin ich Ihnen heute Morgen hierher gefolgt.«
Hier zieht er die Brauen hoch und mustert mich misstrauisch. Ich bemühe mich, nervös und etwas zerknirscht zu wirken. Von Berufs wegen spricht er niemals mit Reportern oder anderen naseweisen Menschen und ist entsprechend vorsichtig.
»Mein Name ist Jana Talker, ich studiere Politikwissenschaft in Berlin und Amsterdam. Für eine Seminararbeit recherchiere ich gerade über die APLA, die ›All People Liberation Army‹ in Uganda. Ich weiß nicht, ob Sie mir hier helfen können, aber in einem Artikel in der ›Financial Times‹ wurde einmal Ihr Unternehmen genannt. Zwar nicht im direkten Zusammenhang mit der APLA, aber vielleicht können Sie mir ja trotzdem ein paar Hinweise geben. Oder mir sagen, an wen ich mich wenden kann.« Diesen Text stoße ich recht atemlos hervor, ganz die blutjunge Studentin, nervös beim Gespräch mit einem erfahrenen Geschäftsmann.
Dann warte ich gespannt. Wenn die APLA zu seinem Kundenkreis gehört, dann dreht er sich gleich mit einem knappen »Kein Kommentar« um und geht. Aber dieses Risiko ist gering. Die APLA hat meinen Nachforschungen gemäß nicht genug Geld, um sich teure Softwaresysteme leisten zu können.
»Das ist aber ein ungewöhnliches Thema«, meint Georg dann langsam und mustert mich immer noch. »Vielleicht sogar gefährlich. Die APLA ist ein bunter Haufen von ziemlich … hm … abenteuerlichen Leuten. Denen würde es sicher nicht gefallen, wenn zu viel über sie berichtet wird.«
»Ich weiß!«, antworte ich schnell. »Das soll auch keine Veröffentlichung geben. Aber mein Professor steht auf diesen Scheiß, und ich will eine Eins bei der Arbeit.«
Georg lacht. Ein gutes Zeichen. Ich lächle ihn zaghaft an und schlage mädchenhaft die Wimpern hoch.
»Also schön!« Er sieht kurz auf seine Armbanduhr (eine dieser sündteuren Schweizer Edelmarken) und nickt mir verbindlich zu. »Zwischen dem letzten Gespräch und dem nächsten habe ich zwei Stunden Zeit. Eigentlich wollte ich noch kurz in die Firma, aber im Moment steht nichts Dringendes an. Was halten Sie davon, wenn ich Sie zum Essen einlade?«
Ich reiße überwältigt die Augen auf.
»Im Ernst? Wow, das ist … Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll!« Dabei breite ich erfreut die Arme weit aus. Mein knapper Blazer klafft auseinander und gibt den Blick auf das tiefe Dekolleté meiner Bluse frei. Sein Blick rutscht hinein. In manchen Dingen sind Männer so berechenbar wie ein Lichtschalter.
Ich erlaube, dass er mich freundschaftlich am Ellenbogen nimmt und mich von der Lounge in das Restaurant des Fünfsternehotels führt. Das »Karel V« ist das erste Haus am Platz, was es zu seinem natürlichen Biotop macht. Fünf Minuten später hat Georg formvollendet in Französisch für uns beide bestellt und mir einen leichten Weißwein aufgedrängt.
»Also gut, die APLA«, nimmt er den Faden wieder auf. »Der Kopf ist ein gewisser Major James Umbriega. Eigentlich nur ein Leutnant, aber er behauptet, bei der Beförderung übergangen worden zu sein.« Georg grinst mir vertraulich zu. Ich grinse verständnisinnig zurück. Natürlich steht er weit über solch profanen Dingen, wie dem Streben nach einem oder zwei Sternen mehr auf einer Schulterklappe. Ich kritzelte eifrig auf meinen billigen Notizblock.
»Denken Sie, dass die APLA ein wichtiger Faktor im politischen Gefüge in Zentralafrika ist?«, spule ich die erste meiner studentischen Fragen ab und sehe erwartungsvoll zu ihm auf.
»Nein, eigentlich nicht. Umbriega hat zwar ein paar Hundert Leute um sich geschart, aber er hat keine ordentliche Geschäftsbasis«, doziert Georg, ganz geopolitischer Experte.
Ich lausche, kritzle, nicke.
»Er hat weder Rauschgift, das in seinem Gebiet angepflanzt wird, noch kann er Waffen an irgendjemanden schmuggeln, noch hat er politische Geldgeber im Hintergrund. Nein« – er nimmt einen Schluck Wein – »Umbriega hat lediglich das Vakuum in den Provinzen ausgenutzt, das der letzte Bürgerkrieg hinterlassen hat. Sobald wieder jemand fest im Sattel der Regierung sitzt, wird Umbriegas Truppe eine der ersten sein, die sich unterwirft. So lange kann er noch plündern und morden und von einer glorreichen Zukunft als Staatsmann träumen, aber dann wird er ziemlich schnell weg vom Fenster sein.«
»Aha, das ist sehr interessant! So etwas steht nicht in den Zeitungen, da wird mein Prof richtig begeistert sein!«, frohlocke ich und beuge mich noch tiefer über meinen Block. Meine Bluse kann so etwas nach vorn hängen und den Blick auf meine Brüste freigeben. Die Tatsache, dass ich noch zwei Sätze schreiben muss, gibt Georg genügend Zeit, sie gebührend zu bewundern. Seine Frau sieht auch sehr schlank aus, fast dünn. Ich vermute also, dass er auf meine Formen steht. Der Gedanke an die Verlockungen, die vor uns liegen, lässt meine Nippel schön hart werden. Auch das ist durch die dünne Bluse gut zu sehen.
Wir unterhalten uns angeregt über Afrika und über alles Mögliche andere. Die Rolle einer jungen, unerfahrenen, aber geistreichen Studentin liegt mir, die Zeit mit Georg macht richtig Spaß. Und ihm geht es ganz ähnlich, wie ich aus seinen Reaktionen entnehme.
»Jetzt ist es aber genug mit der Politik!«, bestimmt er schließlich, als das Essen kommt. »Erzählen Sie mir lieber von sich.«
»Ach, da gibt es nicht so viel zu erzählen«, wehre ich ab. »Ich komme aus der Nähe von London, meine Eltern waren Lehrer. Aber sie sind vor ein paar Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen.« Das mit London stimmt. Das mit dem Autounfall nicht. Kurz blitzt das verzerrte Gesicht meines Stiefvaters in meinem Kopf auf. Er greift sich an den Hals, wo das Blut in einem breiten Schwall aus einem tiefen Schlitz quillt. Den habe ich dort hineingeschnitten. Ich war vierzehn Jahre alt.
Georg nickt mitfühlend.
»Na, und dann bin ich bei entfernten Verwandten in Colchester aufgewachsen. Nach der Schule bin ich ein wenig herumgereist, und seit drei Jahren studiere ich jetzt in London.« Die paar Jahre auf dem Babystrich in London und die ganzen Toten lasse ich der Einfachheit halber weg, das interessiert Georg bestimmt nicht so.
»Und was wollen Sie nach dem Studium machen?«, fragt er nach.
»Tja, weiß ich noch nicht. Vielleicht in die Entwicklungshilfe gehen, eine NGO oder so. Oder zur UNO, aber dafür sind meine Fremdsprachenkenntnisse vielleicht nicht gut genug. Oder ich werde halt Lehrerin wie meine Mutter.«
Wir lachen über diesen schwachen Scherz, und glücklicherweise kann er nicht sehen, wie meine Gedanken kurz ungewollt abschweifen und ich das hagere, von Alkohol und Drogen völlig verwüstete Gesicht meiner Mutter vor Augen habe. Als das Feuer die schäbige Wohnung im sechsten Stock und die Leiche meines Stiefvaters verschlang, da ist sie in ihrem Bett vermutlich einfach explodiert, so viel Schnaps muss da schon durch ihre Adern geflossen sein. Ich schlucke schnell den rabenschwarzen Hass wieder hinunter, der mit der Gewalt einer Wasserstoffbombe in mir aufwallt. Hass auf meinen wirklichen Vater, der kurz nach meiner Geburt abgehauen ist und den ich nicht kenne. Hass auf meine lebensuntüchtige, weinerliche Mutter. Hass auf den Stiefvater, das elende Schwein, das jetzt hoffentlich in der Hölle brutzelt.
Georg erzählt dann auch ein wenig über sich selbst. Vornehmlich Heldengeschichten. Wie er sein Informatikstudium mit Programmierarbeiten finanzieren musste, wie er direkt danach seine Firma gegründet hatte und wie er erfolgreich war mit allem, was er anpackte. Mein Haus, mein Auto, meine Yacht!
Ich mache ein gebührend beeindrucktes Gesicht und die richtigen Geräusche an den richtigen Stellen. Abgesehen davon versuche ich, ihn nur als Körper zu sehen, nur als attraktiven Mann. Das wird es später einfacher machen.
Die zwei Stunden vergehen wie im Flug. Als er bedauernd auf die Uhr sieht und die Rechnung kommen lässt, und dabei meine schwachen Versuche, selbst zu bezahlen, mit einer lässigen Handbewegung wegwischt, da packe ich meine Notizen ein und erkläre ernsthaft: »Das war das beste Gespräch, das ich seit langer Zeit führen durfte. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Mr van Brueggen. Ähm – dürfte ich Sie nochmals ansprechen, wenn ich meine Arbeit geschrieben habe? Ein paar Detailinformationen vielleicht noch? Für den letzten Schliff, meine ich? In zwei oder drei Wochen etwa?«
Georg überlegt nur kurz.
»Nächste Woche bin ich in Warschau und in Kiew. Aber wissen Sie was, Miss Talker? Am Siebzehnten ist eine Tagung über Sicherheitspolitik in Brüssel, an der ich teilnehmen werde. Im ›Hotel Metropole‹. Was halten Sie davon, wenn wir uns an dem Abend nochmals treffen?«
»Oh – das wäre wundervoll! In dieser Woche bin ich ohnehin in Amsterdam, da würde ich ja sogar das Geld für einen Flug sparen!« Natürlich weiß ich, dass er bereits auf der Teilnehmerliste für diese Tagung verzeichnet ist und habe auf diesen Vorschlag halb gewartet.
»Na, sehr schön!« Er lächelt mich onkelhaft an. »Das können Sie bestimmt besser für etwas anderes ausgeben!«
Da hat er sogar recht. Ich kaufe mir für jeden Auftrag eine neue Waffe.
Kapitel 3 - Donnerstag, 14.08.08, 06:20 Uhr
In den letzten drei Tagen vor einem Abschluss spule ich immer das gleiche Programm ab. Das gibt mir Sicherheit. Auch wenn ich schon eine ganz gute Routine habe, so ist die Erledigung eines Auftrages doch auch für mich immer aufregend. Insbesondere, wenn ich das – wie im Fall von Georg – mit gewissen anderen Zielen verbinde.
Jetzt stehe ich in einem kleinen, schwankenden Boot mitten im See eines aufgelassenen Kieswerkes im östlichen Suffolk. Seen sind insofern praktisch, als dass alle Kugeln, Patronenhülsen und sonstige Spuren meiner Übungen sofort untergehen und verschwinden. Zudem ist es weit anspruchsvoller, auf dem Wasser etwas zu treffen, als auf dem festen Land.
Ich halte meine neue Pistole in beiden Händen. Eine Beretta M9 mit Schalldämpfer. Nicht unbedingt meine Lieblingswaffe, aber es gibt so viele davon auf der Welt, dass Nachforschungen nach der Herkunft fast immer im Sand verlaufen.
Eine Reihe von dumpfen »Plopps«, heftiger Rückstoß in meinen Armen. Der Nachen fängt wild zu schaukeln an, obwohl ich bereits gegen die Eigenfrequenz der Bewegung feuere. Trotzdem treffe ich fünf von den sechs Plastikflaschen, die – je mit einem Stein beschwert – etwa fünfzehn Meter vor mir treiben. Gut, aber noch nicht gut genug. Ich werfe eine neue Runde Plastikflaschen über Bord. Als ich diese abschieße, steht für einen Sekundenbruchteil das Bild von Jean zwischen mir und den Zielen.
Jean? Ich runzle die Stirn. Warum denke ich an ihn?
Ach, richtig!
Er war der Erste. Und bei ihm habe ich auch eine Beretta mit Schalldämpfer benutzt.
Nicht mein erster Klient. Und schon gar nicht der erste, den ich umbrachte, aber mit ihm hatte ich den ersten Orgasmus meines Lebens. Da war ich immerhin schon neunzehn.
Eigentlich ist es ein Wunder, dass ich überhaupt sexuell etwas empfinden kann. Wenn man mit zwölf von seinem volljährigen Halbbruder missbraucht wird und wenn der Stiefvater das entdeckt, daraufhin den Halbbruder hinauswirft und einen selbst missbraucht, dann entwickelt sich zwangsläufig einiges nicht ganz normal.
Die vielen Freier danach halfen auch nicht gerade. Dass ich mir in der Zeit nichts Schlimmeres als ein paar Streptokokken eingefangen habe, ist ein zweites Wunder.
Und als mein drittes persönliches Wunder betrachte ich es, dass dieser völlig zugedröhnte Russe in dem Luxushotel in London mir nicht wirklich die Brüste abschnitt, als er in dem Bett auf mir saß und mit dem riesigen Messer herumfuchtelte. Er erwischte mich nur am Arm, als ich ihn abwarf und schreiend zur Tür lief. Nur um festzustellen, dass sie abgeschlossen war. Als er schon brüllend auf mich zukam, da fiel mir gerade noch rechtzeitig auf, wie sein Jackett so einseitig auf der Stuhllehne hing. Und nur der soliden Schulung durch Fernsehkrimis ist es zu verdanken, dass ich von der Notwendigkeit wusste, eine Waffe zu entsichern, bevor man damit schießen kann. Ich glaube, nicht vielen siebzehnjährigen Nutten ist das klar. Von den acht Kugeln trafen damals nur zwei, aber das genügte.
Dass mich danach Antonia als Erste fand und nicht die Polizei, ist entweder Teil von Wunder Nummer drei oder bereits Nummer vier. Ich stand stundenlang wie paralysiert vor dem erkalteten Leichnam des Russen, und als sie durch die Tür kam, da drehte ich mich in einer wunderschön fließenden Bewegung um, brachte die Knarre makellos in Anschlag und drückte mehrmals ab.
Mehrmaliges Klicken.
Aber Antonia war so beeindruckt, dass sie den Russen – einer ihrer Auftragskiller, der ohnehin unzuverlässig geworden war – einfach durch mich ersetzte. Sie vertuschte meine Beteiligung und ließ mich untertauchen. Auch sorgte sie für diese spaßige Grundausbildung in irgend so einem namenlosen Kaff in Kasachstan. Drei Monate pausenlos Schießen, Sprengen, Verkleiden, Verhören, und danach durfte ich Männer abknallen und bekam sogar noch Geld dafür … Ich fühlte mich wie neu geboren.
Seitdem ist sie meine Agentin. Von ihr bekomme ich meine Aufträge, mein Honorar und was ich sonst noch so brauche. Ich weiß nicht einmal genau, wer sie eigentlich ist oder was sie macht, welche Funktion sie in welcher Organisation hat. Wenn sie ehrlich spielt, dann muss ich das nicht wissen. Wenn nicht, dann bin ich sowieso tot, also was soll’s?
Jean war mein vierter Auftrag von Antonia. Damals zählte ich noch mit, deshalb weiß ich das so genau. Bei ihm schlüpfte ich wieder in meine alte Rolle als Nutte, um in sein schwer bewachtes Hotelzimmer in Straßburg zu kommen. Er war ein hohes Tier bei der französischen Mafia, das las ich danach in der Zeitung. Ursprünglich wollte ich ihn mit dem Schalldämpfer erledigen, sobald wir im Zimmer waren und ich die vorher deponierte Waffe aus dem Versteck geholt hatte. Aber mit dem Wissen, dass ich ihn bald töten würde, da fand ich seine ersten Annäherungen unvermutet reizvoll. Also ließ ich zu, dass er mich fickte, und war selbst am meisten überrascht, dass ich mich ihm völlig hingeben konnte, bis hin zu einem grandiosen Höhepunkt.
Seitdem ist mir klar, dass ich Sex nur mit Männern genießen kann, die völlig in meiner Hand sind und die gleich darauf von dieser meiner Hand sterben werden. Alle anderen Situationen lassen mich absolut kalt, oder schlimmer: wecken böse Erinnerungen. Ich bin also in gewisser Weise von meinem Beruf abhängig.
Jaja, ziemlich krank, ich weiß. Aber ich habe nicht darum gebeten, so zu sein. Ich bin nur das Produkt meiner Umgebung, wie es in diesen aufgeblasenen Psycho-Selbsthilfe-Ratgebern immer steht. Also bin ich quasi unschuldig, oder?!?
Und, hey, ich finde meinen Beruf nicht so übel. Interessante Menschen, herausfordernde Aufgaben, gute Bezahlung. Was kann man mehr von seinem Job erwarten???
Kapitel 4 - Sonntag, 17.08.08, 20:45 Uhr
Vor dem »Hotel Metropole Brussels« ziehe ich mein Handy – ein noch unbenutztes Prepaid aus einer verlässlichen Quelle – und rufe John in London an.
»Hallo John, tut mir leid, dass ich so spät noch störe. Aber ich muss bis morgen meine Arbeit ausdrucken und der Treiber spinnt wieder! – Ah – Meinst du? – Okay, dann mach ich das mal … – Ja, scheint zu funktionieren! Jetzt druckt er. Super, ganz lieben Dank! Äh – bist du heute Abend da, falls er noch mal ausfällt? Darf ich dich dann anrufen? Danke, du bist ein Schatz! Ich wünsche dir noch einen schönen Abend, mach’s gut!«
John ist ein Kommilitone, so ein Computerfreak, und außerdem ein wichtiger Teil meines Alibis. Das Handy läuft über eine kleine Digitalschaltung, die ich ganz legal per Internet in einem Elektronikshop in Israel gekauft habe. Der Anruf an John geht so anscheinend von meiner Londoner Wohnung über mein Festnetz-Telefon nach draußen. Die Verbindungsaufstellungen auf der Telefonrechnung weisen zweifelsfrei meine Anwesenheit nach. Und die Protokolle über die Internet-Verbindungen mit regelmäßigen Tastendrücken, die gerade erstellt werden – ein kleines Programm, das ich selbst geschrieben habe – beweisen vollends, dass ich an diesem Abend in meiner Bude verschanzt an meiner Arbeit getippt habe. Titel: »Bildung und Zerfall von paramilitärischen Gruppen in Zentralafrika am Beispiel der APLA, Uganda. Ein lebenszyklustheoretischer Ansatz.« Inzwischen kenne ich mich so gut mit diesem akademischen Mist aus, dass ich vermutlich noch promovieren muss. Hm, das ist eine schöne Vorstellung: »Darf ich Ihnen meine Visitenkarte überreichen: Dr. Jana Walker. Profi-Killerin«. Dabei habe ich nicht mal das Abitur. Die Urkunde ist eine Fälschung, genau wie mein Pass.
Ich betrete die Hotellobby. Alles glänzt hier, Kronleuchter, teure Edelhölzer, Stuck, Messing und Gold in Hülle und Fülle. Das »Metropole« ist das einzige Luxushotel aus dem 19. Jahrhundert, das es im Brüsseler Zentrum immer noch gibt und die Einrichtung lässt nichts unversucht, einem dies ständig unter die Nase zu reiben.
Mein Weg führt möglichst weit weg von der Rezeption, hinein in die verwinkelten Gänge und Räume des Tagungsflügels. Trotzdem folgen mir etliche Augenpaare, als ich in meinem duftigen, weißen Kleid vorüberschwebe, eine elfenhafte Gestalt mit wehenden dunkelbraunen Haaren. Auch dies ist ein Teil der Tarnung.
Zwei Wochen zuvor hatte ich bereits ein anderes Telefonat geführt, ebenfalls auf Niederländisch. Oder Flämisch, wie die Belgier hier dazu sagen.
»Spreche ich mit Denise? Hier ist Anne Spreuw, Privatsekretariat von Mijnheer van Brueggen. Ich würde Sie gern im Auftrag meines Chefs buchen. Für Sonntag, den siebzehnten August, ab dreiundzwanzig Uhr im ›Metropole‹. Wäre das möglich, sind Sie noch frei? Ah, das ist schön! Mein Chef möchte, dass Sie in einem schlichten, weißen Kleid mit Spaghettiträgern kommen, mit weißer Handtasche. Falls Sie nichts Passendes haben, dann kaufen Sie es bitte und setzen es mit auf die Rechnung. Ach ja, und offene Haare bitte – da ist er eigen. Wie bitte? Ja, genau, Barzahlung am Abend. Ich rufe Sie dann an diesem Abend an und gebe Ihnen die Zimmernummer durch, ja? Sehr schön! Ich bedanke mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag! Op Wiederhoeren!«
Das Internet ist eine herrliche Sache, ich weiß nicht, wie die Leute früher ohne überleben konnten! Denise hatte ich problemlos im Netz über ihre Bilder bei einer Brüssler Escort-Agentur aufgetrieben. Sie hat etwa meine Größe und Figur, was ich bei einer persönlichen Inaugenscheinnahme in einem Café prüfte. Sie wunderte sich lediglich, warum der angekündigte Kunde nicht auftauchte und ging schließlich wieder nach Hause. Bei dieser Gelegenheit fand ich auch heraus, wo sie wohnt, dass sie mit einem Mann mit anderem Nachnamen zusammenlebte und dass er offenbar nichts von ihrem einträglichen Nebenberuf als Callgirl wusste. Alle Zutaten für ein perfektes Szenario also!
»Miss Talker! Wie schön, Sie wiederzusehen!«
Georg erwartet mich an der kleinen Bar im 3. Stock. Er trägt einen schicken, anthrazitfarbenen Anzug, eine grellorangefarbene Krawatte und irgendetwas Glitzerndes an den Manschetten. Dabei strahlt er mich an wie ein Immobilienmakler, der einer älteren Dame die Vorzüge eines Anwesens erklärt, und genießt sichtlich meinen feminin zurecht gemachten Anblick. Ich wiederum genieße seinen Blick, wie er über meinen Körper streicht, und spüre prickelnde Vorfreude durch die Schenkel ziehen.
»Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich nochmals Zeit für mich nehmen, Mr van Brueggen!«, bedanke ich mich artig. »Ich bin fast fertig mit der Arbeit, aber ein paar Punkte möchte ich Sie noch fragen.«
»Aber gern. Was möchten Sie trinken?« Er weist auf den Barhocker neben sich.
Nicht gut. Zu viele Leute ringsum.
»Oh, das ist nett, aber könnten wir vielleicht irgendwohin gehen, wo es ein wenig ruhiger ist als hier? Von dem Getippe am Computer habe ich schon den ganzen Tag Kopfweh, und ich möchte mich doch konzentrieren.«
»Ach wirklich. Nun, vielleicht ein Spaziergang … oder …«, er tut so, als falle ihm das ganz spontan ein und schafft es fast, mir dabei nicht in den offenherzigen Ausschnitt zu glotzen, »… wir können uns auf meinem Zimmer unterhalten, dort ist es ganz still.«
»Wäre das möglich? Oh, das ist super. Ich weiß gar nicht, wie ich mich bei Ihnen bedanken kann.«
Seine Augen leuchten auf, und ich kann förmlich das Textband dahinter lesen: »Da fällt mir schon was ein, Kleine!«
Gleich darauf sind wir in seinem Zimmer im fünften Stock, eine Suite mit großem Schlafzimmer, einer Teeküche und einem Eck mit Schreibtisch, alles geschmackvoll-traditionell-modern in Terrakotta und Beigeweiß eingerichtet. Er geleitet mich formvollendet zum Ecksofa und hat mir einen Champagner aufgetischt, noch bevor ich den Block, nun schon halb vollgekritzelt, aus meiner großen und verdächtig schweren Handtasche ziehen kann. Wie ich so in bemühter Unbehaglichkeit auf der Kante des Sofas kauere, da presst sich diese angenehm von unten gegen meinen Unterkörper und ich reibe die Schenkel ein wenig aneinander. Er bemerkt es aus den Augenwinkeln und verschüttet etwas von dem teuren Zeug.
»Also, Mr van Brueggen …«, beginne ich.
»Georg, bitte!«
»Wie bitte? Äh, also … das ist …« Ich räuspere mich. »Gut. Georg. Ich heiße Jana.«
»Schön, dass Sie heute Abend da sind, Jana!« Er hält mir seine Champagnerflöte hin, das Feuer in den Augen immer noch sorgsam verborgen. Die Gläser klingen elfenfein beim Anstoßen.
»Also, Georg«, versuche ich es erneut, »ich habe etwas über diesen Major, diesen James Umbriega nachgeforscht. Sie sagten ja, er hätte keine Verbindungen. Aber wussten Sie, dass er drei Jahre bei den Jesuiten gelebt hat und dass er einen unehelichen Sohn mit einer Philippinerin hat, der in Manila lebt?«
Georg setzt das Glas ab und sieht mich erstaunt an.
»Nein«, meint er langsam und mustert mich mit neuem Respekt. »Das wusste ich noch nicht.«
Kein Wunder. Es ist ja auch schlicht von mir erfunden.
Ich klatsche begeistert in die Hände. »Wow! Das ist krass! Ich dachte nicht, dass ich Sie damit wirklich überraschen könnte. Jedenfalls …«, hier beuge ich mich wieder enthusiastisch weit vor, »… das könnte doch der fehlende Link sein, oder? Die Jesuiten mischen auch an anderer Stelle in Afrika mit, und auf den Philippinen gibt es genug Rauschgift für alle Diktatoren der Welt, oder etwa nicht?«
Er lehnt sich nach einem intensiven Blick in meine Auslage zurück und denkt nach. Die Rädchen in seinem Kopf klicken fast hörbar, als er sich auf der Grundlage meiner Falschinformation, ein neues Bild der Situation einige tausend Kilometer südlich von uns, bastelt. Dann nickt er langsam und sieht mich bedeutungsvoll an.
»Jana, wenn das wirklich stimmt, dann haben Sie einen Volltreffer gelandet! Die Geheimdienste wissen so etwas vermutlich, aber die Öffentlichkeit bis jetzt noch nicht.« Er beugt sich vor und nimmt vertraulich meine Hände in die seinen. Kühle Haut in warmem Griff. Für einen irritierenden Augenblick lang fühlt es sich so an, als befänden sich meine Finger in einer körperwarmen Bärenfalle, kurz vor dem Zuschnappen. Ich schüttle diese Empfindung schnell ab und hole tief Luft, damit sich die Umrisse meiner Brüste schön gegen das eng anliegende Kleid drücken.
»Wenn Ihr Professor das von Ihnen liest und daraus vielleicht eine eigene Veröffentlichung oder einen Artikel macht, dann ist Ihnen die Eins garantiert, das verspreche ich Ihnen.«
»Ehrlich?«, hauche ich überwältigt.
»Ja, bestimmt! Für so etwas leben diese Theoretiker doch. Und falls er keine Lust hat, selbst etwas zu schreiben, dann kann er die Information vielleicht an die ›Financial Times‹ verkaufen oder so.«
Ich sinne kurz nach, dann grinse ich, mache mich aus seinem Griff los und hebe das Sektglas wieder.
»Das ist die beste Nachricht, die ich seit Langem gehört habe, Mr van … Georg! Ich habe mich so verrückt gemacht mit diesem Paper, ich bin seit Wochen gar nicht mehr richtig zum Leben gekommen! Mein Gott, da habe ich jetzt ja einen richtigen freien Abend!«
Das ist vielleicht eine Spur zu direkt aufgetragen, aber wir stehen schließlich etwas unter Zeitdruck. In knapp zwei Stunden wird Denise anklopfen.