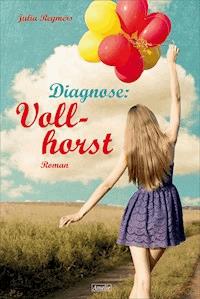Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Neuanfang mit Hürden: Der heitere Liebesroman »Die kleine Gärtnerei in der Heide« von Julia Reymers jetzt als eBook bei dotbooks. Nach einer Pechsträhne erscheint Sophie die unerwartete Erbschaft einer kleinen Heidegärtnerei wie ein Wink des Schicksals. Aber warum hat ihre Tante Hanne ausgerechnet ihr den Hof in Bienenbeek vermacht? Schließlich hat Hanne vor langem den Kontakt zu ihr abgebrochen. Je mehr Zeit Sophie in dem alten Bauernhaus und seinem verwunschenen Garten verbringt, desto mehr spürt sie die besondere Atmosphäre dieses Ortes – und lernt durch den umtriebigen Landfrauenverein und neue Freundinnen unter den Dorfbewohnern bald, was es heißt, ein Bienenbeeker zu sein. Sophie kommt die verwegene Idee, die alte Gärtnerei wiederzueröffnen … doch dann geht eins nach dem anderen schief. Steckt etwa ihr unverschämt gutaussehender Kindheitsfreund Sebastian dahinter, der versessen darauf scheint, Sophies Pläne zu durchkreuzen? Ein Wohlfühlroman über einen unvergesslichen Heidesommer, die große Liebe und eine Dorfgemeinschaft, die gemeinsam Berge versetzt. Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Die kleine Gärtnerei in der Heide« von Julia Reymers ist der zweite Band ihrer »Willkommen in Bienenbeek«-Reihe, in der jeder Wohlfühlroman unabhängig voneinander gelesen werden kann und die Fans von Jana Lukas und Manuela Inusa begeistern wird. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 416
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Nach einer Pechsträhne erscheint Sophie die unerwartete Erbschaft einer kleinen Heidegärtnerei wie ein Wink des Schicksals. Aber warum hat ihre Tante Hanne ausgerechnet ihr den Hof in Bienenbeek vermacht? Schließlich hat Hanne vor langem den Kontakt zu ihr abgebrochen. Je mehr Zeit Sophie in dem alten Bauernhaus und seinem verwunschenen Garten verbringt, desto mehr spürt sie die besondere Atmosphäre dieses Ortes – und lernt durch den umtriebigen Landfrauenverein und neue Freundinnen unter den Dorfbewohnern bald, was es heißt, ein Bienenbeeker zu sein. Sophie kommt die verwegene Idee, die alte Gärtnerei wiederzueröffnen … doch dann geht eins nach dem anderen schief. Steckt etwa ihr unverschämt gutaussehender Kindheitsfreund Sebastian dahinter, der versessen darauf scheint, Sophies Pläne zu durchkreuzen?
Über die Autorin:
Julia Reymers, geboren 1989 in Hamburg, studierte Germanistik und Geschichte in ihrer Heimatstadt. Sie ist als Lehrerin tätig und vor Kurzem mit ihrem Mann und ihrer Tochter in die Lüneburger Heide gezogen. Wenn sie dort nicht gerade auf der Suche nach Ideen für romantische Liebesgeschichten ist, dann verbringt sie jede freie Minute in ihrem bienenfreundlichen Garten.
Die Autorin im Internet:
www.julia-reymers.de
www.instagram.com/juliareymers/
www.facebook.com/juliareymers
In ihrer »Willkommen in Bienenbeek«-Reihe erschien bereits der Roman »Das kleine Haus in der Heide«. Weitere Bände sind in Planung.
***
Originalausgabe Februar 2024
Copyright © der Originalausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Redaktion: Monia Pscherer
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung zweier Fotos von © Friedrich Haag / Wikimedia Commons / »Handorf Bäckerstraße 10 002 2021 06 20« / »Handorf Bäckerstraße 10 004 2020 01 22« / CC BY-SA 4.0; creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode sowie mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-98690-923-9
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die kleine Gärtnerei in der Heide«an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Julia Reymers
Die kleine Gärtnerei in der Heide
Willkommen in Bienenbeek – Band 2
dotbooks.
»Aus den Träumen des Sommers wird im Herbst Marmelade gemacht.«
(englische Gartenweisheit)
Prolog
Juli 2002, Bienenbeek
»Die Luft ist rein!«, rief ich und griff nach Sebastians Hand. Kichernd rannten wir den Sandweg neben dem Gewächshaus hinunter, wobei sich der Verschluss meiner rechten Sandale löste.
»Moment!« Ich blieb stehen, zog mir den störenden Schuh vom Fuß und lief weiter. Die kleinen Steinchen im Sand kitzelten an meiner Fußsohle, doch das war mir egal. Nach wenigen Metern hatten wir unser Ziel erreicht: Das große Erdbeerbeet, das sich verlockend vor uns erstreckte. Wie kleine Räuber fielen wir über die Reihen her und pflückten die größten und saftigsten Früchte, die wir auf den ersten Blick entdecken konnten.
»Hey!«, ermahnte ich Sebastian, als ich aus dem Augenwinkel sah, wie er sich eine Erdbeere direkt in den Mund steckte. »Ich dachte, wir teilen unsere Beute unter dem Apfelbaum!«
»Nur die eine noch«, nuschelte er mit vollem Mund, grinste frech und biss in die nächste Frucht.
»Gleiches Recht für alle«, erwiderte ich und zupfte eine besonders große sattrote Erdbeere vom Stiel. Keine Sekunde später verbreitete sich der fruchtig süße Geschmack in meinem Mund, der mich immer ein wenig an Karamell erinnerte. So intensiv schmeckten wirklich nur die Erdbeeren von Tante Hanne. Kein Wunder, dass Sebastian und ich ganz verrückt danach waren.
»Sophie? Sebastian?«, tönte es plötzlich über den Hof. Erschrocken rissen wir unsere Köpfe hoch und sahen niemand anderen als Tante Hanne, die sich mit großen Schritten dem Erdbeerbeet näherte.
»Abmarsch«, raunte Sebastian mir zu und deutete in Richtung des Apfelbaums. So schnell es mit den prall gefüllten Händen ging, liefen wir los.
»Sophie! Sebastian!«, hörte ich es hinter uns laut rufen. »Wo wollt ihr hin?«
Lachend steuerten wir auf unseren Apfelbaum zu und ließen uns hinter dem knorrigen Stamm ins warme Gras plumpsen. Genau genommen war dies natürlich nicht unser Baum, sondern er gehörte wie die Erdbeeren Tante Hanne. Aber seit Sebastian und ich uns vor fünf Jahren unter den dichten Ästen feierlich ewige Freundschaft geschworen hatten, war dies unser Rückzugsort im großen Garten geworden. Daran hatte sich nichts geändert, obwohl wir nun schon zwölf Jahre alt waren.
»Sophie und Sebastian!« Während Hanne immer näher kam, stopften wir uns so viele Erdbeeren in den Mund, wie es auf einmal ging.
»Was ist hier los?« Wenige Augenblicke später stand Hanne vor uns, die Hände in die schmalen Hüften gestemmt. »Ihr habt doch nicht etwa wieder ...?«
»Niemals!«, nuschelte Sebastian, und wir beide schüttelten fast synchron die Köpfe. Auch ohne den verräterischen roten Saft, der dabei unsere Mundwinkel hinunterlief, hätten wir Hanne nichts vormachen können.
»Also Kinners, ich habe euch tausend Mal gesagt, dass ihr nicht einfach so an die Erdbeeren gehen sollt!« Hanne klopfte sich energisch die Hände an ihrem grünen Arbeitskittel ab. »Ihr wisst doch, dass ich die Erdbeeren für meinen Laden brauche. Außerdem wollt ihr bestimmt auch dieses Jahr ein Glas Marmelade von mir haben, oder?«
Schuldbewusst schluckte ich die letzte Erdbeere in meinem Mund hinunter. »Es tut uns leid, Tante Hanne«, sagte ich zerknirscht.
»Wir sind halt deine besten Kunden«, fügte Sebastian hinzu und grinste Hanne lausbubenhaft an.
»Kann man wohl so sagen.« Hanne schaute uns tadelnd an. Ihre Mundwinkel verrieten jedoch, dass sie ein Lachen unterdrücken musste. »Jedenfalls könnt ihr euch jetzt gleich mal nützlich machen.« Sie zog ihr zum Kittel passendes Kopftuch zurecht, unter dem sich mal wieder einige widerspenstige Strähnen den Weg ins Freie gebahnt hatten.
»Was sollen wir tun?« Eifrig sprang ich auf und wischte mir die klebrigen Hände an meinen Jeansshorts ab.
»Ich würde sagen, erstmal Schuhe anziehen.« Hanne zeigte verwundert auf meinen dreckigen rechten Fuß.
»Ach ja, meine Sandale.« Ich blickte mich suchend um. »Wahrscheinlich liegt sie noch im Erdbeerbeet.«
»Wenn ihr sie da rausgeholt habt, geht doch mal schauen, ob die Glockenheide schon blüht. Falls ja, bringt mir bitte eine Handvoll Zweige mit.« Ohne unsere Antwort abzuwarten, wandte sich Hanne zum Gehen. Als sie einige Schritte entfernt war, drehte sie sich noch einmal um. »Etwas Schleierkraut kann ich auch gebrauchen. Und nun los, bevor ihr wieder etwas ausheckt.« Sie zwinkerte uns zu und stapfte eilig davon.
»Worauf wartest du?«, fragte ich Sebastian, der seinen Kopf immer noch gemütlich an den Stamm gelehnt hatte.
»Was ist mit den Erdbeeren?« Er deutete auf die Reste unserer Ernte, die er geschickt vor Hanne im hohen Gras versteckt hatte.
»Na, die gönnen wir uns später!« Ich griff nach der Holzschachtel, die wir extra für solche Gelegenheiten auf der großen Astgabel platziert hatten. Gemeinsam klaubten wir unser Diebesgut vom Boden auf und ließen es mitsamt der Schachtel wieder im Baum verschwinden.
Dann liefen wir zielstrebig zum Heidebeet, das direkt vor dem großen Gewächshaus lag. Erst dort fiel mir auf, dass ich auf der einen Seite immer noch barfuß unterwegs war. Schulterzuckend entledigte ich mich auch der linken Sandale. Für Schuhe war später noch Zeit.
Atemlos öffneten wir die Ladentür, die mit einem hellen Klingeln unsere Ankunft verkündete.
»Ich bin hier«, tönte es gedämpft aus dem hinteren Teil des Geschäfts. Wir gingen an dem großen Verkaufstresen aus Holz vorbei in das Hinterzimmer – beziehungsweise in die »Werkstatt«, wie Hanne ihren Raum liebevoll nannte.
Ich atmete tief ein. Auch heute lag der süße Duft von frisch geschnittenen Blumen in der Luft.
Hanne stand in ihrer typischen Haltung an dem Arbeitstisch: Weit nach vorne gebeugt, die Stirn in Falten gelegt und den Blick konzentriert auf ihre Hände gerichtet. Vor dem massiven Tisch wirkte sie noch zierlicher, als sie eigentlich war.
»Reichen die?«, fragte ich und streckte Hanne die violett leuchtenden Heidezweige entgegen. Die Glockenheide war eine meiner Lieblingspflanzen, da sich ihre Blüten meist schon in meinen Sommerferien zeigten und wie kleine Glöckchen aussahen – daher der Name, hatte Hanne mir erklärt.
»Und das hier?« Sebastian hielt einen großen Bund Schleierkraut in seinen Händen.
Hanne blickte nur kurz auf. »Sieht gut aus. Legt beides auf den Tisch.«
Wir taten wie befohlen und traten ehrfürchtig einen Schritt zurück. Wer Hanne kannte, wusste, dass man sie bei der Arbeit besser nicht stören sollte.
Neugierig schaute ich zu, wie Hanne aus Blumendraht einen großen Ring formte.
»Machst du wieder Heidekränze?«, platzte es aus mir heraus, obwohl ich eigentlich leise sein wollte.
Hanne nickte nur. Schließlich nahm sie kleine Bündel Stroh und wickelte sie mit geübten Handgriffen um den Ring. Nach und nach verschwand der Draht unter den verschiedenen Schichten. Ich hatte Hanne schon oft bei der Arbeit zugesehen und wusste daher, dass sie Strohrömer herstellte. An denen würde sie später die Heide befestigen.
»Geht mir doch mal zur Hand«, meinte Hanne, ohne ihr Werk zu unterbrechen. »Ihr könnt die Heidezweige der Größe nach ordnen und zu kleinen Sträußchen zusammenbinden.«
»O ja!«, freute ich mich und lief auf die andere Seite des Tisches. Ich liebte es, Hanne zu helfen.
»Komm, Sebastian«, forderte ich meinen Freund auf. »Du legst die kleinen Zweige auf einen Haufen, ich nehme die großen.«
Schweigend sortierten wir die Heide und banden sie anschließend mit Blumendraht zu kleinen Sträußen zusammen.
»Sebastian, du kannst mit dem Schleierkraut weitermachen«, sagte Hanne schließlich. »Und dir, Sophie, zeige ich, wie man den Kranz bindet.«
Stolz stellte ich mich neben Hanne und beobachtete aufmerksam jeden ihrer Handgriffe.
»Du nimmst nun den feinen Schmuckdraht«, begann Hanne zu erklären. »Damit bindest du die kleinen Heidesträuße am Strohrömer fest. Achte darauf, dass du die Zweige immer in derselben Richtung befestigst, zum Beispiel im Uhrzeigersinn.«
»Und die größten Heidezweige kommen an die Außenseite des Strohrömers«, ergänzte ich.
»Gut beobachtet. Die kleineren bindest du an die Innenseite. Probiere es doch direkt einmal aus.«
Ich nahm einen Heidestrauß und legte ihn an die Innenseite des Strohrings. Vorsichtig wickelte ich den Draht einmal herum und zog ihn fest.
»Super!«, lobte mich Hanne. »Du bist ein Naturtalent!«
Ich lächelte zufrieden und blickte zu Sebastian, der so tat, als hätte er das Lob nicht gehört. Manchmal war er nämlich ein bisschen eifersüchtig, weil Hanne mir gerne die schwierigeren Aufgaben anvertraute.
Ich durfte noch ein paar Sträußchen festbinden, ehe Tante Hanne wieder übernahm.
»Bis morgen müssen über dreißig Kränze fertig werden«, meinte sie und seufzte.
»Für wen sind sie denn?«, fragte ich neugierig.
»Für die Landfrauen. Die feiern am Wochenende ihr großes Sommerfest und haben jede Menge Blumenschmuck bei mir bestellt.«
Von den Landfrauen hatte ich schon einige kennengelernt. Sie kamen öfters mal in Hannes Laden und waren immer sehr nett zu mir und Sebastian.
Staunend sah ich zu, wie Hanne den Heidekranz im Handumdrehen fertig steckte und geschickt einige Büschel Schleierkraut hineinarbeitete. Ich fand den Kranz wunderschön und hätte ihn gerne für mein Zimmer zuhause bei Mama und Papa mitgenommen.
Das Klingeln der Ladentür unterbrach plötzlich die Stille.
»Ich bin hier hinten«, rief Hanne und ließ sich nicht weiter in ihrer Arbeit stören.
»Ach, hier habt ihr euch versteckt!« Maria steckte den Kopf zur Tür herein. Sie trug ein geblümtes Kleid und eine Kochschürze. Ihre grauen Haare hatte sie sich zu einem Dutt hochgebunden. Seit ich denken konnte, wohnte Maria in der kleinen Mietwohnung auf Tante Hannes Hof. Sie war Sebastians Oma und wirklich sehr nett. Wir durften oft bei ihr zu Mittag essen. Sie machte wirklich das leckerste Essen, was ich kannte. Bei ihr schmeckte sogar das Gemüse.
»Gibt es Essen?«, fragte Sebastian auch sogleich.
»Hallo erstmal, mein Lieber! Na klar, ich weiß doch, wie hungrig ihr immer seid.« Sie zwinkerte uns zu. »Nun kommt mal raus hier und lasst Hanne in Ruhe weiterarbeiten. Die Kartoffeln und der Fisch sind in zehn Minuten fertig. Könnt ihr mir bitte noch etwas Petersilie pflücken und dann hochkommen?«
»Klaro!« Sebastian griff nach meiner Hand und zog mich mit nach draußen.
»Zum Gemüsebeet geht es aber da lang«, protestierte ich. Maria hatte von Hanne ein kleines Stück Garten gemietet, in dem sie Kräuter und Gemüse anbaute.
»Psst, komm einfach mit.« Sebastian verlangsamte seine Schritte und blickte sich noch einmal um. Was führte er jetzt wieder im Schilde?
Wir ließen das Erdbeerbeet und den Apfelbaum hinter uns und steuerten auf das alte Gartenhäuschen zu, in dem Hanne ihre Geräte aufbewahrte.
»Da sind Spinnen drin, da will ich nicht rein!«, meckerte ich.
»Nun warte doch mal ab.« Sebastian ließ das Häuschen links liegen und nahm den kleinen Trampelpfad daneben, der von dichten Büschen gesäumt war.
»Aua!«, meinte ich, als mich die Dornen eines Strauchs piksten.
»Schnell, wir haben nicht viel Zeit!« Sebastian winkte mich hektisch heran. Nach wenigen Metern wurde der Pfad breiter und ein weiteres Stück Garten kam zum Vorschein. Der Teil gehörte zwar noch zu Hannes Gärtnerei, aber bisher hatte sie ihn nie genutzt. Hier wuchsen seit Jahren nur Wildkräuter und ein paar Blumen.
»Was ist das denn?«, staunte ich. Jemand hatte den Boden umgegraben, geharkt und aus kleinen Feldsteinen eine viereckige Umrandung gebildet.
»Darf ich vorstellen?« Sebastian hob verheißungsvoll die Hände. »Unser eigenes Beet!«
»Hast du das alles gemacht?« Ich traute meinen Augen kaum.
»Ganz alleine.« Sebastian sah mich stolz an. »Ist das nicht super?«
Ich nickte und war ziemlich baff. »Hat Hanne davon nichts bemerkt?«
Er schüttelte den Kopf. »Ich habe das heimlich zwischendurch erledigt, wenn ihr mit euren Blumen beschäftigt wart. Hat ziemlich lange gedauert. Und ich habe mich sogar einmal richtig doll an einer Brennnessel verbrannt.« Unaufgefordert zeigte er mir die rote Stelle an seinem Unterschenkel.
»Oha.« Ich hätte mich wahrscheinlich nicht getraut, so eine waghalsige Aktion zu starten.
»Jetzt können wir unser eigenes Gemüse anbauen. Und natürlich Erdbeeren! Dann können wir so viel naschen, wie wir wollen und keiner hat uns mehr etwas zu sagen!« Sebastian hüpfte aufgeregt auf und ab.
»Das wäre natürlich cool! Aber wo soll das Gemüse herkommen? Und die Erdbeeren?« So ganz überzeugt war ich noch nicht.
»Tada!«, meinte Sebastian jedoch nur und zog ein kleines Tütchen aus seiner Hosentasche. »Ich habe von meinem Taschengeld Radieschensamen gekauft. Die können wir gleich aussäen!«
»Und die Erdbeeren?«
»Wir nehmen einfach Ableger von Tantes Hannes Pflanzen.«
»Ableger?«
»Ich dachte, das wüsste die Super-Gärtnerin? Das sind lange Zweige, die selbst Wurzeln bilden. Man muss sie nur abschneiden und einpflanzen.«
»Woher weißt du das alles?« Normalerweise konnte Sebastian mir nichts vormachen, wenn es um Pflanzen und Blumen ging.
»Ich habe zum zwölften Geburtstag ein Gartenbuch bekommen.« Er grinste. »Wir werden echte Profi-Gärtner!«
»Oh, ja!« Nun war auch ich Feuer und Flamme.
»Lass uns loslegen, ehe wir wieder gesucht werden.« Sebastian zog mit einem Stock zwei tiefe Furchen in die Erde. »Hier, mach deine Hand auf.« Er öffnete das Tütchen und ließ ein paar Samen in meine Hand rieseln. »Leg etwa alle fünf Zentimeter einen Samen in die Erde.«
Beflissen machten wir uns ans Werk. Es war gar nicht so leicht, die feinen Körnchen im richtigen Abstand zu platzieren.
»Jetzt ziehen wir die Rillen wieder zu.« Sebastian zauberte eine Harke aus dem Gebüsch hervor. »Habe ich mir geliehen«, meinte er und grinste.
»Müssen wir die Samen nicht noch gießen?«, fragte ich, als er fertig war.
»Das machen wir später.« Um die Saat zu markieren, legte er zwei Steine auf die Erde. »Komm, wir müssen los, Oma Maria wartet! Und es soll doch keiner von unserem Geheimnis erfahren, oder?«
»Auf keinen Fall!«, flüsterte ich verschwörerisch.
In meinem Bauch kribbelte es aufgeregt, als wir Hand in Hand den Trampelpfad zurückliefen.
Kapitel 1
Juni 2023, Bienenbeek
Mein alter Mini Cooper wurde ordentlich durchgeschüttelt, als ich in die kopfsteingepflasterte Auffahrt der Gärtnerei einbog. Ich parkte direkt vor dem Wohnhaus und stellte den Motor aus. Genau an dieser Stelle hat Hannes großer Transporter seinen Stammplatz gehabt, schoss es mir durch den Kopf.
Obwohl es eine Ewigkeit her war, hatte ich sofort wieder das Bild von damals vor Augen: Hanne, wie sie emsig in ihrem Kittel zwischen dem grün lackierten Wagen und der Ladentür hin und her lief, voll beladen mit Unmengen an Blumen in den leuchtendsten Farben.
Ich atmete tief durch. Dann stieg ich aus dem Auto aus und setzte das erste Mal wieder einen Fuß auf Bienenbeeker Erde.
Einundzwanzig Jahre waren wirklich eine verdammt lange Zeit.
Zögerlich schaute ich mich um, doch außer mir war keine Menschenseele zu sehen. Mein Herz klopfte, als ich mich auf den Laden zubewegte. An der Eingangstür verkündete ein in altmodischer Handschrift verfasster Zettel, dass der Laden geschlossen war. Ich drückte die Türklinke hinunter, doch natürlich war abgeschlossen.
Hoffentlich hat Hanne den Schlüssel in ihrer Wohnung deponiert, überlegte ich und versuchte, einen Blick ins Innere des Ladens zu erhaschen. Durch die staubigen Scheiben konnte ich jedoch nur ein paar leere Tische und den alten Verkaufstresen erkennen.
Das würde ich später genauer erkunden, nahm ich mir vor und ging weiter zum Gewächshaus, das links neben dem ehemaligen Blumenladen lag. Mit all meiner Kraft zog ich an der großen Schiebetür, doch auch sie war abgeschlossen. Ich seufzte und klopfte mir die dreckigen Hände an der Jeans ab. Die Fassade des Gewächshauses war mit grünlichen Ablagerungen bedeckt und am Dach entdeckte ich ein größeres Loch.
Neugierig bog ich in den Sandweg ein, der zwischen dem Gewächshaus und dem Laden verlief. Nach ein paar Metern verjüngte sich der Weg zu einem schmaleren Pfad mit vielen Seitenarmen, die den Zugang zu den nebeneinander angeordneten Beeten der Gärtnerei ermöglichten. Aufgeregt beschleunigte ich meine Schritte. Auf den ersten Blick sah hier alles aus wie früher.
Ich kniete mich vor ein Beet und versuchte, die kleine Holztafel zu entziffern, die schief in der Erde steckte. Hanne hatte immer sorgfältig notiert, was an welcher Stelle wuchs. Doch nun war die Beschriftung vollständig von der Sonne verblasst und Unkraut hatte den Großteil des Erdbodens erobert. Wie schade.
Vorsichtig bog ich einen großen Löwenzahn und einen Sauerampfer zur Seite. Als ich entdeckte, was sich dazwischen verbarg, juchzte ich jedoch vor Freude auf. Inmitten des Durcheinanders wuchs eine einsame, verkümmerte Glockenheide. Ihre Zweige waren kahl, doch an einigen Stellen hatten sich allen Widrigkeiten zum Trotz Blütenknospen gebildet. Kurzentschlossen griff ich zu und befreite das Pflänzchen vorsichtig von seinen aufdringlichen Nachbarn, so dass wieder Luft und Sonne zu ihm vordringen konnten. Den Löwenzahn und den Sauerampfer pflanzte ich an anderer Stelle wieder ein – Hanne hatte mir beigebracht, dass man beide Pflanzen vielseitig in der Küche nutzen konnte. Sie hatte aus Löwenzahnblüten sogar einmal einen besonderen Honig hergestellt.
Ehe ich mich versah, befand ich mich knietief im Beet, wühlte in der Erde herum und entdeckte noch eine Handvoll weiterer verbliebener Heidepflanzen. Ich gelangte in einen regelrechten Rausch und grub immer mehr Beikraut aus, bis meine Hände und Unterarme schwarz von der Erde waren.
Mit jeder befreiten Pflanze spürte ich, wie sich meine innerliche Anspannung ein Stück weit löste. Als ich vorerst genug hatte, ließ ich mich auf dem sandigen Weg nieder, atmete tief durch und strich mir mit dem Blusenärmel den Schweiß von der Stirn. Meine Kleidung sah ziemlich ramponiert aus, aber wen kümmerte es.
Während mein Blick durch die restlichen Beete wanderte und ich mich fragte, wie lange die Gärtnerei schon verlassen dalag, stutzte ich plötzlich. Das war doch nicht etwa ...? Von neuer Energie gepackt, hastete ich zum Ende der Reihen. Und tatsächlich, ich hatte mich nicht geirrt: Vor mir lag das Erdbeerbeet! Ich ging in die Hocke und strich über das seidig behaarte Blatt einer Erdbeerpflanze. Sie trug zahlreiche weiße Blüten, von denen einige bereits zarte, blassgrüne Früchte ausbildeten. Unter den Pflanzen war fein säuberlich Stroh ausgebreitet – das hatte Hanne immer gemacht, damit die Erdbeeren nicht direkt auf der Erde auflagen. Und zu meinem größten Erstaunen war das komplette Beet frei von Unkraut. Ich drückte einen Finger in die Erde. Sie war feucht, als ob hier vor kurzem noch jemand mit der Gießkanne durchgegangen war. Merkwürdig, wunderte ich mich und richtete mich wieder auf. Wer konnte das gewesen sein?
Der Anblick der Erdbeeren versetzte mir einen Stich ins Herz. Ohne Vorwarnung traten mir die Tränen in die Augen und kullerten meine Wangen hinab. Ich schniefte und wischte mir mit dem Ärmel über das Gesicht.
Bevor ich von meinen Gefühlen überwältigt werden konnte, wandte ich mich ab und ging auf den Apfelbaum zu. Er hatte einiges an Größe zugelegt. Andächtig strich ich über die ausladenden Äste, die fast den Boden berührten. Ohne weiter nachzudenken, ließ ich mich unter dem Baum nieder und lehnte meinen Rücken an den knorrigen Stamm. Die dichten Zweige senkten sich wie ein Vorhang vor mir herab.
»Hallo?«
Ich schreckte zusammen. War ich einen Moment weggedöst und hatte geträumt? Die lange Fahrt und die Anstrengung der letzten Tage hätten es auf jeden Fall erklärt.
»Entschuldigung?«, ertönte erneut die tiefe Stimme.
Ich rappelte mich auf und kroch unter den Zweigen des Apfelbaums hervor. Irritiert blinzelte ich ins helle Sonnenlicht. Der Mann, zu dem die markante Stimme gehörte, sah mich an, als sei ich ein Gespenst. Als sich unsere Blicke trafen, verwandelte sich sein Gesichtsausdruck jedoch in ungläubiges Erstaunen.
»Sophie?«
»Sebastian?!«
Ich traute meinen Augen kaum. Vor mir stand wirklich Sebastian, mein Freund aus Kindertagen. Wir blieben einen Moment unsicher voreinander stehen, ehe er mich kurz, aber fest in die Arme schloss.
»Das ist wirklich eine Überraschung«, murmelte er und betrachtete mich neugierig.
»Allerdings«, meinte ich, von einer plötzlichen Schüchternheit ergriffen. Ich stellte fest, dass Sebastians Haare zwar nicht mehr so hellblond wie früher waren, aber genauso verwuschelt. Und um seine Augen herum zeichnete sich immer noch derselbe lausbubenhafte Ausdruck ab.
»Hast du den Garten umgegraben?«, fragte Sebastian amüsiert.
»Wieso?«
»Du hast da etwas Erde im Gesicht.«
»Oh.« Hektisch wischte ich an meinen Wangen herum. »Besser?«
»Hm, ja, ein wenig.« Er grinste schelmisch.
Auch heute würde er noch als Michel von Lönneberga durchgehen. Mal davon abgesehen, dass er jetzt einen Drei-Tage-Bart trug und bestimmt zwei Meter groß war.
»Sag mal, hast du dich um das Erdbeerbeet gekümmert?«, fragte ich ihn unvermittelt.
Sebastian schaute mich verwirrt an. »Welches Erdbeerbeet?«
Ich schilderte ihm kurz, was ich gesehen hatte.
»Nein, da muss ich dich leider enttäuschen. Ich bin heute das erste Mal seit langem wieder hier.«
»Merkwürdig.« Ich blickte nachdenklich in Richtung der Beete. »Aber wenn es nicht die Erdbeeren waren – was hat dich dann hierhergeführt?«
»Vermutlich dasselbe wie dich.« Er zog ein gefaltetes Blatt Papier aus der Brusttasche seines rotkarierten Hemds. Durch die hochgekrempelten Ärmel kamen seine muskulösen, braungebrannten Unterarme zur Geltung. »Hanne hat mir die Wohnung von Oma Maria vermacht.« Er hielt mir das Schreiben unter die Nase.
»Oh.« Ich musste gar nicht näher hinsehen, denn dieser Brief kam mir sehr bekannt vor. Ein ähnliches Exemplar lag auf dem Beifahrersitz im Mini.
»Hat Hanne dir die andere Wohnung vererbt?«, fragte Sebastian.
»Woher weißt du das?«, hakte ich misstrauisch nach. Bisher hatte ich – außer mit meiner besten Freundin Lotte – noch mit niemandem über das Erbe gesprochen. Nicht einmal meine Mutter wusste davon. Dazu waren die Dinge zu kompliziert und die gesamte Situation noch zu unwirklich für mich.
»Es ist naheliegend. Wem sonst hätte sie etwas vererben sollen? Sie hat keine Kinder. Und Oma Maria, ihre beste und einzige Freundin, ist seit fünf Jahren tot.«
»Das tut mir leid.« Ich hatte nicht mitbekommen, dass Maria gestorben war. Aber wie hätte ich es auch erfahren sollen, wenn ich seit einundzwanzig Jahren weder Kontakt zu ihr, Sebastian noch zu Hanne gehabt hatte?
»Ich habe die Gärtnerei geerbt«, rückte ich nach einem unangenehmen Moment der Stille mit der eigentlichen Neuigkeit heraus, da Sebastian mich so fordernd ansah.
»Aha.« Er strich sich nachdenklich übers Kinn.
Ich konnte seinen Gesichtsausdruck schwer einschätzen. War er verärgert? Oder nur zurückhaltend? Sein Verhalten schüchterte mich ein. Eigentlich hatte ich ihn sofort nach unserer Begrüßung fragen wollen, wie es ihm ging, wo er wohnte und was er die letzten einundzwanzig Jahre gemacht hatte.
»Nun ja, Hanne war ja immer schon für Überraschungen gut.« Er verschränkte die Arme vor der Brust.
»Stört dich etwas an ihrer Entscheidung?«, platzte es nun doch aus mir heraus.
Er winkte ab. »Ich habe ja damit gerechnet. Und gleichzeitig wundert es mich.«
»Das könnte ich andersherum ebenso sagen«, entfuhr es mir schärfer als beabsichtigt. »Immerhin bist du gar nicht mit Hanne verwandt.«
»Ja, allerdings hat meine Familie auch nicht den Kontakt zu ihr abgebrochen und sich nie wieder hier blicken lassen.«
Unwillkürlich ballte ich meine rechte Hand zu einer Faust. Es ist nicht deine Schuld, redete ich mir selbst gut zu, um mich zu beruhigen. Du warst noch ein Kind.
»Das ist eine lange Geschichte«, brachte ich schließlich so gefasst wie möglich hervor. »Und Hanne wird ihre Gründe gehabt haben, warum sie das Testament so und nicht anders verfasst hat.«
Ich schluckte die wiederaufkommenden Tränen hinunter. Auch wenn ich meine Tante so lange nicht gesehen hatte, hinterließ ihr Tod einen tiefsitzenden Schmerz in mir. Bis zu dem Vorfall vor einundzwanzig Jahren hatte ich so gut wie meine gesamte Kindheit bei ihr verbracht. In den Sommerferien hatte ich sogar bei ihr gewohnt, da meine Eltern viel arbeiten mussten und ich nicht so oft alleine sein sollte.
Ein schrilles Klingeln unterbrach die angespannte Situation.
»Janssen?«, meldete sich Sebastian an seinem Handy. »Ja, genau, wie verabredet auf dem Parkplatz. Ich bin sofort bei Ihnen.« Kaum hatte er aufgelegt, wandte er sich zum Gehen.
»Komm mit«, meinte er, ohne mich anzusehen. »Das dürfte dich auch interessieren.«
Sebastian erreichte den Parkplatz einige Meter vor mir. In seinen dunkelbraunen Lederboots machte er so große Schritte, dass ich kaum hinterherkam. Früher war ich immer die Schnellere gewesen, ärgerte ich mich, obwohl das jetzt absolut keine Rolle spielte.
Zielstrebig bewegte sich Sebastian auf einen hochgewachsenen Mann um die Vierzig zu, der lässig an einem dunkelblauen, imposanten SUV lehnte. Rechts davon parkte ein weißer, ramponiert aussehender Transporter, auf dessen Heck ein großes Hufeisen abgebildet war. Neben den beiden Fahrzeugen wirkte mein knallroter Mini – ein Oldtimer aus den neunziger Jahren – wie ein unschuldiger Marienkäfer.
»Hallo, Herr Meyer«, begrüßte Sebastian den Kerl, den ich mit seinen geschniegelten blonden Haaren und dem figurbetonten Anzug auf Anhieb unsympathisch fand.
»Guten Tag, Herr Janssen, schön, dass es so schnell geklappt hat!«
Die beiden Männer gaben sich die Hand.
»Das ist Sophie Winter«, stellte Sebastian mich vor. »Sie hat die Gärtnerei und die andere Wohnung geerbt und war zufällig vor Ort.«
Meyer hatte einen unangenehm festen Händedruck.
»Das kommt doch sehr gelegen, dass Sie auch da sind«, meinte er, musterte mich kurz irritiert und wedelte mit einer dicken Mappe in der Luft herum, die er zuvor auf dem Autodach abgelegt hatte. »Dann können wir gleich zum Wesentlichen kommen.«
Ich trat unsicher von einem Bein aufs andere. Ausgerechnet heute musste ich in meinen dreckigen Klamotten wie eine Vogelscheuche aussehen.
»Wollen Sie sich zuerst vom Grundstück einen Eindruck verschaffen oder die Immobilie von innen besichtigen?« Sebastian zog einen Schlüssel aus seiner Hosentasche.
»Entschuldigen Sie, aber was genau geht hier eigentlich vor sich?«, unterbrach ich die beiden ungewohnt mutig.
Über Meyers Gesicht legte sich ein professionelles Lächeln. »Ach, entschuldigen Sie, Frau Winter, ich war mal wieder etwas voreilig. Ich dachte, Sie wären bereits im Bilde.«
»Nein, das bin ich leider nicht.« Ich strich mir nervös eine Haarsträhne hinters Ohr, die sich aus meinem Zopf gelöst hatte.
»Dann lassen Sie mich noch einmal von vorne beginnen. Also, ich führe hier in der Region eine gut aufgestellte Immobilienagentur. Herr Janssen hat mich aufgrund dieses vielversprechenden Objekts kontaktiert und um eine Besichtigung vor Ort gebeten.«
»Ich ... ich verstehe nicht ganz«, stammelte ich.
»Nun ja, Herr Janssen hat mir signalisiert, dass er sein Erbe gerne verkaufen würde. Am lohnenswertesten wäre das natürlich im Komplettpaket mit dem Grundstück und der Gärtnerei. Das würde bei unseren Investoren auf sehr großes Interesse stoßen.«
Ich schluckte und brauchte einen Moment, um das Gehörte zu verarbeiten. Hatte Sebastian einfach hinter meinem Rücken einen Immobilienmakler beauftragt?
»Ich mache jetzt einen Rundgang über das Gelände und informiere meine Mitarbeiter, dass sie ein paar Fotos für das Exposé aufnehmen«, fuhr Herr Meyer unbeirrt fort.
»Nehmen Sie gerne den Schlüssel«, bot Sebastian an.
Der Makler machte eine abwinkende Handbewegung. »Vielen Dank, den benötige ich nicht. Die Innenräume sind für meine Klientel nicht relevant.«
»Wieso?«, fragte ich, obwohl ich es mir bereits denken konnte.
»Nun ja.« Meyer blickte von oben auf mich herab, als sei ich ein kleines Kind. »Ich denke, dass wir uns alle im Klaren darüber sind, dass hier lediglich das Grundstück Potenzial besitzt.«
»Und das heißt konkret?«, ließ ich nicht locker.
»Konkret heißt das, dass meine potenziellen Käufer planen, die Bestandsgebäude abzureißen und einen Neubau zu errichten. Hier besteht momentan auf dem ländlichen Raum eine sehr große Nachfrage. Aller Voraussicht nach werden wir ein Bieterverfahren haben, bei dem wir einen sehr guten Preis für Sie erzielen sollten.« Meyer trat ungeduldig auf der Stelle. »Alle weiteren Details können wir gerne nach der Besichtigung klären. Dann kann ich Ihnen genauere Zahlen nennen.«
Entsetzt blickte ich zwischen Sebastian und dem Makler hin und her. »Einen Moment mal.«
»Ja?« Meyer setzte wieder sein professionelles Lächeln auf.
»Nur um das einmal klarzustellen: Ich habe die Gärtnerei und damit auch das Grundstück geerbt. Herrn Janssen gehört lediglich die obere Wohnung in dem alten Bauernhaus. Und bislang habe ich nicht mein Einverständnis zu einem Verkauf gegeben.« Ich richtete mich so weit wie möglich auf, um mich mit meinen 1,65 Meter gegenüber den beiden hochgewachsenen Männern zu behaupten.
»Frau Winter, wir wollen hier keineswegs etwas über Ihren Kopf hinweg entscheiden«, versuchte Meyer zu beschwichtigen.
»Das sieht aber genauso aus.« Ich verschränkte die Arme vor der Brust und schaute zu Sebastian. »Ganz ehrlich, ich verstehe das nicht. Der Brief vom Nachlassgericht ist erst vor ein paar Tagen verschickt worden. Wieso lässt du sofort einen Makler kommen, ohne vorher mit mir zu sprechen?«
»Ich schlage vor, dass ich Sie für ein paar Minuten alleine lasse. Dann klären sich bestimmt ihre Fragen und Unsicherheiten, liebe Frau Winter.« Ohne meine Reaktion abzuwarten, ging Meyer eiligen Schrittes davon und startete seinen Rundgang.
»Unglaublich!«, entfuhr es mir. Ich hatte mich selten so vor den Kopf gestoßen gefühlt. Am meisten ärgerte mich, dass Sebastian einfach dastand, als ginge ihn das alles überhaupt nichts an.
»Sophie«, sagte er schließlich und hob abwehrend die Hände. »Ich wusste nicht, wie ich dich kontaktieren sollte. Schließlich hast du mir, als wir uns als Zwölfjährige das letzte Mal gesehen haben, keine Handynummer hinterlassen.«
»Trotzdem. Ich finde es unverschämt, dass du einfach über mein Eigentum entscheidest.«
»Nun rege dich nicht so auf. Es ist doch noch gar nichts passiert. Meyer macht uns lediglich ein Angebot, das wir uns in Ruhe anschauen können.«
»Die Möglichkeit, dass ich nicht verkaufen möchte, ziehst du gar nicht in Betracht?«
Sebastian seufzte und vergrub die Hände in den Hosentaschen seiner Levis, die aussah, als hätte sie schon einiges mitgemacht. »Ich weiß nicht, inwieweit du dich über den Zustand der Immobilie informiert hast und was du über die Höhe der Erbschaftssteuer und mögliche Belastungen mit Schulden weißt.« Er trat ungeduldig von einem Fuß auf den anderen. »Ich denke, wir sollten einen kühlen Kopf bewahren, ehe wir uns entscheiden, was wir mit dem unerwarteten Geschenk anfangen.«
»Natürlich«, bluffte ich. Ehrlich gesagt hatte ich mir noch keine genaueren Gedanken gemacht. Ich wusste schließlich erst seit ein paar Tagen von dem Erbe. Außerdem hatte ich gerade noch einige andere Sachen um die Ohren.
»Deswegen bin ich hergefahren und wollte mir vor Ort einen Eindruck verschaffen«, fügte ich so selbstsicher wie möglich hinzu. »Was ich mit der Gärtnerei und der Wohnung mache, entscheide ich ganz in Ruhe. Und bis dahin braucht kein Makler oder Investor meinen Grund und Boden betreten.«
»Sei doch nicht so stur.« Sebastian schüttelte den Kopf. »Du warst doch früher nicht so.«
»Du warst früher auch nicht so ... so ...« Ja, was war Sebastian jetzt eigentlich? Mir fehlten die Worte. Jedenfalls erkannte ich ihn nicht wieder.
»Na, was bin ich?« Er schaute mich herausfordernd an.
Kaltherzig und berechnend, fuhr es mir plötzlich durch den Kopf, doch ich schluckte die Entgegnung hinunter. »Ist egal.«
Sebastian seufzte. »Bist du dieses Wochenende noch einmal hier? Wir sollten uns wirklich in Ruhe zusammensetzen.«
»Mal sehen«, meinte ich vage, obwohl ich mir extra bis zum Ende der Woche freigenommen hatte, um einige Tage in Bienenbeek bleiben zu können.
»Ich gebe dir meine Handynummer, dann kannst du dich melden.« Sebastian zog eine Visitenkarte aus seinem Portemonnaie und drückte sie mir in die Hand.
»Kutschfahrten Janssen«, entzifferte ich die verschnörkelten Buchstaben neben den Umrissen eines Pferdekopfs. »Heiderundfahrten für Groß und Klein.«
»Ich habe mich vor kurzem selbstständig gemacht und meinen eigenen Kutschbetrieb gegründet«, meinte Sebastian. Ich hörte Stolz in seiner Stimme mitschwingen.
»Oh«, sagte ich erstaunt. Sebastian hatte Pferde schon als Kind gemocht, aber dass er einmal beruflich mit ihnen zu tun haben würde, hätte ich nicht gedacht.
»Eigentlich bin ich gelernter Hufschmied, aber ich wollte mir ein zweites Standbein mit meiner Leidenschaft aufbauen«, erklärte er ungefragt.
»Das klingt spannend.« Ich hatte im Moment jedoch nicht die Muße, mir mehr darüber anzuhören. »Leider muss ich jetzt los. Sag deinem Makler, dass hier ohne meine Genehmigung keine Fotos gemacht werden dürfen.«
So lässig wie möglich schloss ich meinen Mini auf und ließ mich auf den Fahrersitz fallen – doch dabei stieß ich mir mit voller Wucht den Kopf am Türrahmen. Ich unterdrückte einen Schmerzensschrei, startete den Motor und fuhr mit zusammengebissenen Zähnen vom Hof.
Als ich einige Meter weiter in den Rückspiegel blickte, bemerkte ich mit Schrecken, dass quer über mein Gesicht eine große, schmierige Spur aus Erde und Wimperntusche verlief.
Großartig, Sophie, schimpfte ich im Geiste mit mir. Das ist mal wieder typisch für dich. Von meinem optischen Desaster mal abgesehen, hätte ein Wiedersehen mit Sebastian auch sonst nicht schlimmer verlaufen können. Was war bloß aus meinem lustigen Freund aus Kindertagen geworden? Ich konnte nicht fassen, wie nüchtern und geschäftstüchtig er Hannes Vermächtnis betrachtete.
Damit wird er nicht durchkommen, nahm ich mir vor. Meine Fingernägel krallten sich in das Lenkrad. Später würde ich mir überlegen, wie es weitergehen sollte. Aber jetzt hatte ich erst mal etwas Wichtiges zu erledigen.
Kapitel 2
Der Friedhof lag versteckt in einer Sackgasse am Ortsrand von Bienenbeek. Ein mulmiges Gefühl breitete sich in meinem Bauch aus, als ich durch das schmiedeeiserne Tor ging. Das lag nicht nur daran, dass Friedhöfe mich stets etwas einschüchterten, sondern dass ich Angst hatte, Hanne nach all den Jahren auf diese Art und Weise gegenüberzutreten.
Es war auf den Tag genau zwei Wochen her, dass an einem Samstagmorgen das Telefon geklingelt hatte.
»Tante Hanne ist gestorben. Sie hatte Krebs«, hatte meine Mutter mir nüchtern mitgeteilt. Wenn sie traurig war, hatte sie es sich nicht anmerken lassen. Ich war danach einige Tage wie gelähmt gewesen, ehe die Nachricht zu mir durchgedrungen war.
Suchend bewegte ich mich durch die Grabreihen. Ich schämte mich zutiefst, dass ich nicht auf Hannes Beerdigung gewesen war. Ausgerechnet an diesem Tag stand eine wichtige Prüfung an, für die ich wochenlang gelernt hatte. Denn neben meinem Job in der Personalabteilung eines Unternehmens hatte ich vor einem Jahr ein Zusatzstudium zur Wirtschaftsprüferin begonnen. Mein Ex-Freund hatte mich dazu angespornt – laut ihm stand mir damit eine glänzende Karriere bevor. In seinen Augen gab es kaum etwas Wichtigeres als die Arbeit. Oft verbrachte er ganze Wochenenden in seiner Kanzlei, um Akten zu wälzen. Doch jetzt wollte ich mich wirklich nicht mit Felix beschäftigen. Ich presste die Lippen aufeinander und versuchte, die Gedanken an ihn aus meinem Kopf zu vertreiben.
Es dauerte einige Zeit, ehe ich Hannes Grab auf der großen Rasenfläche des Friedhofs gefunden hatte. Es bestand lediglich aus einer schlichten Steinplatte im Boden.
»Hallo Hanne«, murmelte ich leise und legte den kleinen Wildblumenstrauß auf der Erde ab, den ich notdürftig am Feldrand gepflückt hatte. Neben der Grabplatte lag schon ein wunderschöner, großer Heidekranz mit einem weißen Spruchband. In liebevoller Erinnerung, deine Landfrauen, las ich und lächelte. Vielleicht war Hannes Beerdigung doch nicht so einsam gewesen wie gedacht.
»Ach Hanne«, sagte ich leise und kämpfte gegen die aufkommenden Tränen an. »Es tut mir leid. Wenn du wüsstest, was gerade bei mir los ist.« Der nagende Schmerz in meinem Bauch wurde stärker. Noch vor zwei Wochen war mein Leben ganz normal gewesen. Dann hatte es sich plötzlich in seine Bestandteile aufgelöst.
Eigentlich wollte ich Hanne noch so viel sagen. Aber es fühlte sich merkwürdig an, auf dieser Rasenfläche zu stehen und Selbstgespräche zu führen.
»Hanne«, brachte ich schließlich doch leise hervor. »Ich verspreche dir, auf deine Gärtnerei aufzupassen. Darauf kannst du dich verlassen.«
Eilig machte ich auf dem Absatz kehrt, ehe mich erneut eine Welle der Traurigkeit erfassen konnte.
Kapitel 3
»Ich nehme das Lütte Heidefrühstück«, meinte ich, als ich mich angesichts der kleinen, aber feinen Auswahl auf der Speisekarte endlich entschieden hatte.
»Eine sehr gute Wahl«, erwiderte die sympathische Bedienung und notierte die Bestellung auf ihrem Block. Sie trug eine lila Schürze, auf der das Logo des Cafés aufgedruckt war: zahlreiche kleine Bienen, die um den nostalgisch gestalteten Schriftzug »Heideglück & Honigblüte« herumschwirrten.
»Darf es sonst noch etwas sein?«
»Ja, gerne. Könnten Sie mir vielleicht einen Kaffee dazu bringen?«
»Na klar, aber sag doch bitte du!«, sagte die Frau, die ich auf etwa Mitte Dreißig, also mein Alter schätzte. Sie trug ihre blonden Haare zu einem lockeren Dutt hochgebunden. »Ich bin Lene. Und wir duzen uns hier alle.«
»Sophie«, stellte ich mich vor und erwiderte ihr freundliches Lächeln.
»Na dann, herzlich Willkommen, Sophie. Dein Frühstück kommt gleich.«
Lene eilte geschäftig zum nächsten Tisch, denn das Café war bis auf den letzten Platz besetzt. Nach meiner ereignisreichen Ankunft in Bienenbeek hatte ich in dem kleinen Gästezimmer übernachtet und wollte nun das Frühstück probieren, von dem im Internet so geschwärmt wurde.
Bereits die Atmosphäre des Cafés war bezaubernd. Auf den Tischen lagen grün-weiß karierte Decken und liebevoll gestaltete Heidegestecke; Teelichter in alten Einmachgläsern verströmten eine gemütliche Stimmung und an den Wänden hingen Gemälde von lokalen Künstlerinnen und Künstlern, wie ich den kleinen Schildern darunter entnahm. Bei Gefallen konnte man die Kunstwerke direkt im Café erwerben.
»Hallo«, ertönte es plötzlich neben mir. Ich zuckte erschrocken zusammen.
»Bienen gucken! Bienen gucken!« An meiner rechten Seite stand ein kleines Mädchen mit blonden Locken, das aufgeregt an meinem Arm zog.
»Huch, wer bist du denn?«, fragte ich erstaunt.
»Johanna!« Lene eilte herbei und zog die Kleine, die ich auf etwa zwei Jahre schätzte, von mir weg.
»Entschuldige«, meinte sie mit Blick zu mir. »Aber meine Tochter ist immer sehr kontaktfreudig.«
»Bienen gucken!«, wiederholte Johanna unbeirrt und grinste ihre Mutter an.
Lene seufzte. »Johanna, ich habe dir doch gesagt, dass du auf Papa warten musst. Er kommt gleich und nimmt dich mit zu den Bienen.«
»Ist dein Mann Imker?«, fragte ich interessiert.
Lene nickte. »Er produziert Heidehonig. Seit neuestem haben wir Bienenstöcke im Garten stehen, weil er seine Völker vergrößert hat und der Platz auf der gepachteten Wiese nicht mehr ausreicht. Johanna findet das natürlich super. Ich muss sie allerdings den halben Tag davon abhalten, zu nah an die Kästen heranzugehen.« Lene lachte. »Na ja, bald geht sie vormittags in den Kindergarten. Oder, Johanna?«
Die Kleine nickte eifrig.
»Wir haben lange auf den Platz warten müssen.« Lene rollte mit den Augen. »Aber das ist eine andere Geschichte. Zum Glück hat sich meist jemand gefunden, der auf sie aufpasst. Das ist das Gute an Bienenbeek. Jeder hilft jedem.«
Sie nahm Johanna an die Hand. »So, du gehst jetzt zu Papa und ich bringe Sophie ihr Frühstück.«
Belustigt beobachtete ich, wie die Kleine sich nur widerwillig von mir wegführen ließ. Doch als ein großer, schlanker Mann am Eingang auftauchte, machte Johanna einen Freudensprung und lief stürmisch auf ihn zu. Er nahm sie hoch, wirbelte sie einmal in der Luft herum und ging durch die geöffnete Terassentür mit ihr in den Garten hinaus.
Während ich den beiden hinterherschaute, traf mich mit einem Mal die bittere Erkenntnis mit voller Wucht: Das, was Lene hier hatte, würde ich mit Felix nicht mehr erleben. Mein Lebensentwurf – Hochzeit, zwei Kinder, vielleicht irgendwann raus aus der Stadt aufs Land – hatte sich nach sieben gemeinsamen Jahren einfach in Luft aufgelöst.
»Ich kann so nicht weitermachen,« hatte Felix mir an dem verhängnisvollen Abend verkündet, als wir uns nach Feierabend gemeinsam an den Esstisch gesetzt hatten.
»Wie bitte?«
»Es tut mir leid, Sophie. Aber ich – ich habe jemanden kennengelernt.«
Vor Schreck war mir der Löffel in den dampfenden Teller Gemüsesuppe gefallen. Nie würde ich vergessen, wie er mich voller Mitleid angeschaut hatte. Wenn er wenigstens traurig gewesen wäre. Von mir aus auch gleichgültig. Aber Mitleid? War das alles, was nach sieben Jahren Beziehung und einer Verlobung übriggeblieben war?
Er liebte mich nicht mehr, begründete Felix seine Entscheidung. Er hätte sich schon seit langem eingesperrt gefühlt. Nicht mehr lebendig. Das sei ihm angesichts unserer Hochzeitsvorbereitungen immer deutlicher vor Augen getreten. Und dann habe er Mila kennengelernt. Ganz klassisch bei der Arbeit. Es hätte sofort gefunkt, er hätte nichts dagegen tun können. Nun wäre es endlich ausgesprochen und das Versteckspiel vorbei. Er sah erleichtert aus.
Für mich hingegen brach eine Welt zusammen. Ich musste alles canceln. Den Termin zur Brautkleidanprobe, das Probeessen im Restaurant und das Treffen mit dem Fotografen. Meine beste Freundin Lotte, die Hochzeiten liebte, hatte sogar den Ablauf der Feier schon minutiös für mich durchgeplant.
Ich konnte es bis heute nicht fassen. Felix und ich waren immer ein gutes Paar gewesen. Vielleicht kein perfektes, aber es hatte nie Streit oder größere Unstimmigkeiten zwischen uns gegeben.
»Einen Moment, da kommt gleich noch mehr.« Lene, die plötzlich mit einem voll beladenen Tablett erschienen war, riss mich aus meinen Gedanken. Sie stellte viele kleine Schälchen und einen Brotkorb auf meinem Tisch ab und eilte zurück in die Küche. Kurz darauf kam sie mit einer niedlichen silbernen Etagere und einem dampfenden Kaffeebecher zurück. »Das wäre alles. In dem Korb findest du eine Auswahl an Dinkel- und Buchweizenbrötchen. Für den süßen Gaumen haben wir hausgemachte Erdbeer- und Heidelbeermarmelade sowie einen Fruchtaufstrich aus Heideblütensirup.« Lene deutete nacheinander auf die verschiedenen Schälchen. »Das hier ist Heidehonig. Achtung, er schmeckt herber und würziger, als du es von anderen Honigsorten kennst. Für den herzhaften Belag gibt es Frischkäse, Heidschnuckensalami und verschiedene Käsesorten. Ach, und hier ist noch ein Pfannkuchen aus Buchweizenmehl. Wenn du magst, kann ich dir auch etwas Joghurt mit Obst oder eine frisch gebackene Waffel bringen.«
»Vielen Dank«, brachte ich staunend hervor. »Aber ich glaube, das ist wirklich mehr als genug für mich.« Wenn das nur das »kleine« Heidefrühstück war, wie sah dann das große aus?
»Lass es dir schmecken.« Lene lächelte und eilte zum Nachbartisch, wo ein junger Mann gerade die Hand hob.
Hungrig biss ich in das noch ofenwarme Buchweizenbrötchen. Es schmeckte genau so frisch und lecker, wie es aussah. Ehe ich mich versah, hatte ich zwei weitere Hälften vertilgt. Iss nicht zu viel, ermahnte ich mich selbst, sonst kannst du dich gleich gar nicht mehr bewegen.
In der Tat hatte ich heute einiges vor. Ich wollte Ordnung in den Beeten schaffen und Hannes Wohnung in Augenschein nehmen. Während ich mich fragte, was mich dort wohl erwartete, fiel mir erneut der Mann am Nebentisch ins Auge. Er hatte dunkelbraunes, volles Haar und eine sympathische Ausstrahlung. Als er seinen Kopf zur Seite drehte und unsere Blicke sich trafen, schaute ich verlegen auf meinen Teller.
Aus dem Augenwinkel beobachtete ich, wie Lene erneut an seinen Tisch trat. Er lachte laut über eine ihrer Bemerkungen, legte die Hand auf ihren Arm und deutete dann auf die Speisekarte. Flirtete er etwa mit ihr?
Schluss jetzt, Sophie, unterbrach ich meine Gedanken. Du hast Wichtigeres vor, also kümmere dich nicht um Dinge, die dich nichts angehen. Ich aß schnell auf und winkte Lene herbei, um zu bezahlen.
Kapitel 4
»Au!«, rief ich, als sich eine stachelige Distel durch meinen Handschuh bohrte. Mit all meiner Kraft zog ich an der widerspenstigen Pflanze, doch ihre Pfahlwurzeln waren so fest im Boden verankert, dass ich keine Chance hatte. Plötzlich fiel mir ein, dass Hanne mir früher erzählt hatte, dass die meisten Distelarten nicht nur eine wertvolle Nahrungsquelle für Bienen und Schmetterlinge waren, sondern sich auch zum Verzehr eigneten. »Entschuldige«, murmelte ich, ließ die Pflanze los und nahm mir vor, später die genaue Art nachzuschlagen.
Nach etwa zwei Stunden war ich schweißgebadet, aber glücklich. Die Hälfte der Beete sah aus wie neu, und ich hatte einige Pflanzen retten können. Anstelle des angekündigten Regens schien die Sonne vom Himmel, so dass es immer wärmer wurde. Ich beschloss, dass ich mir eine Pause redlich verdient hatte, bevor ich Hannes Wohnung erkunden würde.
Also wanderte ich um die Beete herum in den privaten Teil von Hannes Garten, der hinter einer großen Hainbuchenhecke versteckt lag. Das Areal wirkte wie aus einem romantischen Märchen entsprungen: Auf der großen Rasenfläche standen drei alte, riesige Eichen und es gab ein kunterbuntes Durcheinander aus verschiedensten Stauden. Ich ging eine Weile staunend umher und streckte meine Hand nach weißem und violettem Rittersporn, wilden Malven, Stockrosen und Mädchenauge aus. Wie weiß leuchtendes Konfetti hatte sich die echte Kamille überall dazwischen gemischt. Sogar ein besonders schönes Exemplar eines Fingerhuts konnte ich entdecken.
Ein sanfter Windstoß fuhr durch den Garten und ließ die Blätter der Hainbuchen leise rascheln. Auch die Schaukel an der Eiche, die Hanne extra für mich und Sebastian gekauft hatte, setzte sich wie von Zauberhand in Bewegung. Einem inneren Impuls folgend, lief ich dort hin. Kurz inspizierte ich prüfend den dicken Ast und die langen Seile.
Wird schon gut gehen, sprach ich mir selbst Mut zu und schwang mich auf das große Sitzbrett aus Holz. Dann nahm ich kräftig Anschwung und hob ab, die Füße hoch in den strahlend blauen Himmel gestreckt.
Nachdem ich eine Weile geschaukelt hatte, legte ich mich ins warme Gras und döste wohlig erschöpft vor mich hin. Bis ich plötzlich ein Geräusch hörte. Was war das? Ich blickte mich suchend um, aber im Garten war niemand zu sehen.
Da war es wieder. Ein Knarren, gefolgt von einem lauten Klappern. Ich richtete mich auf und erkannte mit Schrecken, dass die Terrassentür zu Hannes ebenerdiger Wohnung weit offenstand. Die Schlagzeile von neulich, dass Diebe über eine aufgehebelte Terrassentür in ein Haus eingebrochen waren, geisterte durch meinen Kopf.
Hektisch suchte ich die Hosentaschen nach meinem Handy ab, doch das lag wohl noch in meinem Auto. Na super, dachte ich und versteckte mich hinter dem dicken Stamm der Eiche. Vorsichtig spähte ich an der Seite vorbei zur Terrasse. Doch die dicht berankten Seitenwände der alten Pergola behinderten die Sicht. Nur schemenhaft konnte ich eine vorbeihuschende Gestalt ausmachen. Vielleicht handelte es sich um den Makler oder Sebastian?
Wieder knarrte und klapperte es. Allem Anschein nach lief die Person geschäftig hin und her. Als sie kurz mit dem Rücken vor der geöffneten Tür stehen blieb, erkannte ich, dass sie eher klein und schmal war. Nein, das war definitiv nicht der Makler. Und auch nicht Sebastian. Weitere Horrorvorstellungen von bewaffneten Einbrechern spukten durch meinen Kopf.
Nun denk nach, ermahnte ich mich. Was hätte Hanne getan? Resolut, wie sie gewesen war, hätte sie sich mit einer Harke bewaffnet und wäre hoch erhobenen Hauptes in ihre »gute Stube« gestürmt, bereit, ihr Hab und Gut zu verteidigen.
Plötzlich kam die Person wieder ganz nah ans Fenster. Ich schreckte zurück und presste mich so eng wie möglich an die Eiche.
»Du bist echt ein feiges Huhn«, hörte ich Hanne auf einmal zu mir sprechen. »Ach, was sage ich! Ein feiges Hühnchen!«
Hilfesuchend blickte ich mich um. Wenn ich da gleich hineinging, wollte ich nicht unbewaffnet sein. Doch in meiner Reichweite gab es absolut nichts Brauchbares – keinen Spaten, keine Hacke, nicht einmal eine Handschaufel. Das Einzige, was in mein Blickfeld geriet, war ein Gartenzwerg, eingewachsen von hohem Gras. Ich seufzte und griff nach dem Kerlchen. Es war wirklich ein ausgemacht hässliches Exemplar mit einer riesigen Knollennase und Glubschaugen, aber dafür richtig schwer. Den armen Kerl fest in der rechten Hand umklammert, pirschte ich mich langsam zur Terrasse vor.
Die Person war nicht mehr am Fenster zu sehen, aber den Geräuschen nach noch im Wohnzimmer zugange. So leise wie möglich trat ich näher, dicht an den schützenden Blättern der weißen Clematis bleibend, die die Pergola erobert hatten. Das Herz schlug mir bis zum Hals.
Auf einmal hörte ich, wie drinnen jemand vergnügt zu summen begann. Was zum Teufel war da los? Ich hielt den Gartenzwerg schützend vor mich gestreckt, jederzeit bereit zum Angriff.
Während ich langsam um die Seitenwand der Pergola herumschlich, übersah ich jedoch die Kante einer in Schieflage geratenen Terrassenplatte. Ich kam ins Straucheln und hielt mich reflexartig mit der freien Hand an dem Rankgitter fest. Dabei geriet die morsche Konstruktion ins Wanken und fiel schließlich laut krachend aus der Verankerung auf die Terrasse.
Von drinnen hörte ich einen spitzen Schreckensschrei. Eine grauhaarige Frau in einem grünen Twin-Set erschien im Türrahmen und starrte mich entgeistert an. In der rechten Hand hielt sie einen Putzeimer und in der linken etwas, das wie ein Fensterabstreifer aussah.
Vor Schreck hielt ich den Gartenzwerg schützend vor mich. Zum Glück hatte er den kleinen Unfall unbeschadet überstanden.
»Wer sind Sie?«, fragte ich verstört, als ich meine Sprache wiedergefunden hatte. »Und was machen Sie in Hannes Wohnung?«
Die alte Dame stellte den Putzeimer ab. »Moment, ich habe meine Brille vergessen.« Sie kam einen Schritt näher und musterte mit zusammengekniffenen Augen mein Gesicht.
»Ach wat!«, entfuhr es ihr. »Sophie!«