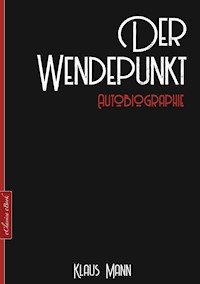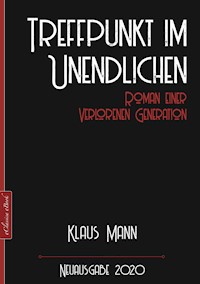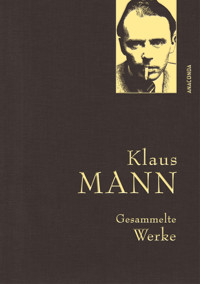Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
mehrbuch-Weltliteratur! eBooks, die nie in Vergessenheit geraten sollten. Die kleine Stadt ist ein Roman von Heinrich Mann, geschrieben vom Herbst 1907 bis zum 31. März 1909 und erschienen 1909. Während eine Wanderoper unter Mitwirkung kunstsinniger Bürger in der kleinen Stadt gastiert, lernt der Priester Don Taddeo eine neue Seite, die sinnliche Begierde, an sich kennen. Als die Komödianten weiterziehen, bringt Alba Nardini aus Eifersucht ihren Geliebten, den lyrischen Tenor Nello Gennari und darauf sich selber um.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 559
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Heinrich Mann
Die kleine Stadt
Roman
I
Der Advokat Belotti trat schwänzelnd an den Tisch vor dem Café „zum Fortschritt“, wischte mit dem Taschentuch um seinen kurzen Hals und sagte erstickt:
„Die Post hat wieder Verspätung.“
„Jawohl“, machten Apotheker und Gemeindesekretär; und da nichts Tatsächliches mehr zu sagen blieb, schwiegen sie. Der Reisende warf hin:
„Ihr wird doch nichts zugestoßen sein?“
Die andern stießen unwillig den Atem aus. Der Leutnant der Carabinieri legte mit Nachsicht, weil es sich um einen Fremden handelte, die große Sicherheit der Straßen dar. Zwei seiner Leute begleiteten stets zu Pferde die Post, und nur einmal hatten sie einzugreifen gehabt. Damals wollte ein Bauer seinen Platz nicht bezahlen und zog gegen den Kutscher das Messer.
„Solche Leute haben wenig Erziehung“, erklärte der Leutnant.
„Ein langweiliges Handwerk, das eure“, rief der Apotheker Acquistapace mit seiner braven Stimme.
„Betrunkene aus dem Graben ziehen und eine entlaufene Kuh zurückscheuchen. Als wir dabei waren, gings anders zu. Wie, Gevatter Achille?“
Der Wirt rief von drinnen: „Zugegen.“
Er stampfte heraus, stützte die Last seines Bauches auf eine Stuhllehne und wartete mit offenem Munde, worin die Zunge umherrollte.
„Wie, mein Alter?“ und der Apotheker klopfte ihn auf den Bauch, „vor unseren Füßen ist manche Granate geplatzt. In Bezzecca wars, als gleich bei uns beiden der General Garibaldi selber stand. Die Granate platzt, wir springen zurück, versteht sich; der General aber rührt sich nicht; er sieht in den Dampf, als ob er sinnt. ‚Keine Furcht, Freunde‘, sagt er zu uns, und, Achille, wir hatten keine mehr.“
„Das ist die reine Wahrheit“, sagte der Wirt; und mit Wucht: „Der General war ein Löwe.“
„Er war ein Löwe“, wiederholte der andere Alte, fuhr mit der Hand durch seinen riesenhaften Schnauzbart und sah alle von oben an. Plötzlich machte er sich klein und tat eine Gebärde, als streichelte er ein Kind.
„Aber auch ein Engel war er: ja, unwissend in manchem, wie ein Engel. Manches geschah, wie, Gevatter? was er nie erfahren hat. Alle wußten, daß jener Nino ein Weib war, nur der General nicht.“
Der Advokat Belotti fragte: „War er eigentlich ein schönes Weib, jener Nino?“
Der Apotheker zischte leise. „Solche Frauen gibt es nicht mehr! Und als ihr Geliebter gefallen war, da kams heraus, daß sie eine war. Aber sie verließ uns darum nicht. Hatte sie nun ihn nicht mehr, um dessentwillen sie mitgezogen war, hatte sie doch uns alle. Und uns alle hat sie geliebt!“
Seine braunen Hundeaugen jubelten in der Erinnerung. Der Wirt lachte lautlos, daß sein Bauch den Stuhl umherwarf. Sein Sohn, der schöne Alfò, war herzugetreten, der junge Savezzo mit frisch gebrannten Locken vom Barbier her über den Platz gekommen; — und alle, alle hatten, wie der Alte endete, ein neidisches Gesicht.
Gleich darauf erinnerten sie sich, daß die Geschichte sehr alt war und daß sie alle, sogar der Reisende, sie kannten, wie sie die Hühnerlucia kannten. Ihre Stunde war da: schon klapperten ihre Holzschuhe in der Gasse neben dem Café. Mit ihrem Gegacker, das lauter war als das der Hennen, mit ihrer Nase, die schärfer war als die Hühnerschnäbel, flügelschlagend mit ihren langen Armen, scheuchte sie das Federvieh zum Brunnen und ließ es aus der Pfütze trinken. Die Kinder kreischten um sie her, stießen sie, zupften an ihr und sprangen vor Lust, wenn die Alte in ihren bunten Lappen wie ein großes mageres Huhn kopflos kreuz und quer flatterte. Ringsum gingen Fensterläden auf; an der Ecke schräg vor dem Café drängten über den Arkaden des Rathauses drei Beamte sich in eins der alten Pfeilerfenster; die dicke Mama Paradisi sah aus ihrem Hause herab; dahinten im Corso sogar streckte Rina, die kleine Magd des Tabakhändlers, den Kopf heraus, und dem Advokaten Belotti schien es, daß sie ein neues Halstuch trage. Er überlegte nicht ohne Unruhe, wer ihr nun das wieder geschenkt haben könne. Inzwischen schloß die Kleine ihr Fenster, Mama Paradisi das ihre; die Hühnerlucia und all ihr Lärm waren bis morgen dahin in die Gasse; und der Platz schlief weiter in seiner weißen Sonne, winklig beleckt von den Schatten. Der des Palazzo Torroni, am Eingang des Corso, lief spitz hinüber zum Dom, und vor der buckligen Kirchenfront malten die beiden säulentragenden Löwen ihr schwarzes Abbild aufs Pflaster. Wildgezackt sprang der Schatten des Glockenturmes bis an den Brunnen vor. Neben dem Turm aber wich das Dunkel zurück, tief in den Winkel, worin man das Haus des Kaufmannes Mancafede wußte. Kaum daß die Umrisse seiner Fenster zu erkennen waren; — hinter einem stand aber sicher auch jetzt, wie sie immer dort stand, die Unsichtbare, das Rätsel der Stadt: Evangelina Mancafede, die niemals ausging und dennoch alles wußte, was geschah, es früher als alle wußte. In der Stadt tat jeder, was er tat, unter den Augen der Unsichtbaren. Durch alle Häuser am Platze schien sie, aus ihrem Schattenwinkel hervor, hindurchsehen zu können: nur eins verdeckte ihr der Turm, den Palazzo Torroni. Auch hieß es, daß sie von dort nichts wissen wollte, daß ihr Vater und ihre Magd — denn sonst erblickte niemand sie — den Namen des Barons vor ihr nicht nennen durften, seit er, den sie geliebt hatte, die andere geheiratet hatte. Seitdem ging sie nicht mehr aus! Sie war damals vierundzwanzig gewesen und war jetzt dreiunddreißig. „Eine schöne Frau“, wisperte der Advokat dem Reisenden ins Ohr. „Vom Stillsitzen soll sie junonische Formen bekommen haben.“
Seine Hände, die diese Formen nachbilden wollten, ließ er rasch wieder sinken, denn zweifellos sah sie ihn. Der Reisende fragte:
„Ist sie, seit ich zuletzt hier war, noch immer nicht ausgegangen?“
„Was denken Sie!“
Alle bekamen gekränkte Mienen.
„Sie verspricht es, sooft der Alte es will, dann läßt er ihr schöne Kleider kommen, sogar von Rom her, denn schließlich ist sie das reichste Mädchen hier und hätte hunderttausend Lire mitbekommen; lädt ihre ehemaligen Freundinnen ein, bestellt den Wagen zur Ausfahrt . . . Die Stunde ist da, der Wagen mit den Freundinnen steht vor dem Hause, Evangelina in ihren schönen Kleidern steigt die Treppe hinab. In der Mitte aber hält sie an, sagt ‚Nicht heute, ein anderes Mal‘ und geht zurück in ihr Zimmer.“
Mehrere lugten aus den Augenwinkeln hinüber nach dem geheimnisvollen Hause. Unten, wie in schwarzer Höhle, glomm ein Licht, und vor seinem Laden ging der Kaufmann hin und her: langsam immer hin und her. Die Gäste des Cafés „zum Fortschritt“ konnten ihm zusehen und bei seiner Bewegung fühlen, daß die Zeit vergehe.
Der Apotheker erhob sich, denn ein Kunde war bei ihm eingetreten: der Junge des Gastwirtes Malandrini. Was konnte bei Malandrini vorgefallen sein? Gewiß handelte es sich um die Frau, die der Tabakhändler erst gestern mit dem Baron Torroni in ziemlich verdächtiger Unterhaltung gesehen hatte. Wer weiß, was sie jetzt aus der Apotheke brauchte. „Nun —?“ und alle Blicke sogen an dem alten Acquistapace, der, sein hölzernes Bein schwingend, zurückkam.
„Die Schwiegermutter hat Sodbrennen.“
Alle Köpfe senkten sich.
„Wenig Bewegung ist hier am Ort“, sagte der Leutnant der Carabinieri zu dem Reisenden und nickte hinüber, wo sich der Kaufmann Mancafede hin und her bewegte. Der Reisende wollte höflich den Ort entschuldigen, aber der Advokat Belotti sagte erstickt:
„Was kann man tun, wenn diese verdammte Post eine Stunde Verspätung hat! Sonst sähe hier vielleicht alles anders aus. Denn schließlich — sagen wir nur die Wahrheit! — können doch jeden Tag die größten Dinge geschehen. Die Stadt steht vor Ereignissen, die . . .“
„— nicht eintreten“, schloß der Gemeindesekretär und lehnte sich zurück, um seine Taille zu zeigen.
„Wer sagt Ihnen das?“
Der Advokat fuchtelte, bevor er sprechen konnte.
„Bin nicht etwa ich der Vorsitzende des Komitees und muß ich nicht als erster wissen, ob etwas geschieht, ob etwas, sage ich, geschehen kann?“
„Bevor die Post da ist?“
„Die Post! Die Post, mein Herr, war schon öfter da. Die Post hat zum Beispiel mir: verstehen Sie wohl, mein Herr, mir dem Vorsitzenden des Komitees, einen Brief ihrer Exzellenz der Frau Fürstin Cipolla gebracht, mit der gütigen Erlaubnis der Frau Fürstin, das Schloßtheater zu benutzen für die Vorstellungen der Truppe, die wir, das Komitee, hierher zu verschreiben gedächten. Und das war bereits kein geringer Erfolg, wenn Sie bedenken —“
Der Advokat wendete sich zum Reisenden; einen seiner mürben Finger, die ihn älter machten als sein Gesicht, reckte er hinter sich, wo die Treppengasse zum Kastell hinaufbog.
„— daß das Theater seit fünfzig: seien wir genau, seit achtundvierzig und dreiviertel Jahren unbenutzt steht, nämlich seit der Vermählung des armen Fürsten . . .“
„War die Vorstellung gut, Advokat?“ fragte beißend der Gemeindesekretär. „Sie haben doch schon damals den Impresario gemacht? Denn wann waren Sie untätig? Gewiß nicht einmal in den Windeln.“
Und der Advokat, mit verächtlichem Achselzucken:
„Des armen Fürsten, um den ihre Exzellenz noch trauert. Darum darf ich auch die Bewilligung unseres Gesuchs mir ganz persönlich zuschreiben und dem Umstande, daß ich der Sachwalter der Frau Fürstin bin.“
„Aber der Kapellmeister?“ fragte sein Gegner. „Sollte nicht auch er einiges Verdienst haben? Alfò, sage unserm Freunde, ob du und die andern alle in der ‚Armen Tonietta‘ eure Instrumente spielen könntet, wenn nicht unser Maestro Dorlenghi wäre!“
„Wer leugnet seine Tüchtigkeit? Übrigens zahlt die Gemeinde ihm hundert Lire monatlich und die Kirche fünfzig. Aber scheint es den Herren nicht, daß wir auf die Künstler, die er uns verschaffen wollte, recht lange warten müssen?“
„Ich wette, daß sie heute in der Post sitzen werden!“ rief der Apotheker. Der Advokat bezweifelte es.
„Vielleicht werde ich als Vorsitzender des Komitees mich noch selbst nach ihnen umsehen müssen. Wer weiß, wohin ich fahren werde: bis nach Rom vielleicht.“
„Aber Advokat,“ sagte der Gemeindesekretär, „was verstehen Sie vom Theater?“
„Ich? Sie vergessen, Herr Camuzzi, daß ich in einer Stadt wie Perugia studiert habe. Dort hatten wir oft genug eine Truppe von Komödianten, und wir Studenten verkehrten mit ihnen, kann ich den Herren sagen, nicht anders, als ich mit Ihnen verkehre. Die Choristinnen: ah! ich sage nur dies Wort, die Choristinnen . . . Natürlich hatte auch die Primadonna den ihren, aber man mußte reich sein, sehr reich; ich erinnere mich, ein Herr aus der Stadt gab ihr dreihundert Lire im Monat. Begreifen Sie das? Dreihundert Lire für eine Frau!“
Da der Advokat in lauter achtungsvolle Gesichter sah, blühte er auf. Er öffnete seinen schwarzen Rock, obwohl keine Weste darunter war. Die Arme in der Luft gerundet, mit rauhen gelben Manschetten, die bis über die Korallenknöpfe herausfielen, und mit einer Flüsterstimme, aus der manchmal ein heiseres Bellen brach:
„Aber so ist die große Welt: man muß sie kennen. Die Herren Künstler sind die großartigsten von allen. Man hat keinen Begriff von dem Leben, das diese Schauspieler und Literaten führen. Jede Nacht Champagner, schöne Weiber, soviel sie mögen, und nie vor zwölf aus dem Bett.“
„Als ich in Forlì stand,“ sagte der Leutnant der Carabinieri, „zeigte man mir einen Maler, der zwei Fiaschi trinken konnte. Freilich war er ein Deutscher.“
„Wozu auch,“ schloß der Advokat, „da sie spielend mehr Geld verdienen, als sie brauchen, und keine Sorgen haben. Für uns Bürger ists anders eingerichtet auf der Welt. Aber es ist nicht übel, daß es auch Menschen gibt, die ein so leichtes Leben haben, nach Herzenslust über die Stränge schlagen dürfen und immer guter Laune sind. Haben wir erst einige der Art hier bei uns, wird es lustig werden.“
„Das kann nicht schaden!“ rief der Apotheker. Gleich darauf hielt er sich den Mund zu und schielte nach seinem Hause hinauf. Man lächelte. Er entschuldigte sich.
„Immer sind Leute in der Nähe, die es mit den Priestern halten.“
Der Advokat behauptete:
„Wenn wir uns die Komödianten nicht zu unserm Vergnügen kommen ließen, sollten wir es tun, um die Priester zu ärgern.“ Der Gemeindesekretär hob die Schultern, der Wirt aber sagte dröhnend:
„Sind wir denn noch immer unter dem Papst?“
Man schrie: „Bravo, Achille!“ — und dahinten sah man aus der Kathedrale über den Corso und in den Palazzo Torroni eine schwarze Gestalt huschen. Der Apotheker seufzte.
„Armer Baron! Auch ihn halten sie mittelst der Frau. Da kann man sich dann nicht rühren, ohne daß es weh tut. Glaubt mir, ihr Jungen, nehmt nie eine Frau, die es mit den Priestern hat!“
Der Advokat stellte die Hand an den Mund.
„Und dennoch ist Don Taddeo betrogen, und der Baron hat mir heimlich, Sie verstehen: unter einem Decknamen seinen Beitrag geschickt für das Theater.“
Funkelnd betrachtete er seine Wirkung, legte sich den Finger auf die Lippen und machte eine Pause. Dann:
„Der Beitrag ist sogar bedeutend genug, daß wir den des alten Nardini verschmerzen können.“
„Eine schöne Familie, die Nardini“ — und der Apotheker stieß den Stock aufs Pflaster.
„Ihre Mitbürger halten sie ihres Verkehrs nicht würdig, nie wollten sie dem Klub beitreten, und die Enkelin stecken sie ins Kloster!“
„Noch ist sie nicht darin“, sagte der junge Savezzo, mit plumper Eleganz an das Haus gelehnt. „Und als ich im Klub meinen Vortrag über die Freundschaft hielt, hat sie ihre Magd hingeschickt und sich darüber berichten lassen.“
„Ah, Totò möchte sie draußen behalten.“
Unter den spöttischen Blicken begann das linke Auge des jungen Menschen auf seine pockennarbige Nase zu schielen. Der schöne Alfò, des Wirtes Sohn, sagte:
„Ist sie schön, die Alba!“
Dann sah er unbeirrt und eitel umher.
„Ihr beide werdet keinen Erfolg haben“ — und der Gemeindesekretär lachte auf. „Hat doch nicht einmal der Severino Salvatori sie bekommen, obwohl er mit einem Korbwagen umherfährt. Vielleicht, wenn ihr keine Mitgift verlangt. Denn der Alte will sie billig los sein. Er ist noch geiziger als fromm.“
„Auch fromm ist er“, versicherte Savezzo. „Und wohltätig. Der alte Brabrà lebt ganz vom Nardini, seit dreißig Jahren bald. Jeden Sonntag nach der Messe wird dort unten in Villascura den Armen das Mehl ausgeteilt. Alba selbst tut es.“
„Alba selbst“, wiederholte Alfò.
„Aber als ich ihm die Liste brachte,“ sagte der Advokat mit steilem Finger, „wissen Sie wohl, was der Nardini mir geantwortet hat?“
Alle wußten es, ließen sich aber gern zum zehntenmal dadurch aufbringen.
„Er hat mir geantwortet: wenn er dafür zahlen solle, daß die Komödianten fortbleiben, dann wolle er zahlen.“
Der Apotheker schlug auf den Tisch; das Schweigen der andern war stürmisch. Da sagte der schöne Alfò, und das einfältigste Lächeln legte seine weißen Zähne frei:
„Dennoch will ich Alba heiraten.“
Niemand würdigte ihn einer Entgegnung.
„Auch seinen Wasserfall“, erinnerte sich der Gevatter Achille, „hat er der Stadt ein wenig teuer verpachtet.“
„Unsere Schuld“ — und der Gemeindesekretär hob die Schultern; „ich war gegen die Elektrizitätsanlage und bin es noch. Aber man hört nicht auf mich“, sagte er mit einem Blick auf den Advokaten, der die Arme in die Luft warf.
„Wollen wir, ja oder nein, den Fortschritt?“ schrie er keuchend.
„Und wem verdanken wir ihn,“ antwortete der junge Savezzo, „als einzig dem Advokaten?“
„Ist es einer Stadt wie der unsrigen würdig,“ fragte der Advokat weiter, „die öffentlichen Plätze mit Petroleum zu erleuchten? Und wie sollen wir vor den Fremden dastehen, die uns besuchen werden, wenn unsere Theatersaison begonnen hat?“
„Versteht sich“, machten die andern; nur der Sekretär schüttelte die zusammengelegten Hände.
„Da haben wirs. Weil wir eine Theatersaison haben, müssen wir elektrisches Licht anlegen, und weil wir wie Venedig oder Turin das Verfassungsfest feiern, mußten wir in einem Feuerwerk fünftausend Lire abbrennen. So zieht eine Tat des Größenwahns die andere nach sich, und das Ende, das ich voraussehe, ist der Bankerott. Ah, Ihr Herren, unsern Bürgermeister, den würdigen Herrn Augusto Salvatori, der das Haus nicht mehr verläßt, trifft keine Schuld: sie trifft nur einen!“
Und er stieß mit dem Finger nach dem Advokaten, der sich auf dem Stuhl umherwarf.
„Wollen wir, ja oder nein, den Fortschritt?“
Da rundete der Leutnant die Hand am Ohr:
„Mir scheint, ich höre sie knarren.“
Sogleich bekamen alle lauschende Mienen. Savezzo und Alfò stürzten an die Hausecke und spähten die Gasse hinab. Plötzlich schrien sie durch die gerundeten Hände:
„He! Masetti! Langsamer!“
Und unter wütendem Peitschenknallen hörte man die Post drunten auf der Landstraße vorbeirasseln. Indes sie den Bogen zum Tor machte, wurden Masettis phantastische Verspätungen aufgezählt; er habe keine Eile, zu seiner Frau zu kommen; — und nun er auf den Platz bog, begannen alle zu pfeifen. Die beiden Carabinieri ließen sich von ihren Pferden herab und hoben die Dreimaster, um sich die Köpfe zu trocknen. Die Diligenza fuhr mit Krachen beim Postamt vor: da zeigte sich, daß sie ganz gefüllt war. Drinnen saßen acht Personen, und eine kletterte soeben vom Bock: ein gedrungener Mann mit einem Cäsarenprofil, den der Handlungsreisende fast für einen Berufsgenossen gehalten hätte. Nur hatte er blaurasierte Wangen und Bewegungen von unbekannter Spannkraft und Form.
Kaum daß die Pferde stillstanden, stürzten über die Füße der andern hinweg zwei Nonnen aus dem Wagen und eilten, so daß die Kreuze der Rosenkränze von ihren Hüften aufflogen, nach dem Treppenweg zum Kloster. Dann stieg ein schöner bleicher junger Mensch heraus, der unbeteiligt umhersah.
„Nello!“ rief eine Frauenstimme. „Hilf mir heraus!“
„Laß lieber mich“, sagte ein hagerer Alter, weiß angezogen und rascher als ein Jüngling; — und er streckte eine faltige Hand aus, worauf ein großer Brillant blitzte.
Der Advokat bemerkte:
„Aber das sind sie! Das sind die Komödianten. Ich als Vorsitzender des Komitees muß sie begrüßen.“
Er erhob sich und schwänzelte über den Platz. Die andern folgten im Abstand.
Aus der Post ward eine schwarze lachende Person gehoben, aber wer sie von hinten unter den Armen hielt — der Advokat mußte auf halbem Wege stehen bleiben — das war, mit dem blonden Schnurrbart über dem roten Gesicht, der Baron Torroni! Er wandte sich um; aus seiner Jagdtasche sahen die Vogelschnäbel; und er setzte noch eine Frau aufs Pflaster: ein kleines unansehnliches Wesen in einem schmutzfarbenen Mantel, wie ein Sack, und die Haare voll Staub. Hinterher, mit einem ausgelassenen und dennoch bestürzten Gesicht, kam der Tabakhändler Polli.
„He! Polli! Was ist denn mit dir geschehen?“ rief der Apotheker.
Der Tabakhändler gesellte sich ihnen zu.
„Ach ja, das fragt nur! Die eine hätte mir fast einen Kuß gegeben: jene große Schwarze.“
„Ein prachtvolles Weib. Die wird eine Stimme haben!“ meinte der Advokat.
„Ich sage euch, sie kann schreien! Geschichten sind heute in dem alten Karren erzählt worden! Ich möchte wissen, ob die beiden Nonnen sie schon kannten. Immer lauter haben sie gebetet, — und seht nur, wie sie laufen!“
„Wozu müssen diese heiligen Unterröcke immer unterwegs sein?“ fragte der Advokat. „Auf allen Straßen sieht man nur sie.“
Polli raunte:
„Und seht euch den Alten an: er ist geschminkt!“
Die Gruppe der Bürger schielte zu den Komödianten hinüber. Der Advokat fand es schwerer als in seinen Studentenerinnerungen, mit ihnen anzuknüpfen. Der untersetzte Mann vom Bock, der ihm noch am meisten Vertrauen eingab, ließ den Kutscher das Gepäck herabheben. Den übrigen schüttelte der Baron Torroni die Hände. Er versprach, ihnen seine Vögel ins Gasthaus zu schicken, machte seine eckigen Kavalleristenverbeugungen und brach sich einen Weg durch die Kinder und Mägde, die herumstanden. Wie er in seinen Ledergamaschen auf sein Haus zuging, schlüpfte eine schwarze Gestalt heraus und in die Kirche.
Mehrere Geschäftsleute stellten sich ein, um nach ihren Paketen zu sehen. Der Kaufmann Mancafede bemühte sich längst um die seinen. Trotz aller Spätsommerhitze war er in seiner dicken braunen Jacke. Das gewölbte Auge in seinem alten Hasenprofil suchte ängstlich und zäh unter den Körben dort oben.
„Und das Petroleum?“ fragte er gelassen und richtete seinen trockenen Finger auf den Kutscher Masetti. Der tat droben einen erbosten Sprung. Er schrie hinab, für so viel Mühe sei er nicht bezahlt; diese Fremden hätten Gepäck für einen ganzen Eisenbahnzug; noch ein Wagen komme mit Leuten und Koffern: darauf werde, wenn Gott es wolle, auch das Petroleum sein. Und durch den abfälligen Empfang, der ihm bereitet worden war, noch tiefer gefärbt als sonst, schwenkte er die ausgebreiteten Arme tobend über der Menge, vor dem blauen Himmel.
Der Kaufmann prüfte ihn blinzelnd und wandte sich an den Tabakhändler.
„Polli, deine Magd ist die letzte Nacht nicht zu Hause gewesen.“
Der Tabakhändler rötete sich.
„Sagt die Evangelina es?“
„Ja“, erklärte Mancafede mit Ruhe und Sicherheit.
„Und dann sagt meine Tochter auch, die Komödianten werden kommen . . . Das sind sie wohl?“ — und zum erstenmal schien er sich umzusehen.
„Meine Lina weiß, daß der berühmte Tenor Giordano dabei ist.“
Plötzlich drehte der weiß angezogene Alte sich um. Leicht und doch groß sagte er: „Das bin ich: der Cavaliere Giordano.“
Ein Augenblick, und der Advokat war über die Hand des alten Sängers hergefallen.
„Sie, Cavaliere! Welch Wiedersehen! Sie erinnern sich doch unserer Bekanntschaft in Perugia? Belotti, Advokat Belotti. Wir verkehrten beide im Café „zur alten Treue.“ Wir spielten Domino, und ich besiegte Sie immer, Sie zahlten all meinen Punsch . . . Wie, Sie wissens nicht mehr? Ach ja, das sind wohl dreißig Jahre her, und was haben Sie seitdem erlebt! Der Ruhm, die Frauen, die großen Reisen! Das nenne ich Leben. Hier in der kleinen Stadt: — nun, Sie werden uns kennen lernen; auch wir können lustig sein, auch wir wissen die Kunst zu schätzen. Meine Freunde werden glücklich sein, Sie kennen zu lernen.“
Er winkte sie herbei.
„Herr Acquistapace, unser Apotheker; Herr Polli, mit dem Sie die Reise gemacht haben; Herr Cantinelli, der brave Anführer unserer bewaffneten Macht . . .“
Und um nicht seinen Gegner, den Gemeindesekretär, vorstellen zu müssen, griff er aus den Umstehenden einen andern heraus.
„Herr Chiaralunzi, höchst geschickter Schneider, der im Orchester das Tenorhorn blasen wird.“
„Und wie!“ meckerte das hämische Stimmchen des Barbiers Nonoggi.
Aber der lange starkknochige Schneider trat vor, sah sich langsam und ehrlich die Fremden an, — und dann verbeugte er sich mit Wucht, daß die Spitzen seines hängenden, rostroten Schnurrbartes schaukelten vor dem kleinen unansehnlichen Wesen im schmutzfarbenen Mantel. Sie stand, indes ihre Kameraden zusammen flüsterten und lachten, ganz allein; durch die Taschenwände sah man, daß sie Fäuste machte; und ihre weit voneinander entfernten Augen gingen kalt über die wachsende Menge, als prüfte eine Macht die andere. Beim Anblick des vor ihr gekrümmten Schneiders bekam sie unvermutet ein Kinderlächeln und gab ihm eine kleine graue Hand.
Darauf schüttelte er die Rechte des alten Tenors, der über die andern Sänger eine Gebärde beschrieb, ohne daß er dabei hinsah: wie ein Fürst, der sein Gefolge vorstellt.
„Herr Virginio Gaddi, Bariton.“
Der untersetzte Mann mit dem Cäsarenprofil mischte sich, eine Hand in der Hosentasche, unter die Bürger.
„Fräulein Italia Molesin, Sopran.“
Die derbe Schwarzhaarige lachte mit großen Zähnen allen zu und stieß dabei kokett mit den Schultern, um den Schal zurückzuwerfen; denn sie trug einen Schal, wie die Masse der Mädchen, und keinen Hut.
„Herr Nello Gennari, lyrischer Tenor.“
Da sahen die Frauen das mattbleiche Gesicht des jüngsten Mannes sich ihnen zuwenden. Weil es einfach und stark gemeißelt war, erkannten die am weitesten Entfernten es, reckten sich und sagten laut:
„O! Ist er schön!“
Seine Augen dankten ihnen allen, ohne Überraschung und ohne Eifer, mit ein wenig schwermütigem Spott.
Nun aber wendete der Cavaliere Giordano sich nach dem Mädchen um, das für sich stand, beugte leicht vor ihr den Rumpf und sagte mit entzückter Stimme:
„Und dies ist unsere Primadonna assoluta, das Fräulein Flora Garlinda, eine Künstlerin von unermeßlicher Zukunft, die Hoffnung der lyrischen Bühne Italiens.“
Dann sah er erwartungsvoll die Bürger an. Der Advokat, der ihr am nächsten stand, fuhr ein wenig zurück; und dann huldigte er der Primadonna um so ehrfurchtsvoller, je weniger er sie vorher beachtet hatte. Er fragte sie, ob sie schon in der Scala gesungen habe. Sie zuckte die Achseln und krümmte den Mund, als verachtete sie die Scala. Darauf machte er einen großen Kratzfuß.
„Ein Fräulein wie Sie muß wohl Liebhaber haben, so viele es nur will.“
Sie lachte auf und ließ ihn stehen. Er schielte nach rechts und nach links, ob man es gesehen habe; — aber in diesem Augenblick schwankte die Menge: jemand teilte sie, mit den Armen stürmisch über ihren Schultern rudernd.
„Der Maestro!“
Er war angelangt; er keuchte. Seine helle Gesichtshaut war unter seinem leichten blonden Bart ganz rosig bewölkt, sein verlegen ehrgeiziges Lächeln zerging manchmal, und dann sah man, daß er zornig war. Er setzte an:
„Das ist aber . . . Ich denke doch, ich bin hier der Kapellmeister . . . Die von mir engagierten Künstler sind da, und niemand ruft mich? Herr Advokat, ich muß Sie . . .“
Der Advokat klopfte ihn auf den Rücken.
„Mein lieber Dorlenghi, alles geht gut, ich habe mich als Vorsitzender des Komitees mit diesen Herren bereits ins Einvernehmen gesetzt.“
„Aber ich begreife nicht, wie man ohne mich . . . Dann führen doch Sie den Kapellmeisterstab!“
„Seien Sie gut, Dorlenghi!“ sagte der Apotheker, und Polli, der Tabakhändler, meinte:
„Das alles ist doch nicht der Mühe wert.“
Der Musiker warf die Arme noch höher.
„Nicht der Mühe wert! Ah! Cavaliere: denn ich irre mich nicht, Sie sind der Cavaliere Giordano, und ich heiße Enrico Dorlenghi und bin Dirigent einer Dorfkapelle, nichts weiter. Ich habe in meinem Zimmer gesessen, da hinten in einem Winkel der Stadt, wo man nichts hört noch sieht, und habe an einer Messe geschrieben, die ich noch diesen Herbst in der Kirche aufführen soll. Inzwischen ernten diese Herren die Frucht meiner Bemühungen; denn ich bin stolz, Sie, Cavaliere, unserer Bühne gewonnen zu haben, Sie und Ihre Kollegen. Nicht der Mühe wert! Wenn Sie ahnten, welch ein Ereignis für einen Verbannten, Geopferten —“
Er ging mit dem alten Sänger um den Postwagen herum; seine keuchende Stimme versank manchmal, denn das Volk schrie ihm zu. Viele schrien auf einmal „bravo Maestro!“ andere: „Seht, er ist verrückt geworden!“ Und die meisten wußten nicht, wer gemeint war, und riefen „he, Masetti!“ nach dem Kutscher, der, stimmlos vom Schelten, an den Pferden zerrte. Er saß mit ihnen fest; Jungen krochen zwischen den Beinen der Menge hervor und kniffen ihn. Er schlug aus . . . Inzwischen ward der Kapellmeister wieder sichtbar, noch immer fuchtelnd. Plötzlich stand er vor der Primadonna. Wie der Cavaliere sie nannte, sahen sie sich an. Der Musiker war auf einmal verstummt, die junge Sängerin sah aus, als gölte es: und die Hände, die sie sich hätten reichen sollen, noch in der Schwebe, traten beide ein wenig zurück. Dann begrüßten sie sich: er rosig von verlegenem Ehrgeiz, sie mit dem entschlossenen Blick von Macht zu Macht, den sie auch auf das Volk gerichtet hatte. Der Kapellmeister sagte:
„Ich würde mich an die ‚Arme Tonietta‘ nicht heranwagen, hätte ich für die Hauptrolle nicht Sie gewonnen, Fräulein Flora Garlinda.“
Sie lächelte gnädig.
„Auch Ihr Name, Maestro, fängt an, sehr bekannt zu werden. Noch neulich in Sogliaco sagte der Direktor Cremonesi . . .“
Er hatte ein Gesicht wie ein Hungernder. Aber ihre Worte gingen aus, wie er kaum anfing, sie zu verschlingen. Der Gastwirt Malandrini bot ihr eins seiner beiden Zimmer an. Der große beleibte Mann war lautlos, man wußte nicht wie, durch das Gedränge gelangt, lächelte breit und glatt und kannte schon jeden beim Namen.
„Ihnen, Cavaliere, meinen Ehrensalon! Gerade muß ich den Handlungsreisenden haben, der immer herkommt; und zudem ist ein Fremder da, der nichts tut: sonst würde ich alle diese Damen und Herren zu mir einladen. Sie aber, Fräulein Flora Garlinda . . .“
Die Primadonna lehnte ab; sie sei zu arm, um ins Gasthaus zu gehen.
„Der Direktor Cremonesi“, sagte angstvoll der Maestro, „gilt für geschickt.“
Der Perückenmacher Nonoggi kam dazwischen, dienerte auf einem Bein und empfahl sich den Künstlern. Er hielt einen Haubenstock und rief zärtlich:
„O! welch schöne Perücke. Wie sollte einen Mißerfolg haben, wer solche Perücke trägt!“
„Was höre ich?“ sagte der Wirt, „der Herr Cavaliere hat schon bei dem Herrn Gemeindesekretär gemietet? Aber das Fräulein Italia Molesin? Verständigen wir uns, Fräulein! Sie sind die Schönste von allen . . .“
„Sein Urteil zählt“, sagte der Kapellmeister; „ich glaube, daß er als Bühnenleiter heute —“
„Und die Herren“, kreischte der kleine Barbier, „bitte ich, mir nur einmal über die Wange zu streichen und dann zu sagen, ob man vermuten würde, daß dort je ein Bart gewachsen ist. So rasiere ich!“
„Ah! so ists recht: auch Sie, Herr Nello Gennari. Das Fräulein Italia und der Herr Nello,“ rief der Wirt, „das sind die geehrten Gäste der Herberge „zum Mond“. Masetti, das Gepäck der Herrschaften! Ihr Leute, den Weg frei!“
Die derbe Schwarze hieb einem halb Betrunkenen, der sie betastete, den Fächer um den Kopf. Dazu lachte sie mit ihrer dicken Kehlstimme.
„Ei seht, die Lustige!“ schrie es. „Ist sie sympathisch!“
„Aber seht das böse Gesicht der andern! Kann man so böse sein! Sie wird die Hexen spielen;“ — und die Frauen traten ganz dicht an die Primadonna hinan und starrten ihr tierisch feindselig in die Augen.
„Ich werde dich nicht heiraten“, erklärte Alfò, der Sohn des Caféwirts, mit seinem törichten Lächeln. Sie betrachtete ihn ohne Spott, die Hände in den Manteltaschen.
„Und ich dich nicht, du Schöner!“
„Er ist nicht mehr schön“, sagte eine Frau und schlug sich auf die Brust. „Der Schöne ist jetzt euer Tenor.“
„Man würde sagen, ein junger Heiliger!“
„Wäre er mein Sohn! Mein Sohn ist häßlich und schlägt mich.“
„Zeig uns dein Gesicht! Ich will dich küssen.“
„O du Schamlose!“
Und tief aus der Menge schallte eine Ohrfeige.
„Bravo!“ sagten Männerstimmen. „Sie sind verrückt, die Weiber.“
„Aber auch ich würde mich verlieben!“ rief der biedere Baß des Apothekers Acquistapace; und viele helle Stimmen, auf allen Seiten und weithin, verstört, selig, im Ton des Träumens:
„Ah! seine Augen. Er sieht mich an!“
Er stand allein; seine Kameraden waren von ihm weggetreten wie auf der Bühne, wenn der Beifall nur ihm galt; und die Arme verschränkt, die Schultern hinaufgezogen, führte er sein leichtes und dennoch beschattetes Lächeln über die Gesichter der Menge. Sie antwortete:
„Es lebe der Gennari!“
Die Jungen kreischten:
„Er lebe!“ — und ein Händeklatschen, irgendwo ausgebrochen, griff um sich, sprang über den Platz.
Es ward zerrissen von einem schweren Glockenschlag; und wie vom Turm nun das Ave stieg, wendeten alle sich ab. Die Menge entfaltete, auseinanderrauschend, zwei weite Flügel; zwischen ihnen, am Ende einer stummen Gasse von Menschen, lag vor dem jungen Sänger die kahle Kirchenmauer. Nur auf ihr noch war ein Streif Sonne. Die einsamen Klänge der Höhe; unten das Staunen der Stille: und da ging dorthinten im Sonnenstreif, allein und rasch, eine Frau in Schwarz entlang. Sie war klein und schlank, ging vor Eile ein wenig geneigt; und in dem schwarzen Schleier, den die letzte Sonne durchleuchtete, sah Nello Gennari ein weißes, weißes Profil, dessen Lid gesenkt war und sich nicht hob. Sie langte beim Portal an, stieg zwischen den Löwen hinauf, und schon schwamm vor dem Dunkel, das sie aufnahm, nur noch, kupferrot und besonnt, ihr großer Haarknoten, — da wendete sie sich um, ganz um und sah von oben die Menschengasse hinab. Er dort am Ende hielt die Arme nicht mehr verschränkt, und sein wankendes Lächeln suchte in den Schleier einzudringen, zu jenem verschwimmenden Oval aus fernem Alabaster . . . Ein Augenblick, dann endete das Läuten, die Menge schloß sich wie ein Tor, und aufschreckend sah der Tenor all die Gesichter zurückgekehrt, die er vergessen hatte.
Sein Kamerad, der Bariton, stand vor ihm und sagte:
„Ich war im Ort umher, nach Wohnungen für uns. Wer sich begnügt, zahlt wenig.“
„Gaddi, wer war jene Frau?“
„Schon eine Frau? Immer Frauen! Ah, dieser Nello. Er verliert seine Zeit nicht.“
„Wer war sie?“
„Ich habe nichts gesehen, mein armer Nello. Was willst du: ich bin ein Familienvater voller Sorgen. Gleich werden die Meinen hier sein, vier Köpfe, und es heißt ihnen Obdach schaffen. Ich suche einen gewissen Savezzo, der Zimmer haben soll.“
„Nichts gesehen! Und du mußt — nein bleibe! Dies ist wichtig: ganz nahe mußt du an ihr vorbeigekommen sein.“
„An wie vielen Frauen bin ich vorbeigekommen! Auch du, Nello, wirst glücklich an dieser vorbeikommen, wie noch an jeder. Gehab dich wohl.“
Und der Mann mit dem Cäsarenprofil nahm gesetzten Schrittes seinen Weg wieder auf. Der Tenor drang planlos in die Menge ein. „An ihr vorbeikommen“, dachte er. „Niemals werde ich an ihr vorbeigelangen. Wenn ich sie wiederfinde, werde ich sie lieben: immer, immer.“ Da schlug ein riesiger Federfächer ihm eine parfümierte Luft ins Gesicht. Mama Paradisi, flankiert von ihren beiden Töchtern, versperrte dem jungen Manne den Weg.
„Das ist er!“ flüsterten sie laut, alle drei; sahen ihn starr lockend an aus ihren breiten, weichen, gepuderten Gesichtern, ließen die Fächer ruhen und die durchsichtigen Blusen sich heben und quellen. Der junge Mann hatte, bevor ers wußte, entgegenkommend gelächelt. Mit Stimmen wie Federkissen versicherten sie ihm, daß sie um seinetwillen ins Theater zu gehen gedächten.
„Wir lieben so sehr die Kunst. Werden Sie, wenn wir recht laut klatschen, uns zu Gefallen eine Arie wiederholen?“
Er versprach es, hingerissen, die Hand auf dem Herzen, mit tiefen Blicken in alle drei Augenpaare.
Ein schreckhafter Ruck in der Menge trennte ihn von den Damen. Dahinten, wo ein Paar wachsblasser Hände durch die Luft schwangen, brach ein hohes, zorniges Jammern an.
„Ihr werdets bereuen! Geht nach Hause, geht! Ah! ihr Gesindel, den Komödianten lauft ihr nach, als hieltet ihr euch am Schwanze Satans fest, um desto sicherer zur Hölle zu fahren.“
„Don Taddeo ist heute nicht gut aufgelegt“, sagte jemand, und der Tenor sah in ein Gesicht voll künstlich verwirrter Locken, mit einer pockennarbigen Nase und einem linken Auge, das nicht stillhielt.
„Ich bin der Savezzo; Ihr Kollege Gaddi wird bei uns wohnen. Übrigens bin auch ich ein Künstler, wir werden uns schon verstehen.“
Nello Gennari gab ihm zerstreut die Hand. „Was wollten sie von mir, diese Weiber? Ach, immer dasselbe. Und immer gehe ich ihnen auf den Leim. Es fängt an, mich zu ekeln . . . Aber sie? Wer war sie?“
„Hören Sie, Herr Savezzo, ich sah vorhin . . .“
Aber die schwache wütende Stimme, die Stimme jener in der Luft stehenden, rückwärts gekrampften Hände fuhr dazwischen; sie klang, als rennte sie in einem hektischen Ansturm alles nieder.
„Fort mit ihnen, ehe es zu spät ist! Sonst frißt die Sünde um sich, ihr verbrennt darin! Wehe denen, die diese Leute gerufen haben! Und verdammt sei, wer sie bei sich aufnimmt!“
Mehrere Frauenstimmen antworteten:
„Recht hat er, wir wollen nicht verdammt werden.“
Der junge Savezzo hob die Schultern.
„Was will denn der? Warum sollte ein Biedermann wie der Herr Gaddi . . .“
„Herr Savezzo, ich sah vorhin eine Frau in den Dom treten, wer war sie?“
„In den Dom? Es treten so viele in den Dom . . .“
„Ein schwarzer Schleier, ein kupferroter Haarknoten.“
„Wir haben hier keinen kupferroten Haarknoten. Wie dieser Priester schreit! und immer dasselbe, man versteht einander nicht.“
„Sehr schlank, von sehr weißer Haut“, sagte flehend der Tenor. Die Miene des andern blieb verschlossen. Plötzlich wendete er sich ab und machte zwischen den Zähnen „oho!“
„Was steht ihr und reibt euch am Laster! Packt euch! O! möchte doch der Himmel auch ein Zeichen geben der Gefahr, ihr Blinden!“
Und die Hände dort über den Köpfen schienen mit dem Himmel zu ringen in letzter Not, wie heilige Jungfrauen beim Sterben.
„Solch ein Fanatismus wirkt abstoßend“, sagte der Advokat Belotti erstickt. „Die Damen zweifeln doch nicht, daß uns trotz diesem traurigen Herrn aus der Sakristei sehr wohl bekannt ist, was wir der Kunst schulden. Ich für meinen Teil werde mir jetzt erst recht die Freiheit nehmen, Ihnen, Fräulein Flora Garlinda, mein Haus zur Verfügung zu stellen.“
Die Primadonna erwiderte:
„Ich danke Ihnen. Aber es würde sich für mich nicht ziemen.“
Da wagte der Apotheker Acquistapace sich vor.
„Wenn das Fräulein denn zu einem Junggesellen nicht gehen will: ich bin verheiratet, wir sind eine sehr ehrbare Familie, und wir wissen wohl, daß die Kunst und das Laster zweierlei ist . . .“
„Romolo!“ rief es sehr scharf hinter ihm.
„Meine Liebe?“ — und die Stimme des alten Kriegers versuchte tapfer zu bleiben.
Plötzlich kreischte alles auf; die Menge schwankte und bekam Risse; einige Jungen liefen heulend davon.
„Der Priester hat sie ins Gesäß getreten“, sagte der Advokat. „Er geht zu Gewalttaten über. Soll man seine Kinder von diesem Elenden mißhandeln lassen?“
Dabei zog er selbst sich ganz leise gegen den Laden des Barbiers Nonoggi zurück. Der Apotheker war fort und viele der nächsten hatten sich unauffällig in das gelichtete Volk gemischt. Vor den Sängern lag ein freier Halbkreis. Der Schneider Chiaralunzi durchmaß ihn allein. Er trat vor die Primadonna hin; aber ohne den letzten Schritt zu beenden, halb schwebend, als wollte er ihr seine Gegenwart leicht machen, begann er zu sprechen. Er rieb seine großen weißen Hände mit den Ballen aneinander, und sein Lanzknechtschnurrbart schaukelte.
„Weil nämlich doch das Fräulein, wie es heißt, die einzige unter den Herrschaften ist, die noch nicht gemietet hat, und obwohl ich natürlich nicht würdig bin, aber was meine Frau kocht, läßt sich essen, denn sie kocht auf Genueser Art, denn sie hatte eine Tante in Genua . . .“
„Und ich soll bei Ihnen wohnen?“
„Ja, Fräulein, ja, das wollte ich sagen.“
„Das tue ich gern. So gehen wir! Hier ist alles, was ich bei mir habe.“
Der Schneider hob den leichten Koffer auf seine Schultern, wie auf einen Turm, und ging vor der kleinen zerzausten und schnellen Person her über den Platz, von dem das Volk ablief.
„Freilich blase ich das Tenorhorn“, sagte er. „Doch werde ich, um dem Fräulein nicht lästig zu fallen, damit auf die Akropolis steigen.“
„Ihr spielt hier wohl jeder ein Instrument? Und der Maestro übt euch?“
„O! mich braucht er nicht zu üben. Denn ich selbst bin Chef einer kleinen Bande und spiele des Sonntags in den Dörfern. Man lebt, wie man kann. Wäre nur nicht die schlechte Konkurrenz! Denn das Fräulein hat wohl gehört, was der Barbier Nonoggi über mich sagte. Denn er ist mein Feind. Denn auch er hat solch eine kleine Bande . . .“
„Aber der Maestro, wie ists mit ihm?“
„Der Maestro, das ist etwas anderes. Er hat auf dem Konservatorium studiert.“
„Ah, er hat studiert.“
„Er ist ein sehr großer Musiker und ein guter Mann.“
„Vielleicht ist er ein sehr großer Musiker, — aber ein guter Mann? Er hat mir nicht gefallen. Er sieht aus wie einer, der keinem andern etwas gönnt. Ich würde ihm nicht zu sehr trauen.“
Überrascht wandte sich der Schneider um und spähte von seiner Höhe nach dem Gesicht, das solche ungeahnte Dinge sprach. Sie nickte ihm so fest und streng in die Augen, daß ihm ein Schauer über den Nacken lief.
„Wenn das Fräulein meint“, sagte er gehorsam. „Man kennt die Menschen niemals ganz. Einst, beim Militär, hatte ich einen Freund . . .“
Sie betraten die Gasse der Hühnerlucia. Der Platz blieb fast leer zurück. Eine letzte schwatzende Gruppe wurde von Frauen zerteilt: „Kommt essen!“ und ringsum in die Dunkelheit getrieben. Ein Alter trippelte nach dem Rathaus, zündete zwei Öllampen an und machte sich quer über den Platz an die dritte beim Palazzo Torroni. Zur vierten am Dom gelangte er nicht: der Tenor Nello Gennari war plötzlich da und erschreckte den Alten.
„Hört! kennt Ihr nicht alle Leute hier? Ihr müßt mir sagen, wer jene schwarz gekleidete Frau war. Sie ging, wie es Ave läutete, in den Dom.“
Da der Alte nur grinste:
„Wollt Ihr Geld? Ach, es ist umsonst. Mir geschieht etwas Unbegreifliches. Sie ging hinein, sie allein, vor allem Volk, und niemand hat sie gesehen. Gute Nacht, Alter, die ganze Welt ist stumm.“
Mit einer weiten Geste enteilte er, hob die Matratze von der Domtür, glitt hinein.
„Wenn sie noch da wäre? Vielleicht erwartet sie mich! Vielleicht aber war sie ein Gesicht und nur ich hatte es?“
Die schattigen Räume mit dem Blick durchirrend:
„O Alba! Süßes Morgenlicht, gehe mir auf! Ich liebe dich. Wenn ich dich finde, will ich in dir verbrennen. Soll ich niemals lieben? Ich hasse die Weiber, die ich gehabt habe. Ich bin zwanzig Jahre, und ich will dich lieben, o Alba, immer, immer.“
Er schwankte, im Rausch seines Herzens. Als er dann hinaustrat, ging beim Glockenturm, wo es am dunkelsten war, irgend etwas hin und her, langsam immer hin und her. Der Tenor machte sich rasch herzu.
„Heda, guter Mann, sagt doch . . .“
„Wie?“ fragte der Kaufmann Mancafede und blieb stehen.
„Verzeihen Sie, Herr . . .“
Der junge Mann erwachte verwirrt. Seit einer Stunde lebte er in einer Welt von Abenteuern, denen alles Volk beiwohnte und die doch nur ihm galten. Diese Stadt und das Wunder in ihr hatten ihn erwartet. Er flog von einem zum andern als einziger Fühlender zwischen verzauberten Steinen und fragte nach der wunderbaren Frau.
„Ich wollte nur . . .“ stammelte er. „Mein Herr, ich bin fremd hier.“
„Man weiß“, sagte der Kaufmann. „Der Herr ist einer der Komödianten.“
„Sie werden auch begreifen, mein Herr, daß man in meinem Alter nicht immer . . . daß man . . . O, mein Herr, sie ging in den Dom.“
„Ah! in den Dom ging sie.“
„Sie kennen sie?“
„Das sage ich nicht. Aber um Ihnen gefällig zu sein, will ich mich bei meiner Tochter erkundigen.“
„Sie wollen . . . O!“
Der Kaufmann ging ins Haus. Der junge Mann fragte nicht, wer diese Tochter sei, die das Erlebnis seines Herzens kannte. Er ließ geschehen, daß die Schleier der Verzauberung wieder heraufstiegen. Mit beiden Händen umfaßte er seine Schläfen, tat zwei stürzende Schritte und schüttelte sich ganz.
„O Alba! Süßes Morgenlicht!“
Der Kaufmann kehrte zurück.
„Meine Tochter weiß wohl, wen Sie meinen; aber sie sagt es Ihnen nicht.“
„Warum nicht?“
„Meine Tochter wird auch das wissen.“
„Aber die Frau hat mich angesehen! Sie wandte sich um, noch in der Domtür, und sah mich an, mich allein.“
„Sie hat Sie also angesehen.“
Der junge Mann stampfte auf.
„Wen geht das alles an, als nur mich! Was will Ihre Tochter! Aber sie weiß gar nichts, Ihre Tochter!“
„Oho!“
Der Kaufmann verlor seine Trockenheit.
„Wenn meine Tochter nichts weiß, dann haben Sie geträumt, junger Mann, und es ist nichts geschehen. Was geschehen ist, das weiß sie auch.“
„Warum sagt sies also nicht?“
„Soll sie jener Unglücklichen einen Menschen schicken, der sie verführt? Meine Tochter ist nicht sehr eingenommen für dergleichen. Aber wissen: o, sie weiß alles.“
„Mein Herr“ — und Nellos Stimme schmeichelte. „Hier habe ich einen schönen Ring. Sie sind Kaufmann. Sie werden den Wert dieses Rubins zu bestimmen verstehen. Wissen Sie, zu welchem Preise ich ihn Ihnen gebe? Für den Namen, mein Herr, für den Namen!“
„Lassen Sie doch sehen!“
Mancafede zog den jungen Mann am Ringfinger bis unter die Lampe vor dem Dom. Plötzlich sah er auf, mit schwarzen Runzeln über die Hornränder seines Klemmers hinweg.
„Von wem haben denn Sie einen solchen Ring, junger Mann?“
Nello errötete tief, zog den Finger zurück und machte sich mit einem Gemurmel davon.
„Ich bin ihrer unwürdig! Noch trage ich den Ring von der Frau des Juweliers!“
Und er suchte Dunkel auf.
Aber es blieb nicht dunkel. Aus dem Corso, über den Platz und zum Tor stürmte ein Haufen Jungen mit Kerzen in Papierdüten. Alle schrien:
„Sie kommen! Es kommen noch mehr!“
Sogleich klappten ringsum Fensterläden an die Mauern, und Licht fiel herab. Die Häuser begannen sich wieder zu leeren von Neugierigen, die noch die Münder wischten. Alle sammelten sich am Ausgange des Platzes, reckten die Arme nach dem Tor und lärmten mit. Denn immer lauter ward dorthinten das Gewirr von Lachen und Gekreisch, das Trommeln auf Holz, das Singen . . . Und mit Rasseln, Knallen und Gebell und umtollt von den Windlichtern der Jungen, brach, voll weiblicher Schreistimmen, ein ganz bunter Wagen herein — niemand begriff etwas vor Buntheit — fuhr mitten auf den Platz und war da. Schon standen, rückwärts gebogen, junge Leute darum her und breiteten Arme aus, lauter Arme, die sich wiegten; — und auf allen Seiten des hohen Stellwagens blähten bunte Röcke und Blusen sich auf, wie die Mädchen hinab in die Arme sprangen, mit geschlossenen Augen darauf los, als sei ringsum Wasser. Dann kletterten die Männer herab.
„Die Choristen sind gekommen!“ rief man den Häusern hinan; und die noch droben waren, stiegen auf den Platz. Im Café ward es ganz hell. Der Konditor Serafini im Corso mußte seinen Laden wieder aufgemacht haben, denn der Karren mit dem Gefrorenen klingelte durchs Gedränge. Der Advokat Belotti wand sich hindurch, er keuchte.
„Wir haben Wohnungen, meine Damen, wir sind das Komitee.“
„Wir sind das Komitee“, heulten die Jungen ihm nach.
Der Advokat schwenkte immer krampfhafter seine Liste über den Köpfen. Der Schneider Chiaralunzi und der junge Savezzo riefen ihren Freunden zu, die Musikinstrumente zu holen.
„Gott! Hilf noch dies eine Mal!“ schrie eine Alte, die erdrückt ward; und die Frau des Kirchendieners Pipistrelli:
„Die Welt geht unter: er hat recht, Don Taddeo. O wir Sünder!“
Im Café „zum Fortschritt“ stand man Fuß an Fuß.
„Gevatter Achille! Einen schwarzen Punsch!“ riefen die vordersten; aber der Wirt war hinter seinem Schenktisch eingesperrt und durfte nicht einmal seinen Bauch darüber wegstrecken. Die gefüllten Gläser, die er hinhielt, reichte einer dem andern. Er kam ins Feuer und verkündete dröhnend:
„Für drei Konsumationen eine umsonst!“
Draußen ließ sein Sohn, der schöne Alfò, sich vom Gewühl umherwerfen und konnte nicht mehr zurück. Er lächelte töricht, sooft ihm eine Frau begegnete; aber wie er der kleinen Rina, der Magd des Tabakhändlers Polli, einen Kuß zuwarf, ward er von hinten grob angelassen. Er hatte jemand getreten, den Tenor Nello Gennari, der an der Mauer lehnte, schon im Gäßchen der Hühnerlucia, und im Dunkeln auf seine Lippe biß. Der schöne Alfò entschuldigte sich freundlich.
„Das kommt von all den Mädchen, die hier sind, mein Herr. Man hat so viel zu tun, wenn man schön ist.“
Der Tenor sah ihn an.
„Es muß ein gutes Leben sein,“ sagte er auflachend, „wenn man schön ist.“
„Nicht immer, mein Herr. Denn alle wollen einen heiraten, und ich werde doch nur die Schönste heiraten: Alba Nardini, die schöne Alba.“
„Wie heißt sie, die Schönste?“
Da brach die Musik los, als börsten alle Hörner.
„Sie heißt Alba? Reden Sie doch!“
Der schöne Alfò nickte nur noch. Eine Volkswelle trug ihn weiter. Alles stürzte vor. Um die Musik her begann ein Drehen: die Stadt tanzte. Sie lärmte in der Nacht, war bunt und tanzte. Nello Gennari ging, den Kopf im Nacken, mit von sich gestreckten und gerungenen Händen, ganz langsam in die Gasse der Hühnerlucia hinein.
„Sie heißt Alba!“
Plötzlich fiel er mit Brust und Gesicht gegen die feuchte schwarze Mauer und weinte über das Wunder.
II
Um fünf, bevor es heiß ward, machte der Advokat Belotti, schon im schwarzen Rock, der hinten spitz abstand, seinen Morgenspaziergang. Wie gewöhnlich wollte er, um auf die Straße zu gelangen, durch den Garten des Palazzo Torroni hinabsteigen; hinter einer Säule im Flur kam aber Saverio hervor, der Hausmeister, Kammerdiener und Gärtner, und stellte die Hand an den Mund.
„Herr Advokat!“
„Was gibt es, Saverio?“
Da der Diener flüsternd sprach, tat auch der Advokat es.
„Der Herr Baron ist die Nacht draußen gewesen. Noch immer ist er draußen.“
„Ah! diese Jäger. Die Jagd, mein Freund, ist eine Leidenschaft, die einen Mann ganz hinnimmt. Wenn ich Ihnen von mir selbst sprechen soll . . .“
„Aber es handelt sich nicht um Jagd, Herr Advokat. Er ist ins Gasthaus „zum Mond“ gegangen und noch nicht wieder herausgekommen.“
Der Advokat öffnete den Mund und erhob den Zeigefinger.
„Schau, schau“, sagte er, — und er begann zu lachen, zuerst ein lautloses Lachen und dann wie ein heiser rasselndes, woraus Husten und Speien ward. Als er zur Ruhe kam, mit aufgerissenen Augen:
„Werden wir einen Skandal haben, Saverio?“
Und er bot dem Diener die Zigarettenbüchse.
„Die Frau Baronin schläft. Ich habe im Schlafzimmer des Herrn alles umhergeworfen, als sei er früh aufgebrochen, und ich habe die Nacht bei der Haustür verbracht.“
„Wenn Sie nicht wären, Saverio! Möchte ers nicht zu weit treiben und heimkehren, bevor alle auf der Straße sind. Ich gehe, damit uns niemand beisammen sieht. Jetzt ist tiefes Schweigen geboten, Saverio.“
Rückwärts machte der Advokat sich aus dem Hause. Den Morgenspaziergang hatte er vergessen; der Schauplatz des Außerordentlichen verlangte seine Gegenwart. Hinter ihm, im Corso, war ein eiliger Schritt: Don Taddeo. Der Advokat grüßte herzhaft.
„Ein schöner Morgen, wie, Reverendo?“
Der Priester sah ihn an mit ganz roten Augen, zog die Soutane enger um seinen mageren Körper, als fürchtete er eine Berührung, und — klapp, klapp — war er um die Ecke. Der Advokat starrte hinterher.
„Kaum daß er an die Kappe gegriffen hat. Weiß er —? Und er steckt mit der Baronin zusammen. Wir werden einen Skandal haben.“
Ungewöhnlich belebt, schwänzelte er den noch stillen Corso hin und drückte sich, dem letzten Domfenster gegenüber, plötzlich um die Ecke, wo es abwärts zum Gasthaus ging. Nun lag es da, noch halb schlafend, beim Rinnen des Brunnens, an seinem kleinen strohbesäten Platz, mit den Ställen links, der Weinlaube drüben, — und im zweiten Stock stand ein Fenster offen. „Sieh da,“ sagte sich der Advokat, „sie lieben die frische Luft. Aber jetzt wäre es Zeit, zu erwachen.“ Er bückte sich nach einem Steinchen und warf es, heftig keuchend, ins Fenster. „Sie scheinen recht sehr ermüdet und werden auch wissen, wovon.“ Wie er das zweite Steinchen auflas, erschien unter dem Haustor neben dem Wirt Malandrini der Baron Torroni selbst. Er war wie immer im braunkarierten Jagdanzug, mit der Flinte über der Schulter, und stürzte sich schon ein großes Glas Wein in den Schlund.
„Ah!“ rief der Advokat sogleich. „Herr Baron, was für eine schöne und gesunde Beschäftigung ist die Ihre! Wäre ich nicht an meine Studierstube gefesselt —. Und wohin geht es an diesem glänzenden Morgen? Aufs Feld, nach Lerchen? Wohl gar ins Gebirge gegen den Eber?“
„Ich bin gekommen,“ erklärte der andere, „um den jungen Mann abzuholen, der hier wohnt: diesen Sänger —“
„Den Herrn Gennari“, ergänzte der Wirt. „Ich werde Sorge tragen, daß er den Herrn Baron nicht warten läßt. Bemühen Sie sich nicht!“
„Er hat mir versprochen, sogleich fertig zu sein. Inzwischen gehe ich voran.“
Er drückte dem Advokaten die weiche Hand und verschwand rasch.
Der Wirt räusperte sich vorsichtig.
„Sehen Sie das offene Fenster?“
Der Advokat zwinkerte.
„Er ist gar nicht zu Hause gewesen“, sagte der Wirt. „Er ist überhaupt nicht heimgekommen.“
„Ah! dann ist es also nicht dieses Zimmer?“
Malandrini zwinkerte.
„Das ist das andere, daneben. Das Fräulein schläft jetzt weiter.“
„Es scheint, sie hat es nötig. Ah! dieser Baron.“
„Ein richtiger Edelmann“, bemerkte der Wirt.
Sie sahen sich an, leise funkelnd.
„Und der andere?“ begann der Advokat wieder. „Der Komödiant? Auch er ist draußen? Da gibt es vielleicht etwas noch Stärkeres? Mein Freund, mir beginnt zu ahnen, daß wir Dinge erleben werden in der Stadt —“
Der Wirt seufzte. Dann aber, mit Händereiben:
„Das Gute ist dabei, daß wir ein wenig Bewegung herbekommen . . . Entschuldigen Sie mich, ich decke lieber gleich selbst in der Laube die Tische. Meine Frau wird erst spät herunterkommen. Sie schläft noch, denn ihr ist etwas Außerordentliches zugestoßen. Wie ich die Augen öffne und sie vergeblich an meiner Seite suche, tritt sie ins Zimmer, sieht verwacht aus und erklärt mir, daß die Seele ihres Vaters sie hinausgerufen habe. Die Seele habe verlangt, daß ich nicht geweckt werde. So viel Rücksicht!“
„Das ist der Aberglaube der Frauen“, sagte zornig der Advokat. „Wie lange noch werden wir ihre Erziehung den Nonnen überlassen! Sie glauben doch nicht an diese alberne Geschichte, Malandrini?“
„Wie werde ich. In den Frauen geht manches vor, was wir nicht kennen. Man muß Geduld haben.“
„Aber sagen Sie doch, dieses Mädchen! Gleich die erste Nacht! Hätten Sie das etwa geglaubt, Malandrini?“
„Warum nicht?“ — und der Wirt fuhr auf. „Ist das Gasthaus „zum Mond“ denn ein Kloster? Und übrigens, was weiß man. Nur was Sie erzählen, Advokat.“
„Oh!“
Der Advokat legte die Hand aufs Herz.
„Dieser Priester scheint gewußt zu haben,“ sagte er noch und drehte nachdenklich von dannen, „warum er die Komödianten nicht zu seinen Schäfchen hineinlassen wollte. Man muß zugeben, daß seinesgleichen sich auf Menschen versteht.“
„Wollen Sie auf die Straße?“ rief Malandrini ihm nach. „Dann benutzen Sie doch die Gartenpforte!“
„Sie haben recht“ — und der Advokat kehrte um. „Man muß bei seinen ruhigen Gewohnheiten bleiben. Seit siebenundzwanzig Jahren habe ich meinen Morgengang nicht sechsmal versäumt, und ich hoffe ihn noch weitere siebenundzwanzig Jahre zu machen.“
Hinter dem Hause ging er den Weinhügel hinab, erreichte drunten die Straße — noch übergitterten die Schatten der Platanen sie dicht — und nahm den Hut ab, um sich zu trocknen. „Ah, hier atmet man. Solche Luft haben sie nicht in den großen Städten, unsere braven Künstler . . . Der Baron weiß diese Weiber zu nehmen, wie es scheint. Man sagt, daß er als Offizier —. In Rondone soll er ein Kind haben . . . Aber schließlich, was ist dabei? Alles wohl bedacht, könnte es sein, daß auch ich —. Der Junge der Andreina, mag sie es mit der Treue auch niemals genau genommen haben, der Junge wird mir jedes Jahr ähnlicher . . . soweit ein Bauer mir ähneln kann. Damals warf ich die Andreina einfach in das Korn. Mit der Komödiantin muß man es ebenso machen.“
Er hielt an, sah angstvoll umher, wie nach einem passenden Platz, und trocknete sich nochmals. Unter der Straße stiegen die Ölbäume, schwachsilbern, die Erdstufen hinab und setzten über den Fluß, der um ihre dunkeln Wurzeln glänzende Schleifen wand. Die letzten dahinten und die weißen Gehöfte zwischen ihnen schienen vom Meer bespült: so tief blaute schon die heiße Ebene. Über ihm blickte dem Advokaten die Stadt nach, aus blinkenden Scheiben, Mauern, die zwischen zwei Zypressen ein wenig klafften, und ganz schwarzen Torbogen. „Wo dieser Tenor steckt! Denn sagen wir nur die Wahrheit: in einem Winkel der Stadt wird er wohl die Nacht verbracht haben. Zu denken, daß er bei der Frau eines meiner Freunde ist, — der einen sehr guten Schlaf haben muß. Sollte es nicht der Polli sein, mit seinem Schnarchen? Vergangenen Herbst hat er sogar beim Erdbeben weiter geschnarcht! Vielleicht läßt sichs ihm ansehen. Das müßte man einem Manne doch ansehen! Eh, eh, es hat sein gutes, als Junggeselle zu leben. In jedem der Häuser dort oben kann jetzt der Komödiant seine Dinge treiben: nur in meinem treibt er sie sicher nicht . . . Und beim Camuzzi? Wie steht es beim Camuzzi?“ Das aufgeblühte Gesicht des Advokaten fiel ein, da er an seinen Feind, den Gemeindesekretär dachte.
„Er verdient es wie kein zweiter, dieser Ignorant, dieser Unverschämte! Ah! setze noch einmal dein höhnisches Lächeln auf, Freund, — und aus deiner Stirne sieht man es indessen keimen!“
Der Advokat tat einen tiefen, glücklichen Atemzug.
„Das ist wirklich ein sehr schöner Morgen.“
„Aber leider“, bemerkte er dann, „scheint diese kleine Frau Camuzzi zufrieden. Dem Severino Salvatori, der sie in seinem Korbwagen umherfahren wollte, hat sie geantwortet: nicht einmal über den Platz bis vor die Domtür! Und doch sollte ihre Mutter dabei sein. Aber die Camuzzi ist bescheiden und stolz, sieht niemand an, geht immer nur zur Kirche. Nicht viel, und sie gehört zu der Garde des Don Taddeo . . . Nein,“ mußte der Advokat erkennen, „von ihr läßt sich nur wenig hoffen.“
Er richtete sich sogleich wieder auf.
„Aber auch andere wären nicht zu verachten, und ich meinesteils hätte nichts dagegen, wenn die Frau des Doktors —. Ah! die da ist eine Lasterhafte: das fühlt man. Denn erstens ist sie zu dick, um tugendhaft zu sein. Und hat sichs erst gezeigt, daß sie dem Komödianten Gefälligkeiten erweist: — denn was ist der Komödiant und sind andere etwa weniger gut? Wenn ichs recht bedenke, hatte ich in betreff ihrer schon längst meine Vorsätze gefaßt. Ihr Gatte soll sehen, daß der Zucker, den er bei mir feststellen wollte, so etwas nicht verhindert. Zucker, wenn noch so wenig, bei einem Mann wie mir! Und ich soll etwas dagegen tun! Der Doktor wird sehen, was ich tue! Ah! Ah!“
Er rieb die Hände, schwenkte sich herum und lachte keuchend nach der Stadt hinauf. Dann fiel er in Nachdenken: sie sah ganz anders aus. Noch gestern hätte man manches nicht für möglich gehalten. Natürlich gab es in ihr die Dinge, die es überall gibt. Abgesehen von dem Hause in der Via Tripoli: auch die Wäscherinnen auf dem Bäckerberg kannte jeder; und der Advokat war persönlich besonders gut unterrichtet über die Witwe eines städtischen Zollbeamten, die vorgeblich Hüte aufputzte. Ferner bestanden die Gerüchte bezüglich der Mama Paradisi und des alten Mancafede; neuerdings und halblaut auch die über Frau Malandrini und den Baron Torroni, — die der Advokat seit heute früh für unwahrscheinlich hielt. Jetzt aber handelte es sich nicht mehr um die oder jene. Kaum eine blieb, nun der Komödiant umging, noch unerreichbar; und das Prickelndste wäre vielleicht dennoch gewesen, wenn im selben Augenblick, wo der Baron Torroni seine Frau mit jenem Mädchen hinterging, die Baronin es ihm mit dem Tenor vergolten hätte! Der Advokat ward erfinderisch, sein Geist schweifte aus und verwandelte die Stadt in sein freies Jagdgebiet. Dem Komödianten folgte er selbst auf dem Fuße, in jedes Schlafzimmer. Vor dem der Baronin hatte er eine alte Scheu zu überwinden; aber dann hüpfte er, mit einem Schnippchen, auch über diese Schwelle.
Von seiner Phantasie verjüngt, war er dahingeeilt, ohne zu merken, wie seine Arme ruderten und wie es unter seiner Perücke hervortroff. Auf einmal, schon hinter dem öffentlichen Waschhause und auf halbem Weg nach Villascura, sah er sich dem Komödianten gegenüber: ihm selbst. Jener grüßte und wollte langsam vorbei; aber der Advokat fuhr auf, nach Luft schnappend.
„Das ist doch . . . da sind Sie: also, da sind Sie.“
„Da bin ich, zu Ihrer Verfügung“, bestätigte der Tenor.
„Das heißt,“ — und das lederfarbene Gesicht des Advokaten ging in ein zynisches Lächeln auseinander, „wer weiß, zu wessen Verfügung Sie hier sind.“
„Was wollen Sie sagen?“ fragte der junge Mann. Unvermittelt ward er drohend aussehend.
„Nichts, o nichts. Sie gehen spazieren, wie ich bemerke, Herr Gennari. Sie sind früh auf. Ich habe, müssen Sie wissen, die kleine Eitelkeit, jeden Morgen der erste draußen zu sein: aber was tut es einem Manne Ihres Alters, auch einmal um fünf das Bett zu verlassen, wo er eine glänzende Nacht verbracht hat.“
„Meine Nacht“, sagte der Tenor mit feindseliger Zurückhaltung, „war sehr wenig glänzend. Gestern abend empfand ich ein Bedürfnis spazieren zu gehen und wich dabei von der Straße ab. Dann bedeckte sich, wie Sie wissen, der Himmel, ich fand nicht mehr zurück und habe irgendwo dort unten in den Weinfeldern mich schlafen gelegt. Sie sehen die Erde an meinen Kleidern.“
Der Advokat wandte ihn um und musterte alles.
„Das ist erstaunlich.“
Darauf machte er eine gleichgültige Miene.
„Sie haben also ausgeruht. Dann schlage ich Ihnen vor, mich zu begleiten. Ich zeige Ihnen unsere Gegend, mein Herr. An Villascura werden Sie vorbeigekommen sein, wie?“
„Ich weiß nicht, mein Herr, was Sie meinen. Ich sagte Ihnen schon, ich war dort unten.“
Der Advokat sah ihn vorwurfsvoll an, zog schweigend einen Taschenspiegel heraus und hob ihn vor das Gesicht des andern.
„Was soll das?“ fragte der Tenor, aber er sah hinein, — und er fand seine Augen darin noch finsterer, als er sie gewollt hätte, denn sie waren umrändert und das Gesicht sehr blaß. Aus seiner körnigen Marmorblässe war die Wärme gewichen, und die schwarze Haarwelle über der Stirn, die Barren der Brauen, der dickrote Mund sprangen gewaltsam hervor aus dem grellen Weiß.
„Ich sage nicht,“ erklärte der Advokat, „daß es Ihnen schlecht stehe, übernächtig auszusehen. Der Schönheit von euch Jungen schlagen die Strapazen eurer Nächte gut an. Wehe uns reifen Männern! Aber was ich andeuten wollte: ein ruhiger Schlaf auf der weichen Erde des Weinackers, in lauer Nachtluft, hätte Sie schwerlich so zugerichtet.“
Er streckte, bevor der andere aufbrausen konnte, beide Handflächen hin.
„Mein Herr, Sie halten mich offenbar für Ihren Feind. Ich bin nicht Ihr Feind, mein Herr. Im Gegenteil, ich billige durchaus, daß die jungen Leute, noch dazu wenn sie Künstler sind, sich unterhalten. Was tut es übrigens mir, der ich Junggeselle bin. Meine verheirateten Freunde freilich werden in ihrer Anerkennung nicht so weit gehen“ — und der Advokat wagte wieder ein Lächeln.
„Also ich bin Ihr Freund, mein Herr, und wenn Sie mir — als Gentleman werden Sie es natürlich nicht tun — verraten würden, in welchem Hause unserer Stadt Sie diese Nacht verbracht haben: Sie könnten sich verlassen auf den Advokaten Belotti.“
Die Miene des Tenors rüstete plötzlich ab, er sah friedlich, sogar unbeteiligt aus.
„Ach so“, machte er. „In der Stadt glauben Sie —. Warum auch nicht?“
Und er begann zu lachen, mit leichter, heller Glockenstimme. Der Advokat rieb sich die Hände.
„Sehen Sie wohl? Wir fangen an, uns zu verstehen. Wie sollten übrigens zwei Männer wie wir sich nicht verstehen, wenn es sich um die Frauen handelt.“
„Sie haben recht!“ und der Tenor lachte stärker. Der Advokat stieß ihm seinen Zeigefinger vor den Magen.
„Ah! Spaßvogel! Unsere Stadt gefällt Ihnen wohl? Sie