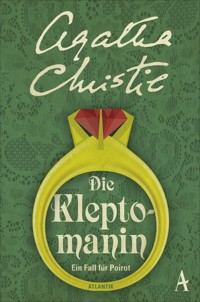
10,99 €
Mehr erfahren.
Als er bemerkt, dass seine Sekretärin in Schwierigkeiten steckt, lässt Hercule Poirot sich nicht lange bitten. Denn Miss Lemon ist untröstlich: Ihre Schwester, Leiterin eines Studentenwohnheims, weiß sich angesichts einer Serie von Diebstählen nicht mehr zu helfen. Poirot erkennt schnell, dass die gestohlenen Gegenstände auf düstere Machenschaften hindeuten und dass ein noch größeres Unglück kurz bevorsteht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 294
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Agatha Christie
Die Kleptomanin
Ein Fall für Poirot
Aus dem Englischen von Jürgen Ehlers
Atlantik
Erstes Kapitel
Hercule Poirot runzelte die Stirn.
»Miss Lemon«, sagte er.
»Ja, Monsieur Poirot?«
»In diesem Brief sind drei Fehler.«
Seine Stimme klang ungläubig. Denn Miss Lemon, diese entsetzlich tüchtige Frau, machte niemals Fehler. Sie war niemals krank, niemals müde, niemals ungehalten, niemals nachlässig. Man könnte sagen, sie war praktisch überhaupt keine Frau. Sie war eine Maschine – die perfekte Sekretärin. Sie wusste alles, sie wurde mit jedem Problem fertig. Sie organisierte Hercule Poirots Leben, sodass auch das wie eine Maschine funktionierte. Ordnung und Methode waren seit langem Hercule Poirots Maximen. George, sein perfekter Kammerdiener, und Miss Lemon, seine perfekte Sekretärin, sorgten dafür, dass in seinem Leben Ordnung und Methode herrschten. Da auf diese Weise alle Ecken und Kanten ausgebügelt waren, bestand keinerlei Anlass zur Klage.
Und dennoch hatte Miss Lemon heute beim Tippen eines einfachen Briefes drei Fehler gemacht und obendrein diese Fehler nicht einmal bemerkt. Die Sterne standen still auf ihrer Bahn!
Wortlos hielt ihr Hercule Poirot das Dokument hin. Er war nicht verärgert, lediglich erstaunt. Dies war eines der Dinge, die nicht passieren konnten – und doch war es passiert!
Miss Lemon nahm den Brief. Sie sah ihn an. Zum ersten Mal in seinem Leben sah Poirot, wie sie errötete. Ein dunkles, unvorteilhaftes Rot verfärbte ihr Gesicht bis zu den Wurzeln ihrer kräftigen, grauen Haare.
»Mein Gott«, sagte sie. »Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen – das heißt, doch, ich kann es mir vorstellen. Es ist wegen meiner Schwester.«
»Wegen Ihrer Schwester?«
Ein weiterer Schock. Poirot hatte nie angenommen, dass Miss Lemon eine Schwester haben könnte. Oder auch nur Vater, Mutter oder Großeltern. Miss Lemon wirkte irgendwie so vollständig mechanisch – wie eine Art Präzisionsinstrument –, dass es geradezu lächerlich erschien, dass sie so etwas wie Meinungen oder Ängste oder familiäre Probleme haben könnte. Es war nur allzu bekannt, dass Miss Lemons Herz und Verstand, wenn sie nicht im Dienst war, der Perfektionierung eines neuen Archivierungssystems gehörten, das patentiert werden und ihren Namen tragen sollte.
»Ihre Schwester?«, wiederholte Hercule Poirot deshalb mit ungläubigem Unterton in der Stimme.
Miss Lemon nickte energisch. »Ja«, sagte sie. »Ich glaube nicht, dass ich sie Ihnen gegenüber jemals erwähnt habe. Sie hat praktisch ihr ganzes Leben in Singapur verbracht. Ihr Mann war in der Gummi-Industrie.«
Hercule Poirot nickte verständnisvoll. Es schien ihm angemessen, dass Miss Lemons Schwester ihr ganzes Leben in Singapur verbracht hatte. Dafür waren Orte wie Singapur da. Die Schwestern von Frauen wie Miss Lemon heirateten Männer in Singapur, sodass die Miss Lemons dieser Welt ihr Leben vollständig mit maschinenartiger Effizienz den Angelegenheiten ihrer Arbeitgeber widmen konnten (und natürlich der Erfindung von Archivierungssystemen – zur Erholung in ihrer Freizeit).
»Ich verstehe«, sagte er. »Weiter.«
Miss Lemon fuhr fort: »Sie ist seit vier Jahren verwitwet. Keine Kinder. Ich habe für sie eine sehr hübsche kleine Wohnung besorgt, zu einer sehr angemessenen Miete …«
(Das war zwar fast unmöglich, aber natürlich würde Miss Lemon genau das geschafft haben.)
»Es geht ihr finanziell nicht schlecht – obwohl das Geld jetzt etwas knapper ist als früher. Aber sie hat keine teuren Hobbys, und sie hat genug, um ein einigermaßen bequemes Leben zu führen, wenn sie aufpasst.«
Miss Lemon machte eine Pause und fuhr dann fort: »Aber, um ehrlich zu sein, sie war natürlich einsam. Sie hatte nie vorher in England gelebt und keine alten Freunde oder Bekannte, und natürlich hatte sie jetzt eine Menge Freizeit. Jedenfalls hat sie mir vor etwa sechs Monaten mitgeteilt, dass sie beabsichtige, diesen Job anzunehmen.«
»Job?«
»Heimleiterin heißt es wohl – in einem Studentenwohnheim. Es gehört einer Frau, deren Vorfahren aus Griechenland stammen und die jemanden gesucht hat, der das Heim für sie leiten könnte. Für die Verpflegung sorgen und dafür, dass alles glattläuft. Es ist eines von diesen altmodischen, geräumigen Häusern – in der Hickory Road, wenn Sie wissen, wo das ist.« Poirot wusste es nicht. »Es war früher eine erstklassige Wohngegend, und die Häuser sind gut gebaut. Meine Schwester sollte eine sehr nette Wohnung bekommen, Schlafzimmer, Wohnzimmer und eine winzige eigene Küche mit Bad …«
Miss Lemon machte eine Pause. Poirot ließ ein ermunterndes Geräusch hören. Bis jetzt schien es ihm ganz und gar nicht wie eine Katastrophengeschichte.
»Ich war mir nicht ganz sicher, was ich davon halten sollte, aber die Argumente meiner Schwester haben mir eingeleuchtet. Sie war nie der Typ, der den ganzen Tag die Hände in den Schoß legt, sie ist sehr praktisch veranlagt und gut darin, Dinge zu organisieren. Und natürlich musste sie kein Geld investieren oder so etwas. Es war ganz einfach ein bezahlter Job. Nicht sehr gut bezahlt, aber das hatte sie auch gar nicht nötig, und es war keine schwere körperliche Arbeit. Sie hat junge Leute immer gern gemocht und kann gut mit ihnen umgehen, und weil sie so lange im Fernen Osten gelebt hat, hat sie auch ein Gefühl für Rassenunterschiede und für die Empfindlichkeiten der Leute. Denn die Studenten in dem Heim kommen aus allen möglichen Ländern. Die meisten sind zwar Engländer, aber es sind sogar Schwarze dabei, glaube ich.«
»Ich verstehe«, sagte Hercule Poirot.
»Heutzutage ist ja anscheinend die Hälfte der Schwestern in unseren Krankenhäusern schwarz«, sagte Miss Lemon skeptisch, »und, soweit ich gehört habe, sind die viel netter und aufmerksamer als ihre englischen Kolleginnen. Aber das tut nichts zur Sache. Wir haben die Angelegenheit durchdiskutiert, und schließlich ist meine Schwester dort eingezogen. Weder sie noch ich haben viel von der Eigentümerin gehalten. Diese Mrs Nicoletis ist eine Frau mit sprunghaften Launen, manchmal charmant, aber manchmal leider auch das genaue Gegenteil. Und sowohl knauserig als auch ohne jeden Sinn fürs Praktische. Aber wenn sie eine kompetente Frau wäre, würde sie ja keine Heimleiterin brauchen. Meine Schwester ist nicht jemand, der sich durch Wutanfälle und Launen aus dem Konzept bringen lässt. Sie weiß sich zu behaupten und lässt keinen Unsinn durchgehen.«
Poirot nickte. Er fühlte sich bei der Beschreibung von Miss Lemons Schwester in gewisser Weise an Miss Lemon selbst erinnert – eine Miss Lemon, gemildert durch die Heirat und das Klima in Singapur, aber mit demselben harten Kern von Vernunft.
»Ihre Schwester hat also den Job angenommen?«, fragte er.
»Ja, sie ist vor etwa sechs Monaten in die Hickory Road 26 gezogen. Im Großen und Ganzen gefiel ihr die Arbeit, und sie fand sie interessant.«
Hercule Poirot hörte zu. Bis jetzt schien ihm das Abenteuer von Miss Lemons Schwester enttäuschend zahm.
»Aber seit einiger Zeit macht sie sich große Sorgen. Sehr große Sorgen.«
»Warum?«
»Nun ja, Monsieur Poirot, da spielen sich Dinge ab, die ihr einfach nicht gefallen.«
»Sind die Studenten beiderlei Geschlechts?«, fragte Poirot vorsichtig.
»O nein, Monsieur Poirot, das meine ich nicht. Auf Probleme in dieser Hinsicht ist man immer vorbereitet, nicht wahr, die erwartet man geradezu! Nein, es ist etwas ganz anderes: Gewisse Dinge sind verschwunden.«
»Verschwunden?«
»Ja. Und so seltsame Dinge … Und immer auf so ungewöhnliche Weise.«
»Wollen Sie damit sagen, dass sie gestohlen worden sind?«
»Ja.«
»Ist die Polizei informiert?«
»Nein. Bis jetzt noch nicht. Meine Schwester hofft, dass das nicht nötig ist. Sie mag diese jungen Leute – einige jedenfalls –, und es wäre ihr viel lieber, wenn sie diese Angelegenheit selbst in Ordnung bringen könnte.«
»Ja«, sagte Poirot gedankenvoll. »Das leuchtet mir ein. Aber das erklärt noch nicht, wenn ich das so sagen darf, warum Sie sich Sorgen machen, die eigentlich die Sorgen Ihrer Schwester sind.«
»Mir gefällt die Geschichte nicht, Monsieur Poirot. Sie gefällt mir ganz und gar nicht. Ich habe das Gefühl, dass hier etwas vorgeht, was ich nicht verstehe. Es gibt keine vernünftige Erklärung für das, was sich da abgespielt hat – und, um ehrlich zu sein, ich habe überhaupt keine Erklärung dafür.«
Poirot nickte gedankenvoll.
Miss Lemons Achillesferse war schon immer ihre Phantasie gewesen. Sie hatte keine. Was Tatsachen anging, war sie unschlagbar. Wenn es dagegen um Vermutungen ging, war sie verloren. Es interessierte sie nicht, was Cortez’ Männer gedacht haben mochten, als sie den Golf von Daren erblickten.
»Also nicht die üblichen kleinen Diebstähle? Ein Kleptomane vielleicht?«
»Ich glaube nicht. Ich habe das nachgeschlagen«, sagte die gewissenhafte Miss Lemon, »in der Encyclopaedia Britannica und in einem medizinischen Fachbuch. Aber das hat mich nicht überzeugt.«
Hercule Poirot schwieg für einen Augenblick.
Sollte er sich wirklich mit den Schwierigkeiten von Miss Lemons Schwester befassen und sich in die Sorgen und Leidenschaften eines multikulturellen Studentenwohnheims einmischen? Andererseits war es lästig, wenn Miss Lemon Fehler beim Tippen seiner Briefe machte. Er versuchte sich einzureden, dass nur das der Grund für sein Interesse an dieser Angelegenheit sei. Er war nicht bereit, sich einzugestehen, dass er in letzter Zeit etwas gelangweilt war und dass ihn darüber hinaus auch die pure Trivialität dieser Angelegenheit reizte.
»›Die Petersilie, die an einem heißen Tag in die Butter sinkt‹«, murmelte er.
»Petersilie? Butter?« Miss Lemon sah ihn verblüfft an.
»Ein Zitat von einem Ihrer Klassiker«, sagte er. »Sie sind doch sicher vertraut mit den Abenteuern – um nicht zu sagen Heldentaten von Sherlock Holmes?«
»Sie meinen diese Baker-Street-Vereinigung und all dieses Zeug?«, sagte Miss Lemon. »Dass erwachsene Männer sich mit so albernen Dingen befassen können! Aber das ist typisch Mann! Genau wie das Spielen mit elektrischen Eisenbahnen. – Ich will nicht behaupten, ich hätte nie die Zeit gehabt, solche Geschichten zu lesen. Aber wenn ich Zeit zum Lesen habe, was selten genug der Fall ist, dann bevorzuge ich etwas Lehrreiches.«
Hercule Poirot neigte würdevoll sein Haupt.
»Wie wäre es, Miss Lemon, wenn Sie Ihre Schwester einmal einladen würden – zum Tee vielleicht? Es könnte sein, dass ich ihr helfen kann.«
»Vielen Dank, Monsieur Poirot, das ist wirklich sehr nett von Ihnen. – Meine Schwester hat nachmittags immer frei.«
»Dann lassen Sie sie uns für morgen einladen.«
Gesagt, getan. Und der getreue George wurde angewiesen, einen Imbiss vorzubereiten aus quadratischen, gebutterten crumpets, symmetrischen Sandwiches und anderen leckeren Bestandteilen eines üppigen englischen Nachmittagstees.
Zweites Kapitel
Mrs Hubbard war ihrer Schwester sehr ähnlich. Ihre Haut hatte einen gelblicheren Teint, sie hatte eine rundere Figur, war aufwendiger frisiert und weniger brüsk im Umgang, aber aus ihrem runden und liebenswerten Gesicht leuchteten dieselben scharf blickenden Augen, die einen durch Miss Lemons Kneifer anblickten.
»Das ist wirklich sehr nett von Ihnen, Monsieur Poirot«, sagte sie. »Sehr nett. Und solch ein köstlicher Tee noch dazu. Ich habe sicher viel mehr gegessen, als ich sollte – na gut, vielleicht noch ein Sandwich – Tee? Ja, bitte, noch eine halbe Tasse.«
»Zuerst kommen die leiblichen Genüsse«, sagte Poirot. »Dann das Geschäftliche.«
Er lächelte sie auf liebenswürdige Weise an und zwirbelte seinen Schnurrbart, und Mrs Hubbard sagte: »Wissen Sie, Sie sind genau so, wie ich Sie mir nach Felicitys Beschreibung vorgestellt habe.«
Nach einem Moment der Überraschung, in dem ihm bewusst wurde, dass Felicity der Vorname der gestrengen Miss Lemon sein musste, antwortete Poirot, dass er bei Miss Lemons Tüchtigkeit auch nichts anderes erwartet hätte.
»Allerdings«, sagte Mrs Hubbard abwesend, während sie ein zweites Sandwich nahm, »hat sich Felicity nie viel Gedanken um andere Menschen gemacht. Im Gegensatz zu mir. Deshalb bin ich ja so besorgt.«
»Könnten Sie mir genau erklären, was Sie beunruhigt?«
»Ja, das kann ich. Ich könnte es ja verstehen, wenn Geld wegkommen würde, kleine Beträge hier und da. Und wenn es Schmuck wäre, dann wäre das auch in Ordnung – ich meine nicht in Ordnung, ganz im Gegenteil –, aber es würde irgendwie passen, zu Kleptomanie oder Unehrlichkeit. Aber ich denke, es ist am besten, wenn ich Ihnen einfach eine Liste der Dinge vorlese, die abhandengekommen sind; ich habe alles aufgeschrieben.«
Mrs Hubbard öffnete ihre Tasche und entnahm ihr ein kleines Notizbuch.
Abendschuh (einer von einem neuen Paar)
Armband (Modeschmuck)
Diamantring (wiedergefunden in Suppenteller)
Puderdose
Lippenstift
Stethoskop
Ohrringe
Feuerzeug
alte Flanellhose
Glühbirnen
Pralinenschachtel
Seidenschal (wiedergefunden, in Stücke geschnitten)
Rucksack (ebenso)
Borax-Pulver
Badesalz
Kochbuch
Hercule Poirot atmete tief ein.
»Bemerkenswert«, sagte er, »und in gewisser Weise – faszinierend.«
Er war hingerissen. Er blickte von Miss Lemons ernster, missbilligender Miene zu dem netten, besorgten Gesicht von Mrs Hubbard.
»Ich beglückwünsche Sie«, sagte er warm zu der Letzteren.
Sie sah ihn überrascht an. »Aber warum, Monsieur Poirot?«
»Ich beglückwünsche Sie dazu, solch ein einzigartiges und hübsches Problem zu haben.«
»Nun, vielleicht verstehen Sie ja, was das alles soll, Monsieur Poirot, aber …«
»Ich verstehe es ganz und gar nicht. Es erinnert mich in erster Linie an ein Spiel, zu dem mich kürzlich, in der Weihnachtszeit, einige junge Leute überredet haben. Es heißt, wenn ich mich recht erinnere, Die dreihornige Lady. Der Reihe nach muss jeder Teilnehmer den Satz sagen: ›Ich fuhr nach Paris und kaufte …‹, und dann irgendeinen Gegenstand einsetzen. Der nächste Spieler wiederholt den Satz und fügt einen weiteren Gegenstand hinzu. Der Sinn des Spieles besteht darin, sich an all die Gegenstände in der richtigen Reihenfolge zu erinnern, einige davon sehr ausgefallen und absurd. Unter anderem war das bei uns ein Stück Seife, ein weißer Elefant, ein Klapptisch und eine Moschusente. Die Schwierigkeit besteht natürlich darin, dass die Gegenstände völlig ohne Beziehung zueinander sind. Genau wie in der Liste, die Sie mir eben gezeigt haben. Spätestens wenn etwa zwölf Objekte genannt sind, wird es so gut wie unmöglich, sie noch in der richtigen Reihenfolge zu wiederholen. Wem das nicht gelingt, der bekommt ein Horn aus Papier überreicht und muss das nächste Mal seinen Satz mit der Formulierung beginnen: ›Ich, die einhornige Lady, fuhr nach Paris‹, und so weiter. Wer drei Hörner erhalten hat, scheidet aus. Wer zuletzt übrig bleibt, ist der Sieger.«
»Ich bin überzeugt, dass Sie der Sieger waren, Monsieur Poirot«, sagte Miss Lemon mit dem Vertrauen der loyalen Angestellten.
Poirot strahlte. »Das war in der Tat der Fall«, sagte er. »Mit ein bisschen Phantasie lässt sich nämlich selbst in die zufälligste Ansammlung von Objekten eine gewisse Ordnung bringen, eine Art sinnvoller Reihenfolge. Man merkt sich zum Beispiel: ›Mit dem Stück Seife wasche ich einen großen weißen Elefanten aus Marmor, der auf dem Klapptisch steht‹ – und so weiter.«
Mrs Hubbard sagte voller Respekt: »Vielleicht könnten Sie das auch mit der Liste von den Gegenständen machen, die ich Ihnen vorgelegt habe.«
»Ohne Zweifel könnte ich das. Eine Dame, die nur ihren rechten Schuh trägt, bindet ein Armband um ihren linken Arm. Sie benutzt Puder und Lippenstift, geht zum Abendessen und lässt ihren Diamantring in die Suppe fallen und so weiter – ich könnte auf diese Weise Ihre Liste einprägsam machen – aber das ist es ja nicht, was wir wollen. Wir müssen uns vielmehr fragen: Warum wurde solch eine zufällige Sammlung von Gegenständen gestohlen? Steckt da ein System dahinter? Irgendein Plan? Das müssen wir als Erstes herausfinden. Wir müssen uns daher zunächst die Liste der Gegenstände sehr genau ansehen.«
Es trat Stille ein, während Poirot sich dem Studium der Liste widmete. Mrs Hubbard sah ihm gebannt zu, wie ein kleiner Junge einem Zauberer, der ein Kaninchen oder zumindest Ströme bunter Bänder hervorzaubern soll. Miss Lemon dagegen blieb unbeeindruckt. Sie widmete sich in Gedanken den Feinheiten ihres Ablagesystems.
Als Poirot schließlich das Wort ergriff, fuhr Mrs Hubbard zusammen.
»Was mir zunächst auffällt«, sagte Poirot, »ist Folgendes: Von den Dingen, die verschwunden sind, haben die meisten nur einen geringen Wert (einige sind praktisch wertlos), mit zwei Ausnahmen – das Stethoskop und der Diamantring. Lassen wir das Stethoskop einmal beiseite, und konzentrieren wir uns auf den Ring. Sie sagen, er war wertvoll – wie wertvoll?«
»Nun, das kann ich nicht genau sagen, Monsieur Poirot. Es war ein Solitär mit je einer Gruppe kleiner Diamanten darüber und darunter. Soweit ich weiß, war es der Verlobungsring von Miss Lanes Mutter. Sie war äußerst verärgert, als der Ring weg war, und wir waren alle froh, als er noch am selben Abend im Suppenteller von Miss Hobhouse wieder aufgetaucht ist. Nichts weiter als ein dummer Scherz, haben wir gedacht.«
»Natürlich kann es ein Scherz gewesen sein. Aber ich denke eher, dass Diebstahl und Rückgabe des Rings eine Bedeutung haben. Wenn ein Lippenstift, eine Puderdose oder ein Buch wegkommen, dann ist das zu unbedeutend, als dass man die Polizei rufen würde. Aber bei einem wertvollen Diamantring ist die Lage anders. In diesem Fall ist es äußerst wahrscheinlich, dass wirklich die Polizei gerufen wird. Daher wird der Ring zurückgegeben.«
»Aber warum wird er erst entwendet, wenn er dann doch zurückgegeben wird?«, sagte Miss Lemon stirnrunzelnd.
»Das ist die Frage«, sagte Poirot. »Aber vorerst wollen wir diesen Punkt offenlassen. Ich bin im Augenblick dabei, die Diebstähle nach ihrer Bedeutung einzuordnen, und ich fange mit dem Ring an. Wer ist diese Miss Lane, der der Ring gehört?«
»Patricia Lane? Das ist ein sehr nettes Mädchen. Sie beabsichtigt, irgend so ein – wie heißt das noch mal? – irgend so ein Diplom in Geschichte oder Archäologie zu erwerben.«
»Wohlhabend?«
»O nein. Sie hat zwar ein bisschen Geld, aber sie geht damit sehr vorsichtig um. Der Ring gehörte, wie gesagt, ihrer Mutter. Sie hat ein oder zwei nette Schmuckstücke, aber wenig neue Kleider, und sie hat kürzlich das Rauchen aufgegeben.«
»Was ist sie für ein Mensch? Beschreiben Sie sie mit Ihren eigenen Worten.«
»Nun ja, sie ist eher unauffällig. Irgendwie farblos. Still und damenhaft, aber ohne viel Pep. Was man vielleicht als ein – nun ja, ein sehr ernsthaftes Mädchen bezeichnen könnte.«
»Und der Ring tauchte schließlich im Suppenteller von Miss Hobhouse auf. Wer ist Miss Hobhouse?«
»Valerie Hobhouse? Das ist ein cleveres, dunkelhaariges Mädchen – ein bisschen sarkastisch. Sie arbeitet in einem Schönheitssalon: Sabrina Fair – ich vermute, Sie haben davon gehört.«
»Und sind die zwei Mädchen befreundet?«
Mrs Hubbard überlegte. »Das würde ich sagen – ja. Sie haben allerdings nicht viel miteinander zu tun. Patricia kommt mit allen gut aus, würde ich sagen, ohne dass sie besonders beliebt wäre. Und Valerie Hobhouse hat ihre Feinde, kein Wunder bei ihrer scharfen Zunge – aber sie hat auch eine Menge Anhänger, wenn Sie wissen, was ich meine.«
»Ich glaube, ich verstehe«, sagte Poirot.
Patricia Lane war also nett und langweilig, und Valerie Hobhouse hatte Persönlichkeit. Er widmete sich wieder der Liste.
»Das Faszinierende sind die unterschiedlichen Arten von Dingen, die hier vertreten sind. Da sind unbedeutende Kleinigkeiten, die ein Mädchen in Versuchung führen könnten, das eitel und knapp bei Kasse ist: der Lippenstift, der Modeschmuck, die Puderdose, Badesalz, die Pralinenschachtel vielleicht. Auf der anderen Seite haben wir das Stethoskop. Eher ein Objekt, das ein Mann stehlen würde, der wüsste, wo er es verkaufen oder als Pfand beleihen könnte. Wem hat es gehört?«
»Es gehörte Mr Bateson – ein großer, netter junger Mann.«
»Ein Medizinstudent?«
»Ja.«
»War er sehr ärgerlich?«
»Er war absolut wütend, Monsieur Poirot. Er hat eine etwas aufbrausende Art – und kann dann alles Mögliche sagen, aber das ist auch schnell wieder vorbei. Er ist jedenfalls keiner, der freundlich aufnimmt, dass seine Sachen geklaut werden.«
»Gibt es denn solche Leute?«
»Ja, da ist zum Beispiel Mr Gopal Ram, einer unserer indischen Studenten. Er lächelt bei jeder Gelegenheit. Er wedelt mit der Hand und sagt, dass materieller Besitz bedeutungslos sei …«
»Ist ihm auch etwas gestohlen worden?«
»Nein.«
»Aha! Wem gehörte die Flanellhose?«
»Mr McNabb. Die war schon ganz alt, und jeder andere würde gesagt haben, sie ist nicht mehr zu brauchen, aber Mr McNabb hängt sehr an seinem alten Zeug und wirft nie etwas weg.«
»Damit sind wir jetzt bei den Dingen, von denen man nicht glauben würde, dass sie es wert sind, gestohlen zu werden – alte Flanellhosen, Glühbirnen, Borax, Badesalz, ein Kochbuch. Vielleicht sind sie von Bedeutung, wahrscheinlich aber nicht. Das Borax kann verlegt worden sein, jemand mag eine durchgebrannte Glühbirne herausgeschraubt und vergessen haben, sie zu ersetzen, das Kochbuch kann ausgeliehen und nicht zurückgegeben worden sein. Irgendeine Putzfrau mag die Hose weggeworfen haben.«
»Bei uns arbeiten zwei sehr zuverlässige Raumpflegerinnen. Ich glaube kaum, dass eine von ihnen so etwas gemacht hätte, ohne vorher zu fragen.«
»Vielleicht haben Sie recht. Dann ist da noch der Abendschuh, einer von einem neuen Paar, soweit ich verstanden habe? Wem haben die Schuhe gehört?«
»Sally Finch, eine Amerikanerin, studiert hier mit einem Fulbright-Stipendium.«
»Sind Sie sich sicher, dass der Schuh nicht einfach verlegt worden ist? Ich kann mir nicht vorstellen, welchen Nutzen ein einzelner Schuh haben sollte.«
»Er ist nicht verlegt worden, Monsieur Poirot. Wir haben alle intensiv danach gesucht. Also, das war so: Miss Finch wollte zu einer Party gehen und dabei das anziehen, was sie als formal dress bezeichnet – Abendkleidung würden wir sagen –, und die Schuhe waren ein entscheidender Bestandteil davon. Es waren nämlich ihre einzigen guten Schuhe.«
»Das war sicher unangenehm für sie – und ärgerlich – ja, natürlich. Ich frage mich … Vielleicht ist doch etwas daran …«
Er schwieg für einen Augenblick und fuhr dann fort:
»Und dann gab es noch zwei weitere Gegenstände – einen Rucksack, der in Stücke geschnitten wurde, und einen Seidenschal, der dasselbe Schicksal erlitten hat. Hier haben wir etwas, das nichts mit Eitelkeit oder Gewinn zu tun hat – sondern mit vorsätzlicher Bosheit. Wem gehörte der Rucksack?«
»Fast alle Studenten haben Rucksäcke – sie trampen ziemlich viel, wissen Sie. Und die meisten dieser Rucksäcke sind sich ziemlich ähnlich – im selben Laden gekauft, sodass man sie schwer unterscheiden kann. Aber es scheint ziemlich sicher, dass dieser entweder Leonard Bateson oder Colin McNabb gehört hat.«
»Und der Seidenschal, der zerschnitten worden ist? Wem hat der gehört?«
»Valerie Hobhouse. Sie hatte ihn zu Weihnachten bekommen – er war smaragdgrün und von wirklich guter Qualität.«
»Miss Hobhouse … Ich verstehe.«
Poirot schloss die Augen. Was er vor seinem geistigen Auge sah, war nicht mehr und nicht weniger als ein Kaleidoskop. Stücke von zerschnittenen Seidenschals und Rucksäcken, Kochbücher, Lippenstifte, Badesalz, Namen und kurze Beschreibungen einer Reihe von Studenten. Nirgendwo ein Zusammenhang oder ein Muster. Beziehungslose Vorfälle und Personen wirbelten durcheinander. Aber Poirot wusste nur zu gut, dass irgendwo ein Muster verborgen sein musste … Die Frage war nur, wo man ansetzen konnte …
Er öffnete die Augen. »Dies ist eine Angelegenheit, über die ich nachdenken muss. Sehr gut nachdenken.«
»Oh, natürlich, das verstehe ich, Monsieur Poirot«, stimmte Mrs Hubbard eifrig zu. »Und ich wollte Ihnen ganz gewiss keine Umstände …«
»Sie bereiten mir keine Umstände. Ich bin fasziniert. Aber während ich nachdenke, könnten wir auch schon mit der praktischen Arbeit anfangen. Aber wo … Der Schuh, der Abendschuh … ja, mit dem könnten wir anfangen. Miss Lemon.«
»Ja, Monsieur Poirot?« Miss Lemon verbannte die Archivierung aus ihren Gedanken, setzte sich noch gerader hin und griff automatisch zu Block und Bleistift.
»Mrs Hubbard wird für Sie, wenn möglich, den verbliebenen Schuh besorgen. Damit gehen Sie zum Bahnhof Baker Street, zum Fundbüro. Der Verlust ereignete sich – wann?«
Mrs Hubbard dachte nach. »Nun, ich kann mich nicht genau erinnern, Monsieur Poirot. Vielleicht vor zwei Monaten. Genauer kann ich es nicht sagen. Aber ich könnte das von Sally Finch herausbekommen, über das Datum ihrer Party.«
»Ja, gut.« Er wandte sich ein weiteres Mal an Miss Lemon.
»Machen Sie nur vage Angaben. Vielleicht sagen Sie am besten, Sie glauben, dass Sie den Schuh in einem Wagen der Circle Line verloren haben. Oder in irgendeinem anderen Zug. Oder vielleicht auch in einem Bus. Wie viele Buslinien gibt es in der Nähe der Hickory Road?«
»Nur zwei, Monsieur Poirot.«
»Gut. Wenn die Nachfrage in der Baker Street ohne Ergebnis bleibt, versuchen Sie es bei Scotland Yard und sagen Sie, Sie haben ihn in einem Taxi vergessen.«
»Lambeth«, korrigierte die tüchtige Miss Lemon.
Poirot winkte ab. »Sie wissen all diese Dinge.«
»Aber warum glauben Sie …«, begann Mrs Hubbard.
Poirot unterbrach sie. »Lassen Sie uns das Ergebnis abwarten. Danach suchen Sie uns wieder auf, Mrs Hubbard, ganz gleich, ob das Ergebnis positiv oder negativ ist, und sagen mir alles, was ich noch wissen muss.«
»Ich glaube, dass ich Ihnen bereits alles gesagt habe, was ich weiß.«
»Nein, keineswegs. Da muss ich widersprechen. Wir haben es hier mit einer Gruppe von jungen Leuten zu tun, mit unterschiedlichen Veranlagungen und unterschiedlichen Geschlechts. A liebt B, aber B liebt C, und D und E liegen sich vielleicht wegen A in den Haaren. Das sind die Dinge, die ich wissen muss. Das Wechselspiel menschlicher Gefühle. Streit, Eifersucht, Freundschaft, Bosheit und alle Arten von kleinen Gemeinheiten.«
»Ich kann Ihnen versichern«, sagte Mrs Hubbard unbehaglich, »dass ich von derartigen Dingen überhaupt nichts weiß. Ich mische mich nicht ein. Ich leite das Heim und sorge für die Verpflegung und alles, was damit zusammenhängt.«
»Aber Sie interessieren sich für Menschen. Das haben Sie mir selbst gesagt. Sie mögen junge Leute. Sie haben diesen Job nicht aus finanziellen Gründen angenommen, sondern weil Sie dadurch in Kontakt mit menschlichen Problemen kommen. Sicher wird es Studenten geben, die Sie gern mögen, und solche, die Sie weniger gern oder vielleicht sogar gar nicht mögen. Das werden Sie mir alles erzählen – ja, das werden Sie mir erzählen! Denn Sie machen sich Sorgen – nicht so sehr wegen der Dinge, die passiert sind – damit könnten Sie ja zur Polizei gehen …«
»Ich kann Ihnen versichern, dass Mrs Nicoletis nicht begeistert wäre, wenn die Polizei ins Haus käme.«
Poirot fuhr fort, ungeachtet der Unterbrechung. »Nein, Sie machen sich Sorgen über jemanden – jemanden, von dem Sie denken, dass er für die Ereignisse verantwortlich ist oder dass er zumindest in irgendeiner Weise damit zu tun hat. Also jemanden, den Sie mögen.«
»Also wirklich, Monsieur Poirot.«
»Ja, wirklich. Und ich glaube, dass Sie zu Recht besorgt sind. Denn der Seidenschal, der in Stücke geschnitten worden ist, das ist übel. Und der zerschnittene Rucksack ist auch übel. Die anderen Sachen mögen kindisch erscheinen – und dennoch – ich weiß nicht. Ich wäre da nicht so sicher!«
Drittes Kapitel
Nachdem sie die Stufen hinaufgeeilt war, steckte Mrs Hubbard den Schlüssel in die Haustür zur Hickory Road 26. Gerade als sich die Tür öffnete, kam ein großer junger Mann mit feuerrotem Haar hinter ihr die Stufen heraufgerannt.
»Hallo, Ma«, sagte er; das war Len Batesons übliche Art, sie zu begrüßen. Er war ein netter Kerl mit einem Cockney-Akzent und Gott sei Dank ohne jeden Minderwertigkeitskomplex. »Na, wo haben Sie sich denn rumgetrieben?«
»Ich war zum Tee, Mr Bateson. Jetzt halten Sie mich bitte nicht auf, ich bin spät dran.«
»Und ich habe heute wieder eine hübsche Leiche aufgeschnitten«, sagte Len. »Toll!«
»Das ist ungehörig von Ihnen, so zu reden. ›Eine hübsche Leiche‹, wie kann man nur! Allein die Vorstellung. Mir wird ganz schlecht, wenn ich Sie so reden höre.«
Len Bateson lachte, dass das Echo laut aus dem Flur zurückschallte. »Das ist jedenfalls nichts für Celia«, sagte er. »Ich hab sie in der Apotheke besucht. ›Ich bin gekommen, um dir von meiner Leiche zu erzählen‹, hab ich gesagt. Sie ist bleich geworden wie ein Bettlaken, sodass ich schon dachte, sie würde glatt ohnmächtig werden. Wie finden Sie das, Mutter Hubbard?«
»Das wundert mich gar nicht«, sagte Mrs Hubbard. »Allein die Vorstellung! Celia hat vermutlich geglaubt, Sie reden von einer echten Leiche.«
»Was soll das heißen – echte Leiche? Was glauben Sie denn, was unsere Leichen sind? Aus Kunststoff vielleicht?«
Ein dünner junger Mann mit langen ungekämmten Haaren kam aus einem Raum zur Rechten und sagte in überheblichem Ton: »Ach, du bist es nur. Ich dachte, es wäre mindestens eine Horde starker Männer, die hier Krach macht. Du hast zwar nur eine Stimme, aber die reicht für zehn Mann.«
»Ich hoffe, das nervt dich nicht.«
»Nicht mehr als üblich.« Nigel Chapman zog sich in sein Zimmer zurück.
»Unser Mimöschen«, sagte Len.
»Nun streitet euch doch nicht«, sagte Mrs Hubbard. »Gute Laune, das hab ich gern, ein bisschen leben und leben lassen.«
Der große junge Mann grinste liebevoll auf sie herab. »Unser Nigel stört mich nicht, Ma«, sagte er.
»Ach, Mrs Hubbard, Mrs Nicoletis ist in ihrem Zimmer und hat gesagt, sie möchte Sie sehen, sobald Sie zurück sind.«
Mrs Hubbard seufzte und ging die Treppe hinauf. Das große dunkelhaarige Mädchen, das ihr die Nachricht überbracht hatte, lehnte gegen die Wand und ließ sie passieren.
Len Bateson, der im Begriff war, seinen Regenmantel auszuziehen, sagte: »Was gibt’s, Valerie? Irgendwelche Beschwerden über unser Betragen, die Mutter Hubbard an uns weiterleiten soll?«
Das Mädchen zuckte mit den schmalen, eleganten Schultern, kam die Treppe herunter und ging durch den Flur. »Dieses Haus wird von Tag zu Tag mehr zum Irrenhaus«, sagte sie über die Schulter.
Noch im Sprechen verschwand sie durch die Tür zu ihrer Rechten. Sie bewegte sich dabei mit der mühelosen Grazie eines professionellen Mannequins.
Hickory Road 26 bestand eigentlich aus zwei Doppelhaushälften, Nummer 24 und 26. Im Erdgeschoss war eine Verbindung geschaffen worden. Dort gab es einen Gemeinschaftsraum und ein großes Esszimmer sowie zwei Toiletten und ein kleines Büro im hinteren Teil des Hauses. Zwei getrennte Treppen führten zu den getrennten oberen Stockwerken. Die Mädchen wohnten auf der rechten Seite des Hauses, und die jungen Männer auf der anderen, der ursprünglichen Nummer 24.
Mrs Hubbard ging nach oben und öffnete dabei den Kragen ihres Mantels. Sie seufzte, als sie die Richtung zum Zimmer von Mrs Nicoletis einschlug.
Sie klopfte an die Tür und trat ein.
»Vermutlich wieder einer ihrer Anfälle«, murmelte sie.
Im Wohnzimmer von Mrs Nicoletis war es sehr warm. Alle Heizspiralen des großen elektrischen Kamins waren eingeschaltet und das Fenster geschlossen. Mrs Nicoletis saß auf dem Sofa und rauchte, umgeben von einer Sammlung ziemlich schmutziger Seiden- und Samtkissen. Sie war eine noch immer gutaussehende, große, dunkelhaarige Frau mit großen braunen Augen und schlechter Laune.
»Ah, da sind Sie ja.« So wie Mrs Nicoletis es sagte, klang es wie eine Anschuldigung.
Mrs Hubbard, echte Lemon, die sie war, ließ sich dadurch nicht beeindrucken. »Ja«, erwiderte sie in scharfem Ton. »Hier bin ich. Man hat mir gesagt, dass Sie mich zu sprechen wünschten.«
»Ja, das will ich in der Tat. Es ist ungeheuerlich, nicht mehr und nicht weniger, ungeheuerlich!«
»Was ist ungeheuerlich?«
»Diese Rechnungen! Ihre Buchführung!« Mrs Nicoletis förderte nach Art eines geübten Zauberers einen Stapel Papiere unter einem Kissen hervor. »Was geben wir diesen elenden Studenten zu essen? Gänseleber und Wachteln? Ist das hier vielleicht das Ritz? Was glauben die denn, wer sie sind, diese Studenten?«
»Junge Leute mit einem gesunden Appetit«, sagte Mrs Hubbard. »Sie bekommen ein gutes Frühstück und ein anständiges Abendessen – einfache, aber nahrhafte Kost. Das ist alles sehr wirtschaftlich.«
»Wirtschaftlich? Wirtschaftlich? Das wagen Sie mir zu sagen? Wo ich am Rande des Ruins stehe?«
»Sie machen einen erheblichen Gewinn mit diesem Haus, Mrs Nicoletis. Für Studenten liegen die Mieten im oberen Bereich.«
»Aber bin ich nicht immer ausgebucht? Habe ich jemals ein Zimmer frei, für das nicht gleich drei neue Bewerber auf der Schwelle stehen? Schickt man mir nicht die jungen Leute vom British Council, vom Studentenwerk der Universität London – von den Botschaften – vom Lycée Française? Habe ich nicht drei Anwärter auf jedes freie Zimmer?«
»Das liegt nicht zuletzt daran, dass die Mahlzeiten hier sowohl appetitlich als auch ausreichend sind. Junge Leute brauchen genügend zu essen.«
»Blödsinn! Diese Rechnungen sind einfach ein Skandal. Diese italienische Köchin und ihr Mann, die stecken dahinter. Die betrügen Sie mit dem Essen.«
»Das stimmt nicht, Mrs Nicoletis. Ich kann Ihnen versichern, dass kein Ausländer mich jemals betrügen könnte.«
»Dann sind Sie es selbst – dann sind Sie es, die mich ausraubt!«
Mrs Hubbard blieb ungerührt. »Solche Anschuldigungen kann ich nicht dulden«, sagte sie in einem Ton, wie ein Kindermädchen mit einem besonders aufsässigen Zögling spricht. »Sie sind einfach ungehörig, und früher oder später werden Sie durch solche Reden in Schwierigkeiten kommen.«
»Ach was!« Mrs Nicoletis warf den Stapel Rechnungen mit dramatischer Geste in die Luft, von wo die Blätter in alle Richtungen zu Boden flatterten. Mrs Hubbard bückte sich und hob sie auf, wobei sie die Lippen zusammenpresste. »Sie regen mich auf!«, schrie ihre Arbeitgeberin.
»Ich möchte darauf hinweisen«, sagte Mrs Hubbard, »dass es schlecht für Sie ist, sich so aufzuregen. Wutanfälle sind schlecht für den Blutdruck.«
»Aber Sie geben doch zu, dass diese Ausgaben höher sind als in der letzten Woche?«
»Natürlich sind sie höher. Es gab ein paar sehr gute Sonderangebote bei Lampson. Die habe ich ausgenutzt. In der nächsten Woche werden die Zahlen deutlich unter dem Durchschnitt liegen.«
Mrs Nicoletis war eingeschnappt. »Sie erklären alles immer so glaubwürdig.«
»Da.« Mrs Hubbard legte die Rechnungen in einem ordentlichen Haufen auf den Tisch zurück. »Gibt es sonst noch etwas?«
»Dieses amerikanische Mädchen, Sally Finch, die redet vom Ausziehen – ich will nicht, dass sie auszieht. Sie hat ein Fulbright-Stipendium. Sie wird andere Fulbright-Stipendiaten zu uns bringen. Sie darf nicht weggehen.«
»Warum will sie uns verlassen? Hat sie Gründe genannt?«
Mrs Nicoletis hob ihre gewaltigen Schultern. »An die Einzelheiten kann ich mich nicht erinnern. Es waren jedenfalls nicht die echten Gründe. So viel steht fest. So was merke ich immer.«
Mrs Hubbard nickte nachdenklich. Sie war geneigt, Mrs Nicoletis in diesem Punkt zu glauben. »Sally hat mir nichts davon gesagt«, sagte sie.
»Aber Sie werden sie darauf ansprechen?«
»Ja, natürlich.«
»Und damit das klar ist: Wenn diese Farbigen, diese Inder, diese Negerinnen sie stören – die können von mir aus alle verschwinden. Glauben Sie mir, diese Amerikaner, die legen größten Wert auf Rassentrennung – und ich lege größten Wert auf die Amerikaner. Und diese Farbigen – nur weg damit!« Sie machte eine dramatische Geste.
»Nicht, solange ich hier etwas zu sagen habe«, erwiderte Mrs Hubbard kühl. »Und davon abgesehen, Sie irren sich. Derartige Vorstellungen spielen bei den Studenten keine Rolle. Und Sally ist bestimmt nicht der Typ. Sie geht häufig mit Mr Akibombo zusammen essen, und niemand könnte schwärzer sein als der.«
»Dann sind es die Kommunisten – Sie wissen, wie die Amerikaner gegen die Kommunisten sind. Und dieser Nigel Chapman – der ist ein Kommunist.«
»Das bezweifle ich.«
»Doch, doch. Sie sollten gehört haben, was er gestern wieder gesagt hat.«
»Nigel legt es darauf an, andere zu provozieren. Er geht einem manchmal ziemlich auf die Nerven!«
»Sie kennen sie alle so gut. Meine liebe Mrs Hubbard, Sie sind wunderbar! Ich sage mir immer wieder – was sollte ich nur ohne Mrs Hubbard anfangen? Ich bin völlig auf Sie angewiesen. Sie sind eine ganz, ganz wunderbare Frau.«
»Nach der Peitsche das Zuckerbrot«, sagte Mrs Hubbard.
»Bitte?«
»Ach, nichts. Ich werde tun, was ich kann.«
Sie verließ das Zimmer und schnitt damit kurzerhand die übersprudelnde Dankesrede ab.
»Verschwendet nur meine Zeit – was für eine unerträgliche Frau!«, murmelte sie und eilte durch den Korridor in ihr eigenes Wohnzimmer.
Doch auch dort war Mrs Hubbard noch kein Friede vergönnt. Eine hohe Gestalt erhob sich, als Mrs Hubbard eintrat, und sagte: »Ich würde gern ein paar Minuten mit Ihnen reden, wenn das möglich ist.«
»Natürlich, Elizabeth.«
Mrs Hubbard war überrascht. Elizabeth Johnston war eine Jura-Studentin aus Westindien. Sie arbeitete fleißig, war ehrgeizig, neigte aber dazu, sich abzusondern. Sie war ihr stets besonders ausgeglichen und kompetent vorgekommen, und Mrs Hubbard hatte sie immer für eine der erfreulichsten Studentinnen gehalten.
Sie wirkte auch jetzt vollständig ruhig, aber Mrs Hubbard entging nicht das leichte Beben in ihrer Stimme, auch wenn das dunkle Gesicht keine Regung zeigte.
»Ist etwas passiert?«
»Ja. Könnten Sie bitte gleich mit in mein Zimmer kommen?«
»Einen Augenblick.« Mrs Hubbard warf ihren Mantel und die Handschuhe auf einen Stuhl; dann folgte sie dem Mädchen aus dem Zimmer und in das andere Stockwerk. Elizabeth hatte ein Zimmer ganz oben. Sie öffnete die Tür und ging quer durch den Raum zu einem Tisch, der nahe am Fenster stand.
»Das hier sind meine Aufzeichnungen«, sagte sie. »Das Ergebnis mehrerer Monate harten Studiums. Sehen Sie, was damit passiert ist?«
Mrs Hubbard hielt den Atem an und schnappte leicht nach Luft.





























