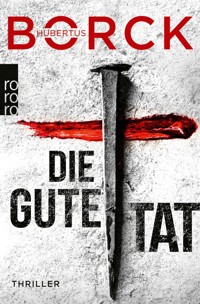9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Erdmann und Eloğlu
- Sprache: Deutsch
Dort, wo du schutzlos bist, wirst du getötet. Ein Unfall mit dem Fahrrad, Krankenhaus, Koma. Als der junge Familienvater nicht mehr in akuter Lebensgefahr schwebt, stirbt er plötzlich. Die Witwe ist überzeugt, dass er umgebracht wurde. Niemand glaubt ihr, bis die Rechtsmedizin ihren Verdacht bestätigt. Wurde er versehentlich falsch behandelt oder absichtlich getötet? Die 59-jährige Kriminalkommissarin Franka Erdmann und ihr junger Assistent Alpay Eloğlu stoßen auf weitere mysteriöse Todesfälle in der Klinik. Eine grausame Serie, die weitergehen wird? Der Ort, der Heilung verspricht, wird zur mörderischen Falle. Wen trifft es als Nächstes? Der zweite Band der Thrillerserie um das ungleiche Hamburger Ermittlerduo Erdmann und Eloğlu: Sie ist hart und abgeklärt, er ist brandneu im Job.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 454
Veröffentlichungsjahr: 2023
Sammlungen
Ähnliche
Hubertus Borck
Die Klinik
Thriller
Über dieses Buch
Dort, wo du schutzlos bist, wirst du getötet.
Ein Unfall mit dem Fahrrad, Krankenhaus, Koma. Als der junge Familienvater nicht mehr in akuter Lebensgefahr schwebt, stirbt er plötzlich. Die Witwe ist überzeugt, dass er umgebracht wurde. Niemand glaubt ihr, bis die Rechtsmedizin ihren Verdacht bestätigt. Wurde er versehentlich falsch behandelt oder absichtlich getötet? Die 59-jährige Kriminalkommissarin Franka Erdmann und ihr junger Assistent Alpay Eloğlu stoßen auf weitere mysteriöse Todesfälle in der Klinik. Eine grausame Serie, die weitergehen wird? Der Ort, der Heilung verspricht, wird zur mörderischen Falle. Wen trifft es als Nächstes?
Der zweite Band der Thrillerserie um das ungleiche Hamburger Ermittlerduo Erdmann und Eloğlu: Sie ist hart und abgeklärt, er ist brandneu im Job.
Vita
Hubertus Borck, geboren 1967 in Lübeck, ist Kabarettist, Texter, Theater- und Drehbuchautor. Er schrieb u. a. für «Gute Zeiten, schlechte Zeiten», «Wege zum Glück» und die NDR-Produktion «Rote Rosen». Hubertus Borck lebt mit seinem Mann in Hamburg. Nach «Das Profil» folgt nun der zweite Band der Thrillerserie mit Franka Erdmann und Alpay Eloğlu.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, März 2023
Copyright © 2023 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Redaktion Carla Felgentreff
Covergestaltung Hafen Werbeagentur, Hamburg
Coverabbildung Shutterstock
ISBN 978-3-644-01226-4
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
1Soltau. Vor zehn Jahren.
Sie musste ihr ganzes Körpergewicht zum Einsatz bringen, denn der alte Mann wehrte sich mit letzter Kraft gegen das Ersticken. Wie sehr der Mensch doch kämpfen kann, wenn es zu Ende geht, dachte sie und presste das Kissen fest auf sein Gesicht. Der Körper mobilisiert Reserven, die ihm nur für den Notfall zur Verfügung stehen. Sie schätzte, dass der Sauerstoff in seinem Blut vielleicht noch für eine knappe Minute reichte, bevor der Mann unter ihr bewusstlos werden würde. Diese sechzig Sekunden, in denen sie über dem Alten lag, erschienen ihr wie eine Ewigkeit. Sechzig Sekunden, um vierundachtzig Jahre zu beenden. Der Rentner strampelte mit den Beinen, und während sie seinen Kopf mit dem Gewicht ihres Oberkörpers auf die Matratze zwang, ruderte er hilflos mit den Armen. Immer wieder wich sie den Schlägen seiner knöchernen Hände aus, doch einmal traf er sie mitten auf das linke Ohr. Der Schmerz brannte überraschend stark. Ein feiner Tropfen Blut landete auf dem weißen Kissen, das sie jetzt noch fester auf sein Gesicht drückte. Die empfindliche Haut ihrer Ohrmuschel musste unter seinem Ehering geplatzt sein.
Die Schreie des alten Mannes, die durch das Kissen nur dumpf nach außen drangen, zeugten von purer Verzweiflung und dem Wissen, dass er verloren hatte. Immer wieder schaute sie zur Tür. Es wurde Zeit.
Ohne das Kissen loszulassen, kletterte sie auf das Bett, legte sich quer über den Kopf des Rentners und schnitt ihm so das letzte bisschen Sauerstoff ab. Unterhalb ihres Brustbeins spürte sie seine Nase durch das Kissen drücken, und die feuchte Wärme seiner Atemluft drang langsam hindurch. Keine Möglichkeit, sich zu wehren, keine Chance auf eine Chance. Warum dauerte das so lange? Ihr Kaffee im Stationszimmer wurde kalt.
Endlich – sein Widerstand ließ nach. Die Schlagzahl der rudernden Arme nahm ab, auch die Beine ermatteten. Gleich würde das Zurücksinken der Zunge in den Hals den Rest erledigen. Sie war außer Atem. Auch wenn der Mann keinen Laut mehr von sich gab und sich nicht bewegte, blieb sie zur Sicherheit noch einen Moment auf ihm liegen. Sie schaute seitwärts zum Fußende hinunter, wo sein linkes Bein bewegungslos aus dem Bett hing. Seine Arme lagen auf ihrem Rücken wie eine Umarmung. Konnte sie es wagen aufzustehen? Oder würde ein letztes Aufbäumen erfolgen? Wie bei dem stinkenden Kfz-Mechaniker mit den verhornten Fußnägeln, dem sie vor zwei Wochen mehrere Einheiten Insulin gespritzt hatte, obwohl der Mann kein Diabetiker gewesen war.
Sie horchte zur Sicherheit noch einmal unter sich. Der Alte machte wirklich keinen Laut mehr. Langsam stieg sie von dem bewegungslosen Körper hinunter, wobei seine Arme von ihrem Rücken auf die Matratze rutschten. Weder am Handgelenk noch am Hals fühlte sie seinen Puls. Es war vorbei. Sie schaute sich im Zimmer um. Das zweite Bett war nicht belegt. Die Wände ringsherum waren angestoßen. Niemand gab sich hier sonderlich viel Mühe beim Rangieren der Betten. Außer ihr, davon war sie überzeugt, gab sich hier kaum jemand mit irgendetwas Mühe.
Sie beugte sich zu ihm hinunter und flüsterte in sein Ohr:
«Nimm die Klage deiner Tage, schnall sie auf den Rücken mir. Mach dein Leid zu meinem Kreuze, das ich trag auf Erden hier.»
Mit Daumen und Mittelfinger schloss sie seine Augen, bevor die Totenstarre seinen panischen Blick verraten konnte. Das Kissen fiel zu Boden. Auf der einen Seite zeugte ein handtellergroßer Speichelfleck von seinem Ersticken, auf der anderen Seite verrieten zwei kleine Tropfen Blut seine Gegenwehr. Ihr blieb noch eine halbe Stunde, bis sie an die Kollegen der Abendschicht übergeben würde.
Wenn sie sich beeilte, das zerwühlte Bett unter ihm zu richten und den eingesauten Kissenbezug zu wechseln, schaffte sie in ihrer Kaffeepause vielleicht noch das Stück Butterkuchen, das sie sich in einer Tupperdose von zu Hause mitgebracht hatte.
Nur eine Stunde später saß sie auf einer harten Kirchenbank. Die Kälte strahlte von den grob verputzten Wänden der kleinen Kapelle und kroch ihr langsam unter die Klamotten. Ihre Füße waren in den Sneakern bereits eisig geworden, die dünnen Gummisohlen hatten der Temperatur des Backsteinbodens wenig entgegenzusetzen. Aber die Ruhe im Inneren der kleinen Feldsteinkirche in der Lüneburger Heide vermittelte ihr ein Gefühl von Sicherheit. Sie wickelte sich enger in ihre Jacke und betastete ihr Ohr. Die kleine Stelle hatte schnell aufgehört zu bluten und war zum Glück niemandem in der Klinik aufgefallen.
Sie hatte es wieder getan. Langsam legte sie den Kopf in den Nacken, schloss die Augen und atmete durch. Es roch nach feuchtem Papier. Vielleicht waren es die Gesangbücher? Unauffällig war sie nach der Tat aus dem Zimmer des Alten auf den Flur geschlichen, hatte den dreckigen Kissenbezug im Wäschesammler der Station entsorgt, anschließend ihren lauwarmen Kaffee getrunken und das Stück Butterkuchen gegessen. Vielleicht, so hatte sie dabei gedacht, sollte sie beim nächsten Mal etwas gröbere Streusel kneten und im Backofen die Oberhitze dazuschalten.
Sie rieb sich die kalten Hände. Im Schwesternzimmer hatte sie mit Brit und Dörte über die Urlaubsplanung auf Station reden müssen, sich anschließend in der Garderobe umgezogen und das Krankenhausgelände auf ihrem Fahrrad verlassen. Niemand hatte bis zu diesem Zeitpunkt den toten Rentner in seinem Bett entdeckt.
Und wie bei den anderen vier Patienten, denen sie zuvor geholfen hatte, saß sie nun in dieser kleinen Kirche in der ersten Bank und konnte endlich aufatmen. Sie schaute sich um.
Hinter dem einfach geschnitzten Altar fiel die untergehende Frühlingssonne schwach durch die drei bleigefassten Kirchenfenster. Das unebene Glas ließ unscharf die gewaltigen Eichen erahnen, die dahinter in einer Art Wall das Gebäude in der Lüneburger Heide beschützten. Im aufdrehenden Wind wirkten die verschwommenen Äste so, als würden sie ihr durch die Scheiben bestätigend zunicken. Ja, auch diese Erlösung war richtig gewesen.
Ihre Hände neben sich auf der Sitzbank, befühlte sie die glatte Oberfläche des kühlen Holzes. Sie musste daran denken, wie sie die Kirche nach ihrer ersten Erlösung vor vier Monaten zum ersten Mal betreten hatte. Obwohl sie jahrelang jeden Tag auf dem Weg ins Hermann-Löns-Krankenhaus in Soltau an der achthundert Jahre alten Kirche vorbeigeradelt war, hatte sie dem Gebäude zuvor keine große Aufmerksamkeit geschenkt. Erst im letzten November war sie, einem Impuls folgend, vor der Kapelle stehen geblieben – und hatte sich selbst darüber gewundert. Denn mit der Kirche als Institution hatte sie bis heute nichts am Hut. Sie erinnerte sich, wie sie damals einige Minuten unschlüssig vor der schweren Eichentür gestanden und sich anfangs nicht über die Schwelle getraut hatte. Auch wenn sie nicht an Gott glaubte, hatte sie doch insgeheim seine Strafe gefürchtet. Denn kurz zuvor hatte sie die vierundzwanzigjährige Krebspatientin, die durch Chemotherapie und Bestrahlung bereits stark geschwächt und vom Morphium sediert gewesen war, mit vierzig Milliliter Gilurytmal in den schnellen Tod gespritzt. Nach fast dreizehn Jahren als Krankenschwester, die Ausbildungsjahre mitgerechnet, hatte sie nicht lange überlegt. Kein Zögern, keine Spur von Unsicherheit, als sie die Spritze in die Armvene gestochen hatte. Mit nachlassender Lungenfunktion der Patientin hatte sie selbst immer befreiter durchatmen können. Als hätte sie sich für den Moment mit der Luft der Sterbenden von der eigenen Atemlosigkeit befreit. Die Gründe, dieser Frau zu helfen, waren so offensichtlich gewesen, während es gleichzeitig kein Argument gegeben hatte, es nicht zu tun. Wie bei den anderen beiden Patienten auch, die sie danach auf dieselbe Weise erlöst hatte. Wie leicht ihr der Schritt gefallen war, hatte sie selber erstaunt. Es hatte sie vorher weder Überwindung gekostet noch hinterher Selbstzweifel beschert. Nein, jeder dieser fünf Todgeweihten war durch ihre Hilfe befreit worden. Die ersten drei Sterbefälle hatten zu Meckis Erleichterung keinen Verdacht bei den Kollegen ihrer Station erweckt – zumindest anfangs nicht.
Erst als sich Frau Dr. Darkow über den ungewöhnlich hohen Verbrauch von Gilurytmal gewundert hatte, war sie vorsichtiger geworden und bediente sich seitdem anderer Mittel, die sie zudem variierte. Heute hatte sie zum ersten Mal ein Kissen benutzt.
Bei dem fünfzigjährigen Kfz-Mechaniker vor zwei Wochen war sie zu Insulin übergegangen. Sie hatte ihm ein leichtes Schlafmittel in den Tee gerührt, bevor sie ihm kurze Zeit später eine Dosis zwischen die Zehen seiner ungepflegten Füße spritzte. Leber und Bauchspeicheldrüse waren gegen die Menge nicht angekommen. Nach einer gehörigen Unterzuckerung war der Mann schnell verwirrt gewesen und ohnmächtig geworden. Und während sie danebengestanden und zufrieden seinen sinkenden Puls kontrolliert hatte, hatte er plötzlich noch einmal die Augen weit aufgerissen. Mit Schaudern erinnerte sie sich daran, wie sein Körper vor Schüttelfrost gezittert hatte, dass ihm die schlechten Zähne aufeinanderklapperten.
Nun, knapp vierzehn Tage nach seinem Tod und zwei Stunden nach dem Ersticken des Rentners, betrachtete Mecki aufmerksam die Holzträgerdecke der kleinen Kirche. Zwei schmucklose mehrarmige Messingleuchter hingen über dem Mittelgang. Sie lauschte dem Wind, der irgendwo, vielleicht im Turm, auf eine kaputte Regenrinne oder ein Fenster traf. Da es hier drinnen keine Orgel gab, konnte sie sich das dunkle Pfeifen nicht anders erklären. Vorne links stand eine einfache kleine Kanzel, deren dunkelgrün gestrichenes Holzdach mit einer Allegorie aus drei geschnitzten Figuren verziert war. Auch wenn Mecki der Tod in Gestalt eines Skeletts schon bei ihrem ersten Besuch aufgefallen war, interessierte sie sich nicht weiter für kirchliche Symbolik. Das Gerippe stand über zwei am Boden liegenden nackten Figuren, die sich, nur mit einem Tuch über der Scham bedeckt, mit einem Arm am Rand des Kanzeldaches abstützten und den Oberkörper flehend Richtung Himmel reckten. Hatte sie die dargestellte Szene bei ihren ersten Besuchen noch abgestoßen – zu plakativ war ihr die Darstellung im Zusammenhang mit ihren eigenen Taten erschienen –, betrachtete sie die Figuren mittlerweile mit einer gewissen Neugier. Jedes Mal fragte sie sich, warum der Tod voller Desinteresse an dem Elend zu seinen Füßen vorbeischaute. Wie konnte man dieses offensichtliche Leiden ignorieren? Im Gegensatz zum dargestellten Tod auf dem Kanzeldach war Mecki barmherzig. Niemand hatte es verdient, sein Ende erbetteln zu müssen.
Gegen die Kälte des Frühlings blies sie ihre warme Atemluft zwischen die Hände und musste schmunzeln. Vermutlich sah sie aus, als würde sie beten. Sie versuchte, sich an das Vaterunser aus dem Konfirmandenunterricht zu erinnern, aber wieder kam sie nicht über die ersten beiden Zeilen hinaus. Vater unser, der du bist im Himmel. Und dann? Warum konnte sie sich die Verse, die sie nach ihren Besuchen bereits einige Male nachgeschlagen hatte, nicht merken? Irgendwo kam doch Dein Wille geschehe darin vor. Egal, sie glaubte ja eh nicht an Gott und dieses ganze Heil versprechende Gequatsche. Wo war Gott denn gewesen, als der alte Mann über Monate vom Krebs zerfressen worden war?
Sie atmete durch, und es schien, als würde sie damit dem Wind um die Kirche neuen Schwung verleihen. Dunkel tönte es um die kalten Mauern. Das fahle Licht der Dämmerung entzog der geschnitzten Jesusfigur an dem dunklen Holzkreuz über dem Taufbecken jegliche Farbe. Da hing er also, der ans Kreuz genagelte bleiche Beweis, dass es Gott ganz offensichtlich nicht gab. Warum sonst hatte er nicht wenigstens seinen Sohn vor dem Leid der Kreuzigung bewahrt? Und wenn er doch existierte, musste er sich die Frage gefallen lassen, warum ihm Jesus egal gewesen war. Vielleicht aus demselben Grund, aus dem Gott sich auch für ihr Schicksal nicht interessierte?
Seit ihrer ersten Patientenhilfe vor vier Monaten fragte Mecki sich immer wieder, warum es sie danach an diesen Ort zog. Warum sie tötete, fragte sie sich nicht.
Ihre eisigen Füße begannen zu schmerzen, und auch die Hände waren steif vor Kälte. Nur in einem hatte sie im Moment Gewissheit: Dank ihrer Hilfe waren fünf Menschen frei von Angst, von Schmerz und von einem aussichtslosen Überlebenskampf. Ein wenig Neid stieg in ihr auf, während der stärker werdende Wind um die Kirche heulte und wie ein trauriges Lied klang, das um ihre Toten weinte. Insgeheim beneidete sie auch den Sturm, der seine Klage laut herausschrie. Etwas, das Mecki sich nie getraut hatte. Im Gegensatz zum Wind hatte sie schon immer geschwiegen. Ein Leben lang.
2Hamburg. Vor vierzehn Tagen.
«Baba, hayır. Ben patlayacağım.»
Zu spät. Alpay Eloğlu konnte sich nicht gegen die riesige Portion Königsberger Klopse wehren, die ihm sein Vater Metin auf den Teller häufte. An diesem warmen Juniabend saß er bei seinen Eltern auf dem gepflegten und mit Kübeln bepflanzten Balkon im vierten Stock eines Wohnungsneubaus in Hamburg-Ottensen. Bei den Temperaturen hätte er lieber einen Salat gegessen, aber die Hackklößchen dufteten köstlich. Er zerteilte eins mit der Gabel und schob es sich genüsslich in den Mund. «Megalecker.»
«Habt ihr beim LKA keine Kantine?», witzelte Metin und wandte sich an seine Frau. «Schau ihn an, Siggi, der Junge ist ja ganz ausgehungert. Kein Gramm Fett, nur Muskeln und Haut.»
Alpay grinste und spannte stolz seinen Bizeps an, der sich auf die Größe einer halben Kokosnuss wölbte und dabei das Bündchen seines Polohemds dehnte.
Sigrid Eloğlu füllte sich etwas Rote Bete auf den Teller. «Wie läuft’s im Dienst?»
«Läuft», antwortete Alpay mit vollem Mund.
«Neues vom Erdmännchen?»
«Ich glaube, der geht’s gut.»
«Du glaubst. Aha.»
Er schaute seine Mutter verwundert an. Dafür, dass sie seine Vorgesetzte nicht mochte, erkundigte sie sich erstaunlich oft nach ihr.
«Wir haben seit dem Fall der toten Influencerinnen vor einem halben Jahr noch nicht wieder zusammengearbeitet. Leider.»
Metin wandte sich irritiert an seine Frau. «Wieso sagt der Junge leider?»
«Diese Hauptkommissarin ist wirklich ein Besen. Da hat der Papa recht.»
«Hayret bir kadın.» Sein Vater wechselte immer dann ins Türkische, wenn er die Sprache für passender hielt, und auch Alpay fand, dass eine unmögliche Frau auf Türkisch tatsächlich noch eine Spur verächtlicher klang.
Metin und Siggi hatten sich ihre Meinung über Franka Erdmann gebildet, nachdem Alpay im letzten November frisch nach der Uni zur Abteilung 4 des Landeskriminalamtes Hamburg gestoßen war und seinen Eltern von den Spannungen zwischen ihm und seiner Vorgesetzten berichtet hatte. Franka und er hatten sich über die Ermittlungsarbeit im Fall der ermordeten jungen Frauen zusammengerauft, was aber nichts an der Tatsache änderte, dass seine Eltern Franka zur Persona non grata erklärt hatten. Alpay selbst hatte die anfänglichen Schwierigkeiten mittlerweile als holprigen Start abgehakt. Nachdem Franka ihn, den unerfahrenen Kollegen, einige Male hatte auflaufen lassen, hatten sie den spektakulären Fall gemeinsam aufgeklärt. Nur das zählte für Alpay. Er war nicht zur Polizei gegangen, um neue Freunde zu finden. Trotzdem hatte es ihn irgendwie gefreut, als Hauptkommissarin Erdmann ihm kurz vor Weihnachten das Du angeboten hatte.
Siggi stupste Alpay mit dem Fuß unter dem Tisch an und nickte unauffällig in Richtung seines Vaters, der genüsslich die restliche Soße von seinem Teller löffelte. «Ich kümmere mich mal ums Dessert.» Dann erhob sie sich und verschwand durch die geöffnete große Schiebetür nach drinnen. Siggi hatte Alpay vorhin zur Seite genommen und noch einmal daran erinnert, dass er Metin von einem Arztbesuch überzeugen sollte, denn seit geraumer Zeit plagten ihn Magenbeschwerden. Manchmal gingen sie schnell vorüber, manchmal dauerten sie an. Genaueres wusste Alpays Mutter auch nicht, denn er spielte seine Krämpfe vor ihr herunter. Nun lehnte Metin sich in seinem Teakstuhl zurück und lächelte seinen Sohn zufrieden an.
«Baba, nasılsın bugün?» Alpay fragte so unverfänglich wie möglich.
«Wie soll es mir heute schon gehen? Hat deine Mutter etwa mit dir gesprochen?» Aus Metins großen bernsteinfarbenen Augen wurden skeptische kleine Sehschlitze.
«Nee, worüber?» Alpay zuckte nicht mit der Wimper.
«Ich hab manchmal so ein ganz leichtes Ziehen im Bauch.»
«Was sagt der Arzt?»
Metin schwieg.
«Papa, das musst du mal abklären lassen.» Alpay bemühte sich, so unaufgeregt wie möglich zu klingen. «Wie lange geht das denn schon?»
«Junge, ich vertrage manche Lebensmittel einfach nicht mehr so gut. Davon geht die Welt nicht unter.» Metin winkte ab.
Alpay war verunsichert. Übertrieb es seine Mutter in ihrer Sorge, oder verharmloste Metin seine Beschwerden, weil er generell nicht gerne zum Arzt ging?
Alpay schaute in die Krone der Rotbuche, die unten im Hof stand. Der fünfgeschossige Wohnungsneubau fügte sich wunderbar in eine grüne Hinterhof-Oase mit dem Schatten spendenden Baum.
«Baba, erinnerst du dich, dass die Erdmann mal einen festen Ermittlungspartner gehabt hat?» Um seinen Vater von einem Arztbesuch zu überzeugen, musste er wohl schwerere Geschütze auffahren.
«Ja, irgendwie klingelt da was.»
«Der ist gestorben, weil er definitiv zu spät zum Arzt gegangen ist. Prostatakrebs.»
Metin zog scharf die Luft ein. «Autsch.»
«Baba, du bist zweiundsechzig. Du gehst ja wohl regelmäßig zur Vorsorge, oder? Hast du eigentlich jemals eine Darmspiegelung machen lassen?»
«Meine Worte, Metin.» Sigrid kehrte mit einem Tablett in der Hand auf den Balkon zurück. «Statt diese Sache abklären zu lassen, steckt dein Vater lieber den Kopf in den Sand.» Sie wandte sich an Metin. «Ich werde zwei Wochen mit dir im Urlaub an der Ostsee sitzen und ständig in Sorge um dich sein.»
«Mama hat recht. Du solltest dich nach eurem Urlaub mal durchchecken lassen, Baba. Schadet ja nichts.»
Siggi griff lieb nach Metins Hand. «Hör mal. Du musst doch keine Angst vor der Untersuchung haben. Im Krankenhaus wird dir geholfen. Was soll denn da Schlimmes passieren?»
Mecki liebte die Nacht mehr als den Tag, denn das Dunkel war so viel leiser. Schon als Kind hatte sie sich sicherer und geborgener darin gefühlt. Daran musste sie denken, während sie gegen drei Uhr nachts über den Flur der Intensivstation in der Hamburger Karesis-Klinik ging. Das hektische Treiben, das schnelle Reagieren, wenn es um Leben und Tod ging, die permanenten Alarm- und Kontrolltöne der Gerätemedizin, das alles wurde ihr tagsüber mittlerweile zu viel. Seit ihrer Fachweiterbildung zur Intensivpflegeschwester vor zehn Jahren arbeitete sie lieber in der Nacht auf Station, obwohl sie während dieser Schichten vier statt wie tagsüber zwei Patienten versorgen musste. Ihrem Empfinden nach war der Lärmpegel einer Intensivstation tagsüber ähnlich hoch wie der Verkehr auf dem zweispurigen Sandtorkai, der sich in der Nähe der Klinik wie eine hässliche Narbe zwischen der Hamburger Speicherstadt und der HafenCity entlangzog. Die Ruhe aus Soltauer Zeiten war schon lange vorbei.
Diese Schicht war bis jetzt ohne Zwischenfälle verlaufen. Kein Rettungshubschrauber war auf dem Dach der Klinik gelandet, keine Messerstecherei auf dem Kiez, kein Patient mit Schlaganfall oder anderem akuten Ereignis hatte das Team in dieser Nacht plötzlich rennen lassen.
In diesem Moment hörte sie nur die weichen Gummisohlen ihrer Crocs, die bei jedem Schritt leise über den polierten Vinylboden schmatzten. Ihre Kollegin Beate kam aus Richtung des Stationszimmers, riss dabei einen verpackten Infusionsbeutel auf und verschwand in einem der Intensivzimmer. Das unauffällige Piepen der Vitalparameter der Patienten drang aus den Zimmern hinaus auf den Flur.
Leise öffnete sie nun die Schiebetür zur 06, schlüpfte hinein und schob sie vorsichtig wieder hinter sich zu, bevor sie ihre Hände unter den Desinfektionsmittelspender hielt. Im Gegensatz zur grellen Flurbeleuchtung wurde das Licht in den Zimmern zur Nacht gedimmt. Alle sechs Zweibettzimmer auf dieser Intensivstation waren mit modernster Medizintechnik ausgestattet. Über jedem Bett hingen die jeweiligen Überwachungsmonitore, die neben Herzfrequenz und Blutdruck auch die Atemfrequenz und die Sauerstoffsättigung im Blut anzeigten. Fiel einer der Werte bedrohlich ab, erklang ein Warnton, und das Gerät machte Meldung an den Computer in der Kanzel. Beide Betten waren belegt. Neben einem zweiundachtzigjährigen Rentner stand eine Beatmungsmaschine. Ein Dialysegerät filterte seit drei Tagen die giftigen Stoffwechselprodukte aus seinem Blut. Der Alte hatte nach einer Tumoroperation einen septischen Schock erlitten. Vor vier Tagen war er schließlich ins Koma gefallen. Die Ehefrau und die Kinder des Mannes waren entsetzt gewesen.
Für das medizinische Personal gehörte der Tod zum Krankenhausalltag dazu. Auch wenn Menschen primär hierherkamen, um geheilt zu werden, eine Garantie dafür gab es nicht. Vielleicht konnte Reichtum Leben verlängern, aber kein Geld der Welt vermochte das Sterben zu verhindern.
Mecki horchte auf den Flur hinaus. Die Schritte der Kollegen eilten draußen vorbei.
Die meisten Kranken auf dieser Station waren ohne Bewusstsein. Nach Meinung ihrer Hamburger Chefs ließ sich eine künstliche Beatmung stark sediert auch besser verkraften. Aber Mecki war anderer Meinung, wie so oft. Mancher Chefarzt blendete aus, dass es bei einem Drittel der intubierten Patienten immerhin noch Monate nach der Langzeitsedierung zu posttraumatischen Belastungsstörungen kommen konnte. Aber wer hörte schon auf eine wie sie?
In dem anderen Bett lag ein junger Familienvater, den der Rettungswagen am Morgen gegen 10:30 Uhr bewusstlos in einer Vakuummatratze in die Notaufnahme gebracht hatte. Bei seinem Fahrradunfall hatte er sich weder Arme noch Beine gebrochen. Auch innere Organe waren nicht verletzt worden. Nicht einmal Schürfwunden hatte der Mann sich zugezogen. Nur diese kleine Fraktur am Schädel, dort, wo er mit dem Kopf auf dem Poller aus Beton aufgeschlagen war, zeugte von seinem Unfall. Wie Passanten dem Notarzt des Krankentransports berichtet hatten, war der Architekt auf dem Weg zur Arbeit lediglich in Schrittgeschwindigkeit mit seinem Fahrrad einen abgeflachten Bordstein am Hamburger Gänsemarkt hinaufgefahren und dabei ins Straucheln geraten. Eine Frau hatte den Sturz als wie in Zeitlupe beschrieben. Vermutlich wäre ihm nichts weiter passiert, so mutmaßten die operierenden Neurochirurgen später, hätte er auf seinem Weg ins Büro nicht nur einen italienischen Anzug, sondern auch einen Helm getragen. Der Vater zweier kleiner Kinder war seitlich mit dem Kopf auf die Absperrung gestürzt. Die Computertomografie von Schädel und Gehirn war ernüchternd. Während der Knochen nur eine leichte Verletzung zeigte, gaben die Einblutungen durch die Hirnquetschung Grund zur Sorge.
Sie strich dem jungen Mann die braunen Locken aus dem Gesicht, die ihm nach der Operation noch geblieben waren. Er hatte Glück gehabt. Die Ärzte konnten ihm als Ventrikeldrainage einen dünnen Schlauch unter die Haut schieben und durch ein winzig kleines Bohrloch im Vorderhorn des Schädels implantieren, statt den Knochen für die Ableitung des Hirnwassers mehrfach aufzubohren. Der Liquor floss nur langsam ab und machte der Hirnschwellung Platz. Nach dem Eingriff wurde der Patient ins künstliche Koma versetzt. Rechts neben seinem Bett standen die Perfusoren übereinander, die dafür sorgten, dass er die benötigten Medikamente automatisch durch Zugänge in Armen und Handrücken verabreicht bekam.
Auch dieser Patient war an ein mikroprozessorgesteuertes Beatmungsgerät angeschlossen. Er schwitzte. Vorsichtig wendete sie seine Bettdecke. Oberschenkel und Waden waren kräftig trainiert. Malte Ostersetzer war neununddreißig Jahre alt und hatte allem Anschein nach gut auf seinen Körper aufgepasst. Sie korrigierte den Sitz der kleinen Gummimanschette, die auf der Kuppe seines Zeigefingers verrutscht war und den Wert des Sauerstoffgehalts in seinem Blut auf den Überwachungsmonitor übertrug. Die Klemme rutschte erneut ab. Noch bevor der Alarmton ausgelöst wurde, steckte sie das Teil auf den Mittelfinger um.
Obwohl sich die Ärzte im Gespräch mit der Ehefrau des Patienten nicht hatten festlegen wollen, wussten sie es eigentlich längst: Der Mann hatte ein so schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten, dass er dauerhafte, gravierende Einschränkungen zurückbehalten würde. Durch die Einblutungen in den Stammganglien, die für die komplexen Abläufe von Bewegungen wie Gehen oder Fahrradfahren zuständig waren, würde sich Malte Ostersetzer nie wieder selbst versorgen können.
Seine Frau hätte ab jetzt ein drittes Kind zu betreuen, da war sich Mecki sicher.
Anna schreckte auf. Sie brauchte nur den Bruchteil einer Sekunde, um zu realisieren, dass sie Maltes Unfall am Tag zuvor nicht geträumt hatte. Sofort griff sie nach ihrem Handy, um zu kontrollieren, ob sich das Krankenhaus gemeldet hatte. Es war 4:15 Uhr, und draußen machten die ersten Vögel bereits Radau. Keiner der Ärzte hatte angerufen. Das war ein gutes Zeichen, oder? Hatten sie nicht angekündigt, sich nur im Notfall zu melden? Niemand hatte Notfall näher definiert, aber ihr war klar, dass damit die Verschlechterung seines Zustands gemeint war. Anna kämpfte mit den Tränen, gegen die sie sich genauso wenig wehren konnte wie gegen das Bild, das sich gestern Mittag in ihrem Kopf festgesetzt hatte. Wie hilflos Malte mit teilrasiertem Schädel halb aufrecht in seinem Bett gesessen hatte. Drum herum die Apparate, Maschinen mit Signalkurven und Warntönen. Dazu noch dieses Ding, das in seinem Kopf steckte. Ihr war im Büro das Telefon aus der Hand gefallen, nachdem ein Arzt aus der Karesis-Klinik in der HafenCity angerufen hatte, um sie über den Unfall ihres Mannes zu unterrichten. Malte hatte ihre Handynummer als Notfallkontakt in seinem Smartphone hinterlegt, und der ließ sich trotz des Sperrbildschirms aktivieren. Sofort hatte Anna die Behörde für Stadtplanung in Wilhelmsburg verlassen und war ins Krankenhaus gefahren.
Bei dem Gedanken presste sie sich ein Kissen ins Gesicht, damit ihre Söhne nicht durch das Schluchzen aufgeweckt wurden. Anna hatte es gestern Nachmittag nicht übers Herz gebracht, Fritz und Paul, die erst neun und sechs Jahre alt waren, die ganze Wahrheit über den Unfall ihres Vaters zu erzählen. In ihrer Version der Geschichte war er zwar gestürzt, aber dass er nach einer Operation im Koma lag, hatte sie ausgelassen. Zumal die Ärzte, und das hatte Anna genau gespürt, sie darüber im Unklaren gelassen hatten, wie schlimm es wirklich um Malte bestellt war. Man wollte sie als Ehefrau schonen und hatte um den heißen Brei herumgeredet. Erst wenn er aus dem künstlichen Koma erwachte, so die Ärzte, könne man eine erste Prognose über den Stand der Dinge wagen. Als Anna gestern völlig fertig zu Hause angekommen war, hatte sie Schädelverletzungen gegoogelt. Ihr war bewusst, dass nichts mehr so sein würde, wie es gestern Morgen noch gewesen war, als sie sich vor der Haustür mit einem Kuss voneinander verabschiedet hatten. In der Nacht zuvor hatten sie miteinander geschlafen und waren sich beim Abschied noch so nah gewesen, dass Anna nur ungern zur Arbeit gefahren war.
Nach ihrem Besuch auf der Intensivstation hatte der Schock dafür gesorgt, dass sie funktionierte. Sie hatte die Familie telefonisch über den Unfall informiert. Maltes Mutter hatte das Gespräch überfordert abgebrochen. Seine Schwester kümmerte sich um die Eltern und hatte Anna geschrieben, dass ihr die gesamte Familie zur Seite stünde. Am Nachmittag hatte Anna dann einige Tage Urlaub beantragt, noch Lebensmittel im Supermarkt um die Ecke besorgt und sich anschließend um die Jungs gekümmert. Erst abends, als Fritz und Paul im Bett gelegen hatten und es ruhiger geworden war, war Anna weinend zusammengebrochen. Vor Erschöpfung war sie schließlich in ihren Büroklamotten auf dem Sofa eingeschlafen.
Und nun brannte in der gesamten Dachgeschosswohnung noch das Licht. Anna schaute wieder auf ihr Handy und scrollte durch besorgte Textnachrichten. Im Freundes- und Bekanntenkreis hatte Maltes schwerer Fahrradunfall schnell die Runde gemacht. Aber sie fühlte sich einfach nicht dazu in der Lage, auch nur eine einzige Antwort zu verschicken.
Malte war ein zäher Fighter, in jeder Beziehung. Sein ganzes Leben hatte er viel Sport getrieben. Er brauchte das als Ausgleich zum Job und konnte ohne Bewegung schnell hibbelig werden. Dann musste er an die frische Luft. Er kickte mit seinen Jungs im Stadtpark, spielte Squash mit seinem besten Kumpel David, und selbst bei Regen zog er im Einer auf der Alster seine Bahnen. Anna freute sich, dass er seinen Bewegungsdrang offensichtlich an die Jungs vererbt hatte, die gerne mit ihrem Vater zum Germania Ruderclub radelten, mit Helmen auf den kleinen Köpfen, worauf der Vater immer bestanden hatte. Dabei war den Jungs längst aufgefallen, dass der Vater Wasser predigte, aber Wein trank. Ein Ausdruck, den Maltes Mutter gern benutzte. Der Kinder wegen hatte er vor einer Woche endlich zugestimmt, einen Helm für sich zu kaufen. Vielleicht war Anna ihm auch einfach nur lange genug auf die Nerven gegangen. Malte hatte ihr schon einige Modelle im Netz gezeigt, die er mal ausprobieren wollte. Wieso hatte er sich nicht früher einen Kack-Fahrradhelm aufgesetzt? «Meine schönen Locken», hatte er sie immer aufgezogen und sich dabei hinten die Haare aufgetufft, wie seine Mutter das machte, wenn sie vom Friseur kam. «Schatz, mach dir keine Sorgen, ich kann Fahrrad fahren», hatte er zur Beruhigung gesagt. Anna konnte nicht begreifen, dass ihrem Mann nun ein abgeflachter Bordstein zum Verhängnis geworden war.
Als Intensivpflegerin ließ sie den Monitor über seinem Bett nur selten aus den Augen, und auch als sie sich auf das Bett setzte, behielt sie die Werte im Blick. Die oberste Linie zeigte in Grün die Herzfrequenz an. Das Organ schlug dreiundsechzig Mal in der Minute. Etwas weniger, als es für einen Mann in seinem Alter üblich war, aber der Pegel aus Sedativa und Analgetika, den die Ärzte ihm seit der Operation verabreichten, hielt das künstliche Koma aufrecht. Trotzdem sprach sie beruhigend auf ihn ein. Sie musste sich beeilen. Durch die Tracheotomie, bei der ihm die Ärzte einen chirurgischen Eingang zur Luftröhre geöffnet hatten, war die Verbindung zu den oberen Atemwegen unterbrochen worden. An seiner Atmung hörte sie, dass die Trachealkanüle Sekret gesammelt hatte. Es musste bald abgesaugt werden. Kurz schaute sie zur geschlossenen Tür und lauschte, ob es auf dem Flur ruhig blieb.
Anna nahm einen Schluck aus dem halb vollen Weißweinglas auf dem Couchtisch, aus dem sie am Abend getrunken hatte. Sie spürte, wie sie etwas Kratziges die Kehle hinunterspülte. Als sie das Glas wieder absetzte, sah sie, dass einige tote Mücken darin schwammen.
«Mami, ich kann nicht schlafen.»
Paul war im Türrahmen aufgetaucht und lehnte sich dagegen. Er hatte sein Laken hinter sich hergezogen und blinzelte durch verknautschte Augen. Anna riss sich sofort zusammen.
«Was ist los?» Sie dirigierte ihren Jüngsten zu sich auf das Sofa und passte auf, dass er mit seinem Laken nicht an dem kleinen Tischchen mit den Familienfotos hängen blieb. Zu spät. Der letzte Zipfel wickelte sich um den dreibeinigen Fuß und brachte die ganze Platte zum Zittern. Onkel Max und Oma Inge wackelten samt ihrem silbernen Rahmen, und auch das Foto von Fritz’ und Pauls Sprung in das Außenbecken des Holthusenbades vibrierte gefährlich. Doch alle Bilderrahmen blieben stehen – bis auf den von Malte. Das Foto darin zeigte ihn glücklich und erhitzt in seinem Ruderboot auf der Außenalster.
Es kippte um und fiel vom Tisch.
Sein saurer Schweißgeruch überlagerte das Desinfektionsmittel. Mecki nahm seine Hand, in der ein intravenöser Zugang mit Dreiwegehahn klemmte, und strich sich mit seinen Fingern zärtlich über die Lippen. Sie schloss die Augen und beugte sich zu seinem Ohr hinunter. Kaum hörbar flüsterte sie ihm zu:
«Nimm die Klage deiner Tage, schnall sie auf den Rücken mir. Mach dein Leid zu meinem Kreuze, das ich trag auf Erden hier.»
Dann öffnete sie die Verpackung einer Einmalspritze und steckte eine Kanüle auf. Sie zog eine Brechampulle aus der Tasche und stellte durch leichtes Klopfen sicher, dass sich kein Wirkstoff des Gilurytmals mehr im oberen Teil befand. Auf dieses Medikament gegen Herzrhythmusstörungen griff sie gern zurück. Wie bei dem jungen Mann, der mit Myeloischer Leukämie am Dialysegerät dahinsiechte und den sie vor fünf Tagen in ihre Obhut genommen hatte.
Nun brach sie den Kopf der Ampulle, vom Körper weg, mit einem Tupfer ab, nahm die Spritze zur Hand und führte die Kanüle bis zum Boden des leicht schräg gehaltenen Fläschchens. Langsam zog sie die fünfzig Milligramm auf, bis der Glasbehälter vollständig geleert war.
Plötzlich hörte sie, wie hinter ihr die Schiebetür des Intensivzimmers geöffnet wurde. Blitzschnell ließ Mecki die Spritze unter der Bettdecke des Mannes verschwinden und tat, als kontrollierte sie den Sitz seiner Trachealkanüle.
«Könnten Sie mir kurz helfen, Frau Kramer? Ich kriege die dreiundneunzig Kilo nebenan nicht alleine gewendet.»
Sie schaute sich nach Cornelia Knüpfer um, die im Türrahmen lehnte. Die einzige Kollegin, mit der sie sich im Team siezte.
«Wenn ich abgesaugt habe, komme ich rüber.» Mecki spürte ihren beschleunigten Puls. Die Knüpfer verschwand und schloss die Tür. Jetzt musste es schnell gehen. Sie zog die Spritze unter der Bettdecke hervor, drückte die Luft aus dem Kolben, entfernte die Nadel und setzte sie an den freien Zugang des Dreiwegehahns in der Hand des Mannes. Ohne noch einmal abzuwägen, ohne ihm noch einen Tag oder eine Nacht Aufschub zu gewähren, verabreichte sie ihm langsam die Injektionslösung, während das leise Glockengeläut der Sankt-Jacobi-Kirche aus der Innenstadt herüberklang, das sich mit jedem gespritzten Milliliter zu einem ohrenbetäubenden Hosianna in ihrem Kopf aufschwang. Er hatte es gleich geschafft.
Sie entledigte sich der Einmalhandschuhe, die sie zusammen mit der Spritze und der Ampulle in den Abwurfbehälter für spitze Gegenstände warf. Der Mann verstarb alleine und ohne Familie exakt um 5:00 Uhr morgens.
Anna Ostersetzer stand am nächsten Morgen vor den verschlossenen Türen der Intensivstation im zweiten Stock der Karesis-Klinik. Gegen 10:00 Uhr klopfte sie nervös gegen die Scheibe des Empfangs. Das Glas des Kastens reichte bis zur Decke und verlieh ihm die Anmutung eines Bankschalters. Gestern, in ihrem Schock über Maltes schwere Kopfverletzung, hatte Anna das scheußliche Orange des Empfangs gar nicht wahrgenommen. Die Tür zum Raum dahinter stand einen Spaltbreit offen. Sie erkannte ein Gewusel aus hellblauen Pflegeuniformen und nahm an, dass es sich um das Schwesternzimmer handelte. Aber niemand hörte oder sah sie auf der anderen Seite der Scheibe stehen. Das Stationstelefon klingelte. Um sich abzulenken, zählte Anna mit. Nach sechs Malen verlor der Anrufer anscheinend die Geduld. Nervös knibbelte sie am Anhänger ihres Autoschlüssels.
Wieder sah Anna Malte in diesem Spezialbett vor sich, eine Seite des Schädels rasiert, ohne Bewusstsein. Die Jungs hatte sie nach dem Frühstück, bei dem sie sich bemüht hatte, Ruhe auszustrahlen, mit dem Auto zu ihrer besten Freundin Nina gefahren, die sich bis zum Nachmittag um die beiden kümmern wollte. Die Sommerferien der Kinder bedeuteten eine zusätzliche Herausforderung in dieser Katastrophe. Sie wie geplant in die Ferienbetreuung zu schicken, kam für Anna nicht infrage.
Warum kam denn niemand? Erneut klopfte Anna und rief laut Hallo. Es fiel ihr schwer, nicht plötzlich in allem ein böses Omen zu sehen – wie Maltes Bild, das in der Früh vom Tisch gefallen war. Oder wie der Moment eben im Auto, als sie einen Prospekt mit Fahrradhelmen unter dem Sitz gefunden hatte, in dem bereits einige Modelle angekreuzt waren. Anna hatte die Stirn auf das Lenkrad gelegt und war heulend sitzen geblieben. Der kurze Moment der Zuversicht, den sie am Morgen noch gespürt hatte, als sie das leichte Sommerkleid mit den blauen Kornblumen angezogen hatte, das Malte so mochte, war vorbei.
Eine Krankenschwester betrat den Empfang, ohne von Anna Notiz zu nehmen. Sie schien in der Ablage neben dem Telefon etwas zu suchen. Anna klopfte zum dritten Mal gegen die Scheibe. Die Frau dahinter erschrak.
«Ach du meine Güte», klang es dumpf aus dem Glaskasten. «Ich habe Sie gar nicht gesehen.» Der Schwester hing ein Stethoskop um den Hals. Die praktische Kurzhaarfrisur passte irgendwie zu ihrer drahtigen Figur. Anna schätzte die Frau auf Ende dreißig.
«Ostersetzer. Ich möchte zu meinem Mann.»
«Die Kollegen sind gerade mit der Körperpflege der Patienten beschäftigt», sagte die Schwester freundlich, aber bestimmt und schaute auf ihre Uhr. «Ich bin gar nicht mehr im Dienst.»
«Ich habe versucht anzurufen», sagte Anna.
«Morgens ist eigentlich immer schlecht. Zwischen 15:00 und 19:00 Uhr ist es am besten.»
«Mein Mann ist gestern erst eingeliefert worden. Er ist nicht bei Bewusstsein.» Anna spürte, wie schwer ihr diese Worte fielen. «Ich möchte … kann ich einen Arzt oder eine Ärztin sprechen?»
«Was sagten Sie, wie war Ihr Name?»
«Ostersetzer, Malte heißt mein Mann.»
Der Gesichtsausdruck der Frau wurde weicher. «Frau Ostersetzer. Moment. Bitte warten Sie.»
Während Anna nervös auf die Automatiktür mit dem orangen Schriftzeichen ITS2 starrte, überschlugen sich ihre Gedanken. Sie musste die Reise an die Nordsee stornieren. Sie konnten doch nicht nächste Woche in die Sommerferien fahren. Dabei liebten sie alle vier das Meer so sehr. Und hatten Malte und sie nicht beide eine Unfallversicherung abgeschlossen? Darum sollte sie sich auch kümmern. Und das Essen morgen Abend bei Wiebke musste sie absagen. Anna wusste, dass das alles total egal war, aber sie brauchte irgendeinen belanglosen Gedanken, der sie von ihrer Angst ablenkte. Endlich gab ein Klacken die Tür frei, die sich surrend öffnete. Anna betrat den Flur und sah zwei Krankenpfleger, wie sie ein leeres Bett in Richtung des Transportaufzugs schoben.
Plötzlich traten alle Geräusche in den Hintergrund, und Anna hörte nur noch ihren eigenen Puls. So, als würde sie den Kopf in der Badewanne unter Wasser tauchen.
Als sie realisierte, dass das Bett aus Maltes Zimmer gekommen war, wurde ihr schwarz vor Augen.
3Soltau. Vor zehn Jahren.
Es nieselte mal wieder in der Lüneburger Heide, als Mecki um 7:30 Uhr in voller Regenmontur mit dem Fahrrad von zu Hause losfuhr. So wie gestern Nachmittag, als sie den Rentner mit seinem Kissen erstickt hatte. Die Dreiviertelstunde, die sie für die knapp vierzehn Kilometer von Wietzendorf bis nach Soltau ins Hermann-Löns-Krankenhaus benötigte, war die einzige Zeit des Tages, die ihr gehörte. Als ihr ein Spaziergänger mit seinem Dackel begegnete, musste sie schmunzeln. Das Tier erinnerte sie an ihre beste Freundin aus Kindertagen. Bis heute konnte sie die Bilder nicht vergessen, wie Susanne vom Rauhaardackel der Familie unter einen riesigen Rhododendronstrauch verschleppt worden war. Er hatte seinem kleinen Opfer den Oberkörper aufgerissen und das Innerste nach außen gekehrt. Manchmal schien es Mecki, als würde die Machtlosigkeit von damals sie noch heute antreiben, wie eine Schuld, die sie begleichen musste.
Heulend war sie auf allen vieren ins Dickicht gekrochen und hatte die einzelnen Teile ihrer verstümmelten Puppenfreundin geborgen. Und während sie mit einer groben Stopfnadel den Körper zusammenflickte, stellte sie sich vor, eines Tages eine berühmte Ärztin zu werden. Die Operation war erfolgreich. Wenn Susanne ihre bunten Kleider trug, sah man ihr die Verstümmelungen auf den ersten Blick kaum noch an. Trotzdem fragte man sich, was mit ihr nicht stimmte. Bei genauerer Betrachtung erkannte man schließlich ihr Dilemma: Das linke Bein war auf der rechten Seite angenäht worden – und umgekehrt. Anfängerfehler. Aber das Wichtigste war, Susanne hatte überlebt, und auch Meckis Tochter Vera hatte als kleines Mädchen noch mit ihr gespielt.
An diesem Morgen hatte Vera bereits eine halbe Stunde früher das Haus verlassen, um mit dem Bus zur Frühstunde nach Hermannsburg zu fahren. Sie besuchte die siebte Klasse des Gymnasiums und war eine mäßige Schülerin, die zu Hause aber früh lernte, dass das Abitur für sie alternativlos war. Dieter schlief noch. Seit fünf Jahren waren Mecki und der Verwaltungsangestellte, der bei der Stadt Munster im Bürgerbüro für Soziales arbeitete, ein Paar. Sie hatten sich im Festzelt auf dem Schützenfest in der benachbarten Garnisonstadt kennengelernt. Anschließend hatte Dieter vor Aufregung am Schießstand danebengeschossen und auch bei der Tombola kein Glück gehabt. Nach Bratwurst mit Pommes und einigen Kurzen am Imbiss hatte er dann in der Raupe endlich genügend Mut aufgebracht. Als das Verdeck geschlossen wurde, hatte er seinen Arm um Meckis Schultern gelegt. Seine Küsse schmeckten rot-weiß. Fünf Monate später war sie mit ihrer achtjährigen Tochter Vera bei ihm eingezogen.
Wie immer, wenn sie wie heute zur Frühschicht durch die Lüneburger Heide ins Krankenhaus radelte, hatte sie Dieter die Kaffeemaschine vorbereitet. Er liebte einen Hauch Zimt auf dem Kaffeepulver, wenn das heiße Wasser durch den Filter lief. Und er liebte sie, wie er ihr immer wieder versicherte. Zwei frische Rundstücke hatte Mecki ihm heute in das Körbchen auf dem Küchentisch gelegt.
Das machte sie selbst dann, wenn sie nach den Nachtschichten nach Hause kam und oftmals noch das benutzte Geschirr vom Abend auf dem Tisch stand, obwohl in der Spülmaschine genügend Platz gewesen wäre. Wie oft hatte sie sich darüber beschwert, wie wenig hatten Dieter und Vera etwas daran geändert?
Nun vertrieb der Regen ihren Ärger und die Restmüdigkeit. Mit jedem Kilometer, den sie auf dem Fahrradweg durch die Natur der Heidelandschaft zurücklegte, die im März noch weit vom prächtigen Lila des Spätsommers entfernt war, konnte sie immer besser durchatmen. Sie beneidete die Wiesen und Waldstücke, die nur den Jahreszeiten Rechenschaft ablegen mussten und sonst in Ruhe gelassen wurden. Das knospige Grün glänzte im Regen.
Eine halbe Stunde später betrat Mecki die Personalumkleide der Allgemeinmedizinischen Station des Hermann-Löns-Krankenhauses. Die Luft war feucht. Sie kippte das Fenster und hängte den Bügel mit ihren nassen Fahrradklamotten an den Griff. Sie war gerne vor den Kolleginnen fertig umgezogen und trank vor Dienstbeginn noch in Ruhe einen Kaffee. Der Enge der Garderobe und dem Gerede über Belangloses entfloh sie meistens rechtzeitig. Heute war sie zu spät.
«Was ein Scheißwetter. Guten Morgen, Mecki.» Brit betrat den Raum und legte ihren tropfenden Regenschirm ins Waschbecken. Schon als sie vor dreizehn Jahren gemeinsam die Schwesternschule in Soltau besucht hatten, war ihre Kollegin bei schlechtem Wetter immer mit dem Bus gekommen.
«Grüß dich.» Mecki schaute Brit nicht an. Auch eine Taktik, das Gespräch zu vermeiden.
«Hast du das gestern eigentlich noch mitbekommen?» Brit öffnete ihren Spind, der sich in einer Schrankreihe an der gegenüberliegenden Wand befand.
«Was?» Mecki tat beiläufig, obwohl ihr das Herz unter der hellblauen Arbeitskleidung bis zum Hals schlug.
«Ach nee, du warst ja schon weg. Der alte Herr Garstedt ist verstorben. Die Kollegen der Abendschicht haben ihn in seinem Bett gefunden. Er war schon kalt. Dörte hat mir gestern getextet.»
«Oh nein!» Mecki fand sich überzeugend. «Als ich das letzte Mal nach ihm geschaut habe, hat er sich noch für das extra Dessert bedankt, das ich ihm mittags besorgt hatte.» Ein Regentropfen lief ihr aus den kurzen Haaren, denen sie ihren Spitznamen verdankte. Der Tropfen blieb an den Wimpern hängen wie eine Träne. Sie wischte ihn weg.
«Ein Tod, wie man ihn sich wünscht. So hat er wenigstens nicht kämpfen müssen.» Brit zog sich für die Schicht um, während Mecki sich unwohl daran erinnerte, wie ihr der alte Mann gestern Nachmittag in seiner Verzweiflung seinen Ehering übers Ohr gezogen hatte.
«Ich will mir vor der Übergabe noch schnell einen Kaffee holen.» Auch wenn die Kollegin offensichtlich keinen Verdacht hegte, wollte Mecki die Umkleide trotzdem so schnell wie möglich verlassen. «Bis gleich.»
Das nächste Teammitglied erschien zum Dienst. Ulla Waldmann betrat den engen Raum und versperrte Mecki den Weg. Sie trug noch ihren Integralhelm auf dem Kopf. Das himmelblau verspiegelte Visier, auf das sie so stolz war, weil es dieselbe Farbe hatte wie ihre schwere Kawasaki, stand offen. Der Regen perlte ihre Motorradkombi hinunter und hinterließ kleine Pfützen auf dem Fußboden. Ulla wurde auch die Gewichtheberin genannt. Sie hatte mehr Kraft als einige der männlichen Pfleger und war die Spezialistin für Wenden und Umlagern. Zartere Kolleginnen waren froh, wenn Ulla in ihren Schichten arbeitete. Manche witzelten, ob sie unter ihrem Kasack einen Stützgürtel trug. Mecki beteiligte sich grundsätzlich nicht an solchen Lästereien. Auch sie war genervt, weil Ulla herumbosste und Arbeit delegierte, obwohl sie keine Teamleiterin war. Trotzdem behandelte Mecki die kräftige Frau mit Respekt – auch wenn sie umgekehrt nicht das Gleiche erwarten konnte.
«Hallo, Ulla.» Mecki wollte schnell an ihr vorbei auf den Flur hinaus.
«Ich wusste nicht, dass wir in derselben Schicht arbeiten.» Ihre Abneigung hätte Ulla gar nicht so sehr betonen müssen, man konnte sie allein an ihrem herablassenden Blick ablesen.
«Was ist denn mit deinem Ohr passiert?»
«Nur ein kleiner Schmiss. Da bin ich an der Tür vom Oberschrank im Stationszimmer hängen geblieben.» Souverän servierte Mecki ihre vorbereitete Antwort, schob sich an der Kollegin vorbei und verließ die Umkleide. Einfach nur raus hier. Ullas Stimme drang durch die geschlossene Tür. «Wem gehören denn diese Scheiß-Fahrradklamotten?» Es klang, als mache sie das Fenster wieder zu.
«Mensch, Ulla, musst du immer so unfreundlich zu Mecki sein?» Es war wirklich nett von Brit, sie so zu verteidigen.
«Ich mag sie auch nicht sonderlich», kam es hinterher. «Aber sie ist eine sehr gewissenhafte Kollegin.»
Zumindest wusste Mecki jetzt, woran sie bei Brit war. Sie blieb stehen und lauschte weiter. Spinde wurden auf- und zugemacht. Das Geräusch einer Spraydose ließ Mecki vermuten, dass Ulla sich wieder mit ihrem nach künstlicher Mango riechenden Deo einnebelte.
«Hast du schon gehört? Der alte Herr mit dem Blasenkarzinom ist gestern gestorben.» Brit brachte die Neuigkeit des Tages weiter unters Volk. Das Fenster wurde wieder gekippt.
«Ist ja ein Ding.» Ulla klang ehrlich überrascht. «Ich hätte ihm mindestens noch zwei Wochen gegeben.» Ein Schlüsselbund fiel zu Boden. «Hatte nicht Mecki gestern Dienst?» Ulla sprach gepresst, vermutlich bückte sie sich gerade nach dem Schlüssel.
Wie kam sie bloß auf diese Frage? Mecki tat so, als würde sie die Taschen ihres Kasacks durchsuchen, als ihr ein Assistenzarzt und eine Intensivkrankenschwester in lila Pflegeuniform einen guten Morgen wünschten. Sie hörte, dass die beiden im Gespräch über Beatmungsmaschinen waren, von denen das Personal auf dieser Station wenig Ahnung hatte.
«Das ist jetzt schon der dritte PAT in kurzer Zeit, der geht, wenn diese Frau Dienst hat.» Ullas Lachen dröhnte durch die geschlossene Tür. Mecki schluckte trocken. Mit der geplatzten Bauchraumarterie der Patientin, die Mecki vor einigen Wochen auf dem Transport im Fahrstuhl verstorben war, hatte sie nichts zu tun gehabt. Außerdem war Fabian dabei gewesen. Trotzdem machten Ullas Mutmaßungen, auch wenn sie nur im Spaß geäußert wurden, Mecki nervös. Der Kaffee musste noch ein bisschen warten.
«Wie hieß noch dieser Typ … der mit den fiesen Füßen?» Ulla ließ nicht locker.
«Wen meinst du?», fragte Brit.
«Den Blinddarm.»
«Der Kfz-Mechaniker? Keine Ahnung.»
Mecki wurde heiß und kalt. Es war unmöglich, dass irgendjemand etwas davon mitbekommen hatte. Sie war beim Spritzen des Insulins alleine mit dem Mann gewesen. Der Arzt, der die Leichenschau durchgeführt hatte, hatte wegen des allgemeinen Gesundheitszustandes des Alkoholikers nicht für eine Sekunde an Herzversagen als Todesursache gezweifelt. Niemandem war die Einstichstelle zwischen den Zehen aufgefallen. Mecki hatte sich sicher gefühlt. Vielleicht zu sicher?
4Hamburg. Vor vierzehn Tagen.
Jemand rief ihren Namen. Um Anna herum war es dunkel. «Frau Ostersetzer? Können Sie mich hören?» Sie spürte leichte Klapse im Gesicht. Anna öffnete die Augen und kniff sie sofort wieder zusammen, weil die Leuchtstoffröhren an der Decke blendeten. Sie hob den Kopf, setzte sich mithilfe einer Krankenschwester langsam auf der Liege auf und zog sich das Papierlaken vom verschwitzten Rückenteil ihres Kleides.
«Frau Ostersetzer?» Ein Mann saß ihr gegenüber. «Dr. Johannes Petzold. Ich bin der Chefarzt dieser Station.» Er lächelte aufmunternd und deutete auf die Blutdruckmanschette in seiner Hand. «Sie sind uns eben im Flur umgekippt.»
Anna schaute ihn verwundert an und nahm ein Glas Wasser von der Krankenschwester entgegen, bevor diese von einer Kollegin zum Umlagern eines Patienten gerufen wurde und das Stationszimmer verließ.
«Was ist mit meinem Mann?» Anna bemerkte das Zittern in ihrer Stimme und trank einen Schluck. «Was ist mit ihm passiert?» Tränen liefen ihr das Gesicht hinunter, die sie trotzig mit dem Handrücken abwischte.
Der Arzt schaute sie überrascht an. «Was soll mit ihm passiert sein? Sein Zustand ist unverändert.»
«Das leere Bett, das eben aus seinem Zimmer geschoben wurde. Ich dachte …» Langsam wurde ihr bewusst, dass sie sich in ihrer Panik das Worst-Case-Szenario zusammengereimt hatte. Sie hörte sich im Geiste mit Malte streiten, weil der sich immer darüber aufregte, dass sie oft vom Schlimmsten ausging, statt die Situation erst zu analysieren und in Ruhe nach einer Lösung zu suchen.
Dr. Petzold schien in diesem Moment wohl zu begreifen, warum sie ohnmächtig geworden war. «Frau Ostersetzer, der Zimmernachbar Ihres Mannes ist heute Nacht verstorben. Wir haben lange gekämpft, aber … Organversagen nach einer Sepsis.» Sein Lächeln drückte Bedauern aus, obwohl er eine solche Nachricht bestimmt schon hundertmal hatte weitergeben müssen. Dabei hatte sie den Verstorbenen überhaupt nicht gekannt.
«Der Tod gehört, ganz besonders auf dieser Station, leider zu unserem Beruf.» Der Arzt blickte kurz durch die geöffnete Tür auf den Flur hinaus. Anna war gestern schon aufgefallen, wie straff organisiert hier alles ablief und wie trotz aller Hektik jeder ruhig seiner Arbeit nachging.
«Befund und Konstitution des verstorbenen älteren Herrn sind nicht mit denen Ihres Mannes zu vergleichen. Er ist Sportler, stimmt’s?»
Sie nickte. Wollte er sie nur beruhigen, oder gab es wirklich Anlass zur Hoffnung? Sie wiederholte die Frage, die ihr gestern nicht beantwortet worden war. «Ich hatte den Eindruck, dass Ihre Kollegen mir nicht die ganze Wahrheit sagen wollten.» Sie schaute dem Arzt in die Augen.
«Sie meinen, wie schlimm seine Verletzung ist?»
«Ja.»
«Es tut mir leid, dass wir zu diesem Zeitpunkt tatsächlich nicht mehr sagen können. Bei Hirnverletzungen ist das so eine Sache, zumal wir Ihren Mann sehr stark sedieren. Wir haben erst Klarheit, wenn wir ihn aus dem künstlichen Koma holen.»
«Darüber, ob er sich noch bewegen kann?»
«Zum Beispiel.»
«Sprechen?»
«Auch. Hören Sie, ich will offen zu Ihnen sein. Der Hirndruck …» Er schaute konzentriert auf die Tabellen vor sich auf dem Computerbildschirm. «Also, bei gesunden Menschen liegt der Wert zwischen fünf und zehn mmHg. Das ist die Einheit, in der wir messen. Ihr Mann hatte am Morgen immer noch einen Wert von über vierzig. Wir sprechen also von einem sehr erhöhten Wert. Und das bei gesetzter Drainage, die den Druck verringern soll.»
Sie schwieg.
«Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen kann er von einer Störung der Ziel- und Feinmotorik, Schwierigkeiten beim Gehen und Stehen, bis hin zu einer Aphasie, also einem Verlust des Sprechvermögens, einige gravierende Einschränkungen zurückbehalten. Aber er wird diesen Unfall überleben. Davon können wir zum jetzigen Zeitpunkt ausgehen.»
Anna nickte stumm. Sie hatte um Ehrlichkeit gebeten und sie von Dr. Petzold erhalten.
«Ich habe was für Sie. Moment.» Er stand auf und ging hinüber zu einem kleinen Schränkchen, aus dem er eine abschließbare Kassette hervorholte.
«Eine Kollegin aus der Nachtschicht hat den Ehering Ihres Mannes gefunden. Erinnern Sie sich? In der Hektik der Notoperation war er gestern verloren gegangen.» Dr. Petzold überreichte Anna Maltes Ehering und bat sie, den Empfang mit einer Unterschrift auf einem Formular zu quittieren. Sie musste schlucken. Noch nie hatte er den Ring abgenommen, nicht einmal beim Rudern. Zu groß war seine Angst, ihn zu verlieren. Anna nahm ihn in die Hand. Der kleine Rubin im Inneren der Ringschiene schimmerte im Deckenlicht wie ein Tropfen Blut. Als Symbol, das Herz des Partners immer bei sich tragen zu wollen, hatten sie die Steine neben die Gravur ihrer Namen und des Hochzeitstages einsetzen lassen. Es war seine Idee gewesen. Sie ballte eine Faust. In guten wie in schlechten Zeiten. Malte würde es schaffen, mit ihrer Hilfe und der Unterstützung der Jungs. Heute Abend würde sie mit Fritz und Paul sprechen. Die Kinder hatten ein Recht zu erfahren, was passiert war. Sie würde es behutsam anstellen, ohne dass sie ihnen unnötig Angst machte.
«Kann ich zu ihm?»
«Frau Ostersetzer, wir alle wissen, wie wichtig die Nähe von Familie für unsere Komapatienten ist.» Der Arzt zögerte. «Aber um diese Uhrzeit sind wir sehr beschäftigt. Die Patienten werden umgelagert, gewaschen, wir wechseln Zugänge, Schläuche und Tuben für die Beatmung. Vielleicht ist es besser, wenn Sie etwas später wiederkommen?» Er sagte das sehr freundlich, und Anna bekam ja den Trubel mit, von dem er sprach. Wie aufs Stichwort betrat eine weitere Krankenschwester das Stationszimmer, nahm die Blutdruckmanschette, mit der Dr. Petzold den Wert bei Anna gemessen hatte, und verschwand wieder.
Anna sah den Arzt an und schüttelte wortlos den Kopf.
«In Ordnung.» Er lächelte verständnisvoll. «Jemand gibt Ihnen gleich einen Kittel.» Sie mochte seine klare, aber freundliche Art.
«Herr Doktor?» Eine junge Schwester, indisch oder pakistanisch, vermutete Anna, schaute kurz zur Tür herein. «Die Rollvene in der 04 macht Astrid Probleme. Sie hat jetzt dreimal danebengestochen. Ich bekomme das aber auch nicht hin.»
«Ich komme.» Die Schwester ging, Dr. Petzold erhob sich.
«Sie entschuldigen mich, Frau Ostersetzer. Benisha kommt gleich zurück und bringt Sie zu Ihrem Mann.»
Kurze Zeit später saß Anna auf einem Stuhl an Maltes Bett. Sie trug einen sterilen Kittel über ihrem Kleid und hatte sich die Hände desinfizieren müssen. Das Mobiltelefon lag ausgeschaltet in ihrer Handtasche, da es sonst die empfindlichen Geräte hätte stören können, wie ihr die Schwester erklärt hatte. Anna schätzte Benisha auf höchstens Mitte zwanzig. Ihre langen schwarzen Haare trug sie zu einem straff geflochtenen dicken Zopf, der über den halben Rücken baumelte und am Ende mit einem kleinen Schleifchen passend zur Farbe ihrer Berufsbekleidung verziert war. Ihr Blick, den sie durch eine knallrote runde Brille schärfte, wirkte munter und freundlich. Anna bemerkte, wie ihre eigene Anspannung durch die unaufgeregten Erklärungen und die Empathie der jungen Frau etwas nachließ. In verständlichen Worten erklärte sie Anna die Funktionen der einzelnen Geräte an Maltes Bett. Anna spürte, wie sie ihr die Angst vor den Kontrolltönen und Blinklichtern zu nehmen versuchte.
«Glauben Sie auch, dass mein Mann …»
«Schsch.» Benisha legte einen Finger auf ihre Lippen und unterbrach sie freundlich. «Wir reden vor unseren Komapatienten nicht über Prognosen. Es hat schon welche gegeben, die konnten sich nach dem Aufwachen an private Gespräche des Klinikpersonals erinnern. Könnte manchmal peinlich werden.» Sie kicherte leise, wobei sie die Zugänge und Schlauchverbindungen kontrollierte, die in allerlei Apparate führten. «Der Blasenkatheter sieht gut aus und auch die Nasensonde für die künstliche Ernährung. Prima.» Zufrieden verabschiedete sie sich. «Bitte nicht länger als zehn Minuten.» Die Schwester schob ihre Brille zurück auf die Nase und verließ das Zimmer.
Endlich. Anna war mit Malte allein. Er sah friedlich aus, wie er halb aufrecht in seinem Bett saß, mit den über Nacht gewachsenen Bartstoppeln. Sie versuchte, das Drumherum auszublenden, und konzentrierte sich ganz auf ihren Mann. Er, der vor Kraft gestrotzt hatte und dessen Lachen so ansteckend war, lag hilflos vor ihr wie ein Kind. «Ich liebe dich», flüsterte sie und küsste seine linke Hand, in der ein abgeklebter Zugang steckte.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: