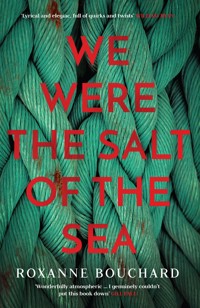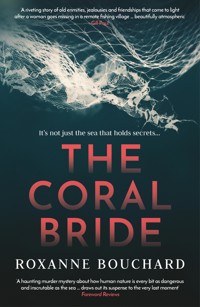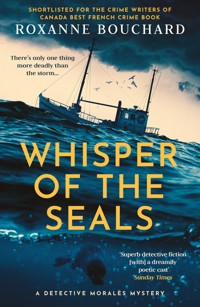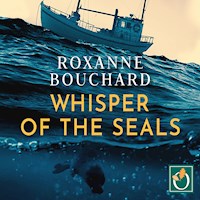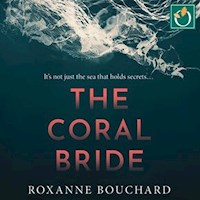Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Atrium Verlag AG
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Vor der Küste der kanadischen Gaspésie-Halbinsel treibt ein verlassener Fischkutter, seine Kapitänin ist nicht auffindbar. Sergeant Morales wird nach Gaspé gerufen, um die Suche nach Angel Roberts zu leiten. Er reist jedoch nur widerwillig in die Kleinstadt, denn sein Freund Cyrille liegt im Sterben, und außerdem ist sein Sohn Sébastien gerade unerwartet in Caplan aufgetaucht. Aber als schließlich Angels Leiche entdeckt wird, wird Morales vollständig vom Sog des Falls erfasst. Zusammen mit Sébastien gerät er in gefährliche Gewässer, in denen alte Feindschaften aufgewirbelt werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 570
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Roxanne Bouchard
Die Korallenbraut
Ein Fall für Sergeant Morales
Kriminalroman
Aus dem Québec-Französischen von Frank Weigand
We acknowledge the support of the Canada Council for the Art.
© Atrium Verlag AG, Zürich, 2022
Alle Rechte vorbehalten
Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel La mariée de corail bei Libre Expression, Montréal, Kanada.
© 2020, by Roxanne Bouchard and Libre Expression
Aus dem Québec-Französischen von Frank Weigand
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München
Umschlagillustration: © Arcangel Images
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
ISBN978-3-03792-186-9
www.atrium-verlag.com
www.facebook.com/atriumverlag
www.instagram.com/atriumverlag
Für Catherine Asselin, SVN, Wörterzählerin und wertvolle Freundin der Gezeiten.
Das Brautkleid
Angel Roberts erwachte von einem Platschen. Es war das Geräusch des Wasserspiegels, der unter dem Gewicht einer herabstürzenden Holzfalle zerriss. Einer Hummerfalle, da war sie sich sicher. Tausende Male hatte sie dieses Krachen gehört, mit dem das Meer aufplatzte und sich wieder schloss, dieses schnalzende Knirschen, das klang wie ein Segel, das in Stücke gerissen wurde.
Sie lächelte, befriedigt über ihre Schlussfolgerung, und versuchte dann, das Hämmern zu identifizieren, das es begleitete. Es klang ein wenig wie das Klappern ihrer Ankerkette, doch war es nicht das regelmäßige, metallische Rasseln in der Winde. Ehrlich gesagt benutzte sie diese Kette nicht besonders häufig. Den Anker übrigens auch nicht.
Das anhaltende Geräusch weckte ihre Neugier. Nach und nach erwachte sie und nahm ihre Umgebung wahr: das Wasser, das gegen den Schiffsrumpf plätscherte, den Geruch nach Salz, den Schmerz in ihrem rechten Arm, der hinter ihrem Rücken verdreht war, den Stoff ihres Kleides, der ihr in der feuchten Nachtkälte auf der Haut klebte. Mühsam schlug sie die Augen auf. Gegen das Ruderhaus gelehnt, erblickte sie die weit offen stehende Heckklappe ihres Hummerkutters und die Kette, die sich ins Meer hinab entrollte. Der Drehring, der die Kette mit dem Ankertau verband, ging über Bord, und nun wurde das Tau hinab in die Tiefe gezogen. Sie versuchte zu erraten: Woran war es wohl festgebunden?
IDENTIFIKATION DER VERSTORBENEN PERSON
Name: Angel Roberts, Alter: 32 Jahre, Wohnort: Cap-aux-Os, Todesursache: Ertrinken
Ein plötzlicher Ruck brachte sie aus dem Gleichgewicht. Ihr Körper wurde über das Deck geschleift, und sie schlug sich den Kopf an. Ihr Kleid rutschte hoch und entblößte ihre Beine, die Kälte biss ihr in die Schenkel, ihre rechte Hand verdrehte sich seltsam hinter ihrem Rücken. In einem Anflug von Panik krallte sie sich mit der Linken in die Vollgummimatte, die über dem Deck lag, und versuchte, die Bewegung zu bremsen. Sie endete unvermittelt von selbst. Wahrscheinlich hatte das Gegengewicht ihres Körpers den Abstieg der Hummerfalle in die Tiefe aufgehalten. Oder womöglich hatte die Falle bereits den Grund erreicht. Das Tau um ihre Waden schloss sich fester. Angel riss sich zusammen, versuchte, die Beine zu bewegen. Was ging hier vor?
Sie holte tief Luft und begriff, dass es jetzt so weit war: Sie wurde umgebracht. Sie beruhigte sich, atmete aus und blickte hoch zum Himmel. Das sanfte Gesicht des Mondes lächelte freundlich zu ihr herab. Sie hatte den Mond immer geliebt, »den trügerischen Mond«, wie ihre Mutter ihn genannt hatte. »Wenn er geformt ist wie ein D, denkst du, er nimmt ab, und wenn er geschwungen ist wie ein C, bist du sicher, er nimmt zu. Aber der Mond ist trügerisch, meine Tochter, merk dir das: Wenn er abzunehmen scheint, nimmt er in Wahrheit zu, wenn er vorgibt zu wachsen, nimmt er eigentlich ab.«
Ein beunruhigendes Geräusch zerfetzte die Luft, der Stoff ihres Kleides zerriss, und dann zog das Tau sie ein Stück weiter auf das Wasser zu. Angel wehrte sich nicht. Sie hatte gewusst, dass es so kommen musste.
TODESUMSTÄNDE (Auszug)
Am 22. September aß Madame Roberts gegen 18 Uhr bei ihrem Vater zu Abend. Anwesend waren dabei ihr Ehemann Monsieur Clément Cyr, ihr Vater Leeroy Roberts, ihr älterer Bruder Bruce und ihr jüngerer Bruder Jimmy. Madame Roberts und ihr Ehemann feierten vier Tage im Voraus ihren zehnten Hochzeitstag. Sie hatten sich für diesen Abend entschieden, weil es ein Samstag war.
Gegen 22 Uhr begaben sich Monsieur Cyr und Madame Roberts zum Gasthaus Le Noroît in Rivière-au-Renard, wo die Wirtin Corine das alljährliche Fest zum Ende der Fischsaison ausrichtete. (Siehe im Anhang die Liste der anwesenden Personen.)
Gegen 23 Uhr 15 bat Madame Roberts ihren Mann, sie nach Hause zu bringen, da sie angab, müde zu sein. Monsieur Cyr fuhr seine Gattin heim und kehrte gegen ein Uhr nachts auf das Fest zurück.
Im Rutschen hatte sich ihr Körper leicht gedreht und dabei ihre Hand freigegeben. Angel verspürte ein Gefühl der Übelkeit, doch sie war nun hellwach. Sie drehte den Kopf und erblickte die leuchtenden Scherben auf dem Wasserspiegel, die der Mond quer über das Meer verstreute. Während neben dem Hummerkutter nur ein paar spärliche Splitter glänzten, wurden sie zum Horizont hin immer dichter und zahlreicher. Vom Festland aus wirkten sie wie ein silberner Pfad, eine mit beweglichen Pailletten gepflasterte Straße, ein mit tausend schimmernden Lichtern geschmückter Teppich. »Romantischer Quatsch«, pflegte ihre Mutter zu sagen. »Wenn sich der Mond im Ozean spiegelt, ist da weder Silber noch eine Straße. Versuch ruhig, irgendetwas zu erhaschen, und du wirst sehen: Alles rinnt dir durch die Finger! Der Mond ist trügerisch und das Meer eine einzige Täuschung.«
Angel rutschte auf das Heck zu, näher an den schaukelnden Rand des Wassers, das ihr Boot hin und her wiegte. Eine kalte Welle küsste ihre Füße, leckte an ihren Beinen. Sie hätte sich winden können, versuchen, das Tau aufzuknoten und sich damit an ihrem Boot festzubinden, sich gegen das Schicksal auflehnen, versuchen, an Bord zu bleiben, aber sie tat es nicht. Bald würde ihr Kutter auf das offene Meer hinaustreiben und sie selbst hinab auf den Grund gezogen werden.
VERMISSTENMELDUNG (Auszug)
Monsieur Cyr kehrte am Sonntag, den 23. September um zehn Uhr morgens nach Hause zurück. Seine Frau war unauffindbar, er versuchte mehrfach, sie auf ihrem Mobiltelefon zu erreichen, aber sie antwortete nicht.
Beunruhigt begab sich Monsieur Cyr an den Kai von Grande-Grave, wo er das Auto seiner Gattin fand und feststellte, dass ihr Hummerkutter nicht mehr am Bootsanleger festgemacht war. Also rief er Jean-Paul Babin an, einen der Deckhelfer seiner Frau, der ihm mitteilte, dass er nicht an Bord des Schiffes sei. Monsieur Babin sprach mit seinem Bruder Guy Babin, der seinerseits Madame Roberts’ Bruder Jimmy benachrichtigte, der wiederum seinen Vater anrief. Da niemand Madame Roberts gesehen hatte, begannen die Fischer, die Stellen abzusuchen, die sie gerne befuhr, wenn sie allein auf See unterwegs war.
Gegen 15 Uhr benachrichtigte Monsieur Cyr die örtliche Polizei, meldete das Verschwinden seiner Frau und ihres Hummerkutters. Daraufhin begannen die Mannschaften der Küstenwache mit den Suchmaßnahmen (siehe Bericht im Anhang).
Das Boot schaukelte sacht hin und her. Angel streckte ihren linken Arm aus, berührte die kalte metallische Kante des Hecks. Sie lächelte. Auf der gesamten Gaspé-Halbinsel gab es nur zwei Frauen, die einen Hummerkutter besaßen. Bald würde dieser Satz Vergangenheit sein.
»Früher gab es einmal zwei Kapitäninnen in der Gaspésie«, würden die Seeleute in Zukunft sagen und hinzufügen, dass eine der beiden auf See ums Leben gekommen war.
»Und noch nicht mal bei Sturm!«
Sie würden erklären, dass Frauen auf See nichts zu suchen hätten, dass Fischerei Männersache sei. Sie würden das erzählen, als sei es offensichtlich, denn schließlich war ihr Beruf hart, und sie sahen sich selbst gern als zähe Kerle.
Sie würden daran erinnern, dass Angel die Tochter eines verbitterten ehemaligen Kabeljaufischers gewesen sei, dass ihr älterer Bruder einmal im Verdacht gestanden hatte, einen Konkurrenten ermordet zu haben, und dass ihr jüngerer Bruder beim Schwarzfischen erwischt worden war. Sie würden erzählen, dass ihr Ehemann zuerst seinen Vater und dann auch noch seine Frau auf See verloren habe – und dass er niemals darüber hinweggekommen sei. Sie würden sagen, das Meer verschlinge jeden, der sich ihm allzu bereitwillig anvertraute.
AUTOPSIEBERICHT (Auszug aus der Zusammenfassung)
Es konnte keinerlei Spur von physischer Gewalt ante mortem festgestellt werden. Keinerlei Zeichen der Verteidigung gegen einen Angreifer, weder an den Armen noch an den Händen oder unter den Fingernägeln. Das Tau, das die Beine des Opfers auf der Höhe der Waden umschnürt hatte, war fest zugezogen, jedoch nicht so sehr, dass es den Blutkreislauf eingeschränkt hätte.
Die erhöhte Konzentration von Alkohol und die Spuren von Beruhigungsmitteln, die in Madame Roberts’ Blut gefunden wurden, legen die Vermutung nahe, dass sie im Augenblick ihres Todes bewusstlos war. Wäre sie wach gewesen, hätte sie vermutlich versucht, das Tau um ihre Beine zu lösen, oder beim Rutschen über das Deck mit ihren Fingern die Gummimatte zerkratzt. Es wurden jedoch weder Fasern noch Gummireste unter ihren Fingernägeln gefunden.
Das Wasser durchtränkte den Stoff, machte ihre Schenkel nass. Die Wellen hatten genau die richtige Höhe, die Strömung war genau berechnet. Jedes Detail stimmte, es handelte sich um einen wohlgeplanten Tod. Die Inszenierung war perfekt: das Brautkleid, der Hummerkutter und dieser ungreifbare Weg des Mondes, auf den sie nun gezogen wurde, wie ein Fisch, der sich in einen kupferfarbenen Köder verbissen hatte. »Wir klammern uns an märchenhaften Trugbildern fest, meine Tochter, und unser Glaube an Träume macht uns zu Verdammten des Meeres.« Ihre Mutter hatte recht gehabt, aber Angel bereute nichts.
ZEUGENAUSSAGEN
Für den Vorfall gibt es keine unmittelbaren Zeugen.
Auf einmal machte das Boot einen Sprung nach vorne. Für einen Sekundenbruchteil schien Angel in der Luft zu schweben, wie ein Kormoran, der seine Schwingen ausbreitete und sich dann fallen ließ. Der Hummerkutter glitt auf das offene Meer hinaus, und das Wasser schloss seine eiskalten Zähne um sie. Einen Augenblick lang trieb ihr Kleid unbeweglich auf der Oberfläche. Angel holte ein allerletztes Mal Luft, breitete die Arme aus, nicht um Widerstand zu leisten, sondern um sich zum Himmel hinzudrehen. Mit weit aufgerissenen Augen warf sie einen letzten Blick auf den Mond. Sie sollte ihre Augen niemals wieder schließen.
Sonntag, 23. September
In den Stunden vor Mitternacht waren die Menschen noch misstrauisch. Danach schliefen sie, wie man so schön sagte, wie Murmeltiere. Sie hatten Vertrauen. Sie träumten. Wenn ein Ordnungsbeamter einen tief und fest schlafenden Bürger aus dem Schlaf klingelte, hatte dies zwangsläufig schwerwiegende Gründe. Meist galt es, die Nachricht von einem Drama zu überbringen, einem Todesfall, einem schweren Verkehrsunfall, einer Messerstecherei oder einer verirrten Kugel. Der Beamte, der die Klingel drückte, hörte das Echo der Türglocke auf dem Gang und wartete im Schatten verborgen, wie ein Bote der Apokalypse. Er stellte sich vor, wie die Leute erwachten, beunruhigt auf die Uhr schauten, sich verwirrt anzogen, den kläffenden Hund zum Schweigen brachten, wie sie die Lichter im Eingangsbereich einschalteten. Dann würden sie sich durch das Fenster vergewissern, dass sie sich nicht getäuscht hatten, dass da tatsächlich jemand auf der Veranda stand. Schließlich würden sie die Tür öffnen, bereits aufs Äußerste alarmiert bei dem Gedanken an das, was sie beim Anblick der Uniform schon längst erraten hatten. Für gute Nachrichten brauchte niemand einen Polizisten. Und sie konnten meist warten, bis es Tag war.
Nein, deswegen wurde man nicht Polizist, dachte Joaquín Morales an jenem Morgen, als gegen sechs Uhr die vier symphonischen Noten seiner Türglocke erklangen. Die Dämmerung hüllte das Innere seines vorhanglosen Hauses in ein blasses Licht. Er stieg aus dem Bett, schlüpfte in eine Jeans und zog einen Pullover über, während er die Treppe herunterstieg.
Der Weckruf im Morgengrauen beunruhigte ihn nicht. Schließlich wusste er, dass heute Nacht die Rekrutin Robichaud Dienst auf der Wache hatte. Sie schwirrte die ganze Zeit um ihn herum, fragte ihn um Rat, bettelte um seine Meinung und klimperte mit den Wimpern, damit er ihr eine Empfehlung für eine Versetzung nach Montréal schreiben würde. Sie war keine schlechte Polizistin, aber noch grün hinter den Ohren, unnötig wagemutig, allzu leicht beeinflussbar. Unbeständig wie eine Meise in einem Nadelwald.
Sie klopfte ein paar Mal diskret gegen die Tür, das war das polizeilich empfohlene Vorgehen, wenn im Inneren keine Geräusche zu vernehmen und kein Licht sichtbar waren. Außerdem konnte es natürlich auch sein, dass die Klingel defekt war.
Morales rieb sich die Augen und streckte seinen Nacken, während er das Wohnzimmer durchquerte. Er war nicht besonders verärgert darüber, dass man ihn um den Schlaf brachte, er war sogar schon wach gewesen und hatte vorgehabt, bald aufzustehen, um angeln zu gehen. Aber das hier war sein arbeitsfreier Sonntag, und er hätte es vorgezogen, wenn die Rekrutin bis Montag gewartet hätte. Bei ihr war immer alles dringend, stets ging es um Leben und Tod, um Gerechtigkeit, um die Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz.
Morales schaltete ein Licht im Eingangsbereich ein, da er sie nicht beim Öffnen überraschen wollte. Niemand pumpte einen leichter mit Blei voll als eine junge Polizeiangestellte, die erschreckt zusammenfuhr.
Da stand sie, Joannie Robichaud, mit ernster Miene wie eine Gerichtsvollzieherin, in den ersten Sonnenstrahlen, die den Tag ankündigten. Ihr Pferdeschwanz war so festgezurrt, dass er ihre Augen in Mandelform zog. Ihr halb geöffneter Mantel gab den Blick auf eine auf Brusthöhe unverschämt aufreizend geschnittene Uniform frei. An ihrem Gürtel hing die komplette Einsatzausrüstung – Handschellen, Schlagstock, Pfefferspray –, die sie stets mit sich herumschleppte, als sei sie auf Streife im schlimmsten Viertel der Bronx. Ihre Hose war so eng, dass sich keine Bügelfalte mehr abzeichnete, die Schuhe frisch gewienert wie bei der Armee.
»Tut mir leid, dass ich Sie wecke, aber es ist dringend.«
Übereifrige Beamte wie sie gab es auf jeder Polizeiwache, sogar in der tiefsten Gaspésie.
Sie schlüpfte in die Diele. Morales machte ein paar Schritte vorwärts, um die Tür hinter ihr zu schließen. Die Luft war kühl, und er war barfuß. Er versuchte, sich an ihr vorbeizuzwängen, und wurde dabei von ihrer Ausrüstung behindert. Sie stießen zusammen, wichen beide zurück, sie errötete, machte einen Schritt in Richtung Esszimmer, blieb stehen, drehte sich auf dem Absatz um und baute sich dann in Diensthaltung vor ihm auf, die Ellbogen vom Körper abgespreizt und die Daumen in den Gürtelschnallen.
Er schloss die Tür und folgte ihr widerwillig.
»Wollen Sie einen Kaffee, Rekrutin Robichaud?«
Sie lehnte das Angebot mit einer knappen Kinnbewegung ab. Sie hätte zum Militär gehen sollen.
»Vielleicht setzen Sie sich besser, Monsieur Morales.«
Nein. »Monsieur« würde sich nicht setzen. Sie ging ihm auf die Nerven. Er nahm es ihr übel, dass sie ihm wegen irgendwelcher Rekrutinnen-Kleinigkeiten den Morgen verdorben hatte – vor allem zu dieser Jahreszeit, wo einem der Sommer durch die Finger rann wie der Sand der Zeit. Außerdem hatte sie ihn nicht »Sergeant« genannt und komplett vergessen, dass sie es mit einem Vorgesetzten zu tun hatte.
»Hören Sie, Rekrutin, ich helfe Ihnen gerne, aber ich bin nicht rund um die Uhr für Sie …«
»Es geht um Ihren Sohn«, unterbrach sie ihn.
»Meinen Sohn?«
»Einen Mann um die dreißig, der auf den Namen Sébastien Morales hört.«
»Sébastien?«
Auf einmal wurde ihm klar, was die morgendliche Anwesenheit der Rekrutin, die Wort für Wort die Vorschriften für nächtliche Einsätze befolgte, womöglich bedeuten konnte.
»Ich habe gegen vier Uhr einen Anruf erhalten, dann aber lieber abgewartet, bis mein Dienst zu Ende war. Ich wollte Sie nicht zu früh wecken.«
»Einen Anruf von wem?«
»Von einer meiner Freundinnen auf der Wache von New Richmond.«
»Ich verstehe nicht.«
Joannie Robichaud tat, als würde sie in ihre Notizen schauen. Sie kannte die Einzelheiten auswendig, doch als bekennender Krimifan setzte sie ihre Effekte gerne sparsam ein. Obwohl sie sich stets sklavisch an die Vorschriften hielt, träumte sie insgeheim von einer leidenschaftlichen Affäre mit einem heißblütigen Verbrecher, einem reichen Drogenbaron. Einem Mann, der ihr verfallen wäre, sie vom rechten Wege abbringen wollte. Sie träumte von einer Entführung und von leidenschaftlichem Sex in einem Wasserbett, einer herzzerreißenden Tragödie, hin- und hergerissen zwischen Verbrechen und Verlangen.
»Kurz vor zwei Uhr wurde Sébastien Morales in Carleton-sur-Mer von der Polizei verwarnt. In der Stadt wurde gerade das Fest zur Tagundnachtgleiche gefeiert. Die Kollegen von der Streife haben ihn gebeten, im Wohngebiet nicht mehr laut herumzugrölen.«
Sie zögerte.
»Sie haben ihn auch gebeten, nicht vor das Rathaus zu pinkeln. Sie haben ihm gesagt, sie würden ihn wegen nächtlicher Ruhestörung und Erregung öffentlichen Ärgernisses mitnehmen, wenn er so weitermacht. Er hat geantwortet, er finde den Weg zum Gefängnis durchaus alleine, schließlich sei sein Vater auf der Wache in Bonaventure. Die Streifenpolizisten haben gedacht, er sei der Sohn eines Straftäters.«
»Das ist unmöglich …«
Eine derartige Geschichte hätte Manu widerfahren können, seinem Jüngsten, aber nicht Sébastien. Sein Ältester war so langweilig und ernsthaft wie die meisten Söhne aus guter Familie: Er betrank sich nie, nahm Standardtanzunterricht, trank alkoholfreies Bier und kaufte sein Toilettenpapier im Sonderangebot.
»Wenig später haben sie ihn gegenüber vom Jachthafen entdeckt: Er tanzte am Kai mit den letzten Feierwütigen. Danach haben sie ihn nicht wiedergesehen. Allerdings haben sie auch nicht nach ihm gesucht. Aber gegen Viertel vor vier tauchte Ihr Sohn auf der Wache von New Richmond auf.«
Sie studierte ihre Aufzeichnungen.
»Er hat behauptet, er sei mit dem Auto gekommen, aber niemand hat ihn am Steuer gesehen. Als er auf die Wache kam, hat er erklärt, ich zitiere: ›Sagen Sie dem Ermittler Morales, sein chiquito ist hier!‹ Als er begriffen hatte, dass er auf der falschen Polizeiwache gelandet war, wollte er wieder ins Auto steigen, aber die Beamten haben ihn dabehalten. Wachtmeister Leroux ist ein scharfer Hund: Er wollte ihn losfahren lassen und dann wegen Trunkenheit am Steuer verhaften, aber meine Freundin hat mich angerufen. Ich hatte ihr so viel von Ihnen erzählt, dass sie sich an Sie erinnert hat.«
Sie errötete, aber Morales bemerkte es nicht. Er hatte sich auf eine Insel des Schweigens zurückgezogen. Sein Blick irrte ins Leere, vergeblich auf der Suche nach einer Antwort, die sich möglicherweise durch ein Wunder in einem Gegenstand oder einem Möbelstück verbarg.
»Vielleicht handelt es sich um eine Verwechslung. Sébastien wäre nicht den ganzen Weg von Montréal hierhergefahren, ohne mir Bescheid zu sagen …«
»Meine Freundin hat mir ein Foto geschickt.«
Joannie Robichaud holte ihr Handy heraus, öffnete das Fotomenü und hielt Morales das Gerät hin.
»Ist er das?«
Nicht wirklich. Joaquín erkannte seinen Sohn kaum. Das mochte an dem Schnurrbart, den unrasierten Wangen und dem wirren Haar liegen, vor allem aber an dem großmäuligen Gesichtsausdruck, diesem trunkenen, gierigen Lächeln, diesem mürrischen Funkeln in den Augen. Dennoch nickte er.
»Wenn man so will.«
Joannie warf einen begehrlichen Blick auf den jungen Mann und biss sich auf die Lippen: Morales’ Sohn war so verführerisch wie ein reicher Gangster.
»Deshalb bin ich hier. Ich dachte mir, ich … könnte Sie begleiten. Er hat zu viel getrunken, um noch selbst zu fahren, und meine Freundin möchte, dass wir ihn abholen, bevor die Tagschicht zur Ablösung kommt. Sonst wird ihr Chef ihr wieder erklären, dass eine Polizeiwache kein Hotel ist. Sie wissen ja, wie nervig Chefs sein können, wenn man …«
Sie brach mitten im Satz ab und errötete erneut, aber ihr Vorgesetzter sagte nichts. Joannie und ihre Freundin aus New Richmond taten ihm heute Morgen einen Gefallen, er würde erst ab Montag wieder Nervensäge spielen.
Durch ihren Auftritt hätte die Rekrutin Robichaud jedermann in Angst und Schrecken versetzt, doch er konnte es ihr nicht übel nehmen. Daher brachte er es nicht übers Herz, ihr zu befehlen, Zivilkleidung anzulegen, um Sébastien abzuholen. Sie wollte ihrer Kollegin aus New Richmond bestimmt zeigen, wie gut ihr die neue Uniform stand, die ebenso autoritär wie sexy wirkte. Morales ließ es gut sein, bestand aber darauf, sein eigenes Auto zu nehmen. Die Konzentration auf das Fahren würde ihm helfen, seine Verlegenheit zu überwinden.
»Es ist ja nicht schlimm, mal einen über den Durst zu trinken, aber Ihr Sohn sollte sich besser nicht in angetrunkenem Zustand ans Steuer setzen.«
Morales blickte nach links auf das Meer hinaus, das im Sonnenaufgang blendend hell erstrahlte. Was hatte Sébastien in der Gaspésie verloren?
»Wenn er ein Problem damit hat, sollten Sie ihm ein Gerät kaufen, damit er vor dem Fahren seinen Alkoholpegel testen kann.«
Warum hatte er nicht angerufen? Und Maude? War er womöglich ohne sie gekommen?
»Ich habe einen Onkel bei den Anonymen Alkoholikern, der könnte ihm bestimmt helfen. Ich werde mal mit ihm reden.«
Was war mit seiner Arbeit?
»Aber manchmal hilft nur eine richtige Entziehungskur. Das Problem ist nämlich, dass neben dem Trinken oft auch noch Drogen im Spiel sind.«
Morales wurde ungeduldig.
»Rekrutin Robichaud, mein Sohn hat kein Drogenproblem.«
»Sie sind sein Vater: Natürlich erzählt er Ihnen nicht alles!«
»Wir verstehen uns sehr gut.«
»Ich will Ihnen nicht widersprechen, aber Sie wussten nicht einmal, dass er in der Gaspésie ist.«
»Er ist ein ernsthafter junger Mann, das ist bestimmt ein Missverständnis.«
Joannie nickte ein wenig enttäuscht: Dabei hatte sie doch extra ihre Uniform anbehalten, damit der gut aussehende Rebell sie als helfende Autorität wahrnehmen würde! Wenn sie gewusst hätte, dass er ein Langweiler war, hätte er genauso gut ein Taxi nehmen können.
»Macht nichts: Wenn er Hilfe braucht, wird er wissen, dass ich da bin. Dass er auf mich zählen kann.«
Morales seufzte. Er wäre jetzt wesentlich lieber mit der Untersuchung eines Tatorts beschäftigt.
Wortlos parkte er vor der Polizeiwache von New Richmond. Während die junge Kollegin vorauseilte, besah sich Morales Sébastiens schief eingeparktes Auto. Joannie hielt einige Sekunden lang die Tür auf, warf ihrem Vorgesetzten einen missbilligenden Blick zu, stellte fest, dass er es anscheinend nicht eilig hatte, seinen Sohn in Empfang zu nehmen, und trat dann allein über die Schwelle.
Joaquín blieb kurz das Herz stehen, als er das Durcheinander im Fahrzeug seines Sprösslings sah. Es war vollgestopft mit Kisten, Tüten, Koffern, Kleidungsstücken, Töpfen und Pfannen, alles im Kuddelmuddel eines überstürzten Aufbruchs, einer erschütterten Existenz, einer in Flammen aufgegangenen Beziehung. Sébastien musste ganz offensichtlich verzweifelt gewesen sein. Das würde seine Trunkenheit erklären. Und bei wem suchte er in seiner Obdachlosigkeit Hilfe? Bei seinem Vater. Morales atmete tief durch, bereits ganz mitgenommen von dem Drama, das ihn erwartete, und betrat dann ebenfalls das Polizeirevier.
Es war niemand am Empfang. Er klopfte gegen die gepanzerte Tür, hinter der undeutliche Geräusche zu hören waren. Endlich öffnete die diensthabende Beamtin. Die Musik brach wie eine Lawine über Joaquín herein: La Vida es un carnaval von Celia Cruz, ein Lied, das er als junger Mann bis zum Abwinken gehört hatte.
Die diensthabende Beamtin bedeutete ihm einzutreten. Es war tatsächlich sein Sohn Sébastien, der dort im Raum kniete und so tat, als würde er Joannie die Zukunft aus der Hand lesen.
Sein Sprössling säuselte etwas von einem langen, romantischen Spaziergang am Meer in Begleitung eines leidenschaftlichen, aber leicht angetrunkenen mexikanischen Herumtreibers und imitierte dabei eher schlecht als recht einen Latino-Akzent à la Antonio Banderas. Gerade als er anfing, mit übertrieben rollendem R die Schönheit seiner Gesprächspartnerin zu rühmen, erblickte er seinen Vater.
»¡Papá!«
Ebenso abrupt wie galant ließ Sébastien Morales die Hand der Rekrutin Robichaud los und kam auf seinen Vater zugestürzt.
»¿Comó estás? ¡Tú eres mi salvador!«, stieß er mit übertriebenem mexikanischen Akzent hervor, umarmte seinen Vater, drückte ihn an sich und wandte sich erneut Joannie und ihrer Freundin von der Wache zu, die beide rote Wangen hatten.
»Con las señorrrritas …«
Joaquín Morales hielt seinen Sohn einen Augenblick an sich gepresst und flüsterte ihm durch die ohrenbetäubend laute Musik ins Ohr: »Was machst du hier? Und hör sofort mit diesem falschen mexikanischen Don-Juan-Akzent auf!«
Sébastien schenkte ihm ein strahlendes, angetrunkenes Lächeln.
»Ich komme dich besuchen!«
Und drückte ihm einen Kuss auf den Mund.
»Gehen wir?«
Als sie den Parkplatz erreicht hatten, überreichte Sébastien der Rekrutin seine Schlüssel.
»Ich fahre mit der señorita.«
»Aber nur, wenn Sie brav sind, Sébastien.«
Sie vermied es, bei diesem Satz ihren Chef anzusehen.
»Sie werden keinen Grund zur Klage haben, versprochen …«
Er setzte sich ins Auto und schaltete die Musik aus seinem tragbaren Lautsprecher wieder ein. Celia Cruz sang ohrenbetäubend weiter.
So kam es, dass Morales dem Auto seines Sohnes in östlicher Richtung auf der Nationalstraße 132 folgte. Joannie Robichaud, die am Steuer saß, beschleunigte und bremste unkontrolliert und hatte offensichtlich Schwierigkeiten, die Spur zu halten. Sogar in betrunkenem Zustand hätte man kaum noch gefährlicher fahren können. In Caplan angekommen bog das Auto plötzlich nach rechts zum öffentlichen Strand ab. Geistesabwesend folgte Morales dem Fahrzeug und hielt kurz darauf dahinter an.
Die jungen Leute stiegen aus und gingen an den Strand. Sébastien hatte die Musik bis zum Anschlag aufgedreht und die Beifahrertür offen stehen lassen. Verdattert sah Joaquín zu, wie sein Sohn die Hand der Rekrutin ergriff und die junge Frau auf dem vom ablaufenden Wasser hart geklopften Sand Pirouetten drehen ließ. Sie hatte ihre Waffe und ihren Schlagstock abgenommen und ihre tadellose Polizeiausrüstung im Fahrzeug zurückgelassen. Was trieb sein Junge da? Machte er seiner Untergebenen den Hof? Direkt vor seiner Nase? Morales regte sich innerlich über diese Schamlosigkeit auf und war hin- und hergerissen zwischen Vaterliebe und seinem Glauben an die ehelichen Werte von Loyalität und Treue. Er selbst war seit über dreißig Jahren mit Sarah verheiratet und …
Und was?
Hinter den Tanzenden ließ das Meer seine Wogen auf den Sand prallen. Vor drei Monaten hatte ihm eine Frau den Kopf und das Herz verdreht. Catherine. Dann war sie davongesegelt und Joaquín hatte seitdem nichts mehr von ihr gehört.
In einer schwungvollen Drehung gelang es Sébastien, Gott allein wusste wie, das Gummiband zu entfernen, das tagtäglich den schmerzhaft wirkenden Pferdeschwanz der jungen Polizeiangestellten zusammenhielt, und ihr goldenes Haar ergoss sich wie eine bernsteinfarbene Woge, eine schillernde Qualle, in die feuchte Morgenluft.
Fassungslos sah Joaquín zu, wie sein Sohn, immer noch wacker aufrecht trotz der langen Fahrt und der durchzechten Nacht, die anstrengende Rekrutin in eine anmutige Tanzpartnerin verwandelte. Hatte er wirklich das Recht, ihm eine Moralpredigt zu halten? Sein Blick schweifte wieder einmal hinaus aufs Meer, Catherines Segelboot nach, auf dessen eventuelle Rückkehr er sehnsüchtig wartete, und kehrte dann zu dem jungen Paar zurück. Woher wollte er wissen, dass die Dinge zwischen Maude und Sébastien im Argen lagen? Vielleicht hatte sein Sohn nur eine Woche Urlaub bekommen und seine Partnerin befand sich auf einem Kongress im Ausland. Das wäre nicht das erste Mal. Vielleicht handelte sein Junge vollkommen unschuldig, schließlich war er ein begeisterter Tänzer. Joaquín blickte hinaus auf die Baie des Chaleurs, die in der Morgendämmerung herzzerreißend verlassen wirkte. Er wandte sich ab, trat die Kupplung durch und fuhr zurück auf die Straße.
Eigentlich wäre es höchste Zeit gewesen, endlich die Angel ins Wasser zu halten, aber Morales starb vor Hunger. Wenig hoffnungsvoll öffnete er den Kühlschrank: Er war schon seit geraumer Zeit nicht mehr zum Einkaufen gekommen. Trotzdem gelang es ihm, drei Pilze, eine halbe Tomate, ein Stück Paprika, zwei Eier, einen Kanten Käse und eine kleine Zwiebel zu retten: Schließlich und endlich würde der Morgen also gar nicht so schlecht werden.
Sébastiens Musik hatte ihm die Ohrwürmer seiner Jugend zurückgebracht. Beschwingt summte er Celia Cruz’ Rie Y Llora vor sich hin, während er sich mit Hingabe ein Frühstück zubereitete. Er wartete nicht auf die Ankunft seines Sprösslings, der am Strand Salsa tanzte. Joannie würde ihn zurückbringen. Just in dem Moment, als er sein Gemüseomelett ranchero auf einen Teller geschoben hatte und sich einen Kaffee einschenkte, hörte er, wie Sébastiens Auto in seiner Einfahrt geparkt wurde. Er unterdrückte einen Fluch, ließ sein Frühstück unangetastet stehen und ging hinaus, um Joannie Robichaud zu danken und seinen verlorenen Sohn in Empfang zu nehmen.
»Sie können auf mich zählen, Messieurs Morales!«
Sie entfernte sich mit wirrem Haar und geröteten Wangen.
»Sie vergessen Ihre Dienstwaffe!«
Joannie kicherte wie ein ertapptes kleines Mädchen, kehrte hüpfend zu Sébastiens Auto zurück, sammelte ihre Ausrüstung ein und tänzelte dann zu ihrem Fahrzeug.
»So habe ich sie noch nie gesehen.«
»Sie hat einen Mexikaner gebraucht.«
»Seit wann bist du Mexikaner?«
»Seitdem ich in der Gaspésie bin.«
»Und was willst du in der Gaspésie?«
Joaquín bereute seine Worte auf der Stelle, er hasste es, seinen Sohn mit Fragen zu überfallen. Sébastien sah peinlich berührt aus. Er stammelte irgendetwas und wandte sich seinem bis obenhin vollgepackten Auto zu. Inzwischen stand die Sonne vollständig am Himmel und beleuchtete die Szenerie, die nach den Ruinen einer Beziehung aussah. Mit einer entschlossenen Handbewegung öffnete Sébastien den Kofferraum, ergriff einen Karton voller Kochtöpfe und hielt ihn an seine Brust, als würde er ein Partykostüm auf seine Größe hin überprüfen.
»Ich bin hier, um kulinarische Experimente durchzuführen!«
Überrascht wich Morales einen Schritt zurück.
»Kulinarische Experimente?«
Sébastien war Koch in einem Restaurant, aber seinen Gerichten hatte es stets empfindlich an Geschmack gemangelt. Er kochte fade Nullachtfünfzehn-Mahlzeiten, die weder eine geschmackliche noch eine sinnliche Erinnerung hinterließen. Morales hatte sich oft gefragt, ob die Gäste fünf Minuten später überhaupt noch wussten, dass sie in diesem Restaurant gegessen hatten. Gerne hätte er geglaubt, dass es die Rezepte des Wirtes waren, die seinen Sohn zu einer Art langweiligem Standard zwangen, doch nachdem er die Gerichte gekostet hatte, die Sébastien liebevoll zu Hause zubereitete, war er zu der messerscharfen Schlussfolgerung gelangt, dass sein Sohn, der Gewürze berechnete und Portionen abzählte, wie ein Buchhalter kochte.
»Ja! Ich habe meinen Chef überzeugt, er findet, das ist eine gute Idee.«
Morales fehlten die Worte.
»Chiquito …«
»Ich würde gerne die lokalen Erzeugnisse der Gaspésie kennenlernen: Du weißt schon, Hummer, Krebs …«
»Die Fangsaison ist zu Ende. Die Fischer haben ihre Reusen schon vor ein paar Wochen eingeholt. Sie sind gerade mit dem Heilbutt fertig, jetzt liegen ihre Boote fast alle auf dem Trockendock.«
Mit der Fußspitze trat Sébastien die Autotür zu.
»Dann eben Krabben!«
»In der Baie des Chaleurs werden keine Krabben gefischt.«
»Macht nichts! Das Meer ist voll von frischem Fisch!«
Die Männer gingen zurück zum Haus, Joaquín machte die Tür auf, um seinen Jungen und die Kochtopfkiste durchzulassen.
»Dein berühmtes Omelett ranchero! Das habe ich schon seit Jahren nicht mehr gegessen! Unglaublich, dass du daran gedacht hast!«
Sébastien knallte die Kiste auf die Arbeitsplatte, schnappte sich den Teller und den Kaffee und trug beides hinüber zum Tisch. Noch bevor er sich richtig hingesetzt hatte, fiel er bereits über das Omelett her, und Morales wusste wieder, warum Kinder eines Tages das elterliche Nest verlassen und sich ihr eigenes Frühstück in ihrem eigenen Zuhause zubereiten sollten. Er kehrte in die Küche zurück, schob zwei Scheiben altbackenes Brot in den Toaster und schaltete die Kaffeemaschine wieder ein.
»Hast du wieder angefangen zu angeln?«
»Ja, ich war gerade auf dem Weg.«
»Wo denn?«
»Am besten am Wasser.«
»Ich meinte: Angelst du direkt hier?«
Joaquín holte die gerösteten Scheiben aus dem Toaster. Die Butter war alle. Er goss sich einen Kaffee ein. Auch Milch war keine mehr da.
»Ja. Man hat über eine Holztreppe Zugang zum Strand. Direkt unten rechts, am Fuß des Felsens ist eine tiefe Stelle. Im Sommer lassen die Fischer dort ihre Reusen runter. Ich war da einmal tauchen: Es gibt da eine Menge Hummer, Krabben und Fische.«
»Was angelst du?«
Joaquín wollte sich an den Tisch setzen, doch sein Junge stand bereits auf. Wie ein Teenager mitten im Wachstumsschub hatte er alles in Rekordtempo heruntergeschlungen.
»Was so anbeißt. Unterwasser-Experimente.«
Sébastien ging nicht auf die Spitze ein.
»Du hast es echt schön hier!«
Es war das erste Mal, dass er das Haus betrat, das sein Vater drei Monate zuvor bezogen hatte. Es war zwar nicht besonders geräumig, dafür aber gemütlich. Das Ess- und das Wohnzimmer hatten große Panoramafenster, eine Terrassentür führte hinaus auf eine Veranda mit Meerblick. Lediglich ein einziges Gemälde, das Morales schon seit jeher aufhob und dessen Farbtöne mit der im Treppenhaus festgepinnten mexikanischen Flagge harmonierten, schmückte den offenen Bereich. Das Mobiliar war neu, und am Fenster stand ein starkes, dem Horizont zugewandtes Teleskop.
Sébastien ließ sich auf das Sofa fallen. Morales setzte sich an den Tisch, schob das schmutzige Geschirr seines Sohns beiseite und aß schweigend. Auch Sébastien sagte kein Wort. Joaquín spürte, dass sein Sohn nicht wagte, den wahren Grund für seinen Besuch anzusprechen. Erst als er seine Toasts aufgegessen hatte, fand er selbst den Mut, eine erste Frage zu stellen.
»Wie lange hast du vor, zu bleiben?«
Sébastien antwortete nicht.
»Es gibt nämlich noch kein Bett im Gästezimmer …«
Schweigen. Morales sah zu Sébastien hinüber: Sein Junge war im Sitzen eingeschlafen, der Kopf war ihm auf die Brust gesunken. Er holte ein Kopfkissen und eine Decke aus seinem Schlafzimmer und brachte Sébastien dazu, sich auszustrecken. Dann trank er mit einem einzigen Schluck seine Kaffeetasse leer. Er griff nach seinem Mantel, seinem Geldbeutel, seinen Schlüsseln und machte sich auf, um ein Bett kaufen zu gehen. Nicht unbedingt, weil ihm daran gelegen war, seinen Sohn unterzubringen wie einen Prinzen, aber es kam überhaupt nicht infrage, dass dieser sein Sofa mit Beschlag belegte, überall seine Sachen ausbreitete und ihn daran hinderte, sein Fernrohr zu benutzen, und sei es auch nur für kurze Zeit.
Als Joaquín endlich die Stufen zum Meer hinabging, neigte sich der Tag bereits dem Ende zu.
Er hatte sich nach Bonaventure zum Möbelgeschäft aufgemacht, jedoch nur verschlossene Türen vorgefunden, da Sonntag Ruhetag war. Am Ende war er bis nach Grande-Rivière gefahren und hatte dort ein Bett bestellt, das am nächsten Tag geliefert werden sollte. Anschließend war er in den Supermarkt geeilt, hatte eingekauft und war dann wieder nach Hause zurückgekehrt. Während sein Sohn immer noch lautstark schnarchte, hatte er die Vorräte aufgeräumt und war dabei mehrmals gegen die sperrige Kiste mit den Töpfen gelaufen. Schließlich hatte er seine Angelrute genommen und war hinunter ans Meer gegangen.
Als er endlich unten am Strand war, ließ er seufzend den bisherigen Tag Revue passieren: Sébastiens betrunkenes Lächeln, Joannies offenes Haar. Er entwirrte die Angelschnur, vergewisserte sich, dass der Silberlöffel sorgfältig festgebunden war, und schleuderte dann den Köder in einer formvollendeten Halbkreisbewegung ins Wasser.
***
Zehn Stunden Fahrt, und gleich bei der Ankunft die erste Lüge. Bereute er es? Zumindest sah Sébastien Morales nicht unbedingt wie ein Olympiasieger aus, als er an diesem Spätnachmittag mit schwerem Kopf, trockenem Mund und in die Bettdecke verhedderten Beinen in der Gaspésie erwachte.
Er setzte sich mühsam auf, warf einen Blick auf sein Handy, das neben dem Sofa lag. Er war sicher, dass ihn ein Klingelton aus dem Schlaf gerissen hatte, aber sein Mobiltelefon war stumm geschaltet. Der Bildschirm zeigte eine Reihe von Textnachrichten und Anrufen in Abwesenheit an. Maude war auf der Suche nach ihm, aber er würde nicht antworten. Jedenfalls nicht sofort.
Seit letztem Donnerstag war er wütend. An jenem Abend hatten seine Freundin und er einen ernsthaften Streit über Untreue gehabt. Jedes Paar hat seine Gesprächsthemen, die wie winzige Haarrisse im Fundament eines Hauses sind. Im zuversichtlichen Überschwang der Jugend hat man ein Grundstück erworben und sich gesagt, dass ein paar Tropfen Frühlingswasser auf dem Betonestrich im Keller der Festigkeit der Grundmauern keinen Abbruch tun. Im Laufe der Jahre werden die Risse breiter, aber aus Faulheit oder Gewohnheit ignoriert man den Schimmelgeruch, der von der Kellertreppe hochsteigt. Eines stürmischen Abends jedoch hört man von unten ein dumpfes Geräusch und stellt fassungslos fest, dass eine Wand eingestürzt ist.
Mitten in der Nacht, zwischen Missverständnissen und abscheulichen Wortgefechten, hatte Maude kurzerhand beschlossen, dass es besser wäre, wenn sie ein paar Tage bei ihrer Schwester verbringen würde, um Sébastien und sich Zeit zu geben, um über die Zukunft nachzudenken. Sie hatte wahllos ein paar Kleidungsstücke zusammengepackt und türenknallend das Haus verlassen, während Sébastien niedergeschlagen im Angesicht der Katastrophe zurückblieb.
Schlimmer als Maudes Geständnisse war der Satz gewesen, den sie ihm wie einen Dolch hingeworfen hatte und der ihm bis zum Morgengrauen im Kopf herumgegangen war: »Für diese Situation sind wir alle beide verantwortlich!« Wie konnte sie ihm ihre eigene Untreue zur Last legen?
Am nächsten Tag war er nicht arbeiten gegangen. Da ein Unglück selten allein kam, hatte ihn auch noch seine Mutter, die seit dem Beginn ihrer Wechseljahre ganz in dem Projekt aufging, eine große Künstlerin zu werden, angerufen, um ihm von der nächsten Etappe ihrer Karriere zu erzählen. Zu Anfang des Gesprächs hatte er nicht wirklich aufmerksam zugehört und war daher zusammengezuckt, als Sarah ihn angefahren hatte: »Hörst du mir zu, Sébastien?«
»Entschuldige, Mama, ich habe den Schluss nicht mitbekommen …«
»Ich möchte, dass du mir morgen beim Umzug hilfst.«
»In die Gaspésie?«
Am anderen Ende der Leitung hatte kurz Schweigen geherrscht.
»Nein. Ich habe dir gerade erzählt, dass ich eine Wohnung hier in Longueuil kaufe, direkt neben meinem Atelier. Ich ziehe morgen um.«
»Du gehst nicht zu Papa?«
»Nein.«
»Du wolltest doch in die Gaspésie! Du hast ihn doch überredet, sich versetzen zu lassen!«
»Stimmt, aber ich hab es mir anders überlegt.«
»Da steckt bestimmt Jean-Paul dahinter. Dein ›Agent‹.«
Er hatte das mit Verachtung gesagt, denn das einzige Mal, dass er seine Mutter in Gesellschaft dieses Mannes gesehen hatte, hatte sie sich benommen wie ein aufgeregtes Schulmädchen, das die Sportskanone der Sekundarschule anhimmelte, und bei dieser Feststellung war ihm übel geworden.
»Meine künstlerische Karriere hat in letzter Zeit unerwarteten Aufwind bekommen, und …«
»Weiß Papa Bescheid?«
Daraufhin hatte ein zweiter, diesmal längerer Moment des Schweigens das Gespräch unterbrochen. Schließlich hatte seine Mutter hinzugefügt: »Dein Vater ist ein erwachsener Mann. Er ist nicht das Opfer meiner Entscheidungen. Er ist genauso verantwortlich wie ich für die Situation, in der wir …«
Sébastien hatte aufgelegt. Wutentbrannt hatte er seine Sachen zusammengepackt und das Auto bis zum Dach vollgestopft. Er hatte Maude nicht einmal eine Nachricht hinterlassen, bevor er sich auf den Weg in die Gaspésie machte.
Er war außer sich vor Wut, aber auch verwirrt: Wem war er eigentlich böse? Seiner Partnerin? Na klar. Seiner Mutter? Vielleicht. Sich selbst? Er hätte nicht sagen können, warum.
Seinem Vater?
Die Frage hallte laut in seinem Kopf nach. Wer war verantwortlich für das Scheitern der Beziehungen in seiner Familie, wenn nicht dieser Mann? Vor etwas über dreißig Jahren hatte Joaquín Morales Mexiko verlassen, weil er eine Touristin geschwängert hatte. Er hatte sich in Longueuil im bürgerlichen Speckgürtel von Montréal niedergelassen, und von diesem Augenblick an war der junge, stolze mexikanische Polizist zu einem braven, fügsamen Vorstadt-Gatten geworden. Hatte er nicht im Grunde sein Land aufgegeben, seine ursprüngliche Familie verleugnet, seine Kultur zur Seite geschoben – all das für seine Frau, Sarah? Je länger Sébastien nachdachte, desto mehr sah er seinen Vater, schweigend und gehorsam, unter dem Pantoffel seiner Mutter stehen. Unterwürfig. Und da keine Frau einen Mann respektieren konnte, der sich verhielt wie ein Waschlappen, kam es nun, wie es kommen musste: Seine Mutter brannte mit einem Impresario durch! Womöglich betrog sie seinen Vater schon seit Jahren. Sie hatte es sogar geschafft, ihn durch ein Umzugsvorhaben in die Gaspésie aus dem Weg zu schaffen!
Auf der Strecke zwischen seinem Zuhause und dem Stadtausgang hatten ihn diese Schlussfolgerungen rasch mit Bitterkeit erfüllt. Da der Apfel niemals weit vom Stamm fiel, sagte sich Sébastien, hatte er selbst wie sein Vater gehandelt, sich schweigend seiner Freundin untergeordnet, und lebte heute mit den demütigenden Konsequenzen ihrer Untreue.
Ihm war aufgegangen, dass sein persönliches Scheitern in der Beziehung im Verhalten seines Vaters wurzelte. Und so war er, von einem unheimlichen Selbstvertrauen erfüllt, blitzschnell auf die Autobahn abgebogen, wild entschlossen, sich nicht nur eine Auszeit von Maude zu gönnen, sondern sich auch mit seinem Erzeuger auseinanderzusetzen, um endlich diese kindliche Unterwürfigkeit abzuschütteln, die ihm das Leben vergiftete.
Zwischen Montréal und Québec hatte er sich seine Ankunft plastisch vorgestellt. Zwischen Québec und Rimouski hatte er seine Argumente ausgebreitet. Zwischen Rimouski und Amqui hatte er den Worten seiner Revolte den letzten Schliff verpasst. Mit jedem Kilometer, den er zurücklegte, wurden seine Gedanken klarer und seine Zunge schärfer. Am Ortseingang von Carleton bemerkte er jedoch plötzlich, dass er Hunger hatte. Von neun langen Stunden Fahrt blieb ihm jetzt nur noch eine Stunde. Er wollte nicht mit leerem Magen bei seinem Vater eintreffen. Das wäre ein bisschen peinlich gewesen.
Also hatte er in einem Bistro haltgemacht. Vom Hunger zum Durst war es nur kleiner Schritt gewesen. Vor allem an einem Samstag, wenn die kleine Küstenstadt in Feierstimmung war. Er hatte sich also dem Alkohol hingegeben, hatte schnell die Kontrolle verloren und war kurzerhand auf die Tanzfläche gesprungen, als er zum ersten Mal seit langer Zeit lateinamerikanische Rhythmen hörte. Von seinem eigenen Schwung davongerissen, hatte er angefangen, ein Mädchen nach dem anderen herumzuwirbeln, und als sie ihm ins Ohr flüsterten: »Morales, das ist mexikanisch, stimmt’s?«, hatte seine Zunge, warum auch nicht, schamlos jenen Akzent imitiert, der einst seiner Familie väterlicherseits gehört hatte. Im Laufe der Nacht hatte er seine Glut betäubt, seine Wut ertränkt und sich mithilfe des Alkohols in einen verlorenen Sohn verwandelt, der schließlich halb verhungert und auf der Flucht vor einer erdrückenden Beziehung im einladenden Hof eines liebenden Vaters eintraf.
Obwohl dieser heute Morgen kaum Fragen stellte, hatte Sébastien, zu erschöpft, um sich in eine Vater-Sohn-Diskussion zu stürzen, einen stummen Druck verspürt, seine Anwesenheit in der Gaspésie zumindest provisorisch zu rechtfertigen. Natürlich hätte er sich irgendeinen unverbindlichen Satz ausdenken können, der es ihm erlaubt hätte, die Konfrontation, wegen der er gekommen war, auf später zu verschieben. Um Zeit zu gewinnen, hätte er eine kleine harmlose Lüge formulieren können, behaupten, dass er unverhofft eine Woche Urlaub bekommen hätte und seinem Vater einen Überraschungsbesuch abstatten wollte. Doch fühlte er sich verpflichtet, etwas Glaubhafteres zu formulieren. Ein Projekt.
Und so hatte er, als er sich zu seinem Auto umdrehte und dort eine gegen die Heckscheibe gelehnte Kiste mit Töpfen erblickte, die Wagentür geöffnet, die Kiste ergriffen und kurzerhand behauptet: »Ich bin hier, um kulinarische Experimente durchzuführen!«
Sein Vater hatte ihn kopfschüttelnd angeblickt, wie ein Kind, das bei einer Schwindelei ertappt wurde, und Sébastien wünschte sich, er hätte den Mund gehalten. Sein Satz war so fehl am Platz gewesen wie ein Baseballmaskottchen in einem Juweliergeschäft. Aber eben drum: Wenn er innegehalten hätte, wäre das der Beweis gewesen, dass er log. Er musste also weitermachen, noch dicker auftragen, Details hinzufügen, zeigen, dass es sich nicht um bloße Wichtigtuerei handelte.
»Ich würde gerne die lokalen Erzeugnisse der Gaspésie kennenlernen: Du weißt schon, Hummer, Krebs …«
Seit Jahren schon zogen ihn die Lügen nach unten, und jetzt, wo er tatsächlich buchstäblich unterging, erfand er noch mehr Geschichten. Allerdings geschah etwas Seltsames: Je mehr er log, desto leichter fiel es ihm, sich selbst einzureden, dass er die Wahrheit sagte. Er hörte sich dabei zu, wie er vollmundig fabulierte, aber das erleichterte ihn, erlaubte es ihm, seinen Schmerz unter dem Gewicht eines Projekts zu ersticken, so wie andere einen Riss in der Wand unter einer hübschen Tapete versteckten. So war das: Je mehr er tanzte, desto mehr Spaß hatte er dabei.
Sébastien faltete die Bettdecke zusammen, stand auf und ging zur Terrassentür. Es fiel ihm schwer zuzugeben, dass er kalte Füße bekommen hatte wie ein ängstlicher Schuljunge. Heute Morgen war er unfähig gewesen, seinem Vater ins Gesicht zu sagen, dass Sarah sich eine Wohnung in Longueuil gekauft hatte und nicht zu ihm in die Gaspésie kommen würde, von der sie gemeinsam geträumt hatten. Er hätte sich geschämt, seinem Vater beim Frühstück an dessen Tisch vorzuhalten, sich seiner Frau unterworfen zu haben. Als er mit Blick auf das Meer erwachte, hatte er keinerlei Lust, sich hellsichtig die Gründe für seinen Aufbruch ins Gedächtnis zu rufen. Nach und nach überzeugte er sich davon, dass es letztendlich besser so sei. Er musste erst mal ankommen, wieder einen Kontakt zu seinem Vater herstellen, bevor er ihm entgegentreten konnte.
Die Sonne verstreute Goldspäne über das Meer. Am Fuße der Klippen, in westlicher Richtung, erblickte Sébastien seinen Vater, der sich zum Angeln bereit machte. Joaquín überprüfte die Schnur und warf sie dann aus. Als er das Wasser durchstieß, erzeugte der Köder eine kleine Welle an der Oberfläche. Sein Vater begann, die Angelschnur einzuholen. Anscheinend hatte bereits einer angebissen. Beim ersten Auswerfen? Das wäre Glück gewesen. Sébastien beobachtete, wie Joaquín die Schnur locker ließ, ein paar Schritte nach links machte und versuchte, sie wieder einzuholen. Ah, nein. Der Angelhaken war irgendwo hängen geblieben. Er ließ die Schnur wieder locker, ging mehrere Schritte nach rechts und versuchte erneut, sie einzuholen. Sie hing immer noch fest. Das war merkwürdig, denn schließlich befand sich dort laut seinem Vater eine tiefe Stelle.
Es sei denn, ein Hirsch war von der Klippe gefallen. Genau gleichzeitig drehten sich Vater und Sohn zur Felswand und kniffen die Augen zusammen. Doch dann wären irgendwo Blutspuren gewesen. Sie schauten beide noch einmal in Richtung tiefe Stelle und fragten sich, woran der Haken wohl hängen geblieben sein konnte.
Joaquín hätte die Angelschnur kappen können. Es ging ihm nicht um den Preis des Köders, aber nein, an dieser Stelle sollte einfach nichts hängen bleiben. Sébastien beobachtete heimlich seinen Vater, der mit den Schultern zuckte und dann eine Entscheidung fällte. Er lehnte seine Angelrute an die roten Felsen, zog seine Schuhe aus und dann seine Socken.
Ein Telefon klingelte. Sébastien schreckte auf. Dieser Klingelton hatte ihn geweckt, da war er sich beinahe sicher. Er suchte nach dem Gerät, fand es auf der Arbeitsplatte in der Küche. Rufnummer unterdrückt. Eilig kehrte er zur Terrassentür zurück, öffnete sie, rief nach seinem Vater, aber dieser hörte ihn nicht, da er gerade damit beschäftigt war, seinen Pullover und seine Hose abzustreifen, und sich anschickte, in das kühle Wasser hinauszuwaten.
Sébastien nahm ab.
»Einen Moment, mein Vater geht gerade schwimmen. Er ist gleich wieder da.«
Er eilte ins Badezimmer, nahm ein Handtuch mit und stieg rasch die Treppe am Felsen entlang herunter. Er legte seine Sachen auf einen Stein, nahm die Angelrute, zog kurz an der Schnur und wartete. Schließlich rührte sich etwas, dann erschien sein Vater an der Oberfläche und schwamm schnell ans Ufer.
»Der Haken ist an einem Baumstamm hängen geblieben.«
Sébastien lächelte, begann, die Schnur einzuholen, die jetzt frei war.
»Ist es kalt?«
»Eiskalt.«
Joaquín stieg zähneklappernd aus dem Wasser und griff nach seinem Handtuch.
»Nimm dein Telefon. Es ist jemand für dich dran.«
Joaquín nahm das Handy, während Sébastien sich um die Angelrute, die Köderkiste und um einen Teil der Kleidung kümmerte.
»Hallo?«
»Ermittler Morales?«
Joaquín Morales blickte seinem Sohn nach, der wieder die Treppe zum Haus emporstieg.
»Am Apparat.«
»Hier ist Leutnant Forest.«
Er versuchte, sich mit einer Hand abzutrocknen.
»Ich wollte Sie sowieso anrufen. Ich würde gerne ein paar Tage freinehmen.«
Er hatte Anrecht auf drei Wochen Urlaub, seitdem er an die Baie des Chaleurs gezogen war, aber seine Chefin schaffte es immer, ihn irgendwie festzunageln. Als er zum ersten Mal in die Einfahrt zu seinem neuen Haus eingebogen war, hatte sie ihn mit einem Mordfall erwartet. Und dann war die Diebstahlserie oben bei den Bauernhäusern gekommen und danach die Geschichte mit der Grabschändung auf dem Friedhof.
Morales war geduldig. Er hat sich nicht gewehrt, weil er vorgehabt hatte, diesen Urlaub bei der Ankunft seiner Frau einzufordern. Doch nun hatte das unverhoffte Erscheinen von Sébastien und seiner Küchenausrüstung ihn davon überzeugt, dass er ein paar Tage Pause machen sollte, um sich um seinen Jungen zu kümmern.
»Ermittler Morales, die Gaspésie ist nicht der richtige Ort, um Urlaub zu nehmen.«
»Aber mein Sohn ist gerade zu Besuch gekommen und … ähm.«
Er wusste nicht genau, wie er sein Anliegen formulieren sollte. Er hatte bei der Arbeit vor Kurzem ein Memo bekommen, in dem erklärt wurde, dass die Betreuung eines Familienmitglieds »in einer psychologischen Notlage« einen Grund für die umgehende Beantragung einiger freier Tage darstellte. Allerdings fiel es ihm als Ermittler und Vater wesentlich schwerer, ein derartiges Thema anzusprechen, als der durchschnittlichen Leserin küchenpsychologischer Ratgeberliteratur.
»Mein Junge braucht … ähm.«
Wie sollte er das in Worte fassen? Joaquín und Sébastien hassten Vater-Sohn-Gespräche ebenso sehr wie Auseinandersetzungen mit ihren Vorgesetzten.
»Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie diesen Satz heute noch beenden könnten, Sergeant.«
»Ich muss ihm bei seinen kulinarischen Experimenten helfen.«
Er hörte sich selbst diese Worte aussprechen, die so fehl am Platz klangen wie ein Trompeter in einem Konzert für Soloklavier. Er spürte, wie er errötete wie ein dummer Junge. Seine Chefin räusperte sich, bevor sie langsam mit einer Stimme fortfuhr, der man anhörte, wie sehr sie sich beherrschen musste, um nicht in einen Schwall sarkastischer Bemerkungen auszubrechen.
»Morales, ich würde Sie stattdessen gerne zu einem ›Ermittlungs-Experiment‹ in die Gegend von Forillon schicken.«
Er kam sich lächerlich vor, aber das war noch lange kein Grund, vor seiner Chefin zu buckeln.
»Das ist nicht mein Gebiet.«
»Es gibt nicht genügend Mordermittler in der Gaspésie, die Wache von Gaspé braucht Hilfe bei der Untersuchung einer Vermisstenmeldung von gestern Nacht.«
»Sie verwechseln Vermisstenmeldung und Mordfall, Leutnant.«
Joaquín stellte fest, dass er vor Kälte schlotterte. Er schlug den Weg zum Haus ein und stieg die Treppe hoch, während seine Chefin so tat, als hätte sie ihn nicht verstanden.
»Hier in der Gegend ist es normal, sich gegenseitig zu unterstützen. So gewinnen wir kostbare Zeit, bis die Kollegen aus Montréal irgendwann ein Team losschicken, das den Fall übernimmt. Falls überhaupt jemand kommt.«
»Ich bin bereits mit der Ermittlung zu der Grabschändung beschäftigt …«
»Ich habe Ihren Fall an die Rekrutin Robichaud übergeben.«
Morales betrat das Haus. Er fragte sich, ob die Rekrutin ihrer Chefin erzählt hatte, unter welchen Umständen sie Sébastien aufgelesen hatten.
»Mein Sohn ist hier, und ich würde wirklich gerne …«
»Ich habe Sie durchaus verstanden. Aber Sie können auch an der Spitze von Gaspé mit ihm plaudern.«
Unmöglich, diesen Fehler wieder auszubügeln und zuzugeben, dass sein Sohn vielleicht Hilfe brauchte. Schließlich war dieser gerade anwesend und kramte auf der anderen Seite seines Kochtopfhaufens in den Vorräten. Marlène Forest nutzte sein Zögern gnadenlos aus.
»Ehrlich gesagt habe ich bei dieser Ermittlung ausdrücklich an Sie gedacht.«
Sein Sohn öffnete den Kühlschrank.
»Warum das, Leutnant Forest?«
»Weil es sich bei der vermissten Person um eine Frau handelt.«
Auf einmal verblasste Sébastiens Anwesenheit und wich einer eiskalten Angst.
»Eine Frau?«
»Ja.«
»Auf See?«
»Ja.«
Seine Chefin weidete sich an dem Schweigen. Joaquín warf einen Blick auf das Teleskop, mit dem er täglich den Horizont absuchte, in der Hoffnung, Catherine, die Frau, die ihn vollkommen aus dem Gleichgewicht gebracht hatte, zurückkehren zu sehen. Sein Herz schlug so heftig in seiner Brust, dass es wehtat.
»Auf was für einem Boot?«
»Einem Hummerkutter.«
Morales atmete langsam aus, stützte sich im Türrahmen ab, schloss die Augen. Sébastien erstarrte vor dem offenen Kühlschrank.
»Papa? Alles in Ordnung?«
Marlène Forest hatte wieder ihren schroffen Vorgesetzten-Tonfall angenommen.
»Frauen, die zur See fahren, lassen niemanden kalt. Weder Sie noch sonst jemanden in der Gaspésie. Wenn Sie das Herz am rechten Fleck haben, dann lassen Sie Ihre Kochtöpfe stehen und fahren auf der Stelle nach Gaspé.«
Sie hatte recht, aber Morales konnte sich nicht dazu durchringen, Ja zu sagen. Sie hatte erraten, wie verletzlich Catherine ihn gemacht hatte, und ihr grausames Spielchen ließ ihn vor Zorn erblassen.
Sébastien schloss den Kühlschrank und ging stirnrunzelnd zu seinem Vater.
»Geht es dir gut?«
Joaquín schlug die Augen auf, blickte seinen Sohn an, seinen geliebten Sohn, der vor ihm stand, mit seiner Musik, seinen Kochtöpfen und seiner Ungeschicklichkeit. Er richtete sich auf.
»Ich bin kein Ermittler für Vermisstenmeldungen, Leutnant Forest. Rufen Sie mich wieder an, wenn ein Mordfall daraus geworden ist.«
Er legte auf, zwinkerte Sébastien verschwörerisch zu und machte sich daran, energisch mit dem Handtuch das Meerwasser von seiner Haut zu rubbeln.
Joaquín Morales joggte bis zum Friedhof, verlangsamte seine Schritte, bog links ab. Sein Zorn war Unentschlossenheit gewichen. Lautlos näherte er sich dem alten Haus, neben dem ein Pick-up parkte, passierte den Brennholzstapel, erreichte die vorsorglich unter einem Fenster aufgestellte Trittleiter, kletterte lautlos die Stufen hinauf, warf einen Blick ins Innere. Zuerst erblickte er einen Beutel Marihuana auf einem Beistelltisch, dann die Hände eines Mannes, der sich einen Joint drehte.
Aufrecht im Bett sitzend schielte Cyrille Bernard mit einem Auge in seine Richtung.
»Das ist therapeutisches Gras, Sergeant«, röchelte er.
Morales öffnete das Fenster und stieg in das Zimmer des kurzatmigen alten Mannes.
»Immer noch am Leben?«
»Noch nicht ganz tot jedenfalls.«
Cyrille Bernard leckte sein Papier an und verklebte es, während Morales das Fenster schloss.
Cyrilles Schwester, mit der er sich das Haus teilte, wollte nicht, dass der Kranke Besuch bekam. Seit dem Hochsommer waren seine Freunde und Bekannten daher dazu übergegangen, auf den Brennholzstapel unter dem Fenster zu klettern, wenn sie den alten krebskranken Mann sehen wollten. Vergangene Woche jedoch hatte Morales beinahe die Hälfte davon zum Einsturz gebracht. Zu seinem Unglück war der Stapel zum Schutz gegen Regenwasser teilweise mit einer Blechplatte abgedeckt gewesen, was also einen Mordsradau ausgelöst hatte.
Während der Polizist einen dramatischen Sturz mitten zwischen die davonrollenden Holzscheite hingelegt hatte, war die Schwester Bernard, gedrungen und mit dröhnender Stimme wie die Karikatur einer frankokanadischen Furie aus dem Haus gestürzt und hatte dabei, wie es der Brauch wollte, ein Nudelholz geschwenkt. Morales würde sich noch lange an die Erscheinung erinnern, die auf ihn eindrang, als er in den Überresten des Holzstapels ausgestreckt die Augen aufschlug. Im Gegenlicht dieses hellen Nachmittags erhob sich ein breiter schwarzer Schatten mit unförmigem Kopf über ihm und reckte bedrohlich einen stumpfen Gegenstand in die Höhe. Noch bevor er sich aufrappeln konnte, hatte sie ihm mit einer leisen, düsteren Stimme zugezischt: »Sammeln Sie mir das auf, und zwar ein bisschen fix!«
Überrumpelt entschuldigte er sich hastig und stapelte das Holz in Rekordzeit wieder auf, während der Schatten, wie er glaubte, hinter ihm verharrte. Als sie ihn bei der Arbeit sah, war Cyrilles Schwester jedoch ins Haus gegangen und hatte ihm eine kleine Trittleiter gebracht: »Stellen Sie das unter das Fenster. Ich will nichts mehr von Ihnen hören.« Er drehte sich um und wollte sich bei ihr bedanken, doch sie hatte ihm bereits den Rücken zugekehrt. Er hatte sie um die Ecke der Veranda verschwinden sehen, in ihren Morgenmantel gehüllt und das Haar voller Lockenwickler. Bis er mit der Arbeit fertig war, hatte er leise vor sich hin geflucht und war dann mit schmerzenden Gliedern zu seinem Freund Cyrille hineingestiegen. Am meisten verletzt hatte die ganze Angelegenheit jedoch seinen Stolz.
Obwohl er seitdem bei jedem Besuch so leise auf Zehenspitzen schlich wie nur möglich, wurde er dennoch den unangenehmen Eindruck nicht los, beobachtet zu werden.
Der alte Fischer zündete seinen Joint an und schloss beim Rauchen die Augen. Joaquín setzte sich neben das Bett.
»Seit ein paar Tagen beginnt das Meer zu erlöschen. Die Sonne geht immer später auf, als hätte sie es satt, über die Berge zu klettern. Sie hat es überhaupt nicht eilig, sich an die Arbeit zu machen, und so geht sie jeden Tag früher unter, müde davon, dass sie so lange geleuchtet hat.«
Cyrille Bernard war nur noch ein Schatten in seinem Bett. Sein Atem pfiff schwerfälliger als je zuvor. Wie ein Ertrinkender, der nach Luft rang.
»Der Wind lässt kaum nach, vor allem bei Tag nicht. Er fegt bösartig über die Bucht hinweg. Wenn die Flut kommt, recken sich die weißen Wellenkämme in die Höhe. Wie Raureifzähne. Es ist noch nicht die kalte Jahreszeit, aber ein Vorgeschmack von dem, was noch kommt.«
»Für einen Typen aus Longueuil hast du ganz schöne Fortschritte gemacht! Vielleicht steckt doch noch mehr Mexiko in dir, als du denkst.«
Morales zuckte mit den Schultern, das Kompliment war ihm unangenehm.
»Bald ist Vollmond.«
»Weißt du, was man hier sagt?«, röchelte Cyrille. »Dass der Mond trügerisch ist und dass sein Spiegelbild auf dem Meer das Silber der Wahnsinnigen ist.«
Der Fischer befand sich in Palliativpflege. Er hatte schon vor einer ganzen Weile aufgehört zu fischen, doch sein Boot lag immer noch im Wasser. Er würde es nicht einwintern. Sein Plan war es, aufs Meer hinauszufahren und dort zu sterben, bevor die große Kälte sie alle beide mitnehmen würde. Das hatte er Joaquín erzählt. Und langsam stieg die Herbstflut.
Morales wusste, wie das enden würde. Schon seit einer Woche hatte Cyrille Bernard sein Bett nicht mehr verlassen, also hatte er selbst es sich zur Pflicht gemacht, ihn zu besuchen und ihm vom Meer zu erzählen. Von den Silbermöwen, die in die eisige Flut tauchten und dabei Wassergarben in die träge Sonne aufspritzen ließen, die wie Raureifblitze aussahen. Von den Wellen, die prustend gegen den Morgenfrost ankämpften. Von dem immer selteneren Kielwasser von Booten auf der Heimfahrt. Von den menschenleeren namenlosen kleinen Stränden, die nun auch von den letzten Feriengästen verlassen wurden. Von dem Grau, das mit jeder Minute näher kam, die der Tag an die Nacht verlor. Von der Stille, die sich wie ein Tuch über das Ufer breitete.
»Mein Ältester ist heute Morgen bei mir aufgetaucht. Total betrunken und sein Auto voller Kochtöpfe.«
Durch den Qualm hindurch hob Cyrille eine Augenbraue.
»Hört sich nach Ärger mit seiner Freundin an«, röchelte er.
Joaquín nickte.
»Letztes Jahr zu Weihnachten hat sie vor der ganzen Familie verkündet, dass sie ein Baby will. Mein Junge ist knallrot geworden.«
»Rot vor Scham?«
»Nein.«
Morales war sein Ältester schon immer ein bisschen feige vorgekommen. Er hatte so oft mitangesehen, wie seine Freundin an seiner Stelle geredet, den Wein entkorkt, die wichtigsten Momente ihrer Beziehung erzählt und sich ein bisschen über ihn lustig gemacht hatte, während sich Sébastien hinter das stumme Lächeln eines Mannes zurückzog, der seine feministische Frau den Verlauf ihres gemeinsamen Lebens bestimmen ließ. Dieses Mal hatte er jedoch anders reagiert.
»Rot vor Zorn.«
Es war das erste Mal gewesen, dass er seinen Jungen in Anwesenheit seiner Freundin zornig gesehen hatte, wenn auch nur schweigend.
Cyrille atmete pfeifend ein und schüttelte die Asche von seinem Joint.
»Will er keins?
Draußen begann das Blau des Himmels langsam zu verblassen.
»Ich weiß nicht.«
»Hast du ihn nicht gefragt?«
Ohne zu antworten, blickte Joaquín hinaus auf den Friedhof.
»Wenn du erst mal da liegst, ist es zu spät, ihn zu fragen.«
»Was soll ich denn zu ihm sagen?«
»Du bist hier der Ermittler. Da wirst du doch in der Lage sein, ein oder zwei intelligente Fragen zu stellen!«
»Ich bin bestimmt nicht in der Lage, ihm beizubringen, wie man eine Frau liebt.«
Morales stand auf und lehnte sich gegen einen Schrank. Er musste erneut daran denken, wie sein Sohn heute Morgen am Strand das Haar von Joannie Robichaud gelöst hatte.
»Und jetzt? Was macht er gerade?«
»Als ich gegangen bin, hat er gerade versucht, sich einen Kaffee zu machen.«
Morales wechselte die Haltung und sah Cyrille dabei zu, wie er seine Tüte fertig rauchte.
»Marlène hat mich vorhin angerufen. Sie hat eine Ermittlung für mich, drüben beim Forillon-Park.«
»Wann fährst du los?«
»Ich bin noch nicht mit dem Friedhofsfall von Saint-Siméon fertig.«
Morales hätte es nie zugegeben, aber er wollte bis zum Ende bei Cyrille Bernard bleiben. Der alte Mann röchelte wieder.
»In der Gaspésie wird kaum gestorben. Du musst das ausnützen, wenn du ein bisschen Ermittler bleiben willst.«
»Es ist kein Mordfall, sondern eine Vermisstenmeldung.«
Joaquín ging ans Fenster. Der Friedhof von Caplan versank sachte im Abendnebel. Gestern war Tagundnachtgleiche gewesen, und über Nacht war lautlos der Herbst gekommen. Die Sonne erwartete den Schnee.
»Wer ist denn verschwunden?«
Der Ermittler zögerte.
»Morales?«
»Eine Frau.«
Cyrille drückte seinen Joint aus. Einen Augenblick lang durchdrang der pfeifende Atem des Sterbenden das Zimmer, als würde er an den Wänden kratzen.
»Was machst du dann noch hier?«
Morales wandte sich zum Bett.
»Sie brauchen mich nicht sofort.«
»Klar wirst du deinem Jungen nie beibringen können, wie man Frauen liebt, wenn du immer schweigend zusiehst, wie sie verschwinden!«
Morales steckte den Schlag ein.
»Mal sehen …«
»Joaquín Morales.«
»Wenn Marlène Forest noch mal anruft …«
»Du wirst da hinfahren. Und zwar ohne dich lang bitten zu lassen!«
Morales schluckte. Hatte er dafür die Stadt verlassen? War er dafür in den Vorruhestand gegangen? Um weit entfernt von seiner Ehefrau zu leben, sich von einer anderen Frau auf einem Segelboot aus der Fassung bringen zu lassen, Sébastien betrunken und verwirrt vorzufinden und um seinen einzigen Freund hier im Angesicht des Todes im Stich zu lassen?
»Mein Sohn ist gerade …«
»Diese Frau da ist auch die Tochter von jemandem!«, krächzte Cyrille.
»Cyrille, ich …«
Der Kranke richtete sich auf seinem Kopfkissen auf. Er durchbohrte seinen Freund mit seinen blauen Augen.
»Hör auf damit! Ich bin krank, nicht blind! Ich brauche dich nicht, um mir vom Meer zu erzählen, Joaquín. Und auch nicht, um in Frieden zu sterben.«
Morales joggte zurück nach Hause. Er lief schnell, als fliehe er vor der Finsternis, die den Sieg über den Tag davongetragen hatte. Seine Beine waren schwer, und er war außer Atem, als er am Ende des Kieswegs ankam. Auf dem Pfad am Meer entlang fiel ihm plötzlich auf, dass die Fenster des Bistros hell erleuchtet waren und im Inneren ungewohnte Betriebsamkeit herrschte. Er machte einen Umweg, um sich das genauer anzusehen. Bereits aus dreißig Metern Entfernung hörte er mexikanische Musik aus den Lautsprechern dröhnen.