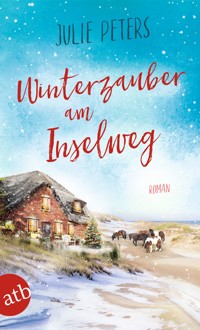10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kämpferische Frauen der Antike
- Sprache: Deutsch
Kann sie die Skythen für einen letzten Kampf einen?
Um ihr Schicksal zu erfüllen und ihrer Schwester Hippolyte als Königin der Skythen nachzufolgen, muss Penthesilea große Schuld auf sich laden. Dann zwingt der lange, blutige Krieg vor den Toren Trojas sie dazu, eine schwere Entscheidung zu treffen. Soll Penthesilea es wagen, mit den Amazonen in den Konflikt einzugreifen, um Skythiens Unabhängigkeit zu verteidigen? Aber kann sie überhaupt frei wählen, oder ist ihr Weg durch die Prophezeiung der Götter vorbestimmt? Wie Penthesilea sich auch entscheidet, die Zukunft Skythiens liegt in ihren Händen ...
Der fulminante Abschluss der Amazonen-Saga über die stärksten Frauen, die es in der Antike gab.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 432
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über das Buch
»In jenem Moment habe ich das Schicksal der Skythen besiegelt, so sehr ich mich auch dagegengestemmt habe.«
Penthesilea ist getrennt von ihrer Schwester, fern der Skythen aufgewachsen. Als die Existenz ihres Volkes bedroht wird, besinnt sich Penthesilea ihrer Herkunft und kehrt zu den Skythen zurück. Nach dem viel zu frühen Tod ihrer Schwester Hippolyte wird sie ihre Nachfolgerin als Königin der Skythen und steht, wie zuvor ihre Mutter und ihre Schwester, vor einer gewaltigen Herausforderung: Sie muss den Kampf um das Überleben ihres Volkes gegen die Achaier fortsetzen. Doch als der Krieg vor den Toren Trojas die Unabhängigkeit und Sicherheit Skythiens gefährdet, fragt sie sich, ob sie mit ihren Amazonen eingreifen muss. Entscheidet sich die Zukunft ihres Volkes fernab der Heimat?
Über Julie Peters
Julie Peters, geboren 1979, arbeitete als Buchhändlerin und studierte Geschichte, bevor sie sich ganz dem Schreiben widmete.
Im Aufbau Taschenbuch sind bereits zahlreiche ihrer Romane erschienen, unter anderem die historischen Romane »Käthe Kruse und die Träume der Kinder«, »Käthe Kruse und das Glück der Kinder«, »Die Dorfärztin«-Saga und die ersten beiden Bände der Amazonen-Trilogie »Die Kriegerin – Tochter der Amazonen« und »Die Kriegerin – Tochter der Steppe«.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Julie Peters
Die Kriegerin – Tochter der Freiheit
Roman
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Kapitel 0
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Epilog
Historische Notiz
Impressum
0
Sie werden Lieder singen.
Aber nicht über mich.
Für mich werden sie nur Verachtung haben, Hass und Misstrauen wird mir entgegenschlagen, sobald die Menschen erfahren, was ich getan habe. Wie viel Schuld ich auf mich lud, um am Ende selbst in den Untergang zu streben.
Aber ich greife vor. Eine gute Geschichte, wie sie an den Lagerfeuern gesungen wird, hat einen Anfang, eine Mitte, ein tragisches Ende. Mein Anfang war das tragische Ende meiner Schwester Hippolyte, denn ohne ihren allzu frühen Tod hätte ich nicht Königin der Skythen und Erste der Amazonen werden können. Es war nicht vorherbestimmt, dass ich die wurde, die ich nun bin. Aber wer weiß? Wenn ich meinen Vater Ares fragen würde, er würde nur lächeln und mich ansehen. Voller Stolz, weil ich die Eine bin, die den Unterschied hätte machen können zwischen Trojas Sieg und Trojas Niedergang.
Er hatte auf mich gehofft, als Hippolyte ihn enttäuschte.
Und dann habe ich ihn enttäuscht. Das weiß ich. Es tut aber nicht so sehr weh wie die Erkenntnis, dass ich mit meinen Handlungen das skythische Volk an den Abgrund getrieben habe. Schon bei meiner Geburt in Ephesos, fern vom Stammland der Skythen im Norden jenseits des Pontischen Meers, hatte sich abgezeichnet, dass ich nicht für die Zukunft des skythischen Reichs stehen würde.
Aber dann wurde ich ihre Königin, und die Zukunft lag in meinen Händen. Ich habe getan, was getan werden musste. Ich bin über Leichen gegangen, ich habe Blut an meinen Händen.
War es das wert?
Ich weiß es nicht.
Ich weiß nur, dass ich in jener Nacht tief im Wald, als ich den Bogen hob und den Pfeil einlegte, fest überzeugt war, das Richtige zu tun.
Als ich den Pfeil von der Sehne schnellen ließ, erkannte ich meinen Irrtum.
Aber da war es schon zu spät.
In jenem Moment habe ich das Schicksal der Skythen besiegelt, so sehr ich mich auch dagegengestemmt habe.
Es tut mir leid. Die Lieder, die sie über mich singen, werden euch widersprüchlich erscheinen. Doch wenn ich euch nun meine Geschichte erzähle, versichere ich, dass sie Sinn ergeben werden.
1
Als noch kein Krieg herrschte zwischen Troja und den achaischen Königen, die mit ihren tausend Schiffen über das Ägäische Meer kamen, besuchte ich an der Seite meines Vaters Ares die Stadt. Prunkvoll und strahlend weiß hockte sie auf dem Felsen über dem Meer, uneinnehmbar hoch ragten die Mauern auf. Kaum vorstellbar für mich, dass es irgendwem gelingen sollte, diese prächtige Stadt einzunehmen.
Mein Vater zügelte seinen Rappen. Der schwarze Wolfshund, der ihn seit vielen Jahren begleitete, jagte einem Kaninchen nach, das er im Unterholz aufgestöbert hatte. Ich lenkte meine braune, unscheinbare Stute neben das Pferd meines Vaters.
»Siehst du Troja?«, fragte er.
»Ja«, antwortete ich, obwohl ich unsicher war, was er meinte.
Ungeduldig schüttelte er den Kopf. »Siehst du die Stadt?«
»Ich sehe hohe Mauern«, erwiderte ich leise. Ich versuchte, mich nicht von ihm einschüchtern zu lassen. Er war mein Vater, er vermied es, mir oder meinen Schwestern gegenüber bedrohlich zu wirken. Dennoch hatte ich mehr als einmal erlebt, wie er mit meiner Mutter Otrere stritt, und das waren meist Situationen gewesen, in denen er noch finsterer, noch wütender, noch unzugänglicher wirkte.
Niemals durfte ich vergessen, dass er der Kriegsgott der Achaier war. Das sagte ich mir, wenn ich Gefahr lief, mich vor ihm zu fürchten. Er musste furchterregend sein, denn Kriege waren furchterregend, also war er es auch. Aber das war nur ein Teil seines Wesens. Für uns war er der liebevolle Vater, auch wenn er sich manchmal vergaß und uns als furchterregender Gott erschien.
»Hohe Mauern.« Er runzelte die Stirn, nickte widerwillig. »Was noch?«
»Troja wurde auf einem Felsen erbaut.«
»Der nicht besonders hoch ist, aber zusammen mit den Mauern immerhin einen passablen Schutz bietet. Was siehst du noch?«
Ich weiß es doch nicht, wollte ich verzweifelt rufen. Aber ich zählte weiter auf: der halbmondförmige, lange Sandstrand im Nordosten, die Hügel im Landesinneren, kleine Wäldchen, saftige Wiesen … Immer noch nickte er ungeduldig, ich wusste nicht, was er meinte, er war unzufrieden mit mir und meinen Gedanken, das spürte ich deutlich.
»Das Meer«, fuhr er dazwischen, als ich begann, die Mauer zu beschreiben. »Was ist mit dem Meer, Penthesilea?«
Ich blickte auf das dunkelblaue, schaumgekrönte Meer, das im Norden und Westen die Halbinsel umschloss. »Über das Meer werden sie kommen«, flüsterte ich. Das leichte Nicken meines Vaters sah ich nur aus dem Augenwinkel. Er gab dem Rappen die Schenkel und ritt auf die Tore der Stadt zu.
Ich folgte ihm und warf einen Blick zu den Kriegerinnen, die uns begleiteten. Mein Vater brauchte niemanden, der ihn beschützte. Er konnte gut auf sich selbst aufpassen. Wir wären allein geritten, doch meine Schwester Hippolyte war der Auffassung, als Prinzessin dürfte ich nicht unbegleitet mit unserem Vater reisen. Was befürchtete sie? Dass Ares mich auf freiem Feld im Stich ließ? Dass wir angegriffen wurden und die Amazonen mich besser verteidigen konnten als der allmächtige Kriegsgott der Achaier?
Ich hatte es aufgegeben, mit Hippolyte zu diskutieren. Früher hatte ich geglaubt, es sei mit unserer Mutter schwierig, die eine genaue Vorstellung davon hatte, wie unser Volk leben sollte. Sie war oft mit uns zwischen Skythien nördlich des Pontischen Meers und Themiskyra gependelt, jener Stadt, die sie selbst in Ionien gegründet hatte, in unmittelbarer Nachbarschaft achaischer Städte. Sie war der Meinung, das skythische Volk könne nur überleben, wenn es sich an die geänderten Umstände anpasste. An die Achaier, die an unsere Küsten kamen und Städte gründeten, deren Sicherheit hinter hohen Mauern auch das Interesse unseres nomadischen Volks weckte. Eine trügerische Sicherheit, denn sobald Menschen so dicht mit ihrem Vieh aufeinanderhockten, breiteten sich Seuchen aus, und wenn die Ernten schlecht ausfielen, gab es wenig Möglichkeiten, gegenzusteuern. Aber davon wollte unsere Mutter nichts hören. Sie sagte, die Skythen sollten entscheiden dürfen, ob sie auf der Steppe blieben oder lieber nach Themiskyra zogen.
Jetzt war sie nicht mehr da. Gestorben, weil sie überzeugt war, ihr Leben sei ans Ende gekommen. Meine ältere Schwester Hippolyte war Königin geworden, und was meine Mutter begonnen hatte, führte sie mit so viel Verve weiter, als hätte sie einen Plan. Ich war überzeugt, dass sie keine Ahnung hatte, was sie tat. Sie verstand die Skythen nicht. Für Hippolyte ging es nur darum, möglichst schnell auf die Steppe zurückzukehren, denn dort fühlte sie sich wohler als in Themiskyra. Und das merkte man ihr an.
Unsere jüngere Schwester Antiope und ich waren mit dem Leben hinter Mauern aufgewachsen. Ich wusste nicht, wie es Antiope damit ging, doch ich war in Ephesos geboren und in Themiskyra aufgewachsen, und dieses Leben behagte mir so viel mehr als das einer Kriegerin im Sattel, das dem Ideal der Amazone entsprach.
Wir erreichten das hohe, massive Stadttor von Troja. Ein Dutzend Soldaten standen Wache. Als wir uns näherten, wurden sie auf uns aufmerksam. Ihr Hauptmann trat uns entgegen. »Halt!«, rief er. »Wer seid ihr und was wollt ihr?«
Um uns herum strömten unbehelligt Bürger der Stadt Richtung Tor, Händler mit Karren, auf denen sich ihre Waren türmten, passierten uns ebenfalls, ohne die Aufmerksamkeit der Wachsoldaten zu wecken. Mein Vater ritt auf den Hauptmann zu, bis er direkt vor ihm stand. »Ich bin Ares.«
Mehr sagte er nicht. Er blickte auf den Mann nieder, der tapfer versuchte, sich ihm entgegenzustellen. Der schwarze Wolfshund neben meinem Vater knurrte. Ich lenkte mein Pferd neben seinen Rappen.
»Ich bin Prinzessin Penthesilea vom Volk der Skythen und bin gekommen, um der Königsfamilie von Troja einen Besuch abzustatten«, verkündete ich mit heller Stimme. »Bitte meldet meine Ankunft im Palast. Ich bin sicher, König Priamos wird uns willkommen heißen.«
Der Blick des Soldaten zuckte zu mir. Er maß mich prüfend, als versuchte er einzuschätzen, ob ich wirklich die war, als die ich mich ausgab. Ich verstand die Nervosität der Troer. Erst vor Kurzem war ein Streit zwischen Troja und Sparta entbrannt, weil der trojanische Prinz Paris Helena, die Königin von Sparta, entführt hatte. Helenas Gatte Menelaos hatte daraufhin seine Verbündeten zu den Waffen gerufen. Es war nur eine Frage der Zeit – und der günstigen Winde – bis die tausend Schiffe der Achaier von Aulis in See stachen und vor Troja landeten. Ein Krieger, der mit einem Dutzend bewaffneter Frauen vor den Toren der Stadt auftauchte, konnte genauso gut eine Vorhut sein. Eine List, um sich Zugang zur Stadt und zur Königsfamilie zu verschaffen.
»Schickt nach Prinz Hektor«, bat ich den Hauptmann. »Er kennt mich.« Zumindest hoffte ich das. Als die Troer uns vor einiger Zeit einen Besuch abstatteten, hatte er nur Augen für meine Schwester Hippolyte gehabt. Eine Weile war auch die Rede davon gewesen, dass die beiden sich vermählen könnten, doch inzwischen hatte Hektor sich anders entschieden.
Der Hauptmann gab einem der Soldaten ein Zeichen. Dieser verschwand durch das große Tor. Mein Vater brummte. Ich wusste, was er sagen wollte. Die Amazonen glitten aus dem Sattel und führten ihre Pferde zu einem Brunnen vor der Stadtmauer, aus dem sie Wasser schöpften und sie tränkten. Wir waren alle staubig, müde und durstig nach der langen Reise. Nun, mit Ausnahme meines Vaters vielleicht, der in seinem schwarzen Brustpanzer so makellos aussah, als hätte er sich gerade erst von seinem Lager in einem achaischen Palast erhoben. Das Fell seines Rappen glänzte ohne ein Körnchen Staub. Ich fragte nicht, wie er das schaffte. Er war ein Gott. Wenn der Hauptmann einen Beweis für seine Göttlichkeit suchte, müsste er nur die Augen aufmachen. Doch das Misstrauen gegen alle Fremden war den Troern tief in die Seele gegraben, seit sie wussten, dass Menelaos seine Gattin Helena notfalls mit Waffengewalt zurückholen würde.
Wenig später ritt Prinz Hektor durch das Tor. Er stieg ab und begrüßte erst meinen Vater, dann mich mit angemessener Ehrerbietung. »Ihr müsst müde sein. Wir gewähren euch gern für die Dauer eures Aufenthalts Quartier in unserem Palast.«
Ich warf dem Hauptman einen triumphierenden Blick zu, als wir Hektor durch das Tor folgten. Doch er ignorierte mich.
Die Pracht Trojas überwältigte mich. Ich hatte gewusst, dass Troja deutlich größer war als Themiskyra. Die Stadt war ja auch viel älter. Doch als wir durch die Gassen hoch zum Palast ritten, der über der Siedlung thronte, machte mich alles sprachlos. Die breiten Straßen, die großen Häuser, in denen die Bürger lebten … Ich verstand. Falls Menelaos einen Grund gesucht hatte, sich dieser Stadt zu bemächtigen, hatte Prinz Paris sie ihm mit der Entführung Helenas geliefert.
Ich rutschte unruhig im Sattel herum. Mein Vater schmunzelte. »Du musst dir keine Sorgen machen.«
Ich antwortete nicht. Die Vorstellung, der schönsten Frau der Welt zu begegnen, sorgte für ein Unbehagen, das ich mir nicht erklären konnte.
»Diese Familie ist nicht anders als deine«, fuhr er fort, ohne den Blick von Hektors Rücken zu lassen, der vorausritt. »Sie haben ebenso zu kämpfen wie du und ich.«
Als müsste mein Vater jemals kämpfen. Ich schnaubte ungehalten. Seine Miene war wie eine Maske.
»Auch ich habe deine Mutter verloren«, sagte er leise, als genügte das als Erklärung. Und ich verstand. Der Tod meiner Mutter hatte bei jedem von uns Spuren hinterlassen. Mein Vater hatte ihn nicht verhindern können, denn meine Mutter hatte beschlossen, dass ihre Zeit in dieser Welt sich dem Ende zuneigte, und als sie nach einem Kampf gegen die Ionier verletzt wurde und ihr falber Hengst sich ein Bein brach, hatte sie zuerst ihr Pferd getötet und dann auf ihr eigenes Ende gewartet, das sich allerdings so lange hinzog, dass Antiope und ich während ihres Siechtums auf uns gestellt blieben, weil Hippolyte nichts unversucht ließ, sie zu retten. Sie ritt sogar nach Ephesos und versuchte, Apollon oder unseren Vater zu überzeugen, ihr zu helfen. Und das, obwohl Hippolyte bis heute kein Vertrauen zu den achaischen Göttern gefasst hatte. Dass nicht mal Ares etwas gegen Otreres Tod unternommen hatte, dass Hippolyte nicht verstand, wie machtlos er war, hatte zwischen den beiden zu einem Streit geführt, der sich nach meinem Entschluss zuspitzte, Themiskyra zu verlassen und mit ihm nach Ephesos zu gehen.
Vorher nach Troja zu reisen, war seine Idee gewesen. Ich hatte sie begeistert aufgegriffen. Weil ich verstehen wollte. Und ich verstand. Die Welt jenseits von Skythien war so viel größer und unbegreiflich schön. Ich wünschte, Hippolyte wäre bei uns. Ich wünschte, sie könnte sehen, wie viel wir noch erreichen konnten.
2
Die Schönheit Helenas war so atemberaubend und kaum in Worte zu fassen, wie man sich erzählte. Vermutlich sollten wir uns glücklich schätzen, überhaupt ihr Antlitz betrachten zu dürfen, denn an dem Bankett, das uns zu Ehren an diesem Abend ausgerichtet wurde, nahmen nur die trojanische Königsfamilie, Ares und ich teil. Die Dienerinnen, die auf goldenen Platten köstliche Speisen auftrugen, hielten die ganze Zeit den Blick gesenkt und liefen barfuß und in bodenlangen, weißen Chitons lautlos durch den kleinen Saal, in dem wir uns eingefunden hatten.
Helena saß neben Paris und Kassandra, gegenüber von Hektor und seiner Frau Andromache. Außerdem waren weitere Kinder des Priamos und der Hekabe anwesend – Krëusa, Troilos und Polyxena. Das Königspaar saß nebeneinander am Kopfende der Tafel, während Ares und ich die Ehrenplätze ihnen zur Seite zugewiesen bekamen. Priamos schien erfreut zu sein, uns als seine Gäste begrüßen zu dürfen, und wurde nicht müde, zu erwähnen, was für eine große Ehre wir ihm damit erwiesen. Mein Vater schob schweigend die Stücke Braten auf seinem Teller hin und her und verfütterte sie an den schwarzen Hund, der unter dem Tisch lag, die Schnauze auf seinen Stiefeln. Ich wusste, dass mein Vater keine menschlichen Speisen zu sich nahm, doch es war neu, dass er versuchte, den Anschein zu erwecken mit uns zu speisen.
Hekabe drückte mir ihr Mitgefühl zum Tod meiner Mutter aus und erkundigte sich, wie es Hippolyte seither ergangen sei. »Hat sie bereits Überlegungen angestellt, sich zu vermählen?« Was sie damit eigentlich sagen wollte, war wohl, dass sie mehr als genug unverheiratete Söhne hatte, die statt Hektor daran interessiert sein könnten, König der Skythen zu werden. Mit einer Heirat würde Troja ein Bündnis mit Skythien schließen, das uns im Falle eines Kriegs zwischen Troja und Achaiern, der inzwischen unvermeidlich schien, in diesen Konflikt hineinziehen würde. Nein, danke.
»Später vielleicht«, sagte Ares neben mir. Dankbar blickte ich meinen Vater von der Seite an. Ich war eine störrische Fünfzehnjährige, die nichts davon hielt, wenn andere für sie sprachen, doch wenn mein Vater als Kriegsgott das Wort ergriff und einem Bündnis mit Troja eine so behutsam formulierte Abfuhr erteilte, war das deutlicher als ein klares Nein von mir es je sein könnte.
Hekabe zuckte auch nur kurz zusammen und wechselte das Thema. Sie erkundigte sich, ob das zugewiesene Quartier mir zusagte, und drückte ihre Hoffnung aus, wir würden uns für die Dauer unseres Aufenthalts wohlfühlen. Darin schwang unausgesprochen die Frage mit, wie lange wir zu bleiben gedachten.
»Es ist alles sehr angenehm«, erwiderte ich und senkte den Kopf. Auf einmal verstand ich, weshalb Hippolyte immer wieder erwähnte, wie schwer es sei, sich mit anderen Herrschern auszutauschen. Hinter jeder Formulierung lauerte eine potenzielle Beleidigung. Das wollte ich um jeden Preis vermeiden.
»Wir werden nicht lange bleiben können.« Wieder sprach Ares für uns. »Penthesilea sehnt sich nach Ephesos, wo sie seit ihrer frühen Kindheit nicht mehr weilte.«
»Wie schön, dass du dorthin zurückkehren kannst«, sagte Hekabe an mich gewandt.
»Ja«, antwortete ich schlicht. Mehr nicht. Hekabe verlor das Interesse an mir, und ich widmete mich dem zarten Zickleinbraten, der mit Thymian vortrefflich gewürzt war. Die Stille an der Tafel war absolut, und ich hob irritiert den Blick. Kassandra schaute in meine Richtung, und ihre Augen weiteten sich.
»Viele werden sterben. Auch du findest den Tod vor den Toren Trojas.« Ihre Stimme war schrill und ängstlich. »Hüte dich vor dem achaischen Helden, der dir von seiner Liebe erzählt.«
Priamos, der neben mir saß, hob abwehrend die Hand, als könnte er sie daran hindern, mehr zu sagen. Doch Kassandra, deren Pupillen winzig wie Nadelstiche waren, schien mit dem, was sie zu sagen hatte, fertig zu sein, denn sie bat mit normaler Stimme um mehr Wein.
An der Tafel herrschte peinlich berührtes Schweigen, und kurz schien es, als müssten sich alle sammeln. Ares lachte rau. »Apollon spricht immer noch aus ihr, hm?«, fragte er an Priamos gewandt. »Mein Bruder hat sich schon mehr als einmal geirrt. Sei es bei der Wahl seiner Orakel als auch bei den Sprüchen, die durch sie verkündet wurden.«
»Da mögt Ihr recht haben.« Priamos wirkte seltsam bedrückt. Ich wusste, warum. Einst hatte Kassandra verkündet, dass Paris eines Tages Troja in Flammen setzen würde, weshalb sich Hekabe und Priamos schweren Herzens dafür entschieden hatten, ihn kurz nach der Geburt in den Bergen auszusetzen. Doch der Säugling war von einem Ziegenhirten gefunden worden, der ihn wie seinen eigenen Sohn aufzog. Später baten Hera, Aphrodite und Athene ausgerechnet Paris im Streit um den goldenen Zankapfel der Eris, den diese bei einem Fest unter die Feiernden hatte rollen lassen, um ein gerechtes Urteil. Er sollte bestimmen, welche der drei Göttinnen die Schönste sei, denn so lautete die Inschrift des Apfels – der Schönsten. Aber wie sollte ein junger Mann ein gerechtes Urteil fällen, wenn jede ihm etwas anderes versprach, falls er ihr den Apfel zusprach? Paris entschied sich für Aphrodite, die ihm die schönste Sterbliche der bekannten Welt versprach – was eine Ironie war, die keinem auffiel, war Aphrodite doch selbst gerade als Schönste ausgezeichnet worden. Sie war es, die Paris half, als er in leidenschaftlicher Liebe für Helena entbrannte, die bereits Königin von Sparta war. Er entführte Helena und brachte sie nach Troja. Menelaos war bereit, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um Helena zurückzuholen – und sei es, Troja in Flammen zu setzen und damit die Prophezeiung der Kassandra zu erfüllen.
Ich war mir daher nicht sicher, ob ich Kassandras Worten wirklich so wenig Bedeutung beimessen sollte wie es mein Vater und alle anderen versuchten. Ich spürte, wie mich ein kaltes Grauen erfasste. Und wenn sie recht hat?, fragte ich mich. Durfte ich Kassandras Weissagung wirklich übergehen? Sie sprach von meinem Tod, von einem achaischen Helden, vor dem ich mich hüten sollte … All das klang geradezu verrückt in meinen Ohren, aber das hatte ihre Prophezeiung zu Paris sicher auch damals getan. Dennoch hatten Priamos und Hekabe alles getan, um die Prophezeiung zu verhindern. Was also war richtig? Oder konnte ich das, was kam, nicht verhindern? Konnte ich meinem Schicksal nicht ausweichen, wenn es einmal vorherbestimmt war?
Was war es, dass man einer klugen Frau nicht zuhörte? Schon einmal hatte sie recht behalten. War es nicht möglich, dass sie auch bei mir recht behielt? Allerdings war ihre Prophezeiung alles andere als subtil.
Ich wandte mich an meinen Vater, wollte meine Fragen bei ihm abladen, doch Ares beugte sich gerade zu Priamos und beachtete mich nicht. Hekabe neben mir legte die Hand auf meine. »Fürchte dich nicht«, sagte sie leise. »Kassandra hat schon so vieles prophezeit. Nur weil ein Orakelspruch aus ihrem Mund eingetroffen ist, muss es kein zweites Mal geschehen.« Sie lachte auf. »Du liebe Güte, wir haben längst aufgegeben, ihre Prophezeiungen für voll zu nehmen. Manchmal ist sie wie von Sinnen, wenn sie etwas vorhersagt. Entschuldige, Kassandra, aber so ist es doch?«
Die rothaarige Prinzessin senkte verlegen den Kopf. Andromache wandte sich nun an mich und erkundigte sich nach Belanglosigkeiten, um mich von diesem Thema abzulenken. Sie waren alle so sehr um mich bemüht, dass mein Misstrauen geweckt war.
Aber vor allem Ares, der das Thema geflissentlich zu ignorieren versuchte, machte mich misstrauisch.
3
Das Bankett wurde früh beendet; es schien fast, als hätte Kassandra uns allen die Laune verdorben. Als sich die Ersten erhoben und dem Ausgang zustrebten, wandte sich noch einmal Andromache an mich. »Möchtest du, dass ich dir die Gärten zeige?«, fragte sie. Ihre Stimme war zart und leise, so wie alles an ihr zart war. Sie machte eine einladende Handbewegung, und ich folgte ihr aus dem Saal und durch die von Fackeln beleuchteten Gänge zu einem Innenhof, in dem es üppig grünte und blühte. Andromache setzte sich auf eine Steinbank und wartete, bis ich mich zu ihr gesellte.
»Ich komme oft hierher«, sagte sie ruhig. »Die Stille tut mir gut.«
Ich lauschte mit ihr. Es war tatsächlich sehr still in diesem Teil des ausgedehnten Palasts, fernab der Wachstuben, Pferdeställe und der Soldatenquartiere.
»Deine Schwester und Hektor waren einst einander versprochen, stimmt das?«
Der abrupte Themenwechsel verwirrte mich. »Davon weiß ich nichts«, erwiderte ich vorsichtig.
Sie nickte langsam. »Es wundert mich nicht, dass das nicht weithin bekannt ist. König Priamos und Königin Otrere haben daraus ein Geheimnis gemacht.«
»Wie hast du davon erfahren?«
»Hektor hat es mir erzählt. Es ging so lange gut voran, man hatte sich sogar schon auf einen Brautpreis geeinigt, aber dann machte Königin Otrere plötzlich einen Rückzieher. Niemand weiß, was sie dazu bewog. Heute muss man sich wohl eingestehen, dass sie gute Gründe hatte, wenn sie das Ziel verfolgte, Skythien aus dem Krieg herauszuhalten. Immerhin war sie Ares’ Gefährtin und wusste Dinge, von denen wir keine Ahnung hatten.«
Ich schwieg. Was immer mein Vater tat, seine Beweggründe – meine Schwestern und ich wussten genauso wenig wie alle anderen. Ich bezweifelte, dass er meiner Mutter mehr anvertraut hatte. Allzu oft hatten sie sich genau darüber gestritten. Dass Ares ihr etwas verbot oder ihr ein Versprechen abrang, ohne ihr dafür konkrete Gründe zu nennen. Meist hatte sie sich widerstrebend gefügt. Und manchmal, so wie kurz vor ihrem Tod, hatte sie ihren eigenen Willen durchgesetzt.
»Nun, zumindest hatte ich keine Ahnung davon, als Hektor an den Hof meines Vaters kam und um meine Hand anhielt. Damals dachte ich, dass es einfach eine glückliche Fügung war. Denn er und ich … als wir einander das erste Mal ansahen, wusste ich, dass wir füreinander bestimmt sind.« Sie blickte auf ihre schmalen, weißen Hände, die im Schoß ruhten. »Ich kann mich glücklich schätzen, dass der Mann, der um mich freite, auch der ist, den ich liebe.«
»Das stimmt.« Ich räusperte mich. Immer mehr war da das Gefühl, dass ich die Falsche war, mit der Andromache redete. Sollte nicht eher Hippolyte statt meiner mit der trojanischen Prinzessin zusammensitzen? Ihre nächste Frage verstärkte mein Unbehagen.
»Steht Skythien trotzdem an der Seite Trojas, wenn die Achaier kommen?«
»Ich weiß es nicht«, sagte ich leise. Und das war die Wahrheit. Ich wusste nichts. Niemand sprach mit mir. Dass Hektor vergebens um Hippolyte gefreit hatte, war mir ebenso unbekannt wie die Antwort auf diese Frage.
»Manchmal habe ich das Gefühl, gar nichts zu wissen.« Ich lachte verlegen. »Ich weiß, dass die trojanische Familie einst bei uns in Themiskyra zu Besuch kam. Damals war ich fünf? Ich wollte deinen Gemahl heiraten mit jener Leidenschaft, zu der nur Kinder in der Lage sind. Ohne zu wissen, was das genau bedeutet.«
Andromache lächelte flüchtig.
»Man könnte also drauf kommen, dass es deinem Schwiegervater und meiner Mutter damals um dieses Bündnis ging. Aber gewusst habe ich davon nichts.«
Andromache nickte. »Wenn du Königin wärst. Wenn statt deiner Schwester du entscheiden dürftest, auf wessen Seite Skythien steht. Wie würde deine Antwort dann lauten? Steht Skythien an Trojas Seite?«
»Skythien steht für sich ein. Nicht für andere Reiche«, erwiderte ich spröde. »Bisher haben die achaischen Königreiche uns allerdings nicht gezeigt, dass sie mit uns verbündet sein wollten.« Das Herz hämmerte in meiner Brust. Ich wischte meine verschwitzten Hände an dem Kleid ab. Auf dieses Gespräch hatte mich niemand vorbereitet. Wusste mein Vater, dass ich von der trojanischen Prinzessin geprüft wurde? Es schien für sie wichtig zu sein, auf welcher Seite die Amazonen standen. Als hinge davon ihr Überleben ab. Als könnten wir einen Unterschied machen.
Hatten wir so viel Macht? Waren die skythischen Kriegerinnen so gefürchtet in der Welt, dass sie eventuell sogar Menelaos abschrecken und einen Krieg verhindern könnten, allein dadurch, dass wir Partei für Troja ergriffen? Und war ich in der Position, dies auszusprechen? Letzteres sicher nicht. Trotzdem drängte Andromache mich, Stellung zu beziehen.
»Vielleicht war es ein Fehler, Teil dieser Familie zu werden.« Sie strich gedankenverloren über den Stoff ihres Kleids. »Aber ich bin glücklich.«
»Dann kann es nicht so falsch sein.«
Ich fühlte mich unbehaglich, weil ich mich zunehmend fragte, weshalb Andromache mich ins Vertrauen zog. Sie suchte meine Nähe, aber mir war nicht klar, warum? Zum ersten Mal wünschte ich, Hippolyte sei hier und könnte es mir erklären. Aber ob sie es selbst wüsste?
Ich verstand immerhin so viel, dass Andromache herausfinden wollte, ob Skythien Troja im Falle eines Kriegs zu Hilfe eilen würde. Die Worte meiner Schwester klangen mir noch im Ohr, und deshalb hatte ich genau das gesagt. Skythien stand für sich ein. Anders wäre es, wenn Hektor meine Schwester und nicht Andromache geheiratet hätte. So aber würden wir neutral bleiben.
»Mein Schwager ist kein schlechter Mensch«, sagte Andromache. »Paris. Er handelte nicht aus Bosheit oder weil er uns in diese ausweglose Lage manövrieren wollte. Er handelte aus Liebe. Und als Liebende kann ich ihn verstehen. Kannst du das auch?«
Ich schüttelte beinahe entsetzt den Kopf, denn von der Liebe verstand ich nichts. »Keine Ahnung«, fügte ich hinzu.
Sie sagte nichts mehr. Ich warf ihr einen Seitenblick zu, doch Andromache starrte auf ihre Hände, als wüsste sie nicht, was sie noch sagen konnte, um mich von der Rechtmäßigkeit dieses Kriegs zu überzeugen.
»Fürchtest du dich?«, fragte ich. »Vor den Kämpfen.«
»Ich weiß nicht. Hektor sagt, die Kämpfe werden vor der Stadt sein, nicht innerhalb der Mauern. Wir sind in Sicherheit. Aber ich fürchte um sein Leben und das aller anderen Männer, die für unsere Freiheit kämpfen.«
Mich hätte interessiert, was Helena dachte. Ob sie diesen Krieg für gerechtfertigt hielt, ob sie bereitwillig mitgegangen war oder nur der Preis war, den Aphrodite an Paris gezahlt hatte, ohne auf Helenas Gefühle zu achten. Konnte es nicht sein, dass sie gern bei Menelaos geblieben wäre? Ich hatte gehört, sie habe ihre Tochter Hermione in Sparta zurückgelassen. Welche Mutter ließ freiwillig ihre Tochter zurück?
Meine Mutter.
Meine Mutter hatte mich in Ephesos gelassen, als sie nach Norden ritt, um die Thraker zu bekämpfen, die in Skythien drohten, unser Reich mit Krieg und Verderben zu überziehen. Und schon zuvor hatte sie Hippolyte bei unserer Tante Mela gelassen, weil sie mit Ares zusammensein wollte und sie ihn nicht in Skythien duldete. Ständig verließen Mütter ihre Kinder, um in die Schlacht zu ziehen, und allzu oft kehrten sie nicht zurück. Aber für die Achaier waren Frauen auf das Muttersein reduziert, anders als bei unserem Volk. Wenn eine Mutter ihr Kind verließ, tat sie das nur in der größten Not – oder als ein Akt der Selbstsucht. So dachten die Achaier. Während ihre Männer in den Krieg zogen, auf Reisen gingen, die Welt für sich eroberten, wie es ihnen gefiel.
Ich stellte mir das sehr frustrierend vor, doch als ich das sagte, schüttelte Andromache den Kopf. »Nein, gar nicht. Es ist die natürliche Ordnung der Dinge.«
Danach schwiegen wir beide. Es wurde deutlich, dass wir uns alles gesagt hatten. Andromache lächelte flüchtig, dann stand sie auf und verließ den Garten. Ich blieb sitzen, unschlüssig, was ich mit diesem Gespräch anfangen sollte.
So fand mich wenig später Ares’ Hund. Er schnupperte an mir, spitzte die Ohren und ließ sich kraulen. Ich wunderte mich, dass er das mit sich machen ließ. Bisher hatte er mich ignoriert, und ich ihn ebenso. Ich fragte mich, ob er die ganze Zeit in der Nähe gewesen und auf mich aufgepasst hatte.
»Du solltest nicht alles glauben, was eine trojanische Prinzessin dir erzählt.«
Ich fuhr zu der Stimme herum. Mein Vater löste sich aus den Schatten der Bäume an der hohen Palastmauer. Er schlenderte heran. Auf einmal wurde mir unerklärlich kalt. Fröstelnd legte ich die Arme um meine Schultern. Ares löste die Fibel seines nachtschwarzen Umhangs und legte ihn mir wortlos um die Schultern.
»Wie lange hast du da gestanden?«, wollte ich wissen.
»Nicht lange. Konnte sie dich überzeugen, dass Skythien sich Troja anschließen sollte?«
Ich zog den Mantel eng um meine Schultern. Ares’ Körperwärme und der fest gewebte, leicht silbrig schimmernde Wollstoff, der so überirdisch schön war, sorgten dafür, dass ich nicht länger fror.
»Skythien steht nur für sich ein.«
»Eine Haltung, die sich auf Dauer als tödlich erweisen könnte«, wandte er ein.
»Du meinst, Skythien kann es sich nicht leisten, sich nur auf sich selbst zu verlassen?«
»Verbündete sind immer eine Überlegung wert.«
»Auf wessen Seite stehst du eigentlich in diesem Krieg?«, erkundigte ich mich. »Denn für mich sieht es so aus, als hättest du mich aus einem bestimmten Grund nach Troja gebracht. Sollte ich mich für die trojanische Seite begeistern, hättest du in Themiskyra mindestens eine Fürsprecherin. Ich vermute daher, dass nicht nur Mutter, sondern auch meine Schwester dich bisher haben abblitzen lassen.«
Sein Mundwinkel zuckte, doch er verschränkte die Arme vor der Brust. »Du nimmst dir zu viele Freiheiten heraus, Penthesilea«, erwiderte er scharf. »Du bist ein Kind, kaum zur Frau herangereift und begierig darauf, dass alle dich anbeten, die dir über den Weg laufen, weil du es aufgrund deiner Herkunft für dein Recht hältst. Aber du bist nicht mehr als all die Sklavinnen in den Palastküchen, nicht mehr als der einfache Soldat, der in Aulis frierend im Regen kauert und darauf wartet, dass das Abschlachten beginnt. Du bist bedeutungslos wie sie alle.«
Er hielt inne. Ich blickte zu ihm auf, und mein Herz hämmerte in der Brust. Sein Ausbruch überraschte mich. Ausgerechnet mir warf er vor, bedeutungslos zu sein und dennoch nach Höherem zu streben? Waren wir nicht deshalb hergekommen? Hatte er nicht auch wegen meiner Ambitionen versprochen, mich nach Troja und anschließend nach Ephesos mitzunehmen? Weil ich es satt hatte, im Schatten meiner älteren Schwester zu stehen, die so offensichtlich damit überfordert war, die Königinwürde zu tragen?
Stattdessen nutzte er die erste sich bietende Gelegenheit und verwies mich in meine Schranken. Er zeigte mir, wie wenig ich wusste, und gab mir das Gefühl, ein Spielball zu sein in den Ränkespielen der Götter.
Der Hund legte die Schnauze auf meine Hand und blickte zu mir hoch. Ich kraulte seine Ohren. Mein Vater runzelte die Stirn. »Komm her«, sagte er leise.
Der Hund blieb bei mir. Ich stand auf, und sofort drängte er sich neben mich. Ares machte einen Schritt auf uns zu. Der Hund knurrte ihn an. Wir sahen beide überrascht auf das Tier, das Ares stets treu zur Seite gestanden hatte – bis auf jene Zeit, als er wie ein Schatten nicht von der Seite meiner Mutter wich.
»Das darf nicht wahr sein«, murmelte mein Vater. »Er gehört nicht dir.«
»Ich weiß«, sagte ich. »Er ist sein eigener Herr. Aber ich denke, er hat gerade eine Entscheidung getroffen.«
Die meinem Vater missfiel. Ich wusste nicht, was genau ihn daran störte, wenn sein Hund mich als neue Herrin auswählte. Hatte sich denn etwas geändert? Oder änderte sich dadurch etwas?
Ich schob den Hundekopf sanft von mir weg. Sein Blick aus den dunklen Augen war so treu und hingebungsvoll, dass ich es nicht über mich brachte, ihn zurückzulassen. Als wir den Garten verließen, blieb er an meiner Seite. Ares ging hinter uns. Er murmelte etwas, das ich nicht verstand, und als ich vor den Frauengemächern stehen blieb und ihm seinen Mantel zurückgab, machte er einen letzten Versuch, den Höllenhund zu sich zu locken.
Vergebens.
»Dann besitzt du wohl nun einen Hund«, sagte er. Ein Wangenmuskel zuckte.
»Kann ich ihm befehlen, bei dir zu bleiben?«
»Das kannst du, aber er wird bei nächster Gelegenheit versuchen, wieder zu dir zu gelangen. Nein, nein. Dieser Hund gehört nun dir.«
»Er wird irgendwann zu dir zurückkehren«, vermutete ich.
»Das wird er.« Mehr nicht. Mein Vater wandte sich ab und ging. Ich blickte ihm nach. Dann betrat ich das Gästequartier und wies dem Hund einen Platz am Fußende meines Betts zu. Still legte er sich hin, den Kopf auf den Pfoten. Er ließ mich nicht aus den Augen, während ich hin und her lief, meinen Schmuck ablegte, den Chiton gegen eine Tunika und eine dünne Hose tauschte, weil sie mir bequemer waren, wie ich meine Haare ausbürstete und mich schließlich ins Bett legte. Erst da stand er auf und sprang auf die Bettstatt.
Ich musste lachen. Wie sollte ich gegen einen Hund, der mir bis zur Hüfte reichte und genauso schwer war wie ich, irgendwie ankommen? »Aber wehe du schnarchst«, warnte ich ihn und zog die Bettdecke hoch.
Einschlafen konnte ich noch lange nicht, doch es tat mir gut, nicht allein zu sein. Seit wir Themiskyra verlassen hatten, war in mir ein Sirren wie von einer gespannten Bogensehne. Das hielt man nicht lange aus, es kostete Kraft, viel besser war es, den Pfeil abzuschießen statt so viel länger die Spannung aufrechtzuerhalten. Aber der Tod meiner Mutter hatte Spuren hinterlassen. Zu frisch die Erinnerung daran, wie sie ihrem Pferd den Gnadenstoß versetzte. Wie sie tagelang neben dem Kadaver wachte, während sie selbst dahinsiechte, dem Tode geweiht nach einer Oberschenkelverletzung. Niemand hatte sie retten können. Auch Ares nicht.
Das hatte ich akzeptiert. Aber was ich niemals hinnehmen würde, war seine Gleichgültigkeit nach ihrem Tod. Er war unsterblich, das hatte ich kapiert. Deshalb musste er nicht gleich so tun, als hätte Otrere ihm nie etwas bedeutet.
Trotzdem war ich hier bei ihm und nicht bei Hippolyte in Themiskyra. Es war eine bewusste Entscheidung, denn ich wollte nicht zu denen gehören, die meiner Schwester zujubelten. Sie war wütend auf Ares’ Untätigkeit, sie gab ihm die Schuld am Tod unserer Mutter. Er hätte das alles verhindern können, dachte sie. Und er hatte nichts getan, hatte es nicht mal versucht. Als wäre das kurze Leben einer Sterblichen es nicht wert, gerettet zu werden.
Ich sah das anders. Für unseren Vater waren wir tatsächlich wie Blütenstaub im Wind, verweht vom Fortgang der Zeit. Machte es für ihn denn einen Unterschied, ob meine Mutter und er zwanzig oder vierzig Jahre zusammen waren? Ein Wimpernschlag oder zwei? Ich war davon überzeugt, denn sonst hätte er mich nicht mitgenommen. Wir bedeuteten ihm etwas. Unsere Mutter, meine Schwestern und ich – er hatte uns nicht im Stich gelassen nach ihrem Tod. Auch wenn Hippolyte das glaubte.
Der Hund lag ruhig neben mir. Als ich mich aufsetzte, hob er den Kopf. Sein Blick war so klug und wissend. Vertrauensvoll legte er die Schnauze auf meine Hand, die ich ihm hinhielt. »Vermisst du sie auch so sehr wie ich?«, flüsterte ich in der Dunkelheit. Er brummte. Ich legte mich wieder hin, diesmal etwas näher bei ihm. Der Leib des Wolfshunds wärmte mich in dieser Nacht und in vielen, die noch folgen sollten.
4
Einen halben Mondlauf blieben wir in Troja. Ich lernte nach und nach all die Geschwister von Hektor und Kassandra kennen, und ich verstand mich gut mit ihnen. Wir maßen uns im Kampf, wir feierten rauschende Feste und ich genoss das Leben am Hof. Ich war für dieses Leben gemacht, und auch wenn ich meine Herkunft als Skythin nicht verleugnen konnte und immer Kämpferin bleiben würde, mochte ich, wie Troja auch die andere Seite von mir hervorlockte.
Der schwarze Hund war mein Schatten, und Ares hielt sich im Hintergrund. Manchmal war er tagelang nicht da, und ich war die Einzige, die ihn vermisste. Wenn ich fragte, ob jemand von seinem Verbleib wüsste, erntete ich nur verständnisloses Kopfschütteln. Als wäre mit ihm auch die Erinnerung daran verschwunden, wie er mit uns feierte.
Mit dem nächsten Neumond verabschiedete ich mich schweren Herzens von Andromache und Hektor, von seinen Eltern und den jüngeren Geschwistern. Sowohl Kassandra als auch Paris und Helena hatten sich während meines Besuchs von mir ferngehalten. Ich versuchte nicht, darin eine Herabwürdigung meiner selbst zu sehen. Ich mochte sie nicht, sie mochten mich nicht. Das war alles.
»Du hast in Troja Freundschaften geschlossen«, stellte Ares fest. Er hatte sich nicht von Priamos und seiner Familie verabschiedet, sondern stieß erst vor den Toren der Stadt zu unserer Reisegruppe. Mein Blick glitt über die Ebene bis zum Meer im Nordwesten. Schwer vorstellbar, dass irgendwann die Achaier hier ihr Lager aufschlagen würden. Doch alle Zeichen sprachen dafür.
»Hektor und Andromache waren gute Gastgeber und sehr freundlich zu mir. König Priamos erwies mir die Ehre, an seiner Seite zu sitzen, und meine Kriegerinnen fühlten sich sehr wohl in Troja.«
Mein Vater nickte stumm. Ich kannte ihn immerhin so gut, dass ich wusste, wenn er etwas zurückhielt. Es brachte nichts, ihn zu bedrängen. Seine Lippen blieben versiegelt.
»Ich bin froh, wenn wir Ephesos erreichen«, sagte er. »Die Zeit dort wird uns guttun.«
Ich nickte widerstrebend. In Ephesos war ich die ersten zwei Lebensjahre aufgewachsen, doch ich hatte keine Erinnerung an den Palast und das Leben dort. Alles, was ich darüber wusste, stammte aus den Erzählungen meine Mutter. Und Otrere hatte nie viel darüber gesprochen. Es gab einen Tempel zu Ehren der achaischen Göttin Artemis, dessen Bau sie einst angestoßen hatte, als sie von der Schwangerschaft mit mir erfuhr. Schon einmal hatte sie fast ein Baby kurz nach der Geburt verloren und ihr Leben mit dazu. Ich sollte Artemis wohl dankbar sein, dass es mich gab.
Außerdem hatte Ares in Ephesos seinen Palast errichten lassen. Ich war neugierig. Wie lebte ein Gott unter Menschen? War es dort ähnlich luxuriös wie in Troja? Der Palast, den meine Mutter in Themiskyra hatte errichten lassen, wirkte auf mich nach unserer Zeit in Troja geradezu ärmlich und schmucklos. Ich hatte ja keine Ahnung, wie viel prächtiger andere Könige lebten. Ich fragte mich, ob Ares mich auch deshalb nach Troja gebracht hatte. Oder welcher Grund sonst dahintersteckte. Denn so viel wusste ich: Mein Vater tat nichts ohne Grund. Selbst ein Palast hatte eine tiefere Bedeutung. Der Ort, an dem er lebte, war ebenfalls ein Zeichen. Wie deuteten die Epheser die Gegenwart des Kriegsgotts in ihrer Stadt? Hatte Ares für sie eine Bedeutung? Verehrten sie ihn? Und wenn es so war, warum verehrten sie ausgerechnet den Gott, der über so viele Völker bereits das tödliche Verderben eines Kriegs gebracht hatte?
Viele Fragen und viel Zeit, darüber nachzudenken, während wir weiter Richtung Süden ritten. Wenige Tage später erreichten wir Ephesos. Es war schon später Abend, als wir die Stadttore erreichten. Anders als in Troja wurden wir sofort erkannt und man ließ uns nicht nur passieren, ein halbes Dutzend Männer schloss sich uns mit brennenden Fackeln an und wies uns den Weg zum Palast. Im Innenhof des Palasts strömten Sklavinnen und Sklaven aus den Türen, sie hielten unsere Pferde, begrüßten uns wie alte Freunde und führten uns hinein, als hätten sie schon lange auf unsere Ankunft gewartet. Ich wunderte mich, denn ich wüsste nicht, dass Ares einen Boten vorgeschickt hatte, der unser Eintreffen ankündigte. Doch zugleich war ich froh, dass wir diesmal nicht warten mussten, bis wir in unsere Gemächer gebracht wurden. Drei Sklavinnen blieben bei mir, und die Älteste von ihnen fragte mich, ob ich ein Bad wünschte und ob ich Hunger hatte.
»Kümmert sich jemand um mein Pferd?«, fragte ich.
»Ja, Herrin.« Die Sklavin blickte nervös zum Hund, der stets an meiner Seite blieb. Ich gab ihm ein Zeichen mit der flachen Hand, und er legte sich sofort neben mich und jaulte nur leise aus Protest. Ares hatte recht. Er war mein Hund geworden. Nicht Hippolyte hatte er gewählt, sondern mich.
»Dann nehme ich gern ein Bad und anschließend ein Nachtmahl.«
»Wie Ihr wünscht, Herrin.«
Die anderen beiden Sklavinnen verschwanden. Die Älteste half mir beim Ablegen des Lederpanzers.
»Ihr wart lange nicht hier, Herrin.«
»Du kennst mich?« Ich sah sie überrascht an. Sie lachte.
»Aber natürlich, Herrin! Einst habe ich mich um Euch gekümmert, als Eure Mutter Euch in Ephesos zurücklassen musste. Sie hat Euch mir anvertraut.«
»Davon wusste ich nichts. Erzähl mir mehr darüber.« Meine Neugier war geweckt. Doch die Sklavin senkte hastig den Blick und sagte leise: »Es war doch nur meine Pflicht.«
Ich verstummte. Schweigend führte sie mich in die angrenzende Badekammer, in der bereits eine Wanne mit warmem Wasser gefüllt wurde. Ich schlüpfte aus Tunika und Hose und ließ mich in das Wasser gleiten. Erst jetzt merkte ich, wie verkrampft meine Muskeln waren. Ich freute mich schon darauf, in den kommenden Tagen nicht länger in skythischer Reiterinnenkleidung im Sattel sitzen zu müssen, sondern in schönen Kleidern den ganzen Tag nichts zu tun außer essen, schöner Musik lauschen und herumliegen.
Was sollte das Gerede darüber, die skythischen Frauen seien dazu geboren, als Kriegerinnen ihr Land zu verteidigen? Früher hatten wir die Wahl gehabt, ob wir lieber kämpfen oder daheim bleiben wollten. Mich hatte niemand gefragt. Die Schwester der Königin und Nichte der Anführerin der Amazonen musste doch reiten und Bogenschießen wollen, dachte jeder.
Fast ein bisschen wehmütig dachte ich an die Zeit in Troja zurück. Dort hatte ich mich mit Hektor und seinen Brüdern ebenfalls im Kampf gemessen, doch es war stets auf eine spielerische Art geschehen, und niemand hatte sich mir gegenüber erstaunt gezeigt, wenn ich erklärte, ich habe genug davon.
Das Badewasser war mit duftenden Ölen und Blütenblättern versetzt. Ich lehnte mich zurück und schloss die Augen. Die Sklavin wusch mich, während ich einfach still dalag und meinen Gedanken nachhing. Das sorglose Leben einer Prinzessin, wie ich es führen durfte, das es mir erlaubte, keine Verantwortung zu übernehmen. Ich genoss das. Jetzt war ich froh darüber, mich nicht mit den Überlegungen herumschlagen zu müssen, die täglich an Hippolyte herangetragen wurden. Sie musste über eine Stadt herrschen, ein Volk regieren. Ich durfte in einem Palast leben und mich jeden Tag aufs Neue den Dingen widmen, auf die ich Lust hatte, nicht denen, die durch meine Verantwortung von mir verlangt wurden.
Nach dem Bad wurde ich in einen warmen Chiton mit passenden Himation gehüllt. In meinem Gemach stand schon ein Nachtmahl bereit, das ich verspeiste. Ich genoss die Einsamkeit, die Stille. Erst jetzt merkte ich, wie sehr mich die Tage unterwegs erschöpft hatten. Der Hund lag neben meinen Füßen, und ich fütterte ihn mit ein paar Bissen Fleisch. Nach der Mahlzeit fühlte ich mich satt und müde. Ich legte mich auf die Bettstatt, der Hund sprang zu mir und ich schloss die Augen.
Im nächsten Moment war ich eingeschlafen.
Ephesos konnte es mit seinen großen Tempeln und dem weitläufigen Palast mit Troja aufnehmen, stellte ich am nächsten Morgen bei Tageslicht fest. Ares holte mich ab und zeigte mir die Stadt. Höhepunkt des Spaziergangs war der Tempel der Artemis, der auf dem Hügel vor den Toren der Stadt errichtet wurde. Die Bauarbeiten waren längst nicht abgeschlossen. Trotzdem beeindruckte mich die Größe des Tempels, dessen Bau einst meine Mutter veranlasst hatte.
Während wir zwischen den Säulen herumgingen, wenig beachtet von den anderen Tempelbesuchern und den Bauarbeitern, erzählte mein Vater mir die Geschichte des Tempels. Ich kannte sie bereits aus Erzählungen meiner Mutter Otrere, doch es war etwas ganz anderes, selbst zwischen den hohen Säulen zu stehen und zu begreifen, dass meine Mutter einst alles getan hatte, um Artemis zu besänftigen.
Sie hatte nach Hippolytes Geburt einst fast meine Schwester und ihr eigenes Leben verloren. Als sie zwei Jahre später nach Ephesos kam und mit Ares hier lebte, erkannte sie bald, dass sie mit mir schwanger war. Sie fürchtete, dass mich dasselbe Schicksal erwartete wie Hippolyte, ja, sie fürchtete auch um ihr eigenes Leben. Um Artemis zu besänftigen, gab sie den Bau des Tempels in Auftrag. Ich wurde geboren und war gesund, wie es ein Säugling nur sein konnte, kräftig und vor allem laut. Mit mir wurden in jener Zeit viele andere Kinder geboren, Artemis’ Gegenwart war spürbar in Ephesos, und die Epheser waren der Göttin dankbar, sie bauten an ihrem Tempel weiter und brachten ihr viele Opfer dar.
Auch heute beobachtete ich einige Frauen, die in Begleitung ihrer Männer in den Tempel kamen und der Göttin ein Opfer brachten. Kleine Sträuße getrocknete Blumen und kleine Krüge mit Öl, die sie auf den Steinstufen kaputtwarfen. Das gelegentliche Scheppern stieg über dem Tempelberg in den Himmel auf.
»Hört sie die Menschen immer noch wie damals?«, fragte ich.
»Frag sie doch selbst.«
Mein Vater drehte sich um. Ich folgte seinem Blick. Eine überirdisch schöne Frau mit dunklen, langen Haaren und einem silbernen Chiton, der ihren Körper mehr offenbarte als verhüllte, kam mit wiegenden Hüften die Stufen herauf. Als sie zwei Stufen unter uns stehen blieb, umspielte ein beinahe zärtliches Lächeln ihre dunklen, vollen Lippen. »Wenn das nicht die kleine Penthesilea ist, deren Lebenswillen einst den Ephesern einen so großen Kindersegen beschert hat.« Sie streckte die Hände nach mir aus. Ihre Finger umschlossen meine. Ich wunderte mich, wie kühl, beinahe eisig ihre Hände sich anfühlten und wollte schon zurückzucken. Doch sie hielt mich fest. Nicht nur mit den Händen, auch mit dem Blick aus ihren silbrigen, hellen Augen. »Willkommen daheim, Penthesilea. Ich habe dich schon erwartet.«
Ich senkte den Kopf. »Göttin Artemis.« Ich war seltsam befangen und konnte nicht sagen, weshalb. Artemis war eine Halbschwester meines Vaters, eine der vielen Tanten und Onkel, die sich auf dem Olymp tummelten. Trotzdem oder gerade deswegen fühlte ich mich nicht wohl in meiner Haut. Ich wurde mir meiner eigenen Unzulänglichkeiten bewusst. Niemals würde ich es mit einer Göttin aufnehmen können.
Artemis lachte leise. »Sie ist schlimmer als Otrere«, stellte sie fest. »Und das schon in so jungen Jahren.«
Mein Vater grinste. »Kannst du es ihr verübeln?«
»Nein, wirklich nicht. Aber ich finde es interessant.«
Verwirrt hob ich den Kopf. Wovon redeten die beiden? Ich war nur eine junge Frau, die ihren Platz in der Welt noch suchen musste. Hatte ich sie irgendwie beleidigt? War meine Ehrerbietung zu unterwürfig?
»Du wirst feststellen, dass Hippolyte ganz anders ist.«
Ich runzelte die Stirn. Merkten die beiden nicht, dass ich neben ihnen stand? Oder war es ihnen egal? Sterbliche, meine Güte, die sollten sich mal nicht so anstellen, wenn man sich dazu herabließ, über sie zu reden.
Artemis und Ares sahen einander stumm an. Dann nickte Artemis. Sie wandte sich von uns ab und stieg die Stufen zum Altar hoch. Ares wandte sich zum Gehen, während ich stehen blieb und der Göttin nachblickte.
»Was war das?«, wollte ich wissen.
»Das war nichts.«
»Ihr habt euch unterhalten. Über mich.«
Er blieb stehen und blickte zu mir. Ich wandte mich von ihm ab und sah Artemis hinterher, die in diesem Moment zwischen den Säulen verschwand. Vielleicht täuschte ich mich, doch es sah so aus, als löste sie sich in Luft auf, und das letzte, was von ihr blieb, war ein Hauch des silbrigen Stoffs in der Luft, der sich in Rauch von einer der Kohlepfannen neben dem Altar auflöste. Eine junge Frau, die gerade ein Sträußchen Kräuter in das Becken warf, erzitterte, als wäre sie von der Göttin berührt worden. Vielleicht hatte Artemis das getan, und die Gebete dieser Frau wurden endlich erhört.
»Es gibt Dinge zwischen den Sternen und den Sterblichen, die selbst für uns Götter zu groß sind«, sagte mein Vater leise. »Und nun komm, Penthesilea. Du hast genug gesehen.«
Wieso wurde ich dann das Gefühl nicht los, dass nicht ich genug gesehen hatte, sondern dass ich zu Artemis gebracht worden war, damit sie mich in Augenschein nahm und ein Urteil über mich fällte? Ich folgte meinem Vater, doch meine Hochstimmung war verflogen. Für den Rest des Tages zog ich mich in den Palast zurück, ich ließ mir von den Sklavinnen die Kleider zeigen, die für mich in Truhen verwahrt wurden. Als hätten sie mich schon lange erwartet, denn all der Schmuck, die Sandalen, die Chitons und Himations – die konnte man nicht in kurzer Zeit zusammensuchen, sobald man von der Ankunft einer Prinzessin erfuhr.
In mir keimte ein Verdacht. Ich versuchte mich zu erinnern, wie das vor zwei Monden gewesen war, als ich zu meinem Vater ging und ihn bat, mich nach Ephesos mitzunehmen. War die Bitte von mir gekommen? In meiner Erinnerung hatte er hoch erfreut reagiert, als ich ihm erklärte, ich halte es keinen Tag länger in Themiskyra aus, es sei mir ein Graus, meiner Schwester dabei zuzusehen, wie sie Königin spielte, während sie Antiope und mich ignorierte.
Er hatte mich nachdenklich angesehen und dann gesagt: »Überleg dir, ob du nach Ephesos willst.« Mehr nicht. Und ich war im ersten Moment verwirrt gewesen, weil ich dachte, nichts zöge mich nach Ephesos. Je länger ich aber darüber nachdachte, umso mehr gefiel mir der Gedanke. Weit weg von Hippolyte könnte ich zur Ruhe kommen. Dachte ich.
Antiope wollte nichts davon hören. »Ephesos ist alt und stinkt«, erklärte sie trotzig, als ich ihr von meinen Plänen erzählte. »Da gehe ich niemals mit.«
»Ich will dich auch gar nicht dabei haben«, erwiderte ich kühl. Es war einer von vielen Streits, wie wir sie zu dem Zeitpunkt führten. Sie fühlte sich von Hippolyte ebenfalls alleingelassen, und nun ließ ich sie auch noch im Stich. Zugleich war sie überzeugt davon, irgendwann werde ein Prinz aus einem fernen Reich kommen und sie »retten«.
Ich wollte nicht gerettet werden. Ich wollte meine Ruhe haben. Ephesos schien dafür der richtige Ort zu sein. Weit weg von Hippolyte. Ich wusste, wie wütend es sie machen musste, weil ich unseren Vater begleitete und weiterhin zu ihm hielt – obwohl er in ihren Augen am Tod unserer Mutter eine gewisse Mitschuld trug.
Als ich zu meinem Vater ging und ihm erklärte, ich wolle mit ihm nach Ephesos kommen, geschah dies nicht, weil ich selbst auf die Idee gekommen war. Er hatte sie mir eingepflanzt. Diese Erkenntnis schmerzte, denn das hieß, dass ich nicht selbst entschied. Dass ich mich von ihm oder von meiner Schwester oder wer auch immer gerade die richtigen Worte fand, beeinflussen ließ.
Ich beschloss, dass dies zum letzten Mal passierte. Dass ich mich nicht länger auf die Ratschläge anderer verlassen würde, sondern nur auf das, was ich für richtig hielt.
5
Und dann kam alles anders.