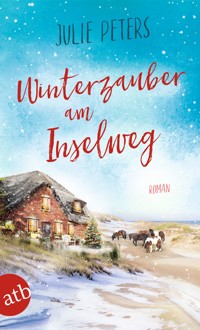14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die ersten beiden Bände der Puppen-Saga erstmals in einem E-Book Bundle! Käthe Kruse und die Träume der Kinder Ein Leben für die Kinder und die eigene Unabhängigkeit Berlin, 1902: Die junge Käthe verliebt sich in den Bildhauer Max Kruse. Als sie schwanger wird, gerät sie in Konflikt mit den Moralvorstellungen der Berliner Gesellschaft und zieht in die Schweiz. Auf dem Monte Verità findet sie inmitten von Künstlern die Freiheit, nach der sie sich sehnte. Als ihre Tochter sich eine Puppe wünscht, macht Käthe sich an die Arbeit. Weich und anschmiegsam soll sie sein, geeignet zum Spielen. Die Puppe wird ein voller Erfolg. Soll Käthe alles auf eine Karte setzen und sich etwas aufbauen – und was bedeutet das für ihre Liebe zu Max? Käthe Kruse und das Glück der Kinder Käthe Kruse – Künstlerin, Liebende, Unternehmerin 1911: Käthe hat sich mit ihren handgefertigten Puppen einen Namen gemacht und lebt mit dem Bildhauer Max Kruse in Berlin. Um die zahlreichen Bestellungen bearbeiten zu können, gründet sie ihre eigene Manufaktur, und wenn es nach ihr ginge, könnten nun goldene Zeiten auf sie warten. Doch plötzlich gibt es auf dem Markt Nachahmungen ihrer Puppen, und alles, was Käthe sich mühsam aufgebaut hat, droht zu zerbrechen. Soll sie den Kampf aufnehmen, auch wenn er für eine Frau in einer Welt von Geschäftsmännern aussichtslos scheint? Die packende Geschichte von Käthe Kruse, einer facettenreichen Frau, die die Bedürfnisse von Kindern verstand und als berühmteste Puppenmacherin der Welt Geschichte schrieb
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 889
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Käthe Kruse und die Träume der Kinder
Ein Leben für die Kinder und die eigene Unabhängigkeit
Berlin, 1902: Die junge Käthe verliebt sich in den Bildhauer Max Kruse. Als sie schwanger wird, gerät sie in Konflikt mit den Moralvorstellungen der Berliner Gesellschaft und zieht in die Schweiz. Auf dem Monte Verità findet sie inmitten von Künstlern die Freiheit, nach der sie sich sehnte. Als ihre Tochter sich eine Puppe wünscht, macht Käthe sich an die Arbeit. Weich und anschmiegsam soll sie sein, geeignet zum Spielen. Die Puppe wird ein voller Erfolg. Soll Käthe alles auf eine Karte setzen und sich etwas aufbauen – und was bedeutet das für ihre Liebe zu Max?
Käthe Kruse und das Glück der Kinder
Käthe Kruse – Künstlerin, Liebende, Unternehmerin
1911: Käthe hat sich mit ihren handgefertigten Puppen einen Namen gemacht und lebt mit dem Bildhauer Max Kruse in Berlin. Um die zahlreichen Bestellungen bearbeiten zu können, gründet sie ihre eigene Manufaktur, und wenn es nach ihr ginge, könnten nun goldene Zeiten auf sie warten. Doch plötzlich gibt es auf dem Markt Nachahmungen ihrer Puppen, und alles, was Käthe sich mühsam aufgebaut hat, droht zu zerbrechen. Soll sie den Kampf aufnehmen, auch wenn er für eine Frau in einer Welt von Geschäftsmännern aussichtslos scheint?
Die packende Geschichte von Käthe Kruse, einer facettenreichen Frau, die die Bedürfnisse von Kindern verstand und als berühmteste Puppenmacherin der Welt Geschichte schrieb
Über Julie Peters
Julie Peters, geboren 1979, arbeitete als Buchhändlerin und studierte Geschichte, bevor sie sich ganz dem Schreiben widmete. Sie lebt mit ihrer Familie im Westfälischen.
Im Aufbau Taschenbuch sind bereits ihre Romane »Mein wunderbarer Buchladen am Inselweg«, »Mein zauberhafter Sommer im Inselbuchladen«, »Der kleine Weihnachtsbuchladen am Meer«, »Die Dorfärztin – Ein neuer Anfang«, »Die Dorfärztin – Wege der Veränderung«, »Ein Sommer im Alten Land«, »Ein Winter im Alten Land«, »Käthe Kruse und die Träume der Kinder«, »Käthe Kruse und das Glück der Kinder« und zuletzt »Ein neuer Sommer am Inselweg« erschienen.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Julie Peters
Käthe Kruse und die Träume der Kinder & Käthe Kruse und das Glück der Kinder
Die ersten beiden Bände der Puppen-Saga erstmals in einem E-Book Bundle!
Inhaltsverzeichnis
Informationen zum Buch
Informationen zur Autorin
Newsletter
Käthe Kruse und die Träume der Kinder
Teil 1 — Breslau
Kapitel 1 — Breslau, August 1883
Kapitel 2 — Dambrau, August 1883
Kapitel 3 — Breslau, September 1883
Kapitel 4 — Dambrau, September 1883
Kapitel 5 — Breslau, April 1889
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8 — Breslau, September 1898
Teil 2 — Berlin
Kapitel 1 — Breslau, Winter 1898/99
Kapitel 2 — Breslau, Herbst 1899
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5 — Berlin, November 1900
Kapitel 6 — Berlin, Herbst 1901
Kapitel 7
Kapitel 8 — Berlin, Januar 1902
Kapitel 9
Kapitel 10 — Berlin, September 1902
Kapitel 11
Kapitel 12 — Berlin, Dezember 1902
Teil 3 — Berg der Wahrheit
Kapitel 1 — Berlin, Sommer 1904
Kapitel 2 — Ascona, Juli 1904
Kapitel 3 — Monte Verità, November 1904
Kapitel 4 — Monte Verità, November 1904
Kapitel 5 — Monte Verità, Frühjahr 1905
Kapitel 6 — Sommer 1905, Ascona
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9 — Monte Verità, Februar 1906
Kapitel 10 — Monte Verità, Herbst 1907
Kapitel 11 — Monte Verità, April 1908
Kapitel 12 — Ascona, Sommer 1908
Teil 4 — Puppenkinder
Kapitel 1 — München, März 1909
Kapitel 2
Kapitel 3 — Hiddensee, September 1909
Kapitel 4 — Berlin, Herbst 1909
Kapitel 5 — Berlin, Sommer 1910
Kapitel 6
Kapitel 7 — Berlin, Frühjahr 1911
Kapitel 8 — Hiddensee, September 1911
Kapitel 9
Kapitel 10 — Berlin, September 1911
Kapitel 11 — Berlin, Oktober 1911
Käthe Kruse und das Glück der Kinder
Kapitel 1 — Berlin, November 1911
Kapitel 2
Kapitel 3 — Berlin, Dezember 1911
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6 — Gehlberg, Juni 1912
Kapitel 7 — Kösen, August 1912
Kapitel 8 — Kösen, Oktober 1912
Kapitel 9 — Kösen, Dezember 1912
Kapitel 10
Kapitel 11 — Kösen, Januar 1913
Kapitel 12 — Berlin, April 1914
Kapitel 13 — Weimar, April 1914
Kapitel 14 — Rom, Mai 1914
Kapitel 15 — Kösen, Dezember 1914
Kapitel 16 — Potsdam, Mai 1915
Kapitel 17 — Kösen, August 1915
Kapitel 18 — Potsdam, April 1918
Kapitel 19 — Kösen, August 1918
Kapitel 20 — Kösen, Januar 1919
Kapitel 21 — Berlin, Februar 1921
Kapitel 22
Kapitel 23 — Holland, Oktober 1923
Kapitel 24 — Kösen, November 1923
Kapitel 25 — Kösen, Dezember 1924
Kapitel 26 — Kösen, Juni 1925
Kapitel 27 — Leipzig, Juli 1925
Kapitel 28 — Bozen, Juli 1925
Kapitel 29 — Kösen, August 1925
Kapitel 30 — Berlin, September 1927
Kapitel 31 — Berlin, Oktober 1925
Kapitel 32 — Kösen, Januar 1928
Kapitel 33 — Berlin, August 1928
Kapitel 34 — Hiddensee, September 1928
Impressum
Orientierungsmarken
Hauptteil
Copyright-Seite
Inhaltsverzeichnis
Julie Peters
Käthe Kruse und die Träume der Kinder
Roman
Teil 1
Breslau
1
Breslau, August 1883
Der Korb mit der Wäsche hing schwer an ihrem Arm. Noch schwerer aber fühlte sich der Bauch an, seit Tagen schon hatte sie das Gefühl, einen Felsbrocken verschluckt zu haben, der sie hinunterzog. Christiane Simon blieb auf halbem Weg die Straße runter stehen, sie stellte den Korb ab und stemmte beide Hände ins Kreuz. Vorsichtig nur streckte sie sich und drückte den dicken Bauch nach vorn. Nicht ohne vorher die Straße rauf und runter zu schauen, ob sie auch niemand bemerkte.
Sie redete sich ein, bisher habe niemand ihren Zustand bemerkt, der so blitzartig über sie gekommen war. Wir haben doch aufgepasst, wieso passiert dir trotzdem was? Roberts Worte, anklagend und verbittert, als sie im März endlich den Mut gefunden hatte, ihm den Grund für ihr wochenlanges Unwohlsein zu beichten. Nach fünf Jahren, in denen er sich zu ihr schlich, wann immer sein Beruf und das Familienleben mit Frau und zwei wohlgeratenen Söhnen es ihm erlaubten, war es nun doch passiert.
Beide waren zu fromm aufgewachsen, um das in Erwägung zu ziehen, was manch andere junge Näherin oder Weißwaschfrau machen ließ, wenn sie dieses Schicksal ereilte. »Wegmachen lassen wir’s aber nicht.« Seine Worte. Sie hatte aufgeatmet. Hatte sie doch in Gedanken schon versucht, sich daran zu gewöhnen, dass es bald vorbei sei, wenn sie zur Engelmacherin ging. Der Gedanke war zu ungeheuerlich, es ging einfach nicht. Sie wollte dieses Baby nicht abtreiben.
»Aber merken darf’s auch keiner, was da bei dir los ist.«
Danach hatte er sie ein paar Wochen lang nicht besucht, und als er wiederkam, hatte er einen Plan, einen ungefähren zumindest. »Du musst aus der Stadt, wenn’s so weit ist. Ich suche was, da kannst du es zur Welt bringen.« Es. Nie sprach er vom Kind oder ließ sonst irgendwie erkennen, dass da schon bald ein Menschlein in der Welt sein würde, sein drittes Kind, ihr erstes. Etwas, das sie mehr verband als zuvor, dachte Christiane zumindest. Manchmal wirkte er so fern, dann wieder so streng, so zärtlich. Ein ständiges Wechselbad war es mit Robert, doch sie konnte nicht von ihm lassen.
Still hegte sie die Hoffnung, er würde sich mit dem Kind mehr ihr zuwenden. Dass er seine Familie für sie verließ, die Hoffnung hatte sie längst begraben, das würde niemals geschehen. Hatte er ihr auch von Beginn an so gesagt. »Was soll ich denn meine Familie verlassen, wie stellst du dir das vor? Meiner Frau kann ich das nicht antun, sie liebt mich doch.«
Aber ich liebe dich auch, hätte sie gern eingewandt. Spürte zugleich, dass ihre Gefühle nicht zählten. Genauso wenig würde wohl ihr Kind einen Unterschied machen. Dennoch hielt sie sich daran fest, denn an irgendwas musste sie sich an den stillen, dunklen Abenden festhalten, wenn sie mit schmerzendem Rücken und brennenden Augen beim schwachen Funzellicht über die Nähmaschine gebeugt saß.
Heute war also ihr letzter Tag in Breslau. Es war Ende August, kühl und fast schon herbstlich. Erstes Laub wehte über die Straße in den Rinnstein. Fröstelnd zog sie das wollene Tuch enger um die Schultern, nahm den Korb wieder hoch und ging mühsam weiter.
Als Näherin wurde sie am Dienstboteneingang empfangen. Das konnte ihr nur recht sein.
»Ah, Frau Simon.« Die Haushälterin Anna Schlösser begrüßte sie. »Haben Sie alles dabei?«
Christiane hob den Korb hoch, reichte ihn weiter. Frau Schlösser öffnete die Deckel, zog bestickte und gesäumte Tischtücher heraus, sorgfältig geplättet und gefaltet. Darunter noch Handtücher, zwei Dutzend Taschentücher. Ein großer Auftrag war es diesmal gewesen.
»Das sieht fein aus, danke. Warten Sie, ich hole das Geld.«
Sie klang beinahe freundlich, wo sie sonst für Christiane allenfalls abfällige Bemerkungen übrighatte. Die Dienstmädchen, die in diesem Haushalt in Stellung waren, ließen selten ein gutes Haar an ihr, umgekehrt war’s ähnlich, und auch die Frauen, die an die Hintertür kamen und ihre Dienste als Näherinnen und Wäscherinnen anboten, mussten mit Frau Schlössers harschen Worten klarkommen.
Unauffällig glitt ihr Blick über Christianes Körpermitte. Sie bemerkte es trotzdem, weil sie so sehr darauf bedacht war, ihren Zustand zu verbergen. Christianes Wangen wurden heiß. Sie war froh um das schwarze Alltagskleid, es kaschierte. Trotzdem war für den geübten Blick kaum übersehbar, in welchen Umständen sie war.
»Hier.« Frau Schlösser legte ein paar Münzen in ihre Handfläche.
»Ich bin nun eine Weile nicht in der Stadt«, sagte Christiane leise.
»Ach ja. Denk’s mir.« Frau Schlösser runzelte die Stirn, als müsste sie angestrengt überlegen. »Da habe ich noch was für Sie.« Sie kehrte mit einem Bündel zurück, das sie der verdutzten Christiane nun hinhielt. »Das hier hatten wir noch übrig. Man könnte vielleicht ein paar Mullwindeln daraus zuschneiden. Sie wissen ja, wie das geht.«
Völlig überrumpelt von so viel Freundlichkeit, stotterte Christiane ein Dankeschön, doch da hatte Anna Schlösser ihr schon das Bündel aus alten Bettlaken in die Hand gedrückt und wieder ihren hochmütigen Gesichtsausdruck aufgesetzt, dass Christiane sich bloß nichts auf ihre Freundlichkeit einbildete.
»Wenn Sie zurück sind, kommen Sie vorbei. Wird sich schon etwas Arbeit finden. Und nun einen guten Tag auch, ich habe hier noch zu tun.«
Rums, knallte sie Christiane die Tür vor der Nase zu, als müsste sie sich selbst davor bewahren, zu viele nette Worte an die junge Frau zu verschenken, als könnte deren Elend auf sie abfärben. Christiane trug das Bündel zur Straße, sie fühlte die Müdigkeit bleischwer in den Knochen. Nicht nur ihre Umstände waren es, weshalb sie so düstere Gedanken hatte, auch die Ablehnung, die ihr von so vielen Frauen entgegenschlug, sobald sie ihren Zustand bemerkten. Dabei tat Christiane alles, um ihn zu verbergen. Als könnte sie damit die anderen vor den unguten Gefühlen bewahren. Aber in wenigen Wochen kam das Baby zur Welt, da ließ sich nichts mehr verbergen, spätestens wenn sie danach wieder auf Arbeitssuche ging. Sie konnte so ein Würmchen ja nicht einfach zu Hause allein lassen. Sie wusste wohl, dass andere Frauen das machten, wenn sie auf sich gestellt waren, weil der Mann weg war oder es nie einen gegeben hatte, der sich verantwortlich zeigte. Aber das brachte Christiane nicht übers Herz.
Es blieb wohl nur eine Möglichkeit, wie sie nach der Geburt ihrer Arbeit nachgehen konnte, ohne dass man sie wegen ihres Kinds schräg anschaute. Sie musste den Säugling weggeben. In Pflege oder in ein Waisenhaus, ihn auf den Stufen einer Kirche ablegen. Möglichkeiten gab’s schon. Aber konnte sie denn sicher sein, dass man sich kümmerte?
Für Robert war die Sache klar. Wenn es erst vorbei war, sollten sie zu ihrem alten Leben zurückkehren. Und das hieß: ohne das Kind.
Das schaffe ich nicht, dachte sie. Ihre Hand strich verstohlen über den Bauch. Du gehörst doch zu mir.
»Nun stell dich nicht so an.«
»Lass los!«, zischte Christiane. Sie zog ruckartig ihren Arm aus seiner Umklammerung. Robert schnaufte. Seit dem frühen Morgen hatten sie nun diskutiert, immer wieder dieselben Argumente ausgetauscht, bis die Kutsche vor dem Haus vorgefahren war, die Christiane, so sein Wunsch, aus der Stadt bringen sollte. Doch sie ließ sich nicht brav von ihm in die Kutsche setzen, sondern wollte weiter mit ihm streiten. Darum blieb sie davor stehen und verschränkte trotzig die Arme vor der Brust. Da hatte er sie grob angepackt und sie angebrüllt. Jetzt stand er vor ihr wie ein begossener Köter, die Arme hingen herunter. Bestimmt blieb der Aufruhr nicht unbemerkt, und Christiane wusste, genau das hatte er um jeden Preis zu verhindern versucht.
Robert schwitzte, bemerkte sie. Christiane legte den Kopf schief. Beinahe fasziniert beobachtete sie, wie er da vor ihr stand und nach Argumenten suchte, die sie dazu bewogen, sich in die Kutsche zu setzen. Nach Dambrau sollte es gehen – weit weg von Breslau und zu guten Leuten, das hatte er ihr versprochen. Dort sollte sich auch eine Hebamme befinden, die sich gegen Zahlung von ein paar Talern um Christiane kümmerte, sobald die Geburt einsetzte. Das Geld hatte Robert ihr zugesteckt, auch ein Glas Rote Bete hatte er ihr besorgt, dazu eine Wurst, die in ein Stück Papier gewickelt in Christianes Pappkoffer steckte.
Es fiel ihr schwer, etwas von ihm anzunehmen. So war das immer schon gewesen, deshalb hatte er ihr noch ein paar Dinge in einen Beutel gepackt, der bereits im Coupé lag. Dazu eine leichte, karierte Decke, damit sie im Fahrtwind nicht fror. Fürsorglich war er, vielleicht auch ein wenig verzweifelt, immerhin fand der Abschied vor ihrem Haus statt, und jetzt weigerte sie sich auf einmal einzusteigen, weil sie so vieles noch auf dem Herzen hatte. Doch statt auf sie zu hören, beugte Robert sich zu ihr runter, blickte noch einmal links und rechts die Straße entlang, dann küsste er sie verstohlen auf den Mund, dass sein Schnurrbart sie kitzelte. Christiane wich vor ihm zurück, da packte er ihr Handgelenk, dass sie leise aufschrie.
»Hab dich nicht so. Was geb ich mich überhaupt mit dir ab, wenn du dich so zierst?«
»Entschuldige.«
»Nun gut. Und jetzt sei brav, mein Tinchen, ja? Steig ein und fahr nach Dambrau, dort ist für alles gesorgt. Mach mir keine Schande, hörst du?«
Sie schluckte die Tränen hinunter, nickte tapfer. Auch wenn es – wieder einmal – nur darum ging, was für ihn das Beste war.
»Und wenn du zurück bist, kümmern wir uns darum, dass dein Kind einen guten Platz findet.«
Dein Kind. Nicht unser Kind.
Nun, wenigstens sprach er endlich mal vom Kind.
»Ich dachte …«
Er lachte, mit der Hand machte er eine wegwerfende Bewegung. »Überlass mir das Denken, Tinchen. So ist’s doch immer am besten gewesen, nicht?«
Stumm nickte sie.
»Und nun los. Der Kutscher wartet nicht ewig.« Er half ihr in die Kutsche, legte ihr in einem Anfall von Fürsorge noch die Decke über die Knie.
»Aber kommst du mich denn gar nicht besuchen in Dambrau? Wenn das Baby da ist?«, fragte sie bang, als die Kutsche schon anrollte.
»Wie stellst du dir das vor?« Er winkte zum Abschied. »Ich schau, ob ich einen Sonntag mal kommen kann!«
Seine Worte verhallten unter dem Rattern der Kutschräder, dem Klappern der beschlagenen Hufe auf dem Kopfsteinpflaster. Schon erreichten sie die nächste Straßenecke, der Kutscher tippte die beiden Braunen an, die auf der Hauptstraße in einen zügigen Trab fielen. Als könnte er sie gar nicht schnell genug aus der Stadt bringen, dass keiner ihre Schande sah.
2
Dambrau, August 1883
Das Zimmerchen war kaum mehr als ein Verschlag, in den sie vorwärts hinein- und rückwärts wieder hinausgehen konnte; ein Bett, daneben unter dem winzigen Sprossenfenster ein Stuhl, der wohl zugleich als Nachttisch dienen sollte. Keine Kommode. Als sie danach fragte, zuckte die Bäuerin mit den Schultern, zeigte unters Bett. »Da kannste den Koffer hintun«, meinte sie.
Christiane packte aus. Ein paar Dinge nur, ein Foto von Robert, das sie auf den Stuhl stellte; die Wurst duftete so herrlich würzig, aber ihr war nicht danach. Die Übelkeit, die sie all die neun Monate nie so ganz verlassen hatte, schwappte wieder hoch, suchend blickte sich Christiane nach einer Waschschüssel um. Die Bauersfrau stand mit verschränkten Armen vor der Brust in der Tür ihrer Kammer und beobachtete sie mit gerunzelter Stirn. Christiane presste die Hand vor den Mund.
»Da entlang.« Endlich trat die Bäuerin beiseite und wies auf die Waschküche, die nebendran lag. Christiane stürzte durch die Tür, draußen zur linken unter ihrem Fenster war der Misthaufen, auf den sie sich übergab. Keuchend blieb sie stehen, die Hände auf die Knie gestützt.
»Bring dir noch ’ne Waschschüssel.« Die Bäuerin zog ab. »Armes Ding«, hörte Christiane sie murmeln.
Sie wischte sich mit dem Ärmel über den Mund und richtete sich auf. Der Hof lag am Rand von Dambrau, ein gutes Stück einen Feldweg herunter. Außer dem Haupthaus mit Ställen gab es noch eine Scheune und eine baufällige Remise. Hinter dem Haus Obstwiese und Gemüsegarten. Zwei Kühe, ein paar Ziegen, ein Kaltblüter. Eine Muttersau mit Ferkeln, die bald schlachtreif waren und sich im Matsch suhlten. Keine erbärmliche Hofstelle wie die, auf der Christiane mit fünfzehn Geschwistern aufgewachsen war.
Sie kehrte in ihre Kammer zurück. Auf dem Boden stand nun eine Waschschüssel mit einem Wasserkrug darin. Sie räumte den Stuhl ab, stellte die Schüssel darauf. Handtuch gab es keins, sie zog eins aus ihrem Koffer unter dem Bett. Wusch sich Gesicht und Hände mit einem Stück Lavendelseife, auch ein Geschenk von Robert, er hatte sie mit in den Beutel gesteckt. Sie schloss verzückt die Augen, schnupperte an ihren Fingern. Redete sich ein, dass es eben seine Art war, ihr seine Gefühle zu zeigen, wenn ein Kuss auf der Straße ihm schon zu viel war. Dabei blieb in Breslau kaum etwas geheim, vermutlich wusste die halbe Stadt, dass der Stadthauptkassenbuchhalter Robert Rogaske mit der Näherin Simon aus der Gartenstraße was Außereheliches trieb. Trotzdem hatte er sie hergeschickt, in dieses Kaff hinter der oberschlesischen Grenze. Dass sie bloß nicht auf die Idee kam, ihn als Vater anzugeben, wenn sie es eintragen ließ, hatte er die letzten Tage vor ihrer Abreise bei jeder Gelegenheit betont. War häufiger zu ihr gekommen, als müsste er ihr dies nur oft genug einschärfen, dass sie es unterließ.
Weil Christiane nichts zu tun hatte und mit dieser Tatenlosigkeit nichts anzufangen wusste, schlich sie über den Hof. Sie beobachtete die Bäuerin, die ihre struppigen Hühner fütterte. Das weckte Erinnerungen an den Hof ihrer Eltern, auf dem sie mit den Geschwistern gelebt hatte, nachdem die Eltern tot waren. Bis ihre ältere Schwester Paula sie an die Hand nahm und sie gemeinsam in die große Stadt zogen.
»Willste nur rumstehen? Gibt hier genug zu tun.« Wenigstens klang die Bäuerin nicht unfreundlich. Christiane trat näher.
»Ich kann im Gemüsegarten aushelfen. Oder im Stall.«
Die Bäuerin schnaubte. »Was denn, mit den feinen Händen?«
»Die können schon zupacken.«
»Na dann.«
So kam es, dass Christiane den Rest des Tags damit beschäftigt war, im Garten zu ernten. Sie band Kräuter zu Sträußen, die im Haus unter die Dachsparren gehängt wurden, neben die letzten Würste und eine Speckseite. Sie zog Möhren aus der Erde, die in Kisten eingelagert wurden für den Winter. Pflückte Bohnen und half der Bäuerin, sie einzukochen. Ihre Hände waren beschäftigt, ihre Gedanken aber wie erstarrt von der Aussichtslosigkeit ihres Lebens. Stundenlang wühlte sie in der Erde, machte sich nützlich, was ihr sogar ein anerkennendes Wort von der Bäuerin eintrug – und zum Abendessen legte sie Christiane eine zweite Scheibe Brot aufs Brettchen, wortlos. Von der Wurst schnitt sie ihr dicke Scheiben ab, die kühle, süße Butter und ein Schälchen Pflaumenkompott rundeten die Mahlzeit ab.
Christiane stellte Teller, Kompott und einen Becher mit Wasser auf ein Tablett. Sie ging in ihr Zimmer, wusste ja, wo ihr Platz war. Nicht bei der Bauersfamilie.
Sie gehörte nirgends hin.
Das Baby trat ihr unter die Rippen.
»Ja, ja«, murrte Christiane. »Du auch nicht.«
Dann wieder strich Christiane über Wiesen und Felder, beobachtete den Bauern mit den Knechten, wie sie sich auf dem Acker abmühten, und trat in den kühlen Wald. Es war noch mal sommerlich warm geworden mit den ersten Septembertagen. Der Druck nach unten, vom Bauch ausgehend, war in den letzten Tagen ärger geworden, sie blieb manchmal stehen, lehnte sich an einen Baum und schnaufte, während leichte Wehen durch ihren Körper gingen. Angst ergriff sie, kam nun das Baby schon? Dann aber ebbte das Gefühl ab, sobald sie auf dem Heimweg war. Sie kehrte um, zurück in die Kühle des Walds. Dort wuchsen Pilze, darüber würde sich die Bäuerin am Abend wohl freuen, dachte sie.
Die Bäuerin lachte sie aus, als Christiane mit der Schürze voll Pilze aus dem Wald zurückkam. »Die sind allesamt nicht gut«, meinte sie, »davon kriegen wir alle nur Bauchweh und Schlimmeres. Wirf sie auf den Mist.«
Am Abend gab’s für alle ein Bier, der Bauer hatte seine Getreideernte besser verkaufen können als erhofft. Als Christiane erst ablehnen wollte, drängte die Bäuerin. »Was denn, trinkste nichts? Auch kein Schnaps?«
Da nahm Christiane doch einen Krug Bier, der ihren Durst aufs Feinste löschte. Und der Schnaps kam zu später Stunde auch auf den Tisch. Christiane, die nur an ihrem Pintchen nippte, wurde von den Bauersleuten aufgefordert, ordentlich zuzugreifen. Nach dem dritten stand sie auf. Ihr war schwindelig, das Herz wurde ihr schwer, weil sie wieder an Robert dachte. Kein Wort von ihm, seit er sie in die Kutsche gesetzt hatte. Als hätte er sie vergessen.
Und vergessen, vielleicht war das besser so. Das wollte sie auch.
Sie ging am nächsten Tag noch mal hinaus, in den Wald und zu den Pilzen, den ungenießbaren. Sammelte die Schürze voll damit, wusste daheim aber nicht, wie sie die zubereiten sollte, dass es fürs Vergessen reichte. Schließlich weichte sie die Pilze in der Waschschüssel ein, und abends, nachdem sie aus der Stube den Steinkrug mit Schnaps stibitzt hatte, goss sie das Wasser ab und mischte es mit dem Obstler.
Erdig und brennend. Sie trank so viel, bis sie aufstoßen musste, dann sank sie aufs Kissen, hielt den Krug auf ihrer Brust umklammert und spürte, wie sie ganz dösig wurde im Kopf, vom Alkohol und von den Pilzen.
Sie wachte davon auf, wie es in ihrer Kehle hochstieg. Christiane drehte den Kopf zur Seite und erbrach das Pilzwasserobstlergemisch auf den Boden. Zugleich hörte sie die Bäuerin vor der Tür ihren Namen rufen. Sie klopfte, doch Christiane fühlte sich zu schwach zum Antworten. Sie krümmte sich, ihre Hände umfingen den Bauch. Alles drehte sich, nie hatte sie sich so elend gefühlt wie in diesem Moment.
Danach war es dunkel, und das Nächste, was sie wahrnahm, war die Stimme der Bäuerin dicht an ihrem Ohr. »Bleib wach!«, kreischte die, und dann an jemand anderes gewandt: »Hol die Hebamme, sie kriegt das Kind oder wollt sich umbringen, so genau weiß ich das nicht.«
»Das Kind bleibt, wo’s ist«, lallte Christiane.
Danach wieder Dunkelheit. Wohltuend umschloss sie ihren Leib und ihren Geist. Endlich nicht mehr grübeln müssen, keine Sehnsucht mehr, nichts.
In der Nacht oder nur wenige Augenblicke später, so genau konnte sie das nicht sagen, war da die Stimme einer anderen Frau, jung klang sie, eher in Christianes Alter.
»Dem Kind hat’s nicht geschadet. Haltet sie warm, gebt ihr zu trinken. Sie soll sich ausruhen. Hat sich überanstrengt, armes Ding.«
Eine kühle Hand umfasste ihre Finger, die erste Berührung seit Ewigkeiten, die nicht von Robert kam. Christiane zuckte zurück. Die junge Stimme verfiel in leisen Singsang. »Schon gut, schon gut. Ich weiß. Du bist nicht allein.«
Wenn es nur so wäre. Aber die Einsamkeit war es, die Christiane trieb, die sie kaum ertrug. Dass sie auf sich gestellt war. Mit dem Baby unter ihrem Herzen hatte sie zum ersten Mal das Gefühl, sie müsste zwar weiter aushalten, dass Robert nie da war. Aber sie wäre wenigstens nicht länger allein. Seine Pläne sahen anders aus, auch das war ihr bewusst. Ging es nach ihm, sollte sie es nach der Geburt in Pflege geben, aus den Augen, aus dem Sinn, dass sie ihr Leben so weiterführen konnten wie bisher.
Was, wenn sie sich gegen seinen Willen auflehnte? Wenn sie das Kind behielt, wie auch immer das gehen sollte. Sie kam jetzt schon kaum über die Runden.
Am nächsten Morgen stand sie auf, der Kopf noch schwer vom Schnaps, das Herz noch schwerer davon, dass sie ihrem Leben lieber ein Ende hatte machen wollen, statt zu Robert nach Breslau zurückzukehren. Sie holte das Schreibzeug aus dem Koffer und saß auf der Bettkante, schrieb auf ihren Knien mit zitternder Hand.
Dass ich nicht mehr leben mag, ohne Dich und ohne das Kind, das sollte mir zu denken geben. Für wen soll ich mich denn entscheiden?
3
Breslau, September 1883
Robert war derweil in Breslau unterwegs und nutzte Christianes Abwesenheit, während der sie ihm nicht ständig am Rockzipfel hing und um seine Aufmerksamkeit bettelte. Er sorgte vor. Die Zukunft musste ihre Ordnung haben, bevor Christiane aus Dambrau zurückkam und mit ihrer romantischen Vorstellung alles zunichtemachte.
Lass es mich behalten, Liebster.
Das schrieb sie. Und wie sie versucht hatte, sich mit einem giftigen Pilzsud und Obstler ins Jenseits zu verabschieden. Sündhaft war das, ließ sich nicht mit seiner Auffassung von einem gottesfürchtigen Leben vereinbaren, aber sündhaft war sie ohnehin schon, weil sie mit ihm zusammen war. Glaubte sie allen Ernstes, er würde ein Kind bei ihr lassen, wenn sie sich um den Verstand soff und lieber ihr Leben beendete?
Nein. Er brauchte einen Platz, wo es bleiben konnte, sobald Christiane aus Dambrau zurückkam.
Als Beamter kannte er viele Leute, die ihm auch diskret Tipps geben konnten. In diesem Fall jedoch hatte er es vorgezogen, einen Blick in die Zeitung zu werfen, wo unter der Rubrik »Vermischtes« Anzeigen von Pflegefamilien standen, neben Haushaltsauflösungen und Lumpensammlern. Freundliches, helles Haus für Pflegekinder. Teichstraße 17. Das wäre sogar nicht allzu weit weg von der Gartenstraße, das müsste Christiane doch gefallen. Sie konnte es gelegentlich besuchen.
Robert strich über seinen Anzug, bevor er den finsteren Hausflur betrat und den Hausmeister, der gerade einen Riegel an der Tür anbrachte, nach der Familie fragte, die hier Pflegekinder aufnahm. Der Mann starrte ihn an, schob die Mütze in den Nacken und kaute auf der Schnurrbartspitze. »Dachgeschoss.«
Im Dachgeschoss gab es nur eine Tür. Robert klopfte und lauschte. Aus dem Innern drang kein Laut. Er wollte sich gerade abwenden, da ging die Tür auf. Eine junge Frau schaute durch den Spalt, die Haare blond und streng zurückgekämmt, der Mund ein zusammengepresster Strich.
»Wer sind Sie?«
»Guten Tag. Ich habe Ihre Anzeige in der Zeitung gelesen. Dass Sie als Pflegestelle für kleine Kinder dienen.«
Sofort hellte sich ihre Miene auf. »Ja, hereinspaziert, mein Herr. Kommen Sie, kommen Sie. Grad schlafen die Kinder.«
Er trat ein. Die Wohnstube war eng, wirkte auch etwas finster und staubig. »Wie viele Kinder betreuen Sie denn derzeit?«
»Ach, ein paar nur. Platz haben wir noch. Worum geht’s denn?«
Sie wies zum Tisch, dass er sich dort hinsetzte. Robert ließ sich auf dem wackligen Stuhl nieder, legte die Hände auf die Oberschenkel und blickte betreten nach unten. Er hatte sich eine Geschichte zurechtgelegt, denn die Wahrheit, die konnte er natürlich niemandem erzählen. Die Frau, die sich als Elisabeth Läuffer vorgestellt hatte, setzte sich mit einem Heft und Bleistift ihm gegenüber.
»Es ist so traurig«, begann er. »Ich habe ein Kind, um das sich keiner kümmern kann.«
»Sind Sie Witwer?« Der geschäftige Stift verharrte.
»Nein, wenn’s nur so wäre.«
Sie lächelte verschlagen. »Ach, wenn das so ist … Da kann ich helfen.«
Jetzt galt es, vorsichtig zu sein, er wusste ja, wie schnell diese Kröten wuchsen. »Noch nicht geboren. Bald aber.«
Die Frau nickte. Sie schrieb weiter, als wären das alles wichtige Informationen. »Da ließe sich was regeln, wenn Sie bereit sind zu zahlen.«
»Wie viel verlangen Sie denn?« Seine Hände fühlten sich schwitzig an.
»Ach, nicht viel.« Die Pflegemutter wurde munter. Sie klappte das Heft zu. »Also, ich nehme zwei Taler die Woche für die Versorgung eines Säuglings, da ist ja mehr zu tun als bei ’nem älteren. Später wird’s aber trotzdem etwas teurer, die wollen ja so viel essen, man kommt kaum hinterher.« Sie lächelte betont fröhlich. »Drei Mahlzeiten am Tag, es teilt sich ein Bett mit ’nem anderen, so viel Platz ist hier nicht, dass Sie Ansprüche stellen könnten. Außerdem sag ich, wie’s ist, so lang halten’s die Blagen hier meist nicht aus. Gibt Eltern, denen das ganz recht ist, wegen der Kosten.«
Dabei zwinkerte sie ihm verschwörerisch zu.
»Ich verstehe nicht.« Er blinzelte verwirrt.
»Na, meist sind diese Kinder ja eher schwach auf der Brust. Gedeihen nicht gut, wenn Sie verstehen, was ich meine. Wäre nicht das erste, das … nun ja.« Sie zuckte mit den Schultern. »Aber das soll Ihre Sorge nicht sein, oder?«
Er blickte sich noch mal um. Sein Unbehagen wuchs. Ihm fiel auch auf, dass es kein Spielzeug gab, nichts, mit dem sich kleine Kinder beschäftigen konnten. »Darf ich die Schlafstube sehen?«
»Natürlich, natürlich!« Nun wähnte sie sich auf der sicheren Seite, dachte wohl, das sei nun ein Selbstläufer, sie werde das Kind schon bald auf ihrem Schoß schaukeln.
Sie ging voran, Robert folgte ihr. Die Tür knarzte, und das kümmerte sie genauso wenig wie das Aufheulen eines der Kinder, die in der Kammer dahinter auf verdreckten Matratzen auf dem Boden lagen.
»Ruhe jetzt!«, fuhr sie den Kleinen an, auf zwei oder drei Jahre schätzte Robert das Kind. Der Junge sah sie mit großen Augen an, dann legte er sich still wieder hin. Die anderen lagen einfach da, keins rührte sich.
Es waren insgesamt vier Kinder, zählte er. Keins älter als der Junge, der wenigstens noch den Mund aufgemacht hatte.
»Na ja«, meinte Frau Läuffer, »Sie sehen ja, die halten’s Maul, wenn man ihnen mit ordentlich Autorität begegnet oder wie das heißt. Das Wort hab ich von meinem Mann, Gott sei seiner Seele gnädig. Bevor er starb, haben wir das hier gemeinsam gemacht.«
»Schaffen Sie das denn allein?«
Robert bemerkte den Eimer in der Ecke, in den offenbar die Kinder ihre Notdurft verrichteten, ein paar stinkende Windeln quollen über den Rand. Er atmete durch den Mund. Der Gestank war unerträglich, wie hatte er das nicht vorher schon bemerken können? Frau Läuffer schien sein Unbehagen zu spüren, sie trat zwischen den Matratzen am Boden zu dem kleinen Dachfenster und riss es auf. Eisiger Wind und eine Böe Regen fegten herein.
»Also, schaffen … Was schafft man schon? Bleibt liegen!«, blaffte sie im nächsten Atemzug zwei winzige Kleinkinder an, die sich unter einer Häkeldecke aneinanderkuschelten, die wohl mal bunt gewesen war.
»Ist ja nicht viel Auswahl, wenn man die lieben Kleinen gut untergebracht wissen will. So, jetzt aber genug geglotzt. Ich hab zu tun.«
Sie scheuchte Robert aus dem Zimmer. Ein letzter Blick zurück, der Dreijährige saß auf seiner Matratze und starrte Robert unverwandt an, als könnte er was am Schicksal dieser bedauernswerten Kreaturen ändern.
Nein, hier durfte er sein Baby auf keinen Fall lassen, so viel war ihm klar.
Den Brief an Christiane hatte er am frühen Morgen geschrieben, als Frau und Söhne noch schliefen. An der nächsten Straßenecke riss er den Umschlag auf, aus der Innenseite seiner Anzugsjacke zog er einen Bleistiftstummel, kritzelte ein Postskriptum unter die harschen Worte, nahm ihnen die Schärfe und hoffentlich seiner Liebsten die Angst.
Gruselig, was sie uns hier als Pflege verkaufen wollen, Höllenlöcher habe ich gesehen! Da können wir das Baby nicht lassen, aber sag, was willst Du sonst damit tun, dass es nicht auf mich zurückfällt?
Denn das durfte nicht sein, dass jemand erfuhr, von wem das Kind war. Das war nun allein Christianes Problem, und er hoffte für sie, dass sich eine Lösung fand.
Eine Pflegestelle, in der die wenigsten überlebten, das war jedenfalls kein rechter Ort für eines seiner Kinder.
4
Dambrau, September 1883
Nun lass schon los.« Die Hebamme klang selbst erschöpft, fast schon resigniert, während Christiane ermattet in die Kissen sank. Wer eigentlich hatte bestimmt, dass Frauen im Liegen gebären sollten? Das konnte sich nur ein schlauer Doktor der Medizin ausgedacht haben, der meinte, so habe er alles besser im Blick. Sie erinnerte sich an ihre Mutter; sechzehn Kinder hatte sie zur Welt gebracht, beim letzten hatten Christiane und Paula ihr zur Hand gehen dürfen. Was genau da geschah, als sie mit den letzten Wehen das Baby aus sich herauspresste, hatte sie zwar nicht gesehen, denn die Mutter hatte dafür vor dem Bett gekniet und sich mit dem Oberkörper auf der Matratze abgestützt, während sie Christianes und Paulas Hände drückte und die Hebamme hinter ihr hockte und irgendwas zwischen ihren Beinen machte. Damals war Christiane fünf oder sechs gewesen, eine ihrer ersten Erinnerungen. Daran dachte sie nun, und bevor irgendwer sie davon abhalten konnte, stieg sie umständlich aus dem Bett und kniete sich davor. So ging’s leichter.
Die Hebamme zuckte mit den Schultern, sie hatte wohl schon einiges gesehen und fand, das eine sei so gut wie das andere, solange es der Gebärenden half. Christiane seufzte, denn es war fast erleichternd, wie der Druck auf ihren Rücken nachließ. Stattdessen lief ein Beben durch ihren Unterleib, sie glaubte zu spüren, wie sich das Baby langsam vorwärtsschob.
»Ich spüre das Köpfchen. Gleich noch mal.« Die Hebamme sprach ganz ruhig. Und dann, mit einem letzten Schieben, war es geschehen. Christiane biss sich in die Faust, ein stechender Schmerz da unten, dann war alles wieder gut, oder auch nicht, einfach leer und schlaff, wo vorher alles noch so erfüllt und prall gewesen war. Sie hörte das Plärren des Babys, mehr ein Maunzen wie von einer Katze.
»Ein Mädchen.« Die Hebamme nabelte den Säugling ab, sie half erst Christiane zurück aufs Bett, dann legte sie ihr das winzige Baby in den Arm, in ein Handtuch gewickelt und noch ein bisschen von weißer Schmiere überzogen. Sofort suchte der kleine, weit aufgerissene Mund; das Baby schien schon die Milch in Christianes prallen Brüsten riechen zu können.
Sie wusste nicht, ob sie lachen sollte oder weinen. Behutsam schnürte sie das Nachthemd auf, dann bot sie dem Säugling die Brust an, der schon bald zufrieden schmatzte. Christiane schloss die Augen und ließ den Kopf nach hinten sinken. Sie fühlte sich erschöpft, aber auf so eine wohlige Art, als hätte sie in dieser Nacht richtig was geschafft.
»Ihr macht das gut.« Die Hebamme kümmerte sich um die Nachgeburt, sie räumte auf und öffnete das kleine Fenster. Besorgt legte Christiane das Handtuch fester um das Babyköpfchen.
»Hast du schon einen Namen für sie?«
»Katharina«, flüsterte Christiane.
Sie wusste in dem Moment, als sie den Namen sagte, dass es nun kein Zurück mehr gab. Sie hatte ein Kind, das Kind einen Namen. Unmöglich, es noch einmal aus den Händen zu geben, da müsste Robert es ihr schon entreißen, und sie würde dennoch bis zum letzten Atemzug drum kämpfen, dass das Kleine bei ihr blieb.
»Eine kleine Käthe, wie süß.« Die Hebamme lächelte.
Christiane verzog den Mund. »Nein. Sie heißt Katharina«, erwiderte sie fest.
Damit war’s beschlossen. Und in dieser Nacht schlief sie zum ersten Mal nicht allein in ihrem Bett. Neben ihr lag das kleine Kind, ihr Kind. Katharina. Die Reine. Nichts war so unschuldig wie dieses Kind.
Christiane war fest entschlossen, dass es so blieb.
* * *
Der Frieden währte nicht lang. Schon zwei Tage später stand Robert Rogaske in dem Kämmerchen, eine Tüte mit Wurst und Schokolade in der einen Hand, einen zerdrückten Blumenstrauß in der anderen, am Feldrain gepflückt oder am Bahnhof auf dem Weg hierher gekauft.
»Wo ist sie?«, wollte er wissen.
Stumm zeigte Christiane auf den Weidenkorb, der am Fußende des Betts stand. Sie hatte ihn mit einer Decke ausgepolstert. Darin lag Katharina tagsüber und schlief, wenn sie nicht an Christianes Brust ruhte oder trank.
Robert runzelte die Stirn, als er in den Korb auf das zerknautschte Baby blickte, dessen Hände winzig klein und schrumpelig waren, als müsste es erst hineinwachsen. Das Gesicht ein wenig verkniffen, als wäre das Leben außerhalb des Mutterleibs eine Anstrengung.
»Da ist sie also.«
»Sie heißt Katharina.«
»So. Hm.«
Robert zog den Stuhl heran, er breitete schweigend die Geschenke aus und überließ es Christiane, die Zukunft anzusprechen. »Was machen wir nun?«, fragte sie.
»Du wirst dir wohl was überlegen müssen. Ich bring’s nicht über mich, sie in so eine Hölle zu sperren. Wenn du das schaffst, wohlan.«
Nein, das brachte sie auch nicht übers Herz. »Ich könnte sie ja behalten …«
Robert schnaubte. »Dass die Leute sich das Maul zerreißen?«
»Das tun sie ohnehin.«
Er schwieg. Packte weiter aus, sogar ein Buch war dabei, das er zwischen Schokolade und ein Päckchen Tee legte. Stumm beobachtete Christiane ihn dabei.
»Was wird dann aus uns?«, traute sie sich endlich, die Frage zu stellen, die sie nicht losließ.
»Was soll schon werden? Du und ich, wir gehören doch zusammen.«
»Auch wenn ich sie behalte?«
»Immerhin spart es mir zwei Taler die Woche, wenn sie bei dir bleibt.« Er seufzte. Setzte sich zu ihr auf die Bettkante und nahm ihre Hände. »Ausreden kann ich’s dir nicht. Ach, Tinchen, warum tust du mir das alles an? Wieso konntest du nicht besser achtgeben oder wenigstens was dagegen tun, ohne mich damit zu belasten? Was ist es, dass du es mir so schwer machen musst?«
»Dir?«
»Na, geht’s nicht darum? Du willst doch, dass ich bei dir bleibe für immer, oder nicht? Darum diese Tänzchen. Ich hab dich von Herzen lieb, aber wie du mich an dich bindest … erst wirst du schwanger, dann bringst du dich fast um, nun willst du es behalten … Ich sehe, was du da treibst!« Spielerisch drohte er ihr mit dem Finger. »So wird das nichts, meine Süße, meine Gute. Ich bleib bei Frau und Söhnen.«
Seine Worte verletzten sie. Glaubte er denn wirklich, sie tat das alles nur, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen? Sie liebte ihn, die Wochen der Trennung waren für sie eine Qual gewesen, und nun meinte er, sie, die sich immer zurückhalten musste, die immer zurückstand, weil er bei jeder sich bietenden Gelegenheit betonte, er würde ja mit ihr zusammen sein, aber es ging nun mal nicht wegen Frau und Kindern, das verstand sie ja – sie hätte sich das Kind herbeigewünscht, dass er zu ihr kam und bei ihr blieb? Aber wie sie es auch versuchte, ob sie sich demütig und still gab oder aufbegehrte, immer verdrehte er ihr die Worte im Mund, dass sie herrschsüchtig sei und ihn nur für sich haben wolle. Ihr die Schuld zu geben, dass es nun dieses Kind gab, war der Gipfel.
Christiane wäre gern stärker gewesen. Mutiger. Sie hätte lieber die Kraft besessen, ihn aus der Kammer zu werfen und damit auch aus ihrem Leben. Aber es würde auch mit seiner Hilfe schwer genug werden, sobald sie zurück in Breslau war. Hilfe, die anzunehmen ihr schwerfallen würde.
»Du musst nichts tun«, sagte sie leise. »Dein Geld will ich nicht.« Das Baby wachte auf und schmatzte leise. Sie beugte sich über den Korb und hob es heraus. Als sie ihr Nachthemd aufschnürte, spürte Christiane Roberts begehrlichen Blick, wie er über ihre Brust glitt. Sie wandte sich halb ab, streichelte Katharinas Köpfchen, die sogleich die Brustwarze fand und sich schmerzhaft festsaugte. Christiane seufzte, spürte das Kribbeln in ihren Brüsten, als die Milch zu fließen begann. Sie spürte, wie das Nachthemd auf der anderen Seite nass wurde.
»Wie willst du es denn ohne mich schaffen? Die Leute werden reden.« Seine Stimme erreichte sie nicht, sie blickte auf Katharina herab und lächelte selig. Sie empfand eine Liebe ohne Bedingungen, ganz anders als die, mit der Robert sie an sich band.
»Die Leute sind mir egal.«
»Du kriegst nicht genug Arbeit, wenn du das Kind hast. Wer soll dir welche geben? Mit Kind bist du unzuverlässig.«
»Ich war immer verlässlich, und das bleibe ich auch.« Notfalls würde sie eben nachts arbeiten, wann immer das Baby schlief. Gegen ihren Willen spürte sie Tränen in den Augen, die sich nicht zurückblinzeln ließen. Wie er immer an ihr herumkritteln musste. Konnte er ihr denn nicht ein einziges Mal Mut machen, ihr versprechen, sich zu kümmern, dass sie nicht ganz allein war mit dieser neuen Situation?
Allein werde ich nun nie wieder sein, fuhr ihr durch den Kopf, und sie neigte sich zu ihrem Baby herunter, küsste es auf den dunklen Flaum, der salzig schmeckte von ihren Tränen. Christiane sog den Babyduft ein, sie weinte, weil ihr dieses Kind zugefallen war, was sie immer hatte verhindern wollen. Und wie glücklich es sie nun machte, das hatte sie nie erwartet. Glücklich und verzweifelt zugleich, weil sie es allein schaffen musste.
Aber wenigstens würde sie von nun an nie mehr einsam sein, nie mehr Tage und Wochen warten müssen, bis Robert sich mal zu ihr bequemte. Sie hatte dieses Kind, sie würde alles tun, damit es ihm gut ging.
»Dann mach halt, wie du meinst.« Er klang unwirsch, fast schon böse. Als spürte er, wie ihre größte Liebe von ihm auf seine Tochter übersprang, als könnte er das nicht verwinden. Nein, wenn die Welt sich nicht um Robert Rogaske drehte, war irgendwas darin verkehrt.
»Wir schaffen das«, flüsterte Christiane ihrer Tochter zu, küsste sie, schniefte und lachte. »Wir beide schaffen alles, uns gehört die Welt.«
* * *
Zunächst aber waren große Teile der Welt ihnen verschlossen. Robert kehrte am selben Tag nach Breslau zurück. Christiane blieb noch zwei Wochen in Dambrau, sie erholte sich von der Geburt, doch lange hielt es sie nicht im Bett. Die Bäuerin stellte ihr dreimal am Tag eine gute Mahlzeit hin, und sobald Christiane sich traute, ging sie wieder hinaus über die Felder und Richtung Wald, die schlafende Katharina im Tuch vor der Brust. Die Hebamme hatte ihr gezeigt, wie das ging, und so erweiterte sich ihr Lebensraum wieder. Sie brachte wieder Pilze mit von den Ausflügen, die von der Bäuerin sorgfältig verlesen, auf Fäden gezogen und unter die Dachsparren gehängt wurden. Weiter ging es im Garten, Pflaumen einkochen, Apfelkompott aus Fallobst, die heilen Früchte sammelten sie für die große Stiege im Keller. Christiane hatte das Gefühl, sie müsste sich nützlich machen, dabei wusste sie, dass Robert für ihren Aufenthalt bezahlt hatte. Daheim liefen derweil die Mietschulden auf, und sie hoffte inständig, ihr Gespartes würde dafür reichen.
Zum Abschied Ende September schenkte die Bäuerin ihr ein Bündel mit Babysachen, die frisch gewaschen und geplättet waren.
»Wir haben die ja nie gebraucht«, sagte sie. Mehr nicht, dabei lag darin so viel Schmerz und Trauer. Freiwillig war sie nicht kinderlos geblieben, wer tat das schon.
Christiane stammelte ein Dankeschön, dann bestieg sie den Pferdekarren, der Bauer fuhr sie zum Bahnhof und sagte unterwegs nicht viel. Christiane hielt Katharina fest, obwohl der Säugling im Tuch friedlich schlief. Sie wuchtete den Pappkoffer, das Bündel mit Babykleidung und den Deckelkorb mit Leckereien allein von der Kutsche.
»Na dann.« Er tippte an den Schlapphut und ließ die Zügel auf den Rücken des braunen Kaltbluts klatschen.
Breslau erreichten sie nach Einbruch der Dunkelheit. Christiane schleppte Koffer, Bündel, Korb vom Bahnhof zur Gartenstraße. Das Herz war ihr schwer, sie fürchtete, die Hauswirtin hätte ihre Wohnung inzwischen neu vermietet und ihre Sachen an die Straße gestellt. Unbemerkt schlich sie ins Haus, stieg die Stufen im dunklen Treppenhaus hoch. Der Schlüssel passte, alles war noch da. Sie atmete auf, stellte die Sachen ab und holte Katharina aus dem Tuch, die wach geworden war und Hunger hatte. Während sie stillte, ging sie langsam auf und ab, sie überlegte. Katharina konnte mit ihr im Bett schlafen, die Nähmaschine stellte sie ans Fenster, mehr Licht und Luft beim Arbeiten. Wenn sie nachts arbeiten wollte, brauchte sie eine zusätzliche Lichtquelle, sonst ging es nicht. Aber erst wollte sie schlafen. Morgen würde sie sich um neue Arbeit kümmern.
Sie wusste nicht, ob Robert irgendwann noch mal zu ihr kam. Ob es sie kümmerte? Das Herz zerriss es ihr. Sie waren nicht im Guten auseinandergegangen, und nun musste sie wie so oft darauf hoffen, er werde sich schon irgendwann melden, wenn ihm der Sinn danach stand.
»Wir werden nicht auf ihn warten«, flüsterte Christiane und küsste Katharinas Köpfchen. »Wir beide, du und ich, wir halten zusammen bis ans Ende der Welt.«
Die erste Nacht von vielen, in denen sie im Bett lag und erst nicht schlafen konnte, weil das Herz ihr überquoll. Von der Liebe zu diesem Kind, aber auch von der Angst, wie es weitergehen sollte, wie um alles in dieser Welt sie die Mietschulden abtragen, Arbeit finden, sich und das Kind über die Runden bringen sollte.
Sie beschloss in dieser Nacht: Wenn Robert wiederkäme, würde sie ihm die Tür nicht verschließen. Würde ihn willkommen heißen. Zu lebendig war ihr noch der Schmerz, als ihre Eltern starben und keiner mehr für sie da war außer Paula und die anderen Geschwister, die sich redlich mühten, aber nicht die Eltern waren. Ein schlechter Vater mochte da besser sein als gar keiner.
5
Breslau, April 1889
Das Stühlchen auf dem Bürgersteig, ringsum Kisten und Körbe, Stoffbündel und nun zu guter Letzt die Nähmaschine, all die Dinge, die ihre kleine Welt waren. Katharina beobachtete mit leicht gerunzelter Stirn, was da vor sich ging. Ihre Mutter hatte ihr versichert, das sei nun der letzte Umzug, doch an die ersten konnte sie sich gar nicht erinnern, weshalb dieser nichts von seinem Schrecken verlor.
»Aus dem Weg!«
Tante Paula brachte noch mehr Körbe, darunter auch einen mit Katharinas Sachen. Zwei Packer, die ihnen beim Umzug zur Hand gingen und die Tante Paula am Morgen mitgebracht hatte, schleppten gerade die alte Wheeler & Wilson-Nähmaschine nach draußen. Sie war schon in die Jahre gekommen und trotzdem der wertvollste Besitz der Mutter, denn nur mit ihr konnte sie für die zahlungskräftigen Kundinnen all die schönen Dinge fertigen, Abendgarderobe und Spitzenwäsche, Tageskleider, Putz und Aussteuer. Christiane Simon nahm jeden Auftrag an, führte ihn gewissenhaft aus. Aber nun brauchten sie mehr Platz, sie hatte ein Lehrmädchen aufgenommen, und Katharina sollte nach den Osterferien zur Schule gehen. Damit sie nicht so weit zu laufen hatte bis zur Tauentzienstraße, hatte sie die neue Wohnung gesucht. »Du wirst es mal besser haben als ich«, seufzte Katharinas Mutter regelmäßig und strich ihr dabei über die kurz geschorenen Haare. Katharina duckte sich darunter weg. Sie mochte die mütterliche Zärtlichkeit wohl, doch das Gefühl auf ihrem Kopf, das missfiel ihr, wie es ihr auch missfiel, wenn ihr alle paar Wochen die Haare raspelkurz geschnitten wurden. Eine Erklärung, wieso ihre Mutter das tat, bekam Katharina nie.
Zur Schule also, bald schon. Sie sollte es ja besser haben; nur deshalb arbeitete ihre Mutter sich die Finger wund, bis die geröteten Augen brannten und sie sich vor Müdigkeit die Nadel in die Fingerkuppen statt in den feinen Batist stach. Manchmal musste Katharina ihr auch schon zur Hand gehen. Das ersparte Geld legte ihre Mutter auf Mark und Pfennig in eine silberne Dose, die sie oben auf dem Vertiko verbarg. Die Mittelschule sollte es sein, sobald Katharina in ein paar Jahren mit der Volksschule fertig war.
»Jetzt sitz hier nicht länger rum, Katharina.«
Ihre Mutter wuchtete eine Kiste auf den Karren, sie runzelte die Stirn, dachte nach. Was hatte sie vergessen, was musste unbedingt erledigt werden? Sie führte zwar in einem Heft alle Aufträge ihrer Kundinnen sorgfältig auf, doch für all die vielen kleinen Erledigungen, die ihr Haushalt mit sich brachte, verschwendete sie kein Papier, und manches Mal verpasste sie Termine oder Verabredungen.
Katharina stand auf. Stumm sah sie zu, wie der kleine Polsterstuhl mit den anderen Sachen aufgeladen wurde, nun ging alles ganz schnell. Ein letztes Mal folgte sie der Mutter in die Stube unterm Dach, sie sahen sich darin um. Beide ratlos und Katharina unerklärlich müde. Später erst, nachdem ihr das Leben mehrere Ortswechsel aufgezwungen hatte, würde sie dieses Gefühl wiedererkennen. Es war ein vorauseilendes Heimweh, Abschiedsschmerz und Sehnsucht, neue Wurzeln zu schlagen.
Katharina schob die Hand in die ihrer Mutter. »Werden wir es gut haben, dort, wo wir hingehen?«, fragte sie leise.
»Dir wird’s mal besser gehen.« Mehr sagte ihre Mutter nicht. Als wäre es ihr unvorstellbar, dass sie selbst irgendwann noch mal bessere Zeiten erleben würde.
* * *
Eine Stube unterm Dach, das Klo im Treppenhaus und so winzige Fensterchen, dass es an Wintertagen kaum hell wurde. Das also war ihr neues Heim, und Katharina versuchte, keine Vergleiche zum alten zu ziehen. Mehr Platz hatten sie wohl, aber alles war etwas schäbiger, der Hausflur feucht und stinkend, die Treppenstufen morsch. Nachts schrien Menschen auf den Straßen, dass sie kaum einschlafen konnte.
»Na, was hat mein Mäuschen?«
Ihre Mutter setzte sich zu ihr. Katharina tastete nach ihrer Hand, war ihr doch die Nähe wichtig, dass sie einschlafen konnte. Sie merkte aber zugleich, wie ihre Mutter unruhig wurde, wann immer Katharina länger zum Einschlafen brauchte. Da ging ihr Blick schon wieder zur Wheeler & Wilson, auf der Platte lag ihre aktuelle Auftragsarbeit. Bei einem Tageskleid sollte sie die Taille auslassen, vermutlich war die Trägerin »in Umständen«, die das erforderten. Das gehörte zu den vielen kleinen Aufträgen, die sie gewissenhaft ausführte, Tag und Nacht, so kam es Katharina manchmal vor.
»Biste aufgeregt?«, fragte ihre Mutter leise.
Morgen ging die Schule los. Katharina schüttelte den Kopf. Doch ihr Blick ging zu dem Lederranzen, in dem Federkasten, Schiefertafel und Fibel steckten.
»Brauchst du nicht sein. Fall nicht auf, dann wird alles gut.« Ihre Mutter zögerte. »Vielleicht machen’s dir die anderen Mädchen schwer«, fügte sie leise hinzu. »Weil du anders bist als sie. Aber lass dich davon nicht beirren. Du hast immer noch mich und deinen Papi. Es macht keinen Unterschied, dass er nicht bei uns lebt.«
Es macht doch einen Unterschied, das wusste Katharina ganz genau. Zu oft hatte sie erlebt, wie ihre Mutter sich mit dem Vater stritt, weil er allzu selten bei ihnen war. Nur freitags war er für sie da, wenn Katharina ihn vom Rathaus abholte und sie ein paar Kleinigkeiten kaufen gingen, die er ihrer Mutter mitbrachte. Ergänzungen zur Speisekammer, die Christiane Simon eher widerstrebend akzeptierte, weil sie ohne hätten hungern müssen. So nahm sie die Würste, die großen Stücke Hartkäse, Brot und gelegentlich eine Tüte Pfefferkuchen und versteckte sie fast verschämt in der winzigen Speisekammer.
»Aber ihr habt doch kaum was«, meinte der Vater bei so einer Gelegenheit mal, als er an Christianes Schulter vorbei auf die leeren Bretter blickte.
»Wir kommen schon rum«, beschied sie ihm und knallte die Tür vor seiner Nase zu.
Wir kommen schon rum. Mehr schlecht als recht, so viel wusste Katharina schon. Aber sie musste selten hungern. Lieber gab die Mutter ihr die zweite Scheibe Brot, statt sie gerecht zu teilen. »Bist ja noch im Wachstum«, meinte sie dann lapidar. »Da brauchst du mehr.« Vermutlich war das der einzige Grund, weshalb sie sich vom Vater was mitbringen ließ – damit Katharina wenigstens satt wurde.
Und nun die Schule. Katharina konnte den Blick nicht von dem Ranzen lassen. Das Wenige, was ihr die Nachbarstochter in der Friedrichstraße über die Schule erzählt hatte, trug nicht gerade zu ihrer Beruhigung bei. »Wenn du nicht spurst, kriegst du den Rohrstock vom Lehrer zu spüren«, erklärte Erna ihr. »Und wenn dem nicht passt, wie du guckst, dann auch.« Das war nicht gerade ermutigend, wer konnte schon was dafür, wie er guckte?
»Mama? Bist du noch da?«
Schon fast eingeschlafen, suchte Katharina nach dem Finger ihrer Mutter, an dem sie sich oft festhielt, bis sie eingeschlafen war.
»Schlaf jetzt«, hörte sie die Mutter flüstern, dann ihr Seufzen, als wäre es eine Zumutung, allabendlich beim Kind zu sitzen. Katharina spürte, wie sich der Finger der Mutter langsam aus ihrem Griff zog, dann den harten Löffelstiel aus Holz, der den weichen Finger ersetzte. Und als dann kurz darauf das leise Surren der Nähmaschine einsetzte, konnte sie beruhigt einschlafen.
* * *
»Was bist du denn für eine?« Abschätzige Blicke von den Mitschülerinnen. Vom kurz geschorenen Schädel über das alte Schulkleid, das ihre Mutter von einer Kundin bekommen hatte und für Katharina enger nähen musste, bis zu den braunen flachen Lederschuhen.
»Wo wohnst du denn?« Eins der Mädchen drängte nach vorne. Blonde Korkenzieherlöckchen, hellblaue Samtschleifen im Haar, ein frisches Gesicht mit runden, geröteten Backen und einem roten Mund. Katharina starrte sie stumm an. »Na, welche Straße!«
Bevor Katharina antworten konnte, betrat die Lehrerin das Klassenzimmer. Sofort schwärmten die Mädchen aus zu ihren Pulten, und Katharina war dankbar, dass sie ihre Ruhe hatte. Die Lehrerin hatte eine sanfte Stimme, sie erklärte den Mädchen, was sie im kommenden Schuljahr erwarten würde. »Ihr werdet lesen, schreiben, rechnen lernen. Das genügt für den Anfang.« Und kam Katharina doch vor wie ein unüberwindlich hoher Berg.
Die anderen Mädchen ließen sie in Ruhe, und Katharina, die sich in einer hinteren Bank einen Platz gesucht hatte, strengte sich an, die Worte der Lehrerin zu verstehen, wenn sie an der Tafel auf die Buchstaben zeigte, die alle Mädchen getreulich wiederholten. »A, E, I, O, U«, so erschloss sich ihr die Welt, und schon wenige Wochen später kam sie nach Hause, schlug die Fibel auf und las ihrer Mutter vor. Langsam noch und stockend, aber sie konnte lesen!
»Die Gänse haben weiße Federn. Die Gänse machen gi-ga-gack.«
»Das machst du wunderschön.«
Katharina blickte bestürzt auf ihre Mutter, die sich verstohlen die Augenwinkel mit dem Geschirrtuch abwischte, mit dem sie gerade Teller und Gläser abtrocknete.
»Aber wieso weinst du?«
»Weil du so schlau bist, mein Kind.« Ihre Mutter trat zu Katharina an den Tisch, sie legte den Arm um die schmalen Schultern und drückte sie an sich. »Du wirst es weit bringen.«
Sie war nicht von dem Gedanken abzubringen, dass Katharina zu Höherem berufen war. Wann immer sie nun aus der Schule heimkam, freute Katharina sich darauf, ihr zu zeigen, was sie an diesem Tag gemeistert hatte. Und jedes Mal war ihre Mutter stolz. Nach dem kleinen Mittagsimbiss, der immer auf Katharina wartete, setzte sie sich brav an den leer geräumten und abgewischten Küchentisch, las und rechnete, während ihre Mutter sich wieder an die leise surrende Nähmaschine begab. Das Lehrmädchen Lies ging ihr dabei zur Hand. Im Laufe des Nachmittags kamen dann Kundinnen in die Wohnstube und ließen sich in der Enge des kleinen Raums zeigen, was Katharinas Mutter für sie angefertigt hatte. Die meisten waren voll des Lobes. Manche sahen auch das kleine Mädchen, das still am Tisch seine Aufgaben machte, und nickten wohlwollend. Die Näherin Simon war fleißig, sorgte für das Kind und ihr Lehrmädchen; dass sie keinen Vater zum Kind hatte, nun, bedauerlich.
Für die instabilen Verhältnisse, in denen Katharina aufwuchs, erlebte sie diese erste Schulzeit als sehr beglückend und genoss die Stunden des gemeinsamen Arbeitens. Ein friedlicher, ruhiger Alltag, das tat ihr gut.
Es waren fröhliche Zeiten, da oben unterm Dach in der kleinen Wohnung. Mit Lies, gerade mal vierzehn Jahre alt, hatte sie eine große Schwester, das machte es weniger einsam als zuvor. Sie hatten tüchtig Spaß, wenn keine Kundschaft da war, sie sangen Lieder, erzählten sich Schauergeschichten, bis Katharinas Mutter leise »tsk!« machte, weil ihr Lehrling und ihre Tochter zu übermütig wurden und kichernd aufeinanderhingen. Dann verstummten beide, beugten die Köpfe still über die Näharbeiten, bei denen auch Katharina helfen musste, sobald sie ihre Aufgaben erledigt hatte.
Abends jedoch wurde es immer früher dunkel, nun, da der Herbst heraufzog. Katharina ging seit einem halben Jahr zur Schule, und wenn sie abends hinaussah und die Oktobersonne sich langsam vom Tag verabschiedete und ein letztes Mal golden über die Dächer Breslaus gleißte, da fühlte sie eine Furcht vor der dunklen Jahreshälfte in sich aufsteigen. Weil die letzten Winter so düster gewesen waren.
Katharina beobachtete ihre Mutter scharf. Sie sah die ersten Anzeichen. Wie sie langsamer wurde. Wie sie sich müde die Augen rieb, wie sie aus dem Fenster blickte und seufzte. Sie ließ die Arbeit früher ruhen an diesen Tagen, schleppte sich zwischen Anrichte und Küchentisch hin und her, fand keine Lust am Kochen, fand an gar nichts Lust. Nicht mal Katharinas Fortschritte konnten sie da noch aufmuntern, auch nicht ein großer Auftrag, wenn sie eine Abendgarderobe nähen durfte für die kommende Ballsaison, immerhin brachte das achtzehn Mark in die Geldkassette. Und sie sparte doch jedes bisschen, damit Katharina es besser haben konnte.
Je finsterer und nachdenklicher ihre Mutter war, umso mehr strengte Katharina sich an. Morgens früh sprang sie beim ersten Scheppern des kleinen Weckers aus dem Bett, sie wusch sich das Gesicht mit eiskaltem Wasser und putzte sich die Zähne, da rührte sich die Mutter gerade mal. Und während sie die halbe Treppe hinunter ins Bad schlurfte, befüllte Katharina den Wasserkessel, brühte Tee und wärmte Milch, röstete Brotscheiben auf einer Herdplatte und schmierte sich für die große Pause ein Brot mit ganz dünn Butter – weil sonst die Mutter wieder schimpfte – und einer kleinen Scheibe Käse.
Wenn die Mutter dann zurück war, stand auch Lies auf und machte sich fertig, und Katharina hatte sich derweil angezogen, ihre Mappe kontrolliert, immer mit Blick auf die Uhr, auf keinen Fall wollte sie zu spät kommen. Sie stellte der Mutter ihren Tee hin und gab ihr noch einen Kuss, dann lief sie schon die Treppen hinunter. Wenn sie mittags zurückkam, waren Lies und ihre Mutter gut beschäftigt, meist hatte sich die Laune gebessert. Sie verdüsterte sich erst wieder, wenn es dunkel wurde.
Jeden Tag ein paar Minuten länger.
Nachts dann lag Katharina oft wach und hörte, wie Lies auf dem Küchensofa schnaufte, weil sie ständig Erkältungen plagten. Ihre Mutter saß immer noch über den Nähmaschinentisch gebeugt, leise murmelnd, weil sie müde war und doch nicht von der Arbeit lassen konnte. »Dieses eine noch«, murmelte sie, »diesen Tag noch, dann ist es geschafft.«
Was genau geschafft sei, wusste Katharina nicht. Aber sie spürte das Unglück ihrer Mutter, das sich mit zunehmender Dunkelheit im Winter auch auf ihr Gemüt legte, bis es kurz nach Weihnachten zu viel wurde – wenn die Kerzen weggepackt waren, der Lichterglanz in den Straßen der Stadt erloschen war.
»Warum mach ich das denn alles noch?«, die Worte ihrer Mutter, ein schweres Seufzen in der Nacht, wenn sie glaubte, dass die anderen schliefen. »Wenn man doch nur nicht mehr aufwachen müsste …«
Wenn es dahin kam, lag Katharina wie erstarrt im Dunkeln, die Augen fest zugekniffen. Dennoch zuckte sie zusammen, wenn ihre Mutter zu ihr ins Bett schlüpfte. Was meinte sie damit? Nicht mehr aufwachen? Und was würde aus Katharina, wenn die Mutter nicht mehr war? Zum Vater konnte sie ja nicht. Das machte er immer wieder klar. Schmerzhaft war das, denn die »andere« Familie war ihm immer wichtiger gewesen, würde es immer bleiben.
Wenn Katharina dann einschlief, war die Nacht zu kurz. Morgens sprang sie wieder aus den Federn, sie kochte, sie küsste die Mutter zum Abschied auf die von der Erschöpfung schlaffe Wange. »Bis heute Mittag!« Wenn ihre Mutter etwas wacher wäre, ein paar Stunden nur. Katharina lebte für diese Nachmittage, die im Winter allzu kurz waren. Sie sehnte den Frühling herbei mit dem erblühenden Leben, weil sie wusste: Dann wurde auch ihre Mutter wieder fröhlich, der Vater brachte ihr Blumen mit, und sie tanzten durch die Stube, als wären die dunklen Nächte nun für alle Zeit vorbei.
6
Zum Glück gab es Tante Paula.
Einmal in der Woche holte sie Katharina von der Schule ab. Sie kümmerte sich, als wäre Katharina ihr eigenes Kind, als wäre die Nichte ihr Trost für die kinderlose Ehe mit Hermann, einem gut situierten Kaufmann. Katharina wusste mehr darüber, weil sie es verstand, sich unsichtbar zu machen, wenn die Erwachsenen redeten. Sonntags beim Kuchen, wenn Lies Ausgang hatte und Paula bei der Mutter saß, beide im Kaffee rührten und vom Kuchen naschten, den Paula mitgebracht hatte. Dann seufzte sie wohl manches Mal. »Schade ist es schon«, sagte sie.
»Aber du hast in so vieler Hinsicht Glück gehabt«, sagte Katharinas Mutter, und Paula lachte dann schon wieder.
»Das hab ich wohl.«
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: