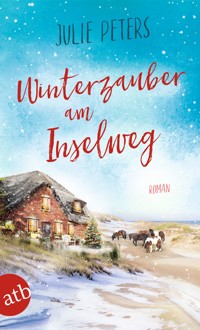10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Kämpferische Frauen der Antike
- Sprache: Deutsch
Gegen übermächtige Kräfte kämpft sie für die Freiheit. Hippolyte ist die junge Herrscherin über die Skythen. Sie führt das Erbe ihrer Mutter Otrere fort und versucht, ihr Volk der Amazonen zu einen und seine ursprüngliche Lebensweise zu bewahren. Doch als der griechische Held Theseus sie entführt und sie zwingen will, ihm den Waffengürtel zu überlassen, den ihr einst ihr Vater, der Kriegsgott Ares, schenkte, muss sie den Kampf gegen die Achaier wieder aufnehmen … Die große Saga über die stärksten Frauen, die es in der Antike gab: die Amazonen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 498
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
»Ich weiß, was sie sich über mich erzählen. Sie sagen, ich sei die größte Herrscherin der Amazonen gewesen. Die Tochter einer Königin und eines Gottes.«
Nach dem Tod ihrer Mutter Otrere ist es Hippolyte, die den Kampf um das Überleben ihres Volkes gegen die Achaier fortsetzen muss. Sie ist als Amazone auf der Steppe aufgewachsen, und das Leben im Palast und in der Stadt bleibt ihr fremd. Als der griechische Held Theseus sie herausfordert, steht sie vor ganz neuen Fragen: Kann sie ihr Schicksal beeinflussen, oder ist ihr Weg von den Göttern vorherbestimmt? Und kann sie sich darauf verlassen, dass ihr Vater sie schützt?
Über Julie Peters
Julie Peters, geboren 1979, arbeitete als Buchhändlerin und studierte Geschichte, bevor sie sich ganz dem Schreiben widmete.
Im Aufbau Taschenbuch sind bereits zahlreiche ihrer Romane erschienen, unter anderem die Romane »Käthe Kruse und die Träume der Kinder« und »Käthe Kruse und das Glück der Kinder«, die Saga »Die Dorfärztin« und der erste Band der Amazonen-Trilogie »Die Kriegerin – Tochter der Amazonen«.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Julie Peters
Die Kriegerin – Tochter der Steppe
Roman
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Epilog
Historische Notiz
Impressum
Prolog
Ich weiß, was sie sich über mich erzählen.
Sie sagen, ich sei die größte Herrscherin der Amazonen gewesen. Die Tochter einer Königin und eines Gottes. Mit meiner Geburt wurde eine Brücke geschlagen zwischen dem Volk meiner Mutter und dem Volk, das meinen Vater fürchtete. Die Skythen fühlten sich von den Achaiern bedroht, und die Achaier zitterten vor ihrem Kriegsgott Ares. Als meine Eltern Otrere und Ares sich ineinander verliebten und eine Verbindung eingingen, hielt das die Achaier lange Zeit davon ab, noch mehr Städte und Siedlungen in unserem Reich zu gründen.
Aber inzwischen waren fast zwanzig Jahre vergangen, seit meine Eltern sich kennenlernten und meine Mutter Königin der Skythen wurde. Sie hatte drei Töchter geboren, von denen ich die älteste bin. Ich wuchs die ersten Jahre meines Lebens auf der skythischen Steppe bei der Sippe meiner Mutter auf, während sie mit meinem Vater in Ephesos lebte und nacheinander zwei weitere Töchter bekam: Penthesilea und Antiope. Ich verstand damals nicht, warum meine Mutter mich zurückgelassen hatte. Ich hielt mich an meine Tante Melanippe, die wie eine zweite Mutter für mich war und mich gemeinsam mit ihrer Gefährtin Nushaba aufzog und mir schon früh den ersten Spielzeugbogen in die Hand drückte. Der Frieden mit den Achaiern würde nicht ewig standhalten, davon war sie überzeugt. Irgendwann würden wir um unsere Freiheit und Unabhängigkeit kämpfen.
Wer hätte gedacht, dass ich diejenige sein würde, die diesen Kampf aufnehmen musste?
1
Meine Mutter war eine Königin.
Mein Vater ist der Gott des Kriegs.
Ich wuchs mit dieser Bürde auf: Prinzessin und Halbgöttin, Heldin und Kriegerin für mein Volk zu sein. Wie meine Mutter, die schon als Kind zu den Kriegerinnen lief, dachten alle, die Tochter einer Kämpferin und des Kriegsgotts kann nichts anderes wollen als den Kampf fortzuführen, den meine Mutter einst begonnen hatte.
Niemand fragte mich, ob ich diesen Kampf führen wollte. Sie gingen davon aus, dass ich es schon wollen würde. Und tatsächlich: Ich ging von klein auf jeden Morgen mit meinen Gefährtinnen zum Kampftraining, während die meisten Mädchen unserer Sippe sich zu ihren Müttern und Tanten gesellten. Sie halfen, die jüngeren Geschwister zu hüten oder wurden in Handarbeiten oder Vorratshaltung unterwiesen.
Ich war fünf, als meine Mutter Otrere aus der achaischen Stadt jenseits des Meers in unser Lager zurückkehrte. Mein halbes Leben war sie fort gewesen, und wann immer meine Großmutter, meine Tanten und die anderen Kriegerinnen von der großen Königin Otrere sprachen, war ich zerrissen zwischen der Bewunderung für diese Fremde, an die ich mich nicht erinnern konnte, und der Wut, weil sie mich so früh im Stich gelassen hatte, um mit meinem Vater und meinen Schwestern im fernen Ephesos zusammenzuleben. Es war schwer, sich nach einer Mutter zu sehnen, von der ich nicht mehr wusste als das, was mir über sie erzählt wurde. Wie sie mich in meinen ersten zwei Lebensjahren aufgezogen hatte, wusste ich ja nicht. Da war nur die Wut, weil sie nicht mehr hier war.
Meine Tante Melanippe hatte versucht, mir zu erklären, warum ich nicht bei meiner Mutter war. »Du gehörst hierher«, sagte sie immer wieder. »Du wirst eines Tages Königin der Skythen. Darum hat sie dich bei uns gelassen. Damit du das Kämpfen lernst. Damit du unsere Lebensweise verinnerlichst. Damit du weißt, was es heißt, eine Skythin zu sein und wofür wir kämpfen. Sie hat deiner Großmutter und mir das Wertvollste anvertraut, was es für sie gibt. Und wir achten auf dich, als wärst du unser eigenes Kind.«
Aber warum sollte ich all das lernen, was von mir erwartet wurde, wenn nicht mal meine Mutter sich für dieses Leben zu interessieren schien? War es nicht gleichgültig, was ich wollte, wenn meine Mutter so offensichtlich nicht als Skythin bei uns leben wollte?
Mit ihrer Rückkehr änderte sich alles.
Sie umarmte mich, und ich spürte, dass ich zu ihr gehörte. Dass das Band, dass sie in meinen ersten zwei Lebensjahren zu mir geknüpft hatte, nicht durch die Trennung zerrissen war, sondern sich sofort wieder neu knüpfte. Sie war für mich da, und ich wich ihr nicht von der Seite. Erst als sie aufbrach, um gegen die Thraker zu kämpfen, musste ich von ihr Abschied nehmen. Und als sie kurze Zeit später zurückkehrte, weil die Thraker ihrerseits drohten, unser Lager anzugreifen, galt ihre größte Sorge meiner Sicherheit. Mein Überleben musste gesichert sein, damit ich ihr nachfolgen konnte, falls sie im Kampf fiel. Unsere Feinde drohten, in das skythische Herzland im Innern der Steppe vorzudringen und uns endgültig zu vernichten, nachdem seit so vielen Jahren immer wieder Krieg zwischen uns herrschte.
Ich musste mich mit meiner Amme Kijina und ihrer Familie verstecken. Das Lager ließen wir leer zurück, um die Thraker in einen Hinterhalt zu locken.
Der Plan glückte, die Thraker wurden besiegt. Die Skythen feierten Königin Otrere. Für ihren Mut, für ihre Entschlossenheit, für ihre Tapferkeit. Niemand sprach mehr darüber, dass sie drei Jahre lang fort gewesen war, um mit meinem Vater im fernen Ephesos zu leben und zwei weitere Kinder zu bekommen.
Meine Schwester Penthesilea kam wenig später zu uns. Sie und unsere Schwester Antiope, die ein halbes Jahr danach auf der Steppe geboren wurde, schloss ich sofort ins Herz. Wir waren eine Familie. Meine Mutter, meine Tante, meine Großmutter, meine Schwestern. Meinen Vater vermisste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Wenn ich nach ihm fragte, strich meine Mutter mir übers Haar.
»Er gehört nicht hierher«, sagte sie.
Doch er gehörte zu uns.
Als meine Mutter uns im Sommer darauf mitnahm und wir über das Pontische Meer nach Ionien segelten, begriff ich, dass es eine Welt jenseits der Grassteppe gab, die viel größer und unfassbar schön war. Ich erfuhr, dass mein Vater unter den Achaiern lebte, weil es ihm gefiel, wie sie ehrfürchtig von ihm sprachen. Dass er jedoch genauso oft auf den Olymp zurückkehrte, die Heimstatt der achaischen Götter, wo er unter seinesgleichen leben konnte. Nichts zog ihn zu uns Skythen, denn dort war er ein Niemand. Keiner betete zu ihm. Bei den Achaiern war er der Kriegsgott, den sie fürchteten. Bei uns hatte keiner Angst vor ihm. Viel später begriff ich, dass es nicht nur um seinen verletzten Stolz ging; meine Mutter wollte ihn auch nicht länger in unserem Reich dulden.
Um ihm näher zu sein und zugleich ihre Unabhängigkeit zu wahren, um das skythische Volk zu retten und sich nicht der Zukunft zu verschließen, gründete meine Mutter Otrere eine Stadt jenseits des Meers und nannte sie Themiskyra. Dort sollten wir leben.
Themiskyra war nicht so wie die achaischen Städte. Zumindest behauptete meine Mutter das. Hinter hohen Mauern lagen die Häuser der Skythen, im Zentrum der Stadt der Palast auf einem Hügel. Vor den Toren der Stadt erstreckten sich Gärten und Felder auf der Ebene, und in den Bergen ringsum waren sommers die Ziegenhirten mit ihren kleinen Herden unterwegs. Es war anfangs nicht mehr gewesen als der Versuch, die achaische Lebensart jenen Skythen anzubieten, die sonst nach Tyras oder in andere achaische Koloniestädte gezogen wären, wo sie für uns verloren gewesen wären. Der Plan meiner Mutter ging auf. Viele Skythen folgten ihr nach Themiskyra, und ein großer Stolz erfüllte viele, wann immer sie von der neuen Hauptstadt im Süden redeten.
Doch ich hasste dieses andere Leben vom ersten Tag an. So wie ich die Achaier hasste, wie ich auch meinen Vater hassen wollte, weil er mir dieses Leben aufzwang. Nur war es mit ihm so ähnlich wie mit meiner Mutter. Als ich ihn zum ersten Mal wiedersah nach so vielen Jahren, erkannte ich sofort, wie viel Liebe er für mich empfand. Und seine väterliche Liebe, sein Stolz auf mich, all das ließ mich hineinwachsen in die Rolle, die mir das Schicksal zugedacht hatte.
Prinzessin. Halbgöttin. Heldin.
Die Achaier würden sagen, dass zwischen meinem Vater und mir nur Groll war, Blitz und Donner, die Zeus von der Heimstatt der achaischen Götter auf dem Olymp auf die Erde niederschleuderte. Das stimmte gar nicht. Mein Vater war mir anfangs fremd, doch bei unserer ersten Begegnung schon gewann er mein Herz. Danach wich ich ihm nicht von der Seite, und meine Mutter sagte, das wunderte sie nicht. »Er hat dich aus der Zwischenwelt zurückgeholt«, sagte sie. Anfangs wusste ich nichts mit diesen Worten anzufangen, aber von dieser Zwischenwelt, aus der ich einst gerettet worden war, sprach sie andächtig, als handle es sich um einen heiligen Ort. Als wäre dort mein Schicksal, meine Zukunft, meine Bestimmung besiegelt worden.
So war es auch. Aber erst viel später sollte ich die ganze Geschichte erfahren.
2
Ich wuchs auf der Steppe auf, weil die Stadt kein Ort war, um Kinder aufzuziehen. Das sagte zumindest meine Mutter.
Wie kann ich jemandem, der nur das Leben hinter hohen Mauern kennt, verdeutlichen, warum sie recht hatte?
Auf der Steppe ist alles anders. Die Elemente berühren Körper und Herz ganz anders, wenn du nur in einem Zelt oder auf einem Karren Schutz vor dem beißenden Ostwind suchen kannst. Wenn im Winter die Kälte alles erstarren lässt, werden Mensch und Tier in einen langsameren Rhythmus gezwungen. Die dunklen Monate verbringen wir meist nah beisammen, wir singen Lieder und erzählen Geschichten, und in den größeren Zelten wärmen wir uns an den Herdfeuern, über denen wir gemeinsam die kargen Mahlzeiten zubereiten. Wenn sich die Vorräte neigen, werden die Tage schon wieder spürbar länger, und wenn die ersten zarten Triebe auf der Steppe hervorspitzen, wenn bald darauf die Tulpen und Krokusse die Ebene überziehen, dann wissen wir, dass wir wieder einen Winter überstanden haben. Dann dauert es nicht mehr lang, bis die ersten zarten Wurzeln und die ersten Blätter unseren kargen Speiseplan bereichern. Nun üben wir uns nicht mehr im Kampf, damit uns warm wird. Wir können mit jedem Sonnentag etwas mehr Kleidung ablegen. Den Winter aus den Pelzen und Decken klopfen. Der Jahreslauf, der aus jagen und sammeln, ernten und schlachten besteht, beginnt aufs Neue.
Im Sommer kennen wir nur eine Pflicht: Vorräte anlegen für den kommenden Winter. Beeren und Pilze sammeln und trocknen, wilde Zwiebeln flechten wir zu Zöpfen und hängen sie mit Büscheln duftender Kräuter unter die Balken unserer Karren. Decken und Goldschmuck tauschen wir bei durchreisenden Händlern gegen Hirse und Öl. Gelegentlich können wir auch ein seltenes Fell eines Schneeleoparden oder Löwen anbieten, jedoch behalten wir diese meist selbst.
Im Herbst versammeln sich viele skythische Sippen am Ufer des Borysthenes. Hier werden Verlobungen geschlossen, es wird Recht gesprochen, gehandelt und getauscht. Es ist wie ein großes Fest, bevor die Sippen sich in ihren Zelten und Karren einigeln und nach einem letzten Schlachtfest kurz vor der Wintersonnenwende in der Stille aus Schnee und Kälte erstarren.
Auf der Steppe hat unser Jahr einen Rhythmus. Jeder Tag ist anders, und doch sind sie verlässlich in ihrer Regelmäßigkeit. Wenn man dieses Leben gewohnt ist, mit all seinen Härten, die es mit sich bringt, lernt man, es zu lieben. Wir Kinder können wählen, wo wir uns einbringen: ob wir uns zu Kriegerinnen ausbilden lassen wollen oder doch eher in der Nähe der Herdfeuer bleiben. Für mich wurde früh entschieden, wohin ich gehörte.
Es mag merkwürdig anmuten, dass ausgerechnet meine Mutter, die im Rhythmus der Natur auf der Steppe aufgewachsen war und stets betonte, dass ich dorthin gehörte, uns schon kurz nach der Gründung von Themiskyra zum ersten Mal dorthin mitnahm. Damals zählte ich gerade sechs Sommer, und meine Erinnerung an die Seereise über das Pontische Meer Richtung Süden ist allenfalls verschwommen. Penthesilea war damals eine trotzige Dreijährige, und Antiope lag als Säugling die meiste Zeit friedlich in einem Weidenkorb und blickte verzückt zu den Segeln auf, die sich im Wind blähten.
In Ionien hatte meine Mutter am Ufer des Flusses Thermodon, gelegen im Schatten bewaldeter Hügel, die sich zu zerklüfteten Bergen auftürmten, ein Stück Land abstecken lassen. Sie gab der Siedlung, die dort schon bald entstand, den Namen Themiskyra.
Die erste Stadt der Skythen, die den Namen auch verdiente. Es gab schon seit Langem eine Siedlung weit im Norden, wo die Steppe fruchtbar war und sich manche Skythen niederließen, um Hirse anzubauen und in einem großen Stammesverbund zusammenzuleben. Auch die beiden anderen Könige der Skythen, alte zahnlose Onkel meiner Mutter, lebten in Mamai-Gora. Doch sobald ich das erste Mal bewusst Themiskyra oder die achaischen Palaststädte wahrnahm, erkannte ich, dass Mamai-Gora nur ein Schatten dessen war, was hätte möglich sein können.
Für Otrere war das Leben in einer Stadt, hinter hohen Mauern versteckt und in winzigen Behausungen eingepfercht, nie erstrebenswert gewesen. Auch aus Stein erbaute, prächtige Paläste bereiteten ihr Unwohlsein, sie wohnte dort nicht gern. Sie tat es trotzdem. Weil sie den Wandel nicht aufhalten konnte, der durch den Kontakt mit den Achaiern über unser Volk gekommen war. Viele Skythen wandten sich von dem entbehrungsreichen Leben auf der Steppe ab, sie erhofften sich in den Städten mehr Sicherheit, Nahrung und Schutz.
Dass ausgerechnet meine Mutter diese Stadt am Thermodon gründete, noch dazu so nah bei den Achaiern, verstand ich lange nicht. Es ergab überhaupt keinen Sinn für mich. Bis ich sah, wie Themiskyra meine Mutter empfing. Wie die Menschen dort auf sie reagierten. Sie jubelten ihr zu, als sie durch die Straßen zu dem Palast schritt, der damals noch eine Baustelle war. Sie wollte mir das alles zeigen, denn eines Tages sollte es mir gehören.
Einst wurden unsere Könige in Mamai-Gora gewählt. Wenn ein König starb, kamen die Skythen dort zusammen und wählten aus ihren Reihen neu. Da es seit Anbeginn der Zeit immer drei skythische Könige gab, passierte dies ziemlich häufig. Könige starben in der Schlacht, manchmal kämpften sie auch gegeneinander, weil sie in Streit gerieten, wer gerade wie viel Macht haben sollte.
Doch spätestens mit meinem Großvater Mazjar änderte sich das. Wir gaben diesen Ort auf und überließen ihn den greisen, machtlosen Mitkönigen, die sich verzweifelt daran klammerten, ein Mitspracherecht zu haben. Hatten sie aber nicht. Keiner fragte sie.
Denn die Macht war bei uns. Bei meiner Familie. Sie war nicht länger an einen bestimmten Ort gebunden, sondern nun fest verknüpft mit den Personen, die diese Macht ausübten.
Die Macht, das war meine Tante Melanippe, die mit ihren Kämpferinnen, denen der Ruf von den Amazonen vorauseilte, über die Steppe ritt und die Thraker, Kimmerer und Achaier, die es wagten, in unser Reich einzudringen, zurückschlug.
Die Macht, das war meine Großmutter Barkida, deren sieben Kinder in alle Himmelsrichtungen verstreut lebten und die die Grenzen unseres Reichs sicherten.
Die Macht, das war vor allem meine Mutter Otrere. Königin des skythischen Volks. Geliebte des achaischen Kriegsgott Ares. Mutter von drei Töchtern: Penthesilea, Antiope und als Älteste ich, Hippolyte.
Die Macht, das waren wir drei. Denn nachdem sie ihre greisen Onkel in Mamai-Gora endgültig von ihrem Thron gestoßen hatte, stand für meine Mutter fest, dass meine Schwestern und ich ihr einst nachfolgen würden.
Ich zählte acht Sommer, als sie mich zum zweiten Mal nach Themiskyra mitnahm. In den vergangenen drei Jahren war die Stadt am Thermodon von einer Ansammlung von Zelten und Erdhöhlen zu einer Stadt herangewachsen, in der über tausend Skythen lebten – eine für mich unvorstellbar große Zahl. Die Stadtmauern wuchsen ebenso in die Höhe wie die Häuser und Paläste der reichen Bürger. Sogar ein paar achaische Händler und Handwerker hatten sich inzwischen in der Stadt niedergelassen und einen Tempel gebaut, den sie Apollon widmeten.
»Natürlich Apollon«, knurrte meine Mutter, als sie davon erfuhr. Aber dann lachte sie, denn sie war dem achaischen Gott der Heilkunst einmal begegnet, als er meine Tante Melanippe von ihrem Krebsgeschwür heilte. Sie war ihm dankbar für das, was er damals getan hatte. Was aber nicht hieß, dass sie ihn in ihrer Stadt duldete.
Die Skythen bauten keine Tempel. Sie verließen sich bei der Anbetung ihrer Götter auf die Enaree – Hohepriester, die im Kontakt mit Tabiti und den anderen Göttern standen und uns mitteilten, welche Opfer sie von uns verlangten. Einer der Enaree war mein Onkel Maspi, der mit seiner achaischen Frau und seinen Söhnen in Tyras lebte – einer achaischen Stadt an der Nordküste des Pontischen Meers. Einst kamen die Achaier in unser Land, besetzten den Küstenstreifen und bauten ihre Tempel und Paläste. Als meine Mutter es an ihrer Küste im Süden ihnen gleichtat und Themiskyra aufbaute, sorgte dies für Unruhe unter den Achaiern.
Verhindern konnten sie den Bau unserer Stadt allerdings nicht, und nach drei Jahren hatte sich ein brüchiger Frieden etabliert, der vermutlich nur so lange hielt, bis ein Jägertrupp aus Themiskyra versehentlich die Ziege eines ionischen Hirten schoss und die nur mühsam verhohlene Feindseligkeit wieder aufbrach.
Als unser Schiff im Hafen von Themiskyra vor Anker ging, atmete meine Mutter auf. Sie hüllte sich in ihren blauen Mantel und stand auf. Mit meiner jüngsten Schwester Antiope auf dem Arm verließ sie das Schiff, das uns sicher über das ruhige Meer gebracht hatte. Ich folgte ihr mit Penthesilea an der Hand. Wir wurden nicht seekrank, sobald wir die Planken eines Schiffs unter unseren Füßen spürten. Dafür sollten wir wohl dankbar sein, denn für unsere Mutter bedeutete jede Überfahrt, dass sie tagelang von Übelkeit geplagt wurde.
Der Hafen von Themiskyra bestand aus kaum mehr als ein paar befestigten Stegen, einer Handvoll Lagerhäuser und einem kleinen Leuchtturm, der weniger vor dem flachen Wasser warnte als vielmehr die Reisenden an unsere Küste leitete. Meine Mutter winkte uns ungeduldig, damit wir ihr folgten. Eine Handvoll skythische Kriegerinnen, die unserem Schutz dienten, liefen vor und hinter uns. Mit grimmigen Blicken hinderten sie die Seeleute daran, uns zu nahe zu kommen.
Ich hörte dennoch, was sie flüsterten. »Die Königin ist da«, und mancher neigte ehrfürchtig den Kopf vor meiner Mutter.
In Themiskyra waren die Wege nicht weit, wir erreichten schon kurz darauf den Palast, den meine Mutter im Zentrum der Stadt für sich hatte erbauen lassen. Ich starrte auf die bunt bemalten und vergoldeten Säulen, die das Eingangstor flankierten, das mit Bronze beschlagen und aus Eichenholz gefertigt war. Die Kriegerin Pardis, die neben mir ging, lächelte. »Man sieht dir das Staunen an, kleine Hippolyte.«
Ich drückte Penthesileas Hand fester und blickte Pardis finster an, obwohl sie unter den Amazonen eine der liebsten war. Einst hatte ihre Schwester Nushaba sich mit Melanippe um mich gekümmert. Aber Nushaba war tot, gestorben beim Angriff der Thraker auf unser Herzland, und Melanippe verließ die Steppe noch viel widerstrebender als ich.
»Es ist ein Palast, der einer Königin angemessen ist«, erwiderte ich würdevoll. So würdevoll wie eine Achtjährige nun mal sprechen konnte, die ihre Bewunderung kaum verhehlen konnte.
»Wahr gesprochen, Prinzessin.« Sie lächelte mich aufmunternd an, dann ließ sie sich etwas zurückfallen, damit ich vor ihr den Innenhof des Palasts betreten konnte.
Wir wurden von den Dienerinnen begrüßt, und meine Mutter ließ sogleich nach meinem Onkel schicken, der während ihrer Abwesenheit Statthalter von Themiskyra war. Sie winkte Penthesilea und mich an ihre Seite. Penthesilea schmiegte sich an sie, ich stand aufrecht an ihrer anderen Seite. Gern hätte ich mich auch an ihren blauen Umhang mit der goldenen Stickerei geklammert, doch ich verschränkte die Finger hinter dem Rücken. Keine Schwäche zeigen. Niemals.
So hatte es mich Melanippe gelehrt.
»Königin Otrere!«
Die helle Stimme einer Frau, die durch eine hohe Tür in den Hof trat, ließ mich aufblicken. Sie schritt weit aus. Über dem hellroten Chiton trug sie einen dunkelroten Mantel, und hinter ihr drängten drei rotznasige Jungen in den Hof, die mich und meine Schwestern sogleich misstrauisch beäugten. Sie waren in die kurzen Chitons gekleidet, in die Achaier ihre Kinder steckten. Die drei Jungen waren ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten, die nun mit weit ausgebreiteten Armen auf meine Mutter zukam und sie in die Arme schloss.
»Wie gut, dass ihr heil angekommen seid. Ich hörte von Stürmen auf dem Pontischen Meer.«
»Sie haben uns zum Glück verschont.« Meine Mutter verzog das Gesicht. Es war in unserer Familie ein offenes Geheimnis, wie sehr Otrere das Meer hasste. Was sie nicht daran hinderte, es regelmäßig zu überqueren, wenn sie zwischen unserem Reich im Norden des Pontischen Meers und Themiskyra im Süden hin und her pendelte.
»Du bist diesmal nicht allein gekommen.« Der Blick, mit dem die Frau uns maß, war schwer zu deuten. Nicht direkt feindselig, aber etwas Abschätziges lag darin, als wüsste sie noch nicht, was sie davon halten sollte, wenn die Königin mit den drei Prinzessinnen in ihrem eigenen Palast aufkreuzte.
»Wo ist mein Bruder?«, fragte meine Mutter.
»Er wird irgendwo in der Stadt herumlaufen. Mit den Menschen reden. Sie brauchen immer viel Zuspruch.«
Selbst ich erkannte mit meinen acht Jahren die Kritik, die in ihren Worten mitschwang.
»Nun denn.« Meine Mutter legte die Hand auf meine Schulter. »Deine Tante Afina und deine Cousins leben mit deinem Onkel das ganze Jahr in Themiskyra, Hippolyte. Maspi verwaltet die Stadt für uns.«
Das wusste ich, aber ich nickte ernst, als sei dies eine neue Information für mich. »Hippolyte, Penthesilea und Antiope werden in meinen Gemächern wohnen«, fügte sie an Afina gewandt hinzu. Sie neigte den Kopf.
»Wie du wünschst, Königin Otrere.« Sie klang leicht spöttisch, und dies war der Moment, in dem ich mich fragte, ob tatsächlich meine Mutter Macht über diesen Palast, die Stadt und die Menschen, die hier lebten, besaß, oder ob nicht eher Afina und mein Onkel Maspi die wahren Herrscher von Themiskyra waren.
Ich hatte ja keine Ahnung.
Wir wurden in den Palast geführt. Ich ging an Afinas Söhnen vorbei, ohne sie eines Blicks zu würdigen, und der Älteste von ihnen zischte meiner Mutter ein feindseliges »Männermörder« hinterher.
»Still!«, herrschte Afina ihre Söhne an. »Wir beschimpfen hier niemanden, hört ihr?« Sie zerrte den Ältesten am Oberarm von uns weg. »Entschuldige dich bei deiner Tante, Petros. Verzeih, Königin Otrere.« Auf einmal war alle Überheblichkeit aus Afinas Miene gewichen, und sie zog den Kopf zwischen die Schultern.
Meine Mutter lächelte kalt. »Ist schon in Ordnung«, sagte sie leise.
Aber nichts war in Ordnung. Ich spürte, wie viel Hass und Abneigung von meinen Cousins ausging. Sie verabscheuten uns, weil wir Kriegerinnen waren, während sie selbst in Themiskyra als Prinzen ohne Königreich aufwuchsen. Ich reckte leicht das Kinn und wollte mich ihnen überlegen fühlen. Dabei wusste ich zu wenig über die Welt, in der sie lebten. Die sich so sehr von unserer Welt unterschied. Mein Staunen über die Pracht des Palasts und über die vielen Menschen sah man mir wohl an, denn meine Mutter ließ sich etwas zurückfallen. »Du starrst«, sagte sie leise.
Ich nickte stumm.
»Wir reden später über das, was du hier siehst. Aber lass dir nicht einreden, wir seien weniger wert, weil wir auf der Steppe leben. Du bist die Prinzessin der Skythen und die Tochter eines Gotts.«
Als ließe sie mich das je vergessen. Ich schritt neben ihr durch die hell erleuchteten Gänge und folgte einer Sklavin, die uns in große, helle Gemächer führte. Mehrere Räume gingen ineinander über, üppig ausgestattet mit Teppichen, Sesseln und Betten, auf denen sich Pelze und Decken häuften; Holztruhen standen an den Wänden aufgereiht. Die Räume waren um einen Innenhof gruppiert, in dem ein großes Wasserbecken mit einem Springbrunnen von vielen üppigen Pflanzen umgeben zum Verweilen einlud. Ein wenig Grün an diesem versteinerten, fremden Ort. Ich trat in den Hof, während meine Schwestern die einzelnen Gemächer erkundeten und sich gegenseitig zuriefen, was sie entdeckten. Penthesileas helles Lachen hallte durch die Räume, während Antiope vergnügt krähte und mit einem »Penthe, Penthe!« hinter unserer Schwester her wackelte. Ich wandte mich ab. Meine Finger berührten die Blätter eines Olivenbaums.
Meine Mutter trat zu mir und legte mir eine Hand auf die Schulter. »Ich weiß, was du denkst«, sagte sie leise. »Wie können wir an so einem Ort glücklich werden, der uns so fremd erscheint?«
Ich sagte nichts. Ich war ein Kind, und wohin unsere Mutter ging, begleitete ich sie. Es war das zweite Mal, dass sie mich nach Themiskyra mitgenommen hatte. Doch bei meinem ersten Besuch hatte der Palast noch nicht mal ein Dach gehabt. Nun erstrahlte er in all seiner Pracht und machte mich sprachlos. Otrere musterte mich, als erwartete sie eine Antwort von mir, deshalb räusperte ich mich.
»Werden wir für immer hier leben?«
Sie lächelte und legte eine Hand auf meine Wange. »Ach, Hippolyte … Ihr müsst hier nicht leben. Ich lasse euch die Wahl. Ihr könnt hier leben oder auf der Steppe bei deiner Tante Mela und Großmutter Barkida.«
»Wann darf ich zurück?«
Sie drückte meine Schulter. »Warte doch erst mal ab«, sagte sie munter. »Bald kommt dein Vater, und vielleicht änderst du deine Meinung noch.«
Ich schüttelte den Kopf. Niemals würde ich diesen Ort mögen, an dem meine Mutter als Männermörderin beschimpft wurde und der aus riesigen Steinklötzen gemauert war. Was an diesem Leben sollte mir denn gefallen?
Mein Vater. Dass er hier sein würde, das gefiel mir schon. Denn meine Mutter verbot ihm, uns draußen bei unserem Volk aufzusuchen. Zuletzt hatte sein Auftauchen bei den Skythen für Unruhe gesorgt. Er war nicht irgendein Gott, sondern der Gott des Kriegs. Wir waren ein Volk, das es gewohnt war, zu kämpfen. Doch der Kriegsgott eines fremden Volks unter uns, das empfanden viele als eine Bedrohung, als die Prophezeiung eines Kampfs gegen sein Volk, den wir nicht führen wollten.
Ich wusste, dass meine Mutter oft bei ihm war. Entweder hier in Themiskyra oder in Ephesos, einer Stadt weiter südwestlich. Dort lebten sie in einem ähnlichen Palast zusammen, und meine Mutter überwachte den Bau eines Tempels für die achaische Göttin Artemis. Als gehörte sie schon längst nicht mehr zu uns Skythen.
Doch sie war unsere Königin. Melanippe hatte es mir so erklärt: meine Mutter war frei darin, wie sie ihre Herrschaft gestaltete. Einst hatte sie sich gegen den achaischen Einfluss gewehrt, denn sie fürchtete, damit werde unser Volk seine Identität verlieren. Inzwischen hatte Otrere begriffen, dass es sinnlos war, sich dem kulturellen Austausch zwischen den Achaiern und den Skythen entgegenzustellen, und sie setzte nun ihre Kraft darein, den Austausch selbst zu steuern.
Sie wollte nicht, dass die Achaier in uns nur die Kriegerinnen sahen, die marodierend und brandschatzend über die Steppe zogen und die Achaier und Thraker niedermetzelten. Für meine Mutter waren die Skythen mehr als das. Es gab Händler unter ihnen, Handwerker und Bauern. Der Wunsch vieler Skythen nach einer Alternative zu dem entbehrungsreichen Leben auf der Steppe hatte dazu geführt, dass sie sich zunächst in den achaischen Siedlungen niederließen, und schließlich waren viele Wagemutige meiner Mutter nach Themiskyra gefolgt.
Wenn es danach ging, war ich nicht mutig. Ich hasste die Stadt, ich hasste es, dass ich mein Pferd hatte zurücklassen müssen. Nicht mal meinen Bogen hatte ich mitnehmen dürfen, und hier in Themiskyra sollte ich mich gefälligst wie eine Prinzessin benehmen, sollte Kleider tragen und nicht ständig in Hosen herumrennen. Dabei gab es nichts Bequemeres als skythische Kleidung.
Meine Mutter ließ mich anfangs gewähren. Sie dachte wohl, es falle mir leichter, mich in der Stadt einzugewöhnen, wenn sie mir ein Stückweit diesen Freiraum ließe. Schon bald tollten Penthesilea und Antiope in achaischen Kleidern durch den Palast, sie spielten Fangen in den Gängen und wurden von einer Sklavin beaufsichtigt. Ich entwischte ihr regelmäßig und ging auf eigene Faust auf Erkundungstour. Am häufigsten zog es mich in die Ställe, wo ich stundenlang von einem Pferd zum nächsten ging, ihre weichen Nasen streichelte, das Gesicht in ihren Mähnen vergrub und wünschte, ich könnte mich einfach auf einen Pferderücken schwingen und davonreiten. Raus aus der Stadt, weiter und immer weiter über die Ebene bis in die bewaldeten Berge und darüber hinaus. Doch im Stall hatte immer eine Kriegerin ein Auge auf mich. Meist war es Pardis, die sich zu mir gesellte, aber sie sprach mich nie auf meine gedrückte Stimmung an, sondern lächelte mich immer wieder verständnisvoll an. Ich vermutete, es ging ihr ähnlich; auch sie sehnte sich nach der Steppe.
3
Schon wenige Tage nach unserer Ankunft in Themiskyra kam es zu einem Streit mit meiner Mutter. Sie hatte direkt nach unserer Ankunft Gäste eingeladen, die sich offensichtlich sofort auf den Weg machten, sobald sie von Otrere hörten. Mein Vater hingegen ließ sich nicht blicken. Doch der Besuch sorgte für helle Aufregung im Palast.
Meine Mutter bestand darauf, unsere Auswahl der Kleider für das abendliche Festmahl zu überwachen. Wir waren im Grunde noch viel zu jung, um daran teilzunehmen, doch sie beharrte darauf, dass wir zumindest zu Beginn der Festlichkeit anwesend waren, damit der benachbarte König und sein Gefolge uns kennenlernen konnten.
»Er hat mehrere Söhne«, erklärte sie mir, als sei das ein großes Glück, während zwei Sklavinnen ein halbes Dutzend Kleider aus einer der Truhen in meinem Schlafgemach zogen und auf dem Bett ausbreiteten. Ratlos starrte ich auf die zarten Seidenstoffe, die rot, blau, grün und golden gefärbt waren. »Kann ich nicht meine Hose anbehalten?«, maulte ich.
»Du ziehst etwas Hübsches an. Nicht deine Kriegerinnenkluft.« Meine Mutter strich prüfend über die Stoffe. Dabei umspielte ein wehmütiges Lächeln ihre Lippen. »Ich wünschte, es wäre anders, Hippolyte. Aber wir sind in Themiskyra, und unsere Gäste sind ebenfalls Könige. Hier gelten andere Regeln, als wenn sie uns draußen auf der Steppe besuchen.«
Ich verschränkte die Arme vor der Brust. »Ich will aber gar nicht hier sein«, erwiderte ich finster. »Du hast mir versprochen, dass unser Vater herkommen wird. Kommt er auch heute Abend?«
Meine Mutter hielt inne. »Das weiß ich nicht«, erwiderte sie leise.
Ich stampfte auf. »Warum nicht? Du hast es mir versprochen.«
Das war nicht ganz richtig. Sie hatte mir nur versichert, er werde auch bald nach Themiskyra kommen. Wann genau das sein würde, ließ sie offen. Für Götter war Zeit vermutlich ein dehnbarer Begriff – welchen Unterschied machten angesichts der eigenen Ewigkeit schon ein paar Tage, Mondenläufe oder Jahre?
»Weil dein Vater macht, was er will. Er …« Sie biss sich auf die Unterlippe. Ich sah ihr an, dass sie mehr sagen wollte, doch sie unterließ es, weil sie nicht mit einer Achtjährigen über Dinge sprechen konnte, die für sie selbst so schwierig waren. Sie wollte mich nicht auch noch damit belasten.
»Ich hab keinen Bock auf diesen König und seine Söhne.« Trotzig verschränkte ich die Arme vor der Brust.
»Schau sie dir doch wenigstens an«, sagte meine Mutter ruhig.
Penthesilea kam hereingewirbelt, sie trug bereits ein rotes Kleid, das über den Boden schleifte. »Mama, Mama! So wird mich der Prinz von Troja bestimmt als seine Braut wählen!«, jubelte sie und raffte das Kleid, damit wir ihre mit Goldplättchen bestickten Sandalen bewundern konnten.
»Troja?«, fragte ich. Von diesem Reich hatte ich noch nie gehört. Ich wusste, dass es die Achaier gab, die sich wiederum in verschiedene Gruppen und Reiche aufteilten. Von Troja hörte ich zum ersten Mal.
»Der König von Troja ist heute Abend unser Gast«, erklärte meine Mutter ruhig. »Er ist sehr mächtig, und er hat seine Frau und seinen ältesten Sohn und eine Tochter mitgebracht«, fuhr sie fort, ohne mich aus den Augen zu lassen. »Wir möchten, dass Hektor und du euch kennenlernt.«
Ich kaute auf meiner Unterlippe herum. »Wieso?«, wollte ich wissen.
»Weil du nach mir die Königin der Skythen wirst, und Hektor wird der König der Troer, wenn sein Vater Priamos nicht mehr ist. Wir sind Nachbarn. Eines Tages werdet ihr herrschen. Deshalb.«
Ich nickte.
»Aber ich will Hektor heiraten!«, mischte sich Penthe ein. Sie schob die Unterlippe vor. Meine Mutter ging vor ihr in die Hocke. »Für dich finden wir auch noch einen Prinzen, meine Schöne«, versprach sie ihr.
Ob meine Mutter damals genau daran dachte? Dass Hektor ein guter Ehemann für mich wäre? Kein Skythe, aber was viel wichtiger war: kein Achaier. Und König über ein benachbartes Reich, das man dann mit unserem vereinigen könnte.
Rückblickend kann ich nicht sagen, ob meine Mutter darauf spekulierte. Gut möglich, dass sie schon zu diesem Zeitpunkt die Vision hatte, unser Schicksal mit dem von Troja eng zu verknüpfen.
Ich wählte ein grünes Kleid aus und ließ mich von einer Sklavin frisieren. Sie verrieb eine rote Paste auf meinen Lippen und meinen Wangenknochen, bevor sie zufrieden das Ergebnis ihrer Bemühungen musterte. Meine Mutter hatte sich in der Zwischenzeit ebenfalls umgezogen. Sie trug ein gold glänzendes Kleid, dazu einen roten Ledergürtel und Goldschmuck mit Rubinsplittern. Die Krone saß auf ihren Haaren, die zu Zöpfen geflochten um ihren Scheitel festgesteckt waren. Zum Schluss mussten ihr zwei Sklavinnen in den roten Mantel helfen, der mit zahllosen, dünnen Goldplättchen bestickt war, die bei jedem Schritt leise klirrten.
Penthesilea und Antiope stolperten vor Aufregung fast über ihre eigenen Füße. Meine Mutter ging voran, und ich hörte meine Schwestern hinter mir kichern, während ich ihr folgte. Wir gingen zum Thronsaal, dessen hohe Eichenholztüren verschlossen waren. Davor wartete bereits ein Dutzend Kriegerinnen auf uns. Sie trugen die traditionelle Uniform der skythischen Kämpferinnen: gewebte Wollhosen und blaue Tuniken, darüber ein Lederpanzer und an den Füßen weiche hellbraune Stiefel aus Ziegenleder, die bis zu den Knien geschnürt waren. Jede hielt eine Streitaxt in der Hand und hatte einen Dolch am Gürtel.
Sie waren die Leibgarde meiner Mutter und begleiteten sie zu jedem offiziellen Auftritt. Nicht, weil meine Mutter um ihr Leben fürchtete, sondern weil jeder König und jede Königin es so hielt.
»Königin Otrere.« Pardis war die Erste der Kriegerinnen. Sie trat vor und verneigte sich vor meiner Mutter. »Bist du bereit?«
»Sind die Gäste bereits eingetroffen?«
»Ja.«
»Ist mein Bruder mit seiner Familie schon im Thronsaal?«
»Wie du es befohlen hast.«
»Warten sie schon lange?«
Die beiden lächelten einander zu, und ich begriff, dass sie dies nicht zum ersten Mal machten. Dass es auch darum ging, die Macht meiner Mutter zu untermauern.
»Alles ist so, wie du es wünschst.«
»Dann lass uns noch einen Moment warten.«
Stille senkte sich über uns. Nur Antiope wurde direkt unruhig; es war spät, und sie hatte Hunger. Meine Mutter hob sie hoch und kitzelte sie am Kinn, bis meine Schwester leise kicherte.
»Es ist soweit.« Meine Mutter ließ Antiope herunter, eine Sklavin nahm meine Schwestern an die Hand. Meine Mutter winkte mich zu sich heran. Sie straffte die Schultern. »Bereit?«, fragte sie.
Ich nickte tapfer.
Die Türen wurden aufgerissen, und wir schritten in den Thronsaal.
Ich hatte genickt, als meine Mutter mich fragte, ob ich bereit war, und eventuell hatte ich mich bereit gefühlt, soweit das ein achtjähriges Mädchen entscheiden konnte. Doch als ich mich den vielen fremden Menschen gegenüber sah, die sich bei unserer Ankunft ausnahmslos in unsere Richtung drehten, spürte ich, wie sich etwas tief in meinem Innern schmerzhaft zusammenzog. Meine Mutter ergriff meine Hand. »Ich weiß«, murmelte sie. »Schau geradeaus, und geh einfach im Gleichschritt mit mir.«
Ich hielt mich an ihrer Hand fest. Der Weg zu ihrem Thronsessel kam mir unendlich weit vor, dabei waren es gerade mal zwanzig Schritte. Die Menschen machten uns Platz. Ich folgte meiner Mutter die Stufen hoch auf das Podest, wo sie sich umdrehte und schweigend auf die Männer und Frauen blickte. Ich ließ ihre Hand los und war froh, dass die Sklavinnen meine Schwestern zu mir stellten, die sich sofort an mich drängten. Ich legte die Hand auf Penthesileas Schulter. Antiope drückte sich an mich, und ich streichelte ihre blonden Löckchen.
Stille.
»Willkommen, liebe Freunde. Ich begrüße euch in meinem Palast.« Meine Mutter blickte über alle Versammelten, und ich tat es ihr gleich. Ich erkannte meine Tante Afina mit ihren Söhnen; sie trug ein hellblaues Kleid, die Jungen waren jeweils in blaue Chitons gesteckt worden. Mein Onkel Maspi verbarg sein fehlendes Auge hinter einer Augenklappe, er hatte das Fell eines Schneeleoparden über seiner Tunika, die allerdings nicht aus Wolle, sondern aus Leinen gewebt und gefältelt war wie ein Chiton. Dazu trug er eine helle Hose und Stiefel – er war also eher skythisch gekleidet, wie es sich für den Enaree geziemte.
Mein Blick wanderte weiter. Alle anderen Gäste waren mir fremd. Eine Gruppe stand etwas abseits von den anderen: ein hochgewachsener Mann mit Spitzbart, einem Goldreif auf den grau melierten Locken und einer wunderschönen Frau an seiner Seite, die im Alter meiner Mutter war. Der Jüngling neben ihm trug einen Lederpanzer und war seinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten. Das war dann wohl Hektor. Neben ihm stand eine junge Frau, einige Jahre älter als er. Sie war so atemberaubend schön, dass sie alle anderen überstrahlte. Das musste Kassandra sein, die Tochter von König Priamos und Königin Hekabe. Von ihr erzählte man sich gar wundersame Geschichten. Einst soll der achaische Gott Apollon sie in der Kunst der Weissagung unterwiesen haben.
»Heute begrüßen wir als Ehrengäste an unserer Tafel König Priamos aus dem nahe gelegenen Königreich Troja. Danke, dass du mit deiner Familie unserer Einladung gefolgt bist.«
Meine Mutter machte eine weit ausholende Handbewegung. Der König trat mit seiner Familie vor, und sie verneigten sich vor uns. Ich blickte fragend zu meiner Mutter, die den Kopf neigte, und ich machte es ihr nach.
»Wir danken dir von Herzen für die Einladung, Königin Otrere. Das Bündnis zwischen Skythien und Troja ist ein wichtiger Pfeiler für den Frieden. Darf ich dir meine Gemahlin und meine Kinder vorstellen?«
»Sehr gerne.« Meine Mutter trat dem König entgegen, und die beiden umfassten die Unterarme des jeweils anderen und lächelten einander an. Dann stellte Priamos nacheinander seine Frau Hekabe, seinen ältesten Sohn Hektor und Kassandra vor. Meine Mutter gab mir ein Zeichen, und ich nahm Penthesileas und Antiopes Hände. Wir gesellten uns zu der trojanischen Königsfamilie und meiner Mutter, die uns ihrerseits vorstellte.
»Ah, Ares’ Töchter.« Priamos lächelte warm. »Ich habe schon viel von euch gehört.« Er sah sich um. »Dein Gemahl ist nicht zugegen?«
»Fasse es nicht als Geringschätzung deiner Familie auf, König Priamos.« Meine Mutter strahlte ihn an. »Aber Ares hat sein Leben noch nie an den Plänen seiner menschlichen Familie ausgerichtet. Vermutlich wird er durch göttliche Angelegenheiten aufgehalten.«
»Verstehe.«
»Lasst uns heute Abend dennoch feiern, dass wir zusammenkommen und sich unsere Familien ein wenig besser kennenlernen können.«
Meine Mutter klatschte in die Hände, und sogleich strömten zwei Dutzend Sklaven in den Saal und servierten auf großen Platten die köstlichsten Speisen. Zwei lange Tafeln erstreckten sich im Saal, und meine Mutter lud König Priamos und seine Familie ein, sich zu uns an die Kopfseite der einen Tafel zu setzen.
Es fügte sich, dass ich zwischen Hektor und seiner Mutter Hekabe Platz nahm, Priamos und Kassandra saßen uns gegenüber. Die Prinzessin musterte mich nachdenklich, und ich hatte das unangenehme Gefühl, dass in ihren Augen etwas Wissendes lag. Ich senkte den Blick.
Meine kleinen Schwestern wurden – wenn auch unter Protestgeheul seitens Penthesileas, die sich ausgeschlossen fühlte – aus dem Saal geführt. Königin Hekabe wandte sich an mich. »Ich gebe zu, ich war neugierig, dich kennenzulernen.« Sie musterte mich prüfend. »Du bist groß für dein Alter. Und recht hübsch.« Sie klang enttäuscht.
»Mit der Schönheit deiner Tochter kann sie es nicht aufnehmen«, sagte meine Mutter. Sie hob ihren Weinkelch. »Aber lasst uns lieber auf die Wehrhaftigkeit der tapferen Frauen trinken, die so viel mehr wert ist als jede Schönheit.«
»Weise gesprochen«, pflichtete König Priamos ihr sogleich bei und hob ebenfalls seinen Kelch. »Mögen unsere Töchter und Söhne friedlichen Zeiten entgegenblicken und unsere Völker in ewiger Freundschaft verbunden sein.« Er zwinkerte meiner Mutter zu. »Mir ist bewusst, dass der Frieden deinem Gemahl in vielerlei Hinsicht widerstreben muss.«
»Ich spreche für mich und nicht für meinen Gemahl«, erwiderte Otrere kühl. »Aber ich für meinen Teil habe genug Schlachten geschlagen und kann zukünftig gut darauf verzichten.«
»Dann steht einer friedlichen Zukunft nichts mehr im Wege. An uns soll es nicht liegen.«
Die Stimmung an diesem Abend war gelöst, beinahe fröhlich und ausgelassen. Meine Mutter plauderte mit König Priamos, während Königin Hekabe mich ausfragte. Sie reagierte überrascht, als ich ihr erzählte, ich werde von meiner Tante im Bogenschießen, Reiten und im Nahkampf mit der Streitaxt ausgebildet und habe fest vor, einst Kämpferin für die Skythen zu werden.
»Aber möchtest du nicht deiner Mutter folgen?«, fragte sie. »Königin werden?«
»Meine Mutter wird noch lange leben«, erklärte ich überzeugt.
So überzeugt, wie eine Achtjährige eben sein kann.
Hektor, der bisher schweigend neben mir gesessen hatte, hob erstmals den Blick. Er lächelte flüchtig. Ich schwärmte seiner Mutter davon vor, wie schön es sich anfühlte, auf dem Rücken eines Pferds über die Steppe zu galoppieren.
»Wir spannen unsere Pferde vor Streitwagen«, warf er ein.
Davon hatte ich noch nie gehört, und er erklärte es mir. Schon bald waren wir in eine angeregte Diskussion darüber verstrickt, ob ein Streitwagen vorteilhafter war oder eine Reiterin, die vom Pferderücken kämpfte.
»Ein Streitwagen ist viel unflexibler«, behauptete ich.
»Dann hast du noch nie gesehen, wie wir unsere Streitwagen lenken. Komm doch mit deinen Eltern nach Troja, um es dir anzusehen!«, schlug er vor.
»Eine hervorragende Idee«, mischte sich Hekabe ein. »Was hältst du davon, Königin Otrere?«
Meine Mutter neigte den Kopf. »Das machen wir sehr gerne.« Dabei sah sie mich nachdenklich an. Ich bemerkte, dass ihr Blick nicht nur auf mir, sondern auch auf dem hochgewachsenen, muskulösen Jüngling neben mir ruhte, als überlegte sie, ob Hektor und ich zueinander passten.
Ich hatte mein Urteil bereits gefällt. Der trojanische Prinz war nicht nur hübsch, sondern auch klug, und ich blickte zu ihm auf. Nicht nur, weil er sich so gewandt ausdrückte und so viel über die verschiedenen Kampftechniken wusste. Mir gefiel vor allem, dass er mich, ein achtjähriges Mädchen, als gleichwertige Gesprächspartnerin wahrnahm. An diesem Abend durfte ich zudem das erste Mal vom starken roten Wein kosten, der unseren Gästen kredenzt wurde, und während mein Kopf schwer wurde und sich alles um mich drehte, hörte ich mich sagen, was für ein kluger, tapferer Krieger Hektor sei. Er lächelte nachsichtig.
Als ich mich nach dem Gastmahl von Hektor verabschiedete, umarmte er mich flüchtig, und ich stellte mir vor, wie das wohl sein würde, als seine Königin eines Tages in Troja zu leben. Der Traum eines Kinds, der sich nie erfüllen sollte, aber sogar meine Mutter lächelte zufrieden, als sie mich zur Guten Nacht küsste, bevor ich von einer Sklavin aus dem Saal geführt wurde.
Ich bemerkte die Blicke der anderen Gäste. Und vielleicht bildete ich es mir ein, aber meine Tante Afina starrte mir finster nach. Sie sagte etwas zu meinem Onkel Maspi, der nur knapp den Kopf schüttelte.
Vielleicht meinte sie mich gar nicht. Aber ich konnte nicht vergessen, wie viel Hass ich in ihren dunklen Augen gesehen hatte.
4
In meiner Erinnerung verschwimmen die Tage unseres ersten Aufenthalts in Themiskyra zu einem steten Wirbel aus Festlichkeiten und viel Ausgelassenheit. Es muss wohl ein paar Tage nach der Abreise der trojanischen Königsfamilie gewesen sein, dass ich eines Abends in meinem Bett lag und nicht schlafen konnte. Am Tag hatte ich mich mit Penthesilea gestritten, die darauf beharrte, mit mir »Hochzeit mit Hektor« zu spielen, wobei sie natürlich die skythische Prinzessin sein wollte. »Du kannst kämpfen, also bist du der Mann!« Sie hatte mich so lange genervt, bis ich nachgab. Aber wir stritten immer wieder, weil ich fand, dass sie mich als Prinzessin zu mädchenhaft darstellte.
»Aber du wirst ihn ja gar nicht heiraten!«, verkündete Penthesilea. »Mama wird ihn bestimmt mit mir verheiraten, sonst würdet ihr ja über Troja und Skythien herrschen, als wäre es ein Reich. Das wird keiner wollen.«
Ich biss mir auf die Lippen. Stimmte das? Ich hatte keine Ahnung, und Penthe plapperte vermutlich auch nur das nach, was sie bei den Sklavinnen belauschte. Aber sie redeten über mich, und das störte mich und ließ mich nicht schlafen.
Aus dem Schlafgemach meiner Mutter hörte ich ein Geräusch, und ich setzte mich auf. Eine tiefe Stimme. Sofort war ich in Alarmbereitschaft. Hatten die Leibwächterinnen meiner Mutter nicht aufgepasst? War jemand in unsere Gemächer eingedrungen? Was wollte derjenige von meiner Mutter?
Ich stand auf und lief barfuß durch den Raum. Meine Schwestern schliefen in ihren Betten. Meine Streitaxt durfte ich nicht im Schlafgemach aufbewahren, und nicht zum ersten Mal hielt ich das für einen großen Fehler. Wie sollte ich meine Mutter ohne Waffe verteidigen können?
Wieder hörte ich die fremde Stimme, und dann lachte meine Mutter, leise und atemlos.
Ich blieb stehen. Ein Mann war bei meiner Mutter, und sie schien hoch erfreut darüber zu sein, dass er bei ihr war. Mitten in der Nacht.
Das konnte nur eines bedeuten.
Mein Vater war endlich hergekommen.
Der Kriegsgott Ares hatte sich des Nachts zu seiner Gefährtin geschlichen.
Ich hörte meine Eltern flüstern. Meine Mutter kicherte, und das war der Moment, in dem ich wusste, dass ich nicht zu ihnen gehen würde.
Aber ich konnte sie belauschen, denn von Melanippe hatte ich gelernt, mich anzuschleichen. Ich schob mich näher zu dem Durchgang zwischen den Räumen und drückte mich gegen die kühle Steinwand. Jetzt verstand ich, was sie redeten, und wenn ich den Kopf ein wenig vorstreckte, konnte ich in den von kleinen Öllampen beleuchteten Raum blicken. Meine Mutter saß mit gekreuzten Beinen auf dem Bett, und auf der Bettkante saß ein großer, muskulöser Krieger mit schwarzen Haaren. Seine Augen blitzten in der Dunkelheit, und in seinem Blick lag eine tiefe Zuneigung. Gerade hob er die Hand und strich meiner Mutter eine Locke aus der Stirn.
»Was ist mit Troja?«, fragte er.
Ich hielt unwillkürlich die Luft an.
»König Priamos und Königin Hekabe sind mit Hektor und Kassandra hier gewesen. Es war ein sehr interessanter Besuch. Die Königin … Sie wirkt auf mich immer noch sehr … bedrückt.«
»Man sollte meinen, sie hätte inzwischen den Verlust ihres Sohns verwunden. Schließlich hat sie noch viele andere Kinder.«
Meine Mutter lachte. »Das sollte dir mal einer sagen. ›Du hast ja noch mehr Töchter‹, wenn sie dir Hippolyte nähmen.«
»Du hast recht, ich wäre alles andere als begeistert. Es ist aber das eine, wenn mir jemand ein Kind wegnimmt. Oder wenn ich mich von der Prophezeiung meiner ältesten Tochter dazu gezwungen sehe, das Kind direkt nach der Geburt auszusetzen.«
Ich horchte auf. Wer hatte ein Kind ausgesetzt? Die Königin von Troja?
Ich wusste von dem Brauch mancher Völker, die Säuglinge kurz nach der Geburt auszusetzen, wenn sie kränklich oder zu schwach wirkten oder wenn ein weiterer hungriger Mund die Ressourcen der Sippe überforderte. Es oblag oft dem Familienoberhaupt, diese Entscheidung zu treffen. Auch die Skythen bedienten sich dieses Brauchs. Doch es geschah nur selten. Nicht, weil wir so viel hatten. Sondern weil dieses Opfer unter Umständen hieß, dass uns fünfzehn Sommer später eine Kriegerin fehlte, die den Unterschied machte.
Selbst mein Onkel Maspi, der kurz nach seiner Geburt schwer erkrankte und sein Auge verlor, war von unserer Sippe aufgezogen worden. Es musste große Not herrschen, dass wir zu diesem drastischen Mittel griffen.
»Hekabe war nicht glücklich damit. Das hat sie mir anvertraut«, fuhr meine Mutter fort. Sie klang nachdenklich. »Ich hatte das Gefühl, sie suchte nach einer … Verbündeten. Jemandem, der ihr bestätigt, dass sie richtig gehandelt hat. Es lässt ihr keine Ruhe, nach all den Jahren nicht …«
»Wie lange ist es her?«, fragte Ares.
»Acht Jahre nun. Dieser Sohn wäre in Hippolytes Alter.«
»Verstehe.«
Ich drückte mich noch dichter an die Steinwand und hielt den Atem an. Ein Kind, das in meinem Alter wäre …
»Sie drückte ihre Hoffnung aus, dass sich ihr großes Opfer gelohnt habe. Dass Troja nicht brennen werde. Und sie bat mich, dich zu fragen, ob du schützend die Hand über Troja halten kannst.«
»Ich. Schützend.« Mein Vater lachte. »Das ist ja mal was Neues.«
»Sie sind unsere Verbündeten.«
Mein Vater murmelte etwas, das ich nicht verstand.
»Ich habe dir mehrmals gesagt, dass du dich nicht in meine Entscheidungen einmischen sollst«, erwiderte meine Mutter scharf.
»Und ich habe dir gesagt, such dir Verbündete, wo du willst, aber Troja …«
»Was ist mit Troja?«
Er schwieg.
»Siehst du, das habe ich mir gedacht. Denn so oft wir über Troja reden, erzählst du mir, ich solle mich mit diesem Nachbarn nicht zu gut stellen. Troja, sagst du, wird alle ins Verderben reißen. Aber wenn es so wäre, warum ignoriert ihr Götter die Stadt nicht ebenso? Apollon treibt sich ständig dort herum und umwirbt Kassandra. Er hat sie zur Seherin ausgebildet, zur Enaree. Und Troja richtet sein Tun nach dem aus, was sie sieht. Nur darum wurde dieses Kind ausgesetzt. Weil Kassandra Troja hat brennen sehen, wegen diesem Knaben. Wie kann die Stadt dem Untergang geweiht sein, wenn Apollon seine schützende Hand über die Stadt hält?«
»Du hast für meinen Geschmack eine zu hohe Meinung von meinem Halbbruder.«
»Ist das so.«
Ich merkte, wie die Stimmung kippte. Wie meine Eltern nicht mehr von der Freude über das Wiedersehen beseelt waren, sondern sich – vermutlich nicht zum ersten Mal – in fruchtlosen Diskussionen verloren. Ich tapste in das Gemach und rieb mir die Augen.
»Bin aus einem schlechten Traum aufgewacht«, murmelte ich gespielt verschlafen. Die Miene meines Vaters hellte sich auf, er eilte mir entgegen, hob mich hoch und wirbelte mich mühelos herum. Ich legte die Arme um seine Schultern und schmiegte mein Gesicht in die Halsbeuge.
»Meine große Prinzessin. Kaum schaue ich ein paar Monde nicht hin, bist du wieder gewachsen.« Er stellte mich aufs Bett.
»Darf ich bei euch schlafen?«, fragte ich. »Bitte!«
Meine Eltern blickten einander an, und meine Mutter zuckte mit den Schultern. Damit hatte ich gewonnen, denn ich wusste, nur ein Veto meiner Mutter konnte Ares davon abhalten, mir einen Wunsch zu erfüllen.
Ich kuschelte mich zwischen meine Eltern. Ares hatte den Brustpanzer abgelegt und streifte die Stiefel von den Füßen. Er legte sich neben mich, und sein Blick ruhte zärtlich auf meiner Mutter und mir. Fürsorglich zog er die Decke höher, und ich schmiegte mich an meine Mutter und schloss die Augen. So geborgen konnte ich einschlafen.
Als ich am Morgen aufwachte, war mein Vater wieder fort.
Seitdem fragte ich mich, wie oft er nachts zu meiner Mutter kam, wenn meine Schwestern und ich schliefen.
Und ob es einen Grund dafür gab, dass er nur nachts kam und ging.
Über Troja verlor meine Mutter danach für viele Jahre kein Wort mehr, und von einem Gegenbesuch war ebenfalls nicht mehr die Rede. Doch in den folgenden Jahren kam mein Vater Ares immer häufiger zu uns, wenn wir in Themiskyra weilten.
5
Doch die längste Zeit meiner Kindheit und Jugend verbrachte ich auf der Steppe. Themiskyra blieb mir fremd.
Da draußen war alles einfach. Die Sippe meiner Mutter lebte schon so lange im Herzland, dass die Väter unserer Vorväter bereits dort beigesetzt worden waren. Die Kurgans erhoben sich in einiger Entfernung vom Sommerlager. Jedes Jahr, wenn wir zu den Weidegründen am Fluss zurückkehrten, waren sie das Erste, was wir sahen. Die sanften Hügel passten sich im Laufe der Zeit der Landschaft an, sie sanken immer tiefer in sich zusammen, bis nur noch eine kleine Erhebung blieb. Der größte Kurgan war vor zwanzig Jahren für meinen Großvater Mazjar ausgehoben worden. Kleinere Erhebungen waren die Gräber von einfachen Kriegern. Im Tod machten wir einen Unterschied. Im Leben gab es keinen; wir waren alle gleich. Wir hatten dieselben Pflichten und unterwarfen uns denselben Regeln. Ich musste genauso wie alle jungen Kriegerinnen täglich zum Training und bei allen anderen Aufgaben war ich ebenso gefordert. Ich sammelte Beeren, jagte Kleinwild mit der Steinschleuder, half beim Haltbarmachen der Vorräte und beim Spinnen der Wolle, die von den Frauen um meine Großmutter Barkida gefärbt und zu Teppichen geknüpft wurde. Bei letzterem zog ich mich raus, denn ich hatte keinen Sinn für das Schöne, zu oft verwechselte ich die unterschiedlichen Rottöne, und das Ergebnis genügte selten Barkidas Ansprüchen.
»Du hast andere Qualitäten«, pflegte sie zu sagen, wenn ich wieder an einem der komplizierten Muster scheiterte. Und dabei sah sie mich an, als bezweifelte sie, dass ich es irgendwann zu etwas bringen würde.
Von Mela lernte ich, aus dem Sattel mit dem Bogen auf ein stehendes und später auf ein bewegliches Ziel zu schießen. Ich lernte, mich im Nahkampf mit der Streitaxt zu verteidigen. Wir übten mit stumpfen Äxten, doch wenn man mit voller Wucht am Oberschenkel erwischt wurde, trug man blaue Flecken davon, die in den kommenden Tagen ordentlich schmerzten. Also lernte man schnell, sich lieber nicht erwischen zu lassen.
Das Schönste waren für mich die Winter. Wenn wir uns in den Karren und Zelten einigelten und die Pferde einen dichten Pelz bekamen. In den Wintermonaten hatten wir viel Zeit für die Dinge, die wir im Sommer zurückstellen mussten. Der Sommer sicherte unser Überleben. Der Winter heilte unsere Seele, weil wir dann zur Ruhe kamen.
In dem Jahr, als ich fünfzehn Sommer zählte, kam mein Onkel Maspi mit meinem Cousin Petros zu uns. Maspi wollte, dass sein ältester Sohn lernte, wie die Skythen lebten. Dass er begriff, was sich hinter Stadtmauern nicht begreifen ließ. Er sollte spüren, was wir spürten, wenn wir im Jahreslauf mit der Natur lebten.
Ich freute mich darauf, Petros alles zu zeigen. Als die Reitergruppe sich dem Lager näherte, sprang ich auf den Rücken der Grauen und preschte ihnen entgegen. »Willkommen!«, rief ich, sandte den trillernden Jubelschrei in den Himmel, mit dem wir unsere Freunde begrüßten und unsere Feinde verjagten. Ich beugte mich tief über den Hals der Stute, ritt in einer engen Kurve um die Männer herum. Petros, der im Sattel eines behäbigen Schimmels saß, krampfte die Hände um die Zügel. Er war kein geübter Reiter.
Aber nun war er hier. Höchste Zeit, dass er es lernte.
Sobald die Reiter das Lager erreichten und aus den Sätteln stiegen, griff ich nach Petros’ Hand und zog ihn mit. »Ich zeige ihm alles!«, rief ich Maspi zu, und mein Onkel lächelte. Er wurde von den Kindern und Frauen umringt, die ihn streichelten und auf ihn einredeten. Mein Onkel war der Bruder der Königin, er kam aus der Stadt jenseits des Meers und war bei uns hoch angesehen. Die Menschen liebten unseren Enaree. Er stand im Kontakt zu unseren Göttern und war zugleich der Bruder der Königin. Sein Sohn war zwar halb Achaier, aber auf ihn strahlte trotzdem die Sympathie ab, die sie Maspi entgegenbrachten.
Am nächsten Morgen weckte ich Petros kurz nach Sonnenaufgang. Er konnte kaum die Augen offenhalten und jammerte, es sei viel zu früh. »Wir haben viel vor!«, lockte ich ihn, doch er stöhnte bloß.
Ich wartete vor seinem Zelt, während er sich anzog. Als er nach draußen trat, verzog ich das Gesicht. »Es wird wirklich Zeit, dass du diese achaische Kleidung ablegst. Du bist Skythe!«
»Nur halb«, widersprach er. »Was spricht gegen den Chiton?«
»Du wirst dir im Sattel den blanken Hintern wundreiten.«
Das Argument schien er zu verstehen.
»Hast du eine Hose?«
»Ja, irgendwo da drin.«
»Dann geh und zieh sie an.«
Ich kicherte und lief zwischen den Zelten auf und ab. Es kribbelte in meinen Fingern, meinen Zehen, mein ganzer Körper war gespannt wie die Bogensehne kurz vorm Abschießen eines Pfeils. Ich konnte es kaum erwarten, Petros zu zeigen, warum das Leben auf der Steppe so viel besser war als das in Themiskyra, das er ja so sehr schätzte.
Wir liefen zuerst zu den Pferden. »Such dir eins aus!«, forderte ich ihn auf.
»Ich habe ein Pferd.«
»Du hast einen lahmen Gaul aus Tyras, mit dem du niemals schnell genug reiten wirst, dass du im vollen Galopp einen Pfeil abschießen kannst.«
Petros’ Blick flackerte. »Ich glaube nicht, dass ich das lernen werde.«
»Ich bringe es dir bei.« Wieso sollte er nicht lernen, was bei uns siebenjährige Kinder beherrschten?
»Dann nehme ich das da.« Er zeigte auf die Leitstute, die mit erhobenem Kopf abseits der Herde stand und uns nicht aus den Augen ließ. Mich kannte sie, aber bei Petros konnte sie wohl noch nicht abschätzen, ob ihrer Herde Gefahr drohte oder nicht.
»Nimm lieber einen von den beiden.« Ich zeigte auf zwei flinke Braune, von denen ich wusste, dass sie sich auch von einem ungeübten Reiter nicht aus der Ruhe bringen ließen. Sie sahen eben nicht besonders hübsch aus; der eine hatte eine krumme Blesse, der andere einen weiß gesprenkelten Hals. Petros entschied sich für den mit der Blesse, und ich zeigte ihm, wie er sich dem Pferd näherte und mit ihm vertraut machte. Petros machte seine Sache gut, dafür dass er nicht mit Pferden aufgewachsen war wie ich.
Wir führten die beiden Braunen zum Lager. Wir sattelten und zäumten die Pferde, und dann schwang ich mich mühelos in den Sattel. Petros folgte meinem Beispiel, doch er sah etwas ungelenk aus. Ich lächelte nachsichtig. »Du wirst es schon lernen.«
»Ich kann reiten«, beharrte er.
»In Ordnung.« Ich zeigte zu den Kurgans in der Ferne. »Wagen wir ein Wettrennen?«
Er gab seinem Pferd den Kopf frei und trieb es in den Galopp, ohne auf meine Frage zu antworten. Ich hatte damit gerechnet und trieb den braunen Hengst hinter ihm her. Der Wind riss an meinen Haaren, und ich rief meine Begeisterung über diesen rasanten Ritt in den Himmel.
Natürlich holte ich ihn kurz vor den Kurgans ein, und es dauerte auch nur deshalb so lange, weil ich ihn nicht demütigen wollte. Ich lenkte den Braunen um den Kurgan meines Großvaters herum und parierte ihn durch.
»Siehst du?« Petros neigte den Kopf. »Deiner ist der bessere Renner.«
»Wir können gern für den Rückweg tauschen.«
Er ging auf das Angebot nicht ein. Ich zeigte zum Fluss. »Diesmal aber kein Wettrennen.«
Unterwegs ließ ich meinen Blick in die Ferne gleiten. Es fühlte sich gut an. Keine Stadtmauern, an die mein Blick oder mein Geist stießen. Keine Steine unter den Hufen, nur das weiche Gras, die sanft geschwungene Ebene, der Duft wilder Kräuter in der Nase. Ich seufzte und schloss verzückt die Augen.
»Hier bist du zu Hause«, stellte Petros fest.
Ich öffnete die Augen. »Kannst du es jetzt verstehen?«, fragte ich. Petros wollte erst den Kopf schütteln, doch dann zuckte er mit den Schultern. »Vielleicht wär’s mir auch so gegangen, wenn ich hier aufgewachsen wäre.«
»Aber du lebst lieber in Themiskyra.«
»Vielleicht ist das so. Dass wir das lieben, was wir kennen.«
»Das glaube ich nicht. Es gibt genug Skythen, die sich gegen das Leben hier draußen entscheiden und in den Städten glücklich werden. Oder werden sie nicht glücklich?«
»Das kann ich dir nicht sagen. Sie können ja zurück, wenn es ihnen dort nicht gefällt.«