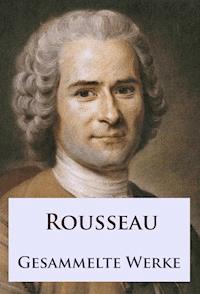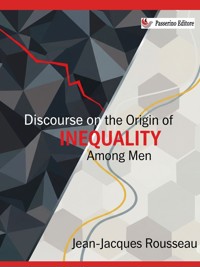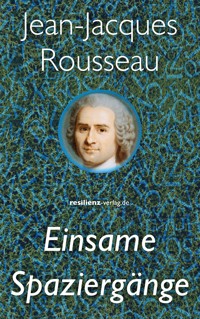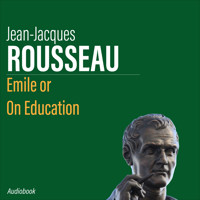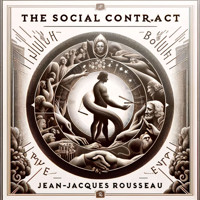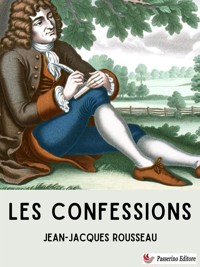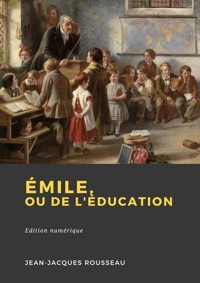4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Anaconda Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Geschenkbuch Weisheit
- Sprache: Deutsch
Jean-Jacques Rousseau, der große Philosoph der französischen Aufklärung, ist den meisten heute als Denker des »Gesellschaftsvertrags« bekannt. Doch stellte er sich zeitlebens auch die scheinbar alltägliche Frage, was es heißt, gut zu leben. Als von der Gesellschaft Verstoßener bewegte sich Rousseau jenseits der bürgerlichen Vorstellungen vom guten Leben; daher beschäftigte er sich gerade in seinem Spätwerk intensiv mit dieser Frage. Die ausgewählten und kommentierten Passagen schaffen Einblicke in seine »Kunst zu leben« und machen dabei die Grundsteine Rousseau’schen Denkens zugänglich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 202
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Jean-Jacques Rousseau
Die Kunst zu leben
Herausgegeben und übersetzt
von Erich Ackermann
Anaconda
Die Übersetzung aus dem Französischen erfolgte durch Erich Ackermann auf der Textgrundlage: Collection complète des œuvres de J.J. Rousseau, Citoyen de Genève, Genf 1782–1789.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikationin der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Datensind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-641-27899-1V001
© 2021 by Anaconda Verlag, einem Unternehmender Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlagmotive: Adobe Stock / Kseniya
Umschlaggestaltung: Druckfrei. Dagmar Herrmann, Bad Honnef
www.anacondaverlag.de
Inhalt
Vorwort
Über den Menschen und das Leben im Allgemeinen
Gedanken über das Glück
Das kurze Glück meines Lebens
Wenn ich einmal reich wäre …
Mitleid – eine universelle Tugend
Was ist Wahrheit?
Wohltätigkeit aus Pflicht oder Neigung?
Die beste Art zu reisen: zu Fuß
Herbstliche Gedanken
Von der Kürze des Lebens
Ich werde alt und lerne immer noch dazu
Die Macht des Schicksals
Wie Rousseau zum Misanthropen wurde
Vereinsamt und von allen verlassen
Liebesglück und Liebesleid
Allgemeine Bemerkungen über die Erziehung
Die erste Erziehung ist rein negativ
Verwöhnte Kinder
Rousseau und die Kinder – Anspruch und Wirklichkeit
Die Religion
Ein Gebet in Gottes freier Natur
Eine Ekstase
Dolce far niente – Die süße Kunst des Müßiggangs
Die Zivilisation hat die Sitten verdorben
Über die Ungleichheit unter den Menschen
Vom Gesellschaftsvertrag
Vorwort
Am 18. Juni 1712 in Genf als Sohn eines Uhrmachers geboren, verliert Jean-Jacques Rousseau schon kurz nach der Geburt seine Mutter und wird von seinem Vater aufgezogen. Der aber muss Genf wegen eines Streits bald verlassen und gibt das Kind in die Obhut eines Onkels, der Jean-Jacques dem Pfarrer Lambercier zur Erziehung anvertraut, bei dem er eine unglückliche Kindheit verlebt. Nach einer kurzen Lehre bei einem Gerichtsschreiber und danach bei einem Graviermeister beschließt Rousseau 1728, die Stadt Genf zu verlassen, und beginnt ein vagabundierendes Leben, das ihn zunächst in die Nachbarregion Savoyen führt. In Annecy nimmt ihn Françoise-Louise de Warens, eine zum Katholizismus konvertierte Calvinistin, herzlich auf. Die mütterliche Freundin und später auch Geliebte veranlasst ihn, nach Turin zu reisen und dort ebenfalls zum katholischen Glauben überzutreten. Nach dem vergeblichen Versuch, in ein Priesterseminar aufgenommen zu werden, durchwandert Rousseau ab 1730 die Schweiz und Frankreich; 1732 lässt er sich in Paris nieder und verdient dort seinen Lebensunterhalt als Hauslehrer und Kopist von Musikpartituren. Dann kehrt er wieder zu Madame de Warens zurück, die jetzt in der Nähe von Chambéry in einem bewaldeten Tal ein ländliches Anwesen, Les Charmettes, gepachtet hat. Dort verbringt Rousseau mit seiner Gönnerin 1736 bis 1742 jedes Jahr einige Zeit, und dort findet er das kurze Glück seines Lebens, wie er es formulierte: Er liest, musiziert, befasst sich intensiv mit Geschichte, Literatur, Philosophie, Physik, Chemie und versucht die Wissenslücken zu füllen, die sein bisheriges unstetes Leben offen gelassen hatte.
In dieser idyllischen Zeit mit seiner Geliebten, die er zärtlich »Maman« nennt, knüpft er Beziehungen zu literarischen Kreisen und beginnt zu schreiben. Parallel dazu entwickelt er ein musikalisches Notensystem, das er sich in Paris patentieren lässt. Doch bald wird Madame de Warens seiner müde und sucht sich einen neuen Geliebten. Rousseau verlässt Les Charmettes 1742, um sein Glück in Paris zu suchen, wo er bald in die mondäne Gesellschaft aufgenommen wird und die literarischen Salons besucht. Vor allem sucht er die Unterstützung einflussreicher Damen dieser Gesellschaft und wird Sekretär von Madame Dupin, später sogar Botschaftssekretär in Venedig. Doch er fühlt sich in diesen Kreisen nicht wohl, verschließt sich in sich selbst, und seine Verbindung mit der Wäscherin Thérèse Levasseur trägt mit dazu bei, ihn immer mehr aus dem exklusiven Milieu auszuschließen. Fünf Kinder werden aus dieser Verbindung geboren, die er alle nach ihrer Geburt ins Waisenhaus abgibt.
Bald stellen sich schriftstellerische Erfolge ein: 1749 gewinnt Rousseau mit seiner Abhandlung über die Wissenschaften und die Künste einen Preis, den die Académie von Dijon ausgelobt hatte: Seine These, die Wiederherstellung der Wissenschaften und Künste habe dazu beigetragen, die Zivilisation und die Sitten zu verderben, macht ihn mit einem Schlag in ganz Europa bekannt und hilft ihm auch finanziell auf die Beine. Während die übrigen Philosophen der französischen Aufklärung (siècle des Lumières) noch dem modernen Fortschrittsglauben huldigen, sieht Rousseau in der Zivilisation den Niedergang der Menschheit und wird so zu einem der Begründer des modernen Kulturpessimismus. Noch klarer formuliert er seine Kritik an der Zivilisation in einer zweiten Abhandlung auf eine Preisfrage der Académie von Dijon 1755. Seine Abhandlung über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen bringt ihm zwar keinen Preis mehr ein, steigert aber noch seinen Ruhm. Rousseau geht hier davon aus, dass der Mensch von Natur aus gut sei und dass die soziale Ungleichheit aus der geschichtlichen Tatsache der Vergesellschaftung des Menschen und sodann aus der Etablierung des Privateigentums herrühre. Erst die Errungenschaften der Zivilisation wie Eigentum und Gesetze bedingten die Ungleichheit der Menschen und führten zu ihrem Niedergang.
Rousseau verfeindet sich mit dem Kreis der Philosophen der französischen Aufklärung, insbesondere mit Voltaire; eine Gönnerin, Madame d’Epinay, verschafft ihm ein Asyl unweit ihres Schlosses bei Paris in einer Einsiedelei (Ermitage). Dort kann er in ländlicher Idylle seiner schöpferischen Arbeit nachgehen und sich der Ausarbeitung seiner Hauptwerke widmen, die er dann in Montmorency, einem kleinen Ort unweit von Paris, 1761/62 vollendet: den Briefroman Julie oder die neue Héloïse, die staatstheoretische Schrift Vom Gesellschaftsvertrag oder Prinzipien des Staatsrechtes und den Bildungsroman Émile oder Über die Erziehung. Während der Briefroman großen Erfolg hat und Vorbild für viele Romane in Briefform in ganz Europa wird, z.B. auch für Goethes Werther, werden der Gesellschaftsvertrag und Émile sofort nach ihrem Erscheinen verboten. Rousseau muss in die preußische Exklave Neuchâtel fliehen; danach zieht er auf die kleine Petersinsel (île Saint-Pierre) im Bielersee, wo er 1765 einige Wochen in einem einsamen Haus zusammen mit seiner Frau Thérèse Levasseur und einem Steuereinnehmer samt Gesinde lebt. Als der Senat von Bern ihn auffordert, die Insel zu verlassen, muss er sich erneut aufmachen; diesmal ist sein Ziel England, wohin ihn der Philosoph David Hume eingeladen hat, mit dem er sich aber bald überwirft. Mehr und mehr wähnt sich Rousseau von all seinen früheren Bekannten, Kollegen und Gönnern verunglimpft und in die Enge getrieben.
Nach Frankreich zurückgekehrt, beginnt erneut ein Wanderleben für ihn. Dem Beispiel des heiligen Augustinus folgend verfasst er eine Autobiografie, seine Confessions, Bekenntnisse, in denen er sein Leben mit allen Verfehlungen schonungslos offenlegt und rechtfertigt. Bald aber ist er den nervlichen Belastungen und dem Druck seiner Kritiker nicht länger gewachsen, seine Ängste nehmen wahnhafte Züge an. Seine letzten beiden Lebensjahre verbringt Rousseau mit Thérèse in Paris in einer bescheidenen Unterkunft. Von dort aus unternimmt er zahlreiche Spaziergänge, die er in seinem unvollendeten Werk Die Träumereien eines einsamen Spaziergängers festhält. In die Schilderungen der Natur mischen sich autobiografische Rückblicke und Meditationen über seine gegenwärtige innere Stimmung; all dies macht das geradezu lyrische Werk zu einem Wegbereiter der Romantik.
Im Mai 1778 folgt Rousseau der Einladung des Marquis de Girardin auf dessen Schlösschen Ermenonville nördlich von Paris, wo er am 2. Juli 1778 wahrscheinlich an einem Schlaganfall stirbt. Dort wird er im Schlosspark auf der île des peupliers (Pappelinsel) beerdigt. Am 11. Oktober 1794, nach dem Sturz Robespierres, werden Rousseaus sterbliche Überreste triumphal ins Pariser Panthéon, die nationale Ruhmeshalle Frankreichs, überführt.
Erich Ackermann
Über den Menschen und das Leben im Allgemeinen
Alle Tiere besitzen genau die Fähigkeiten, die zu ihrer Erhaltung notwendig sind; nur der Mensch hat welche, die eigentlich überflüssig sind. Ist es nicht sehr sonderbar, dass gerade diese überflüssigen Kräfte die Ursache seines Unglücks sind? In jedem Land vermögen die Arme eines Menschen durch Arbeit mehr hervorzubringen als seine Mittel zur Subsistenz*. Wenn er weise genug wäre, diesen Überschuss als nichts zu erachten, hätte er immer das Notwendige, denn er hätte nie etwas zu viel. Die großen Bedürfnisse, sagte schon Favorinus**, entständen aus großen Besitztümern, und oft sei das beste Mittel, die Dinge zu bekommen, die wir nicht haben, aber sehnlichst wünschen, dass man diejenigen wieder weggibt, die man hat. Dadurch dass wir uns abplagen, um unser Glück zu steigern, verwandeln wir es selbst in Unglück. Jeder Mensch, der nur zu leben wünscht, würde glücklich leben, folglich wäre er auch gut; denn welchen Vorteil hätte er davon, schlecht zu sein?
Wenn wir unsterblich wären, wären wir höchst unglückliche Wesen. Es ist zweifellos hart, zu sterben, aber angenehm ist die Hoffnung, dass wir nicht ewig leben und dass ein besseres Leben der Mühsal und den Leiden hienieden ein Ende bringen wird. Wer würde denn wohl, wenn man ihm die Unsterblichkeit auf Erden anbieten würde, dieses trostlose Geschenk annehmen? Welche Hilfsmittel, welche Hoffnung, welcher Trost würden uns dann noch gegen die bitteren Schläge des Schicksals und gegen die Ungerechtigkeiten der Menschen bleiben? Der Unwissende, der über keine Voraussicht verfügt, spürt den Wert des Lebens wenig und hat auch wenig Angst, es zu verlieren. Der aufgeklärte Mensch kennt wertvollere Güter, welche er dem vorzieht. Nur das Halbwissen und eine falsche Sicht der Weisheit lenken unseren Blick allein bis zum Tod und nicht darüber hinaus und machen dann aus ihm das schlimmste aller Übel. Die Notwendigkeit, sterben zu müssen, ist für einen weisen Menschen nur ein Grund, die Leiden des Lebens zu ertragen. Wenn man nicht sicher wäre, es eines Tages zu verlieren, würde man es zu teuer erkaufen.
Unsere moralischen Übel beruhen alle auf Einbildung, mit Ausnahme des Lasters, und dieses hängt von uns ab. Unsere körperlichen Übel zerstören sich selbst oder sie zerstören uns. Die Zeit oder der Tod sind unsere Heilmittel. Aber wir leiden umso mehr, je weniger wir zu leiden verstehen. Und wir verursachen uns mehr Qualen damit, unsere Krankheiten zu heilen, als wir welche hätten, wenn wir sie bloß aushielten. Lebe nach der Natur, sei geduldig und jage die Ärzte weg. Dadurch wirst du nicht den Tod verhindern, aber du wirst ihn nur einmal spüren, während die Ärzte ihn dir jeden Tag in deine gestörte Einbildungskraft bringen. Und ihre lügenhafte Kunst nimmt dir jede Freude am Leben, statt es zu verlängern …
In den menschlichen Einrichtungen ist alles nur Torheit und Widerspruch. Je mehr Wert unser Leben verliert, desto größere Sorgen machen wir uns um es. Die alten Leute hängen mehr an ihm als die jungen. Sie wollen all die Aufwendungen, die sie getroffen haben, um es zu genießen, nicht verlieren; mit sechzig Jahren ist es sehr grausam zu sterben, wenn man eigentlich noch nicht zu leben begonnen hat. Man ist der Meinung, dass der Mensch einen lebhaften Selbsterhaltungstrieb hat, und das stimmt ja. Aber man erkennt dabei nicht, dass dieser Trieb, so wie wir ihn fühlen, größtenteils das Werk der Menschen ist. Von seiner Natur her ist der Mensch nur so weit bestrebt, sich selbst zu erhalten, wie er die Mittel hat, die ihm dazu zur Verfügung stehen. Sobald ihm diese ausgehen, ergibt er sich seinem Schicksal und stirbt, ohne sich noch weiter sinnlos zu quälen. Die Natur lehrt uns das erste Gesetz, sich dem Schicksal zu ergeben. Ebenso wie die Tiere sträuben sich auch die Wilden recht wenig gegen den Tod und erdulden ihn fast ohne zu klagen. Ist dieses Naturgesetz umgestoßen, bildet sich daraus ein anderes, das aus der Vernunft her resultiert; aber wenige nur verstehen es, daraus den richtigen Schluss zu ziehen, und deshalb ist diese künstliche Resignation nie genauso klar und vollständig wie die erste natürliche.
Die Vorsorge! Die Vorsorge, die uns unablässig über uns selbst hinausträgt und uns oft an eine Stelle bringt, die wir nie erreichen werden – hierin liegt die eigentliche Quelle all unserer Leiden. Welche Sucht hat doch ein derart vergängliches Wesen wie der Mensch, immer weit voraus in eine Zukunft zu schauen, die in dieser seiner Sichtweise selten kommt, und dabei die Gegenwart zu vernachlässigen, deren er sicher ist! Diese Sucht ist umso unheilvoller, als sie mit dem Alter ständig zunimmt, und die alten Leute, misstrauisch, vorsorglich und geizig wie sie sind, versagen sich heute lieber das Notwendige, als dass ihnen in hundert Jahren etwas Überflüssiges fehlt. So halten wir an allem fest, klammern uns an alles. Die Zeit, die Orte, die Menschen, die Dinge, alles, was ist, und auch alles, was sein wird, ist für jeden von besonderer Wichtigkeit. Unser individuelles Selbst ist so nur noch der geringste Teil von uns. Jeder dehnt sich sozusagen auf der ganzen Erde aus und wird auf dieser ganzen großen Oberfläche spürbar. Kann es deshalb erstaunen, dass unsere Leiden sich an allen Punkten vervielfältigen, an denen man uns verletzen kann? Wie viele Fürsten sind todunglücklich über den Verlust eines Landes, das sie nie zu Gesicht bekommen haben! Wie viele Kaufleute genügt es in Indien anzurühren, dass sie in Paris ein großes Geschrei erheben!
Ist es die Natur, die die Menschen so weit von ihrem wirklichen Sein entfremdet? Ist es ihr Wille, dass jeder sein Schicksal von anderen erfährt, und manchmal sogar als Letzter, sodass der eine oder andere schon glücklich oder elend gestorben ist, ohne dass er je etwas davon gewusst hätte? Ich habe einen frischen, fröhlichen, kräftigen und gesunden Mann vor meinen Augen, seine Anwesenheit bereitet mir Freude; aus seinen Augen strahlen Zufriedenheit und Wohlsein, ein wahres Abbild von Glück. Da kommt auf einmal ein Brief mit der Post; unser glücklicher Mann schaut diesen an, er ist an seine Adresse gerichtet, er öffnet ihn, er liest ihn, und im selben Augenblick ändert sich seine Miene; er wird bleich und fällt in Ohnmacht. Als er wieder zu sich kommt, weint er, zittert, stöhnt, rauft sich die Haare, seine Schreie erfüllen die Luft, und er scheint von schrecklichen Zuckungen und Krämpfen befallen. Du Törichter! Welches Leid hat dir dieses Stück Papier denn angetan? Welches Körperglied hat es dir denn genommen? Zu welchem Verbrechen hat es dich angeregt? Was hat es schließlich in deinem Innern so verändert, dass du in den Zustand geraten bist, in dem ich dich jetzt sehe?
Wenn nun dieser Brief verloren gegangen wäre, wenn eine gutmeinende Hand ihn ins Feuer geworfen hätte, wäre das Schicksal dieses glücklichen und zugleich unglücklichen Menschen, wie es mir scheint, für uns ein eigentümliches Problem gewesen. Sein Unglück war real, werden Sie sagen. Sehr richtig, aber er merkt und fühlt es nicht. Wo wäre es denn aber gewesen? Sein Glück war nur ein eingebildetes. Das gebe ich zu. Die Gesundheit, die Heiterkeit, das Wohlbefinden, die innere Zufriedenheit sind also nur Träume und Hirngespinste. Wir existieren nicht mehr, wo wir sind; wir existieren nur, wo wir nicht sind. Ist es dann der Mühe wert, dass wir eine solch große Furcht vor dem Tod haben, wenn die Bedingung, in welcher und durch welche wir leben, dieselbe bleibt?
Oh Mensch, beschränke deine Existenz auf dein Inneres und du wirst nicht mehr länger unglücklich sein. Bleibe an der Stelle, die die Natur dir in der Kette der Wesen zugewiesen hat, dann wird nichts dich von dort verweisen können. Sträube dich nicht gegen das harte Gesetz der Notwendigkeit und erschöpfe deine Kräfte nicht dadurch, dass du dich ihr widersetzt. Denn der Himmel hat dir diese Kräfte nicht gegeben, um deine Existenz zu erweitern oder zu verlängern, sondern lediglich um sie zu erhalten, wie es ihm und solange es ihm gefällt. Deine Freiheit und deine Macht erstrecken sich nur so weit wie deine natürlichen Kräfte und nicht darüber hinaus. Alles Übrige ist nur Sklaverei, Illusion, Ruhmsucht. Sogar die Herrschaft ist sklavisch, wenn sie vermeintlich ist, denn du bist dann von den Vorurteilen derjenigen abhängig, über die du durch Vorurteile regierst. Um sie zu führen, wie es dir gefällt, musst du dich führen, wie es ihnen gefällt. Sie brauchen nur einmal ihre Denkweise zu ändern, und schon musst du gezwungenermaßen deine Handlungsweise ändern. Diejenigen, die in deiner Nähe leben, brauchen es nur fertigzubringen, die Meinungen des Volkes zu lenken, das du zu lenken vermeinst, oder der Günstlinge, die dich lenken, oder die deiner Familie oder deine eigenen. Wenn das der Fall ist, dann werden diese Wesire, diese Höflinge, diese Priester, diese Soldaten, diese Diener, diese Schwatzbasen und alle hinab bis zu den Kindern dich inmitten deiner Legionen wie ein Kind führen, und das selbst, wenn du an Geist dem Themistokles gleich wärest. Was du auch immer tust, deine wirkliche Macht kann sich nie über die Grenzen deiner wirklichen Fähigkeiten hinaus erstrecken. Sobald du gezwungen bist, mit den Augen anderer zu sehen, muss deren Willen dein eigener sein. Magst du auch mit Stolz verkünden: »Mein Volk, das sind meine Untertanen.« Zugegeben, aber was bist du? Der Untertan deiner Minister. Und deine Minister, was sind sie? Die Untertanen ihrer Beamten, ihrer Mätressen, die Diener ihrer Diener. Reißt alles an euch, raubt alles und gebt dann euer Geld mit vollen Händen aus; lasst Batterien von Kanonen auffahren, errichtet Galgen und Folterräder, erlasst Gesetze und Verordnungen, setzt immer mehr Spione ein, mehr Soldaten, Henker, Gefängnisse und Ketten: arme kleine Menschenkinder, was nutzt euch denn das alles? Man wird euch deshalb nicht besser bedienen, nicht weniger bestehlen, nicht weniger täuschen, und eure Macht wird auch nicht absoluter werden. Ihr werdet dauernd sagen: »Wir wollen«, und trotzdem immer das tun, was die anderen wollen.
Der Einzige, der seinen eigenen Willen ausführt, ist derjenige, der dazu keine fremde Arme auf seine eigenen zu setzen braucht, woraus folgt, dass das höchste aller Güter nicht die Autorität, sondern die Freiheit ist. Der wirklich freie Mensch will nur, was er vermag, und tut nur, was ihm gefällt. Das ist mein Hauptgrundsatz. Man braucht ihn nur auf die Kindheit anzuwenden, und alle Regeln der Erziehung leiten sich davon ab.
Die Gesellschaft hat den Menschen schwächer gemacht, nicht nur dadurch, dass die ihm das Recht genommen hat, das er über seine eigenen Kräfte hatte, vor allem aber dadurch, dass sie diese Kräfte für seinen Gebrauch unzulänglich machte. Deshalb vermehren sich seine Wünsche mit dieser Schwäche, und darum ist ein Kind, verglichen mit dem Mannesalter, schwächer. Wenn ein erwachsener Mensch ein starkes Wesen und ein Kind ein schwaches ist, dann nicht, weil der Erstere eine größere absolute Stärke als das Letztere besitzt, sondern weil der eine von Natur her für sich selbst sorgen kann, das andere aber nicht. Der erwachsene Mensch muss also mehr Willen haben, das Kind hingegen mehr Fantasie, worunter ich alle Wünsche verstehe, die keine wirklichen Bedürfnisse sind und die nur mithilfe anderer zufriedenzustellen sind.
Émile, Buch 2
*Subsistenz ist das Prinzip der Selbsterhaltung und beruht auf der Sicherung von Grundbedürfnissen wie Nahrung, Kleidung, Behausung, Fürsorge und allem, was materiell und sozial zum Überleben nötig ist; es ist die Existenzgrundlage.
**Favorinus war im 1. Jahrhundert n. Chr. ein römischer Schriftsteller, der vor allem Reden und populärphilosophische Weisheiten verfasst hat.
Gedanken über das Glück
Was absolutes Glück oder Unglück ist, wissen wir nicht. In diesem Leben ist alles gemischt, kein Gefühl können wir ganz rein genießen, und wir verharren nicht einmal zwei Augenblicke in dem gleichen Zustand. Unsere seelischen Befindlichkeiten wie auch unsere körperlichen Veränderungen sind in einem ständigen Fluss. Das Gute und das Böse ist unser gemeinsamer Besitz, aber in verschiedenem Maße. Am glücklichsten ist derjenige Mensch, der am wenigsten unter Not und Pein leidet, am unglücklichsten jener, der am wenigsten Freude empfindet. Für alle aber gibt es einen gemeinsamen Unterschied: die Zahl der Stunden, in denen wir leiden, ist größer als die, an denen wir unsere Freude haben. Das Glück der Menschen ist also hienieden nur ein negativer Zustand; es lässt sich nur nach der geringeren Anzahl der Übel ermessen, unter denen wir leiden.
Jedes Gefühl von Schmerz ist untrennbar mit dem Wunsch verbunden, ihn wieder loszuwerden, und mit jedem Gefühl von Vergnügen geht der Wunsch einher, daran einen Genuss zu finden. Jeder Wunsch setzt eine Entbehrung voraus, und jede Entbehrung, die man empfindet, ist schmerzlich. Unser Elend besteht also in dem Missverhältnis zwischen unseren Wünschen und unseren Fähigkeiten, diese zufriedenzustellen. Ein empfindsames Wesen, dessen Fähigkeiten den Erfüllungen seiner Wünsche entsprächen, wäre ein absolut glückliches Wesen.
Worin besteht also die menschliche Weisheit oder der Weg zum wahren Glück? Nicht etwa darin, unsere Wünsche zu verringern, denn wenn diese unter unserem Vermögen lägen, sie Wirklichkeit werden zu lassen, dann würde ein Teil unserer Fähigkeiten müßig daliegen, und wir würden nicht unser ganzes Sein voll genießen können; auch nicht darin, unsere Fähigkeiten zu erweitern. Wenn sich nämlich damit gleichzeitig auch unsere Wünsche in noch größerem Maße steigerten, würden wir dadurch nur noch umso unglücklicher werden. Sie besteht aber darin, dass wir das Übermaß der Wünsche, das unsere Fähigkeiten übersteigt, vermindern und unser Vermögen dazu und unseren Willen vollständig in Einklang bringen. Nur dann nämlich, wenn alle Kräfte in Tätigkeit sind, wird deshalb die Seele friedlich bleiben, und der Mensch wird sich wohl geordnet befinden.
So hat es die Natur, die alles aufs Beste macht, von Anfang an eingerichtet. Unmittelbar gibt sie den Menschen nur die Triebe mit, die zu seiner Erhaltung nötig sind, und hinreichende Fähigkeiten, diese zufriedenzustellen. Alle übrigen hat sie als Reserve tief in unserer Seele verankert, wo sie sich dann je nach Bedürfnis entwickeln können. Nur in diesem primitiven Entwicklungszustand halten sich Können und Wollen in einem Gleichgewicht, und der Mensch ist nicht unglücklich. Sobald sich aber seine potenziellen Fähigkeiten in Tätigkeit setzen, erwacht die Einbildungskraft, die aktivste von allen, und eilt ihnen allen voraus. Es ist diese Einbildungskraft, die uns die Grenzen des Möglichen erweitert, und zwar im Guten wie im Bösen, sie ist es, die folglich die Begierden erregt und nährt in der Hoffnung, dass sie Befriedigung finden. Aber das Objekt dieser Begierden, das man anfangs geradezu in den Händen zu halten scheint, flieht schneller, als man ihm zu folgen vermag. Wenn man schon glaubt, es erreichen zu können, verwandelt es sich und erscheint in noch weiterer Ferne. Da wir die schon zurückgelegte Strecke nicht mehr sehen können, halten wir sie für äußerst gering; und die, die wir noch zurückzulegen haben, vergrößert sich und dehnt sich unaufhörlich weiter aus. So erschöpfen wir unsere Kräfte, ohne aber das Ziel zu erreichen, und je näher wir der Genusssucht kommen, desto weiter entfernt sich das Glück von uns.
Im Gegenteil: Je näher der Mensch bei seinem natürlichen Zustand geblieben ist, desto kleiner ist der Unterschied zwischen seinen Wünschen und seinen Fähigkeiten, diese Wirklichkeit werden zu lassen, und folglich ist er dann auch weniger weit vom Glück entfernt. Nie wird er weniger unglücklich sein, als wenn er aller Dinge beraubt zu sein scheint, denn das Unglück besteht nicht im Mangel an den Dingen, sondern im Bedürfnis nach ihnen, das man dann zu spüren bekommt.
Die wirkliche Welt hat ihre Grenzen, diejenige aber, die wir uns nur in der Einbildung vorstellen, ist grenzenlos. Da wir nun die eine, die reale, nicht erweitern können, so wollen wir die andere einengen, denn allein aus dem Unterschied der beiden entsteht all die Not und Pein, die uns wirklich unglücklich macht. Außer der Kraft, der Gesundheit und der Selbstachtung beruhen alle Güter dieses Lebens auf unserer bloßen Annahme und Meinung; außer den körperlichen Schmerzen und den Gewissensbissen beruhen all unsere Übel auf Einbildung. Das ist ein allbekannter Grundsatz, wird man nun sagen. Das gestehe ich zu, aber dessen praktische Anwendung ist nicht allgemein, und gerade um diese praktische Anwendung geht es hier.
Émile, Buch 2
Im Auf und Ab eines langen Lebens habe ich festgestellt, dass die Zeiten, an die ich mich besonders gern erinnere und die mich am meisten bewegen, nicht die der angenehmsten Genüsse und der lebhaftesten Vergnügungen waren. So stürmisch diese kurzen Augenblicke des Wahns und der Leidenschaften auch gewesen sein mögen, so sind sie doch, und zwar wegen ihrer Heftigkeit, nur dünn gesäte Punkte in der Linie meines Lebens. Sie sind so selten und gehen so rasend schnell vorbei, als dass sie einen dauernden Gemütszustand bildeten, und das Glück, nach dem sich mein Herz sehnt, besteht nicht aus kleinen flüchtigen Punkten, sondern aus einem einfachen und dauernden Zustand, der nichts Heftiges in sich hat, sondern dessen Dauer den Reiz derart steigert, dass man darin letztlich die höchste Glückseligkeit findet.