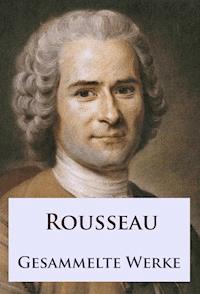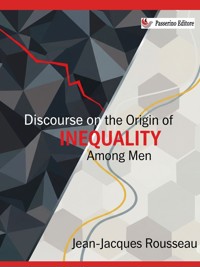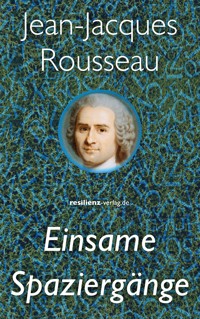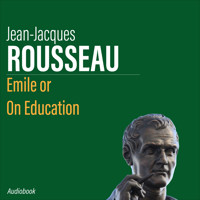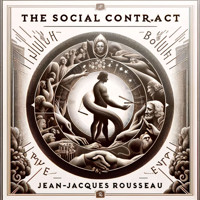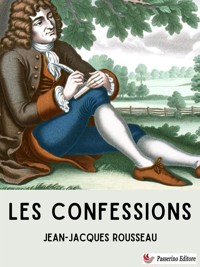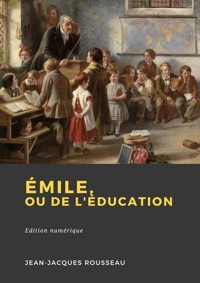Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Cividale Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Cividale klassik
- Sprache: Deutsch
Nicht weniger als revolutionäre Gedanken - "Vom Gesellschaftsvertrag oder Die Grundsätze des Staatsrechtes", so die wörtliche Übersetzung des Original-Titels, hatte es nach seinem Erscheinen 1762 nicht leicht: Schließlich stellt Rousseau darin das herrschende politische und gesellschaftliche System grundlegend infrage. Die geistige Sprengkraft, die auch bald Einfluss auf die Französische Revolution haben sollte, schien berechtigterweise so groß, dass das Buch mehrfach verboten wurde. Heute rechnet man das Werk auch den Wegbereitern unserer Demokratie zu. Rousseau erklärt, wie er sich die richtige Organisation eines Staates vorstellt: Die Bürger des Gemeinwesens stimmen zunächst zu, dass sie zu dem Staat gehören wollen. In Volksversammlungen wird dann über Gesetze entschieden - aber laut Vertrag soll der Einzelne nicht für jene Vorhaben stimmen, die seinen eigenen Interessen entsprechen, sondern für den Vorschlag votieren, der dem Allgemeinwohl am förderlichsten ist. Doch so sehr wir Rousseau auch in den Reihen der Basisdemokraten verorten möchten - er hatte doch auch einige Bedenken gegenüber einer solchen Regierungsform. Welche? Lesen Sie selbst … Die zweisprachige Ausgabe beinhaltet den deutschsprachigen Text in der Übersetzung von Hermann Denhardt, überarbeitet von Iris Michaelis sowie die französische Originalversion. Eine ca. 80-seitige Einführung von Timo Pongrac erläutert die grundlegenden Gedanken des Gesellschaftsvertrags und enthält eine Leseempfehlung der wichtigsten Kapitel sowie eine umfangreiche Literaturliste.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 541
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jean-Jacques Rousseau
Der Gesellschftsvertrag
Du Contract Social
Mit einer Einführung von Timo Pongrac
1. Auflage
© Cividale Verlag Berlin, 2014
Kontakt: [email protected]
www.cividale.de
ISBN 978-3-945219-02-7
eISBN 978-3-945219-02-7
Umschlaggestaltung: Nina und Christoph von Herrath, www.cvh-graphic-design.de
Übersetzung: Hermann Denhardt, überarbeitet von Iris Michaelis
Lektorat der Einführung: Carola Köhler
Inhalt
Der Gesellschaftsvertrag von Jean-Jacques Rousseau
Eine Einführung von Timo Pongrac
1. Einleitung
2. Absicht und Kontexte des Gesellschaftsvertrags
3. Vom Individuum zum Volk. Freiheit und Vertragsschluss
4. Institutionen der Freiheit
5. Ausblick. Bedingungen der Freiheit
6. Inhaltsübersicht und Lektüreempfehlungen
Endnoten
7. Literaturhinweise
7.1. Verwendete Primärliteratur
7.2. Kommentierte Sekundärliteratur
7.3. Weitere verwendete Literatur
ERSTES BUCH
1. Kapitel
INHALT DES ERSTEN BUCHES
2. Kapitel
DIE ERSTEN GESELLSCHAFTEN
3. Kapitel
DAS RECHT DES STÄRKEREN
4. Kapitel
DIE SKLAVEREI
5. Kapitel
ALLE ÜBEREINKÜNFTE BERUHEN AUF EINER ERSTEN ÜBEREINKUNFT
6. Kapitel
DER GESELLSCHAFTSVERTRAG
7. Kapitel
DER SOUVERÄN
8. Kapitel
DER STAATSBÜRGERLICHE ZUSTAND
9. Kapitel
DAS REALEIGENTUM
ZWEITES BUCH
1. Kapitel
DIE SOUVERÄNITÄT IST UNVERÄUSSERLICH
2. Kapitel
DIE SOUVERÄNITÄT IST UNTEILBAR
3. Kapitel
OB DER ALLGEMEINE WILLE IRREN KANN
4. Kapitel
DIE GRENZEN DER SOUVERÄNEN GEWALT
5. Kapitel
DAS RECHT ÜBER LEBEN UND TOD
6. Kapitel
VOM GESETZ
7. Kapitel
DER GESETZGEBER
8. Kapitel
DAS VOLK
9. Kapitel
FORTSETZUNG
10. Kapitel
FORTSETZUNG
11. Kapitel
DIE VERSCHIEDENEN SYSTEME DER GESETZGEBUNG
12. Kapitel
DIE EINTEILUNG DER GESETZE
DRITTES BUCH
1. Kapitel
DIE REGIERUNG IM ALLGEMEINEN
2. Kapitel
VON DEM PRINZIP, NACH DEM DIE VERSCHIEDENEN REGIERUNGSFORMEN ORGANISIERT WERDEN
3. Kapitel
DIE EINTEILUNG DER REGIERUNGEN
4. Kapitel
DIE DEMOKRATIE
5. Kapitel
DIE ARISTOKRATIE
6. Kapitel
DIE MONARCHIE
7. Kapitel
DIE GEMISCHTEN REGIERUNGSFORMEN
8. Kapitel
NICHT JEDE REGIERUNGSFORM IST FÜR JEDES LAND GEEIGNET
9. Kapitel
DIE KENNZEICHEN EINER GUTEN REGIERUNG
10. Kapitel
VOM MISSBRAUCH DER REGIERUNG UND IHRER NEIGUNG ZUR ENTARTUNG
11. Kapitel
VOM TOD DES POLITISCHEN KÖRPERS
12. Kapitel
WIE SICH DIE SOUVERÄNE MACHT AUFRECHTERHÄLT
13. Kapitel
FORTSETZUNG
14. Kapitel
FORTSETZUNG
15. Kapitel
DIE ABGEORDNETEN ODER DIE VERTRETER DES VOLKES
16. Kapitel
DIE EINSETZUNG DER REGIERUNG IST KEIN VERTRAG
17. Kapitel
DIE EINSETZUNG DER REGIERUNG
18. Kapitel
DIE MITTEL, DEN USURPATIONEN DER REGIERUNG VORZUBEUGEN
VIERTES BUCH
1. Kapitel
DER ALLGEMEINE WILLE IST UNZERSTÖRBAR
2. Kapitel
VON DEN ABSTIMMUNGEN
3. Kapitel
DIE WAHLEN
4. Kapitel
DIE RÖMISCHEN COMITIEN
5. Kapitel
DAS TRIBUNAT
6. Kapitel
DIE DIKTATUR
7. Kapitel
DAS CENSORAMT
8. Kapitel
DIE BÜRGERLICHE RELIGION
9. Kapitel
SCHLUSS
Fußnoten
AVERTISSEMENT
LIVRE PREMIER
Chapitre I
SUJET DE CE PREMIER LIVRE
Chapitre II
DES PREMIÈRES SOCIÉTÉS
Chapitre III
DU DROIT DU PLUS FORT
Chapitre IV
DE L'ESCLAVAGE
Chapitre V
QU'IL FAUT TOUJOURS REMONTER A UNE PREMIÈRE CONVENTION
Chapitre VI
DU PACTE SOCIAL
Chapitre VII
DU SOUVERAIN
Chapitre VIII
DE L'ÉTAT CIVIL
Chapitre IX
DU DOMAINE RÉEL
LIVRE DEUXIÈME
Chapitre I
QUE LA SOUVERAINETÉ EST INALIÉNABLE
Chapitre II
QUE LA SOUVERAINETÉ EST INDIVISIBLE
Chapitre III
SI LA VOLONTÉ GÉNÉRALE PEUT ERRER
Chapitre IV
DES BORNES DU POUVOIR SOUVERAIN
Chapitre V
DU DROIT DE VIE ET DE MORT
Chapitre VI
DE LA LOI
Chapitre VII
DU LÉGISLATEUR
Chapitre VIII
DU PEUPLE
Chapitre IX
SUITE
Chapitre X
SUITE
Chapitre XI
DES DIVERS SYSTÈMES DE LEGISLATION
Chapitre XII
DIVISION DES LOIS
LIVRE TROISIÈME
Chapitre I
DU GOUVERNEMENT EN GÉNÉRAL
Chapitre II
DU PRINCIPE QUI CONSTITUE LES DIVERSES FORMES DE GOUVERNEMENT
Chapitre III
DIVISION DES GOUVERNEMENTS
Chapitre IV
DE LA DÉMOCRATIE
Chapitre V
DE L'ARISTOCRATIE
Chapitre VI
DE LA MONARCHIE
Chapitre VII
DES GOUVERNEMENTS MIXTES
Chapitre VIII
QUE TOUTE FORME DE GOUVERNEMENT N'EST PAS PROPRE A TOUT PAYS
Chapitre IX
DES SIGNES D'UN BON GOUVERNEMENT
Chapitre X
DE L'ABUS DU GOUVERNEMENT ET DE SA PENTE A DÉGÉNÉRER
Chapitre XI
DE LA MORT DU CORPS POLITIQUE
Chapitre XII
COMMENT SE MAINTIENT L'AUTORITÉ SOUVERAINE
Chapitre XIII
SUITE
Chapitre XIV
SUITE
Chapitre XV
DES DÉPUTÉS OU REPRÉSENTANTS
Chapitre XVI
QUE L'INSTITUTION DU GOUVERNEMENT N'EST POINT UN CONTRAT
Chapitre XVII
DE L'INSTITUTION DU GOUVERNEMENT
Chapitre XVIII
MOYENS DE PRÉVENIR LES USURPATIONS DU GOUVERNEMENT
LIVRE QUATRIÈME
Chapitre I
QUE LA VOLONTÉ GÉNÉRALE EST INDESTRUCTIBLE
Chapitre II
DES SUFFRAGES
Chapitre III
DES ELECTIONS
Chapitre IV
DES COMICES ROMAINS
Chapitre V
DU TRIBUNAT
Chapitre VI
DE LA DICTATURE
Chapitre VII
DE LA CENSURE
Chapitre VIII
DE LA RELIGION CIVILE
Chapitre IX
CONCLUSION
Notes
Der Gesellschaftsvertrag von Jean-Jacques Rousseau.
Eine Einführung von Timo Pongrac
1. Einleitung
Wer sich heute mit dem Gesellschaftsvertrag von Rousseau beschäftigt, wird dazu vermutlich eine von zwei Veranlassungen haben. Die erste könnte historisches Interesse sein: Die Schrift erscheint als ein wertvolles Dokument vergangenen Denkens, das uns einen Einblick in die politischen Ideenwelten zurückliegender Zeiten eröffnet. Man liest sie in derselben Einstellung, mit der man ein Museum betritt. Ein solcher Zugang ist zweifellos naheliegend, denn Rousseaus Zeiten waren bewegte Zeiten. Er lebte in der Epoche der europäischen Aufklärung und damit in einer spannungsreichen Umbruchphase, in der die Fundamente der modernen Welt gelegt wurden. Das schlug sich auch in seinem Werk nieder. Es ist ein Dokument des sozialen Wandels, Ausdruck des bürgerlichen Strebens nach Emanzipation und Selbstbestimmung, des Kampfes gegen die feudalen und kirchlichen Fesseln der Vergangenheit. Dies gilt selbst dann noch, wenn man einräumt, dass Rousseau in vielen Dingen gerade gegen den herrschenden Zeitgeist, auch den der Aufklärung, anschrieb. Man mag ihn als Zivilisationsfeind, als rückwärtsgewandten Kritiker von Wissenschaft und Technik ansehen, erfüllt von den Sehnsüchten nach einem einfachen Leben.i Und doch ist Rousseau immer auch Aufklärer geblieben. Er beklagt die Missstände seiner Zeit und entwirft, in steter Auseinandersetzung mit seinen Zeitgenossen, Visionen des Besseren.
Letzteres wird wohl in keiner Schrift so deutlich wie in seinem Gesellschaftsvertrag, den man ohne zu übertreiben als wichtigsten oder zumindest einflussreichsten demokratietheoretischen Grundtext der Moderne bezeichnen kann. In ihm bündeln sich nicht nur die zentralen politikphilosophischen Interpretationslinien der europäischen Neuzeit. Er stellt auch eine bleibende Quelle der Inspiration für alle radikaldemokratischen Bewegungen der jüngeren Geschichte dar. Den Jakobinern etwa galt der Gesellschaftsvertrag gleichsam als Programmschrift der Französischen Revolution.ii Man könnte sich daher geneigt sehen, den historischen wie werkgeschichtlichen Ort des Textes auszuloten und Rousseaus Abhandlung vor dem Hintergrund ihrer Zeit zu erschließen, um sie in die vielgestaltigen und weitreichenden Diskurse der Aufklärung einzuordnen. Doch obzwar ein solcher Zugang zweifelsohne aussichtsreich und verlockend erscheinen mag, soll er in der hier vorliegenden Einführung ausdrücklich nicht verfolgt werden bzw. zumindest nicht im Zentrum stehen. Denn man kann sich der Schrift auch aus einer alternativen Perspektive und mit anderen als musealen Absichten anzunähern versuchen.
Dies führt uns zu dem zweiten möglichen Grund für eine Auseinandersetzung mit Rousseaus Abhandlung: Wer den Gesellschaftsvertrag nicht aus historischem Interesse zur Hand nimmt, der oder die dürfte vor allem wissen wollen, was uns das Werk heute noch zu sagen hat. Eine derartige Absicht kann man als systematisches Erkenntnisinteresse bezeichnen. Und auch sie erscheint legitim, denn Rousseaus Abhandlung ist eine philosophische Schrift. Als eine solche sucht sie nach allgemeinen und überhistorischen Wahrheiten, die im hier vorliegenden Falle die Grundsätze des Staatsrechts betreffen. Mit diesem Anspruch kann man den Gesellschaftsvertrag durchaus ernst nehmen. Man wird sich dann weniger für die vielfältigen geschichtlichen Bezüge und Querverweise interessieren. Im Zentrum steht vielmehr die Frage nach der Überzeugungskraft der im Text vertretenen Positionen und der zu ihrer Begründung angeführten Argumente. Man möchte wissen, wie schlüssig und plausibel die von Rousseau vorgebrachte Konzeption ist, um sich auf diesem Wege Anregungen für das heutige politische Denken und Handeln zu verschaffen. Dafür müssen die Begründungszusammenhänge des Textes selbst in den Blick genommen werden. Denn nur deren Kenntnis gestattet ein informiertes Urteil darüber, welche Überlegungen und Einsichten des Gesellschaftsvertrags auch für die Gegenwart noch relevant sein könnten. Diesem Erkenntnisinteresse entgegenzukommen, ist die erklärte Absicht der vorliegenden Einleitung. Sie möchte den Zugang zum Text erleichtern, indem sie die konzeptionellen Grundlagen und systematischen Zusammenhänge der von Rousseau verfolgten Argumentationslinien so transparent und plausibel wie möglich nachzuzeichnen versucht. Auch wenn dies manchmal mühevoll erscheinen mag, ist es der einzige Weg, sich das Anliegen des Gesellschaftsvertrags zu vergegenwärtigen.
Das soll indes nicht bedeuten, dass dabei ohne jede kritische Distanz verfahren wird. Mitdenken heißt Weiterdenken! Eine systematische Rekonstruktion des Gesellschaftsvertrags wird daher nicht nur die Stärken der Abhandlung, sondern ebenso die Schwachpunkte und Schwierigkeiten der rousseauschen Konzeption zu berücksichtigen haben. Auch das ist ein Gebot ernsthafter Auseinandersetzung mit dem Text. Nur wenn man diesen in allen seinen Facetten, also auch den problematischen, zur Kenntnis nimmt, kann man sich ein ausgewogenes Gesamturteil bilden.
Eine kritisch-distanzierte Einstellung einzunehmen, bedeutet aber auch, dass man nicht alle Ansichten des Autors teilen muss, um sich der Grundintention seines Werks zu vergewissern. Dadurch eröffnen sich gewisse Freiheitsspielräume. Von ihnen soll in der hier vorliegenden Einführung vor allem in einer Hinsicht Gebrauch gemacht werden: Wie viele seiner Zeitgenossen war auch Rousseau davon überzeugt, dass Politik eine ausschließlich männliche Domäne darstellt. Frauen sollten sich seiner Auffassung zufolge nicht um die öffentlichen Angelegenheiten bekümmern, sondern in der Sphäre des Haushalts ihren vermeintlich ‚natürlichen‘ Pflichten und Bestimmungen nachkommen. Obwohl sich diese Position nicht explizit im Gesellschaftsvertrag selbst ausgeführt findet, wird man sie durch Hinzuziehen anderer Schriften Rousseaus ohne weiteres belegen können.iii Inwiefern diese Ansicht auch sein politiktheoretisches Hauptwerk berührt, ist jedoch fraglich.iv Wir wollen im Folgenden jedenfalls davon ausgehen, dass sich der Gesellschaftsvertrag auch dann plausibel rekonstruieren lässt, wenn man dabei keinen politischen Ausschluss von Frauen voraussetzt. Das hat zur Folge, dass bei der Darstellung von Rousseaus politiktheoretischer Konzeption ganz selbstverständlich stets von Bürgern wie von Bürgerinnen die Rede sein wird. So viel interpretatorische Freiheit wird man sich herausnehmen müssen, um das rousseausche Projekt nicht bereits von seinen Grundlagen her hoffnungslos zu diskreditieren.
Damit ist die Absicht der vorliegenden Einführung in groben Zügen umrissen. Ihr Ziel besteht in einer systematischen Rekonstruktion des Gesellschaftsvertrags, bei der die wichtigsten Begründungszusammenhänge und Argumentationsfiguren des Textes betrachtet und diskutiert werden sollen. Historische Bezüge und Querverweise geraten dabei nur insoweit in den Blick, wie dies für eine Veranschaulichung des Grundanliegens der Schrift angebracht erscheint. Sie werden uns zudem ausnahmslos in Gestalt von anderen politischen Theorien begegnen – solchen nämlich, mit denen sich Rousseau in seinem Werk selbst auseinandergesetzt hat. Realgeschichtliche Darlegungen wird man in der Einleitung hingegen ebenso wenig finden wie biographische Ausführungen. Darin besteht eine Konsequenz der hier verfolgten theoretischen Schwerpunktsetzung.v
Die systematische Rekonstruktion des Gesellschaftsvertrags soll dabei in vier Schritten erfolgen. Zunächst wollen wir uns mit der grundlegenden Absicht des Textes vertraut machen. In diesem Zusammenhang werden auch die theoretischen Modelle anderer politischer Philosophen eine Rolle spielen. Sodann ist das spezifische Begründungskonzept in den Blick zu nehmen, mit dessen Hilfe Rousseau das von ihm ins Auge gefasste Gesellschaftsmodell zu rechtfertigen sucht: die titelgebende Figur eines hypothetischen Gesellschaftsvertrags. Welche konkreten politischen Einrichtungen und Institutionen auf diesem Wege Legitimation und Begründung finden sollen, wird das Thema des folgenden Kapitels sein. Abschließend widmen wir uns den externen Bedingungen, unter denen eine Umsetzung des rousseauschen Modells möglich schiene. Mit diesen Hintergrundinformationen sollte der Leser bzw. die Leserin imstande sein, sich durch die Lektüre des Gesellschaftsvertrags ein eigenes Urteil über die Überzeugungskraft und den möglichen bleibenden Wert der Schrift zu verschaffen.
2. Absicht und Kontexte des Gesellschaftsvertrags
Rousseaus Gesellschaftsvertrag ist ein Werk von bescheidenem Umfang. Lediglich eine „kleine Abhandlung“ könne er vorlegen, einige kurze Passagen aus dem, was ursprünglich einmal ein umfassenderes Werk über die Natur politischer Institutionen hätte werden sollen, das zu vollenden jedoch die Kräfte des Verfassers überstiegen habe.vi Rousseau, der im Laufe seiner Studien zu der Überzeugung gelangt war, „daß alles im letzten Grunde auf die Politik ankäme und daß, wie man es auch anstellte, jedes Volk stets nur das würde, was die Natur seiner Regierung aus ihm machen würde“vii, eröffnet sein politiktheoretisches Hauptwerk mit dem Eingeständnis, dass es sich dabei um nicht viel mehr als um ein Bruchstück handele. Eine solche Bemerkung lässt aufhorchen. Fragmente lesen sich nicht leicht. Vieles bleibt in ihnen unausgeführt, was eigentlich umfangreichere Betrachtungen und Erläuterungen erfordert hätte. Es geht um das Ganze – aber nur Teile davon werden präsentiert. Rousseau warnt uns also vor: Der Gesellschaftsvertrag ist das Resultat einer jahrelangen Arbeit, die nun in komprimierter und verdichteter Form verabreicht wird. Damit ist Komplexität vorgezeichnet. Um trotzdem den Überblick zu behalten, ist es hilfreich, sich vor der ersten Lektüre zunächst mit dem Grundanliegen der Schrift vertraut zu machen. Was ist die generelle Absicht von Rousseaus kurzer Abhandlung über die Grundsätze des Staatsrechts?
Eine Antwort darauf findet sich bereits auf den ersten Seiten des Gesellschaftsvertrags. „Der Mensch“, so heißt es im ersten Kapitel des ersten Buches, „wird frei geboren, und überall ist er in Ketten. Mancher hält sich für den Herrn seiner Mitmenschen und ist trotzdem mehr Sklave als sie. Wie hat sich diese Umwandlung zugetragen? Ich weiß es nicht. Was kann ihr Rechtmäßigkeit verleihen? Diese Frage glaube ich beantworten zu können.“viii Man sollte sich von der Formulierung nicht in die Irre führen lassen. Rousseaus Anliegen ist es keinesfalls, irgendwelche Formen personaler Abhängigkeit zu rechtfertigen – auch wenn es dem Anspruch nach durchaus um eine Legitimierung von Ketten geht. Aber welcher Art von Ketten? Das ist die Frage! Denn für Rousseau sind nicht alle Fesseln gleichermaßen akzeptabel. Solche jedenfalls sind es mit Sicherheit nicht, die einzelne Menschen der willkürlichen Verfügung durch andere unterwerfen. Man sollte das Wort ‚Ketten‘ vielleicht mit dem neutraleren Wort ‚Bindungen‘ übersetzen. Wenn wir eine Bindung miteinander eingehen, wie dies in gesellschaftlichen Verhältnissen stets der Fall ist, bedeutet dies, dass wir einen Teil unserer Unabhängigkeit aufgeben und etwas von unserer Autarkie preisgeben müssen. Die Frage lautet dann: Wie können wir uns so miteinander vereinigen, dass die konkrete Form dieser freiheitseinschränkenden Bindung zugleich als rechtmäßig angesehen werden kann? Welche sozialen und politischen Ketten sind hinnehmbar und akzeptabel?
Das Grundanliegen des Gesellschaftsvertrags ist damit ein normatives. Anders als noch in seinen berühmten kulturkritischen Schriftenix geht es Rousseau hier nicht um eine historische Erklärung der Entstehung von gesellschaftlichen bzw. politischen Abhängigkeitsverhältnissen; geschichtliche Beschreibungen dienen im Gesellschaftsvertrag allenfalls zur Veranschaulichung und nicht zur systematischen Begründung. Rousseaus eigentliche Absicht ist eine andere: Er fragt nicht danach, wie gesellschaftliche Verbindungen tatsächlich entstanden sind, sondern wie sie beschaffen sein müssten, um Legitimität beanspruchen zu können. Rousseau sucht also nach geeigneten Maßstäben, anhand deren sich beurteilen lässt, ob soziale Beziehungsformen anerkennenswürdig sind oder nicht. Wie sollte ein Gemeinwesen aufgebaut und institutionell verfasst sein, damit es die rational motivierte Zustimmung seiner Mitglieder verdient? Das ist die Grundfrage des Gesellschaftsvertrags.
Rousseau zielt dabei insbesondere auf eine Begründung angemessener politischer Institutionen. Solche Institutionen gehen in aller Regel mit hierarchischen Beziehungsmustern einher. Es gibt Regierende und Regierte. Damit sind Herrschaftsverhältnisse im Spiel. Aber aus welchem Grund bemüht sich der Verfasser des Gesellschaftsvertrags, politische Autoritätsstrukturen zu legitimieren, wenn doch der Mensch ein zur Freiheit geborenes Wesen ist? Wären nicht auch horizontalere Beziehungsformen möglich?
Eine Antwort auf diese Fragen lässt sich im Sinne Rousseaus wie folgt umreißen: Zwar sind die Menschen in der Tat frei geboren. Allerdings sind sie, jedenfalls unter normalen Umständen, gezwungen, in gesellschaftlichen Beziehungen zu leben, die ihnen ein kooperatives Verhalten abverlangen. In einer Gesellschaft kann nicht jeder und jede einfach immer das tun, wonach ihm oder ihr gerade der Sinn stehen mag. Er oder sie muss vielmehr Rücksicht auf die Wünsche und Nöte der anderen nehmen. Wären Menschen vollkommene moralische Geschöpfe, so würden sie bei allen ihren individuellen Entscheidungen stets von sich aus das Wohl aller anderen im Auge behalten – vorausgesetzt, dass sie sich über sämtliche Konsequenzen ihres Handelns im Klaren sein können. Eine solche Annahme ist aber unrealistisch. Menschen sind zwar durchaus zu moralischen Rücksichten in der Lage. Sie sind aber ebenso egoistische Wesen, die in vielen Situationen primär auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind, der nicht immer automatisch im Einklang mit den Forderungen der Moral zu stehen braucht. Deshalb bedarf es anderer als moralischer Garantien, um ein kooperatives Miteinander zu gewährleisten, das auch unter Bedingungen von Interessenkonkurrenz aufrechterhalten werden kann.
Dies ist exakt der Punkt, an dem für Rousseau die Politik ins Spiel kommt: „Gäbe es keine verschiedenen Interessen“, heißt es in einer Fußnote des Gesellschaftsvertrags, „würde [alles] ganz von selbst gehen, und die Politik aufhören, eine Kunst zu sein.“x Da die Menschen aber, wie beschrieben, oftmals dazu tendieren, eher ihren partikularen Neigungen als allgemeinen Grundsätzen der Moral zu folgen, bedarf es nach Rousseau der Kunst der Politik. Diese erzwingt, machtgestützt und sanktionsbasiert, kooperatives Verhalten auch in solchen Fällen, in denen die moralischen Ressourcen der Individuen dafür nicht ausreichend wären. Ihre Aufgabe ist es, kollektiv bindende Regeln des Miteinanders festzulegen und diese, wenn nötig unter Androhung von Strafe, gegenüber den Einzelnen durchzusetzen, damit diese von ihren Freiheiten keinen missbräuchlichen Gebrauch machen. Wie aber muss Politik institutionalisiert und organisiert werden, damit sie ihrerseits die ihr zukommende Macht und Autorität nicht ausnutzt – indem etwa Gesetze verabschiedet werden, die ausschließlich den partikularen Interessen der Herrschenden zugute kommen? Das führt uns wieder zur Ausgangsfrage des Gesellschaftsvertrags zurück. Was sind die Grundzüge eines rechtmäßigen Gemeinwesens?
Natürlich ist diese Frage alles andere als neu. Die Suche nach der guten und gerechten Ordnung beschäftigt das europäische Politikdenken mindestens seit Platon.xi Rousseau zeichnet sich allerdings dadurch aus, dass er beinahe alle bisherigen Überlegungen seiner Vorläufer als fehlerhaft zurückweist. Seine Kritik verfolgt dabei im Wesentlichen zwei Stoßrichtungen: Einerseits kritisiert er die grundbegrifflichen Fundamente, von denen ausgehend politische Autorität in vielen Fällen abgeleitet wurde. Andererseits verwirft er die Institutionalisierungsvorschläge seiner Vorgänger. In Abgrenzung dazu entwickelt Rousseau seine eigenen Grundsätze des Staatsrechts – die zugleich auf die von ihm favorisierte Einrichtung von Politik vorausweisen. Das ist das hauptsächliche Thema des ersten Buchs des Gesellschaftsvertrags, um das es nun zunächst gehen soll.
Wir fangen mit dem ersten Punkt von Rousseaus Kritik an seinen Vorgängern an: den fehlerhaften grundbegrifflichen Fundamenten, die zur Rechtfertigung politischer Autoritätsansprüche herangezogen wurden. Rousseau weist hier insbesondere alle Versuche zurück, die Legitimität politischer Herrschaft in irgendeiner Weise von der Natur abzuleiten. So lässt sich eine Berechtigung zur Ausübung politischer Autorität seiner Ansicht nach zum Beispiel nicht auf ein ursprüngliches Recht des Stärkeren zurückführen. Das ist eine Begründungsstrategie, wie sie etwa in der Antike von dem griechischen Sophisten Thrasymachos vertreten wurde.xii Was ist daran falsch? Nun, es mag zwar sein, dass in der Geschichte tatsächlich oftmals die Stärksten die Geschicke der Politik bestimmen konnten. Aber wir erinnern uns: Rousseau fragt nicht danach, wie politische Autorität de facto zustande gekommen ist, sondern wie sie beschaffen sein muss, um Legitimität beanspruchen zu können. Tatsachen schaffen kein Recht; und Stärke vermag dies ebenso wenig. „Die Stärke ist ein physisches Vermögen; ich begreife nicht, welche sittliche Verpflichtung sie bewirken könnte. […] Muss man aus Zwang gehorchen, so braucht man nicht aus Pflicht zu gehorchen, und wird man nicht mehr zum Gehorchen gezwungen, so ist man dazu auch nicht mehr verpflichtet. Man sieht also, dass das Wort ‚Recht‘ der Stärke nichts verleiht; es ist hier vollkommen bedeutungslos.“xiii
Physische Gewalt stiftet keine sittliche Verpflichtung, ihr Folge zu leisten. Die Berechtigung zu politischer Machtausübung ergibt sich daher nicht aus dem schieren Faktum körperlicher Überlegenheit. Sie lässt sich aber auch nicht aus anderen als ‚natürlich‘ aufgefassten Qualitäten und Beziehungsformen ableiten. Weder gibt es naturhaft zur Herrschaft und zur Sklaverei geborene Menschen, wie es die Ansicht von Aristoteles war;xiv noch kann politische Autorität auf eine vermeintlich ‚natürliche‘ Autorität des Vaters über seine Kinder zurückgeführt werden, wie es die Verteidiger der Erbmonarchie, allen voran Robert Filmer,xv immer wieder behaupteten. Alle Menschen sind frei geboren; und in dieser Freiheit sind sie gleich. Die zufälligen Umstände ihrer Geburt und ihrer körperlichen Verfassung bilden keine normativ belastbaren Fundamente für die Begründung eines Führungsanspruchs der einen oder anderen. Interessant ist nicht zuletzt auch, was Rousseau in diesem Zusammenhang nicht anführt: Die Vorstellung einer Herrschaft von Gottes Gnaden – immerhin die wirkmächtigste politische Legitimationsformel seiner Zeit – ist dem Autor des Gesellschaftsvertrags nicht einmal eine Erwähnung wert. Solches Schweigen ist beredt. Politische Autorität jedenfalls hat, so kann man mit Rousseau beschließen, weder natürliche noch übernatürliche Quellen.
Man muss sich daher schon etwas größere Mühe machen, wenn man politische Institutionen auf einem tragfähigen Fundament errichten will. Welche rechtfertigungstheoretische Grundlegung nimmt Rousseau für seinen Ansatz in Anspruch? Die Antwort darauf fällt eindeutig aus: „Da kein Mensch eine natürliche Herrschaft über seinesgleichen hat und da die Stärke kein Recht schafft, so bleiben also Vereinbarungen die einzige Grundlage jeder rechtmäßigen Ausübung von Herrschaft unter den Menschen.“xvi Legitim ist nur diejenige politische Autorität, auf deren Einsetzung man sich zwanglos einigen könne. Rousseau stellt sich mit dieser Überlegung in die Traditionslinie des Kontraktualismus, also der neuzeitlichen Vertragstheorien, als deren prominenteste Vertreter, neben Rousseau selbst, die Engländer Thomas Hobbes und John Locke gelten.xvii Er teilt mit ihnen die Überzeugung, dass nur solche Herrschaftsformen Rechtmäßigkeit beanspruchen dürfen, auf die sich die von ihnen betroffenen Menschen vernünftigerweise verständigen könnten, wenn man sie fragen würde. Man muss sie nicht tatsächlich fragen. Es reicht vollkommen aus, mit hinreichend überzeugenden Argumenten plausibel zu machen, welche Regierungsform sich die Regierten selbst gäben, wenn sie dazu die Wahl hätten. Diese Argumentation gleichsam stellvertretend zu übernehmen, ist das Anliegen der Vertragstheorien. Politische Herrschaft wird darin nicht aus irgendwelchen naturhaften Qualitäten abgeleitet oder transzendent in einer göttlichen Stiftung verankert, sondern von der virtuellen Zustimmung der ihr Unterworfenen abhängig gemacht – Legitimität gleichsam von unten, demokratisch, jedenfalls der Idee nach.
Aber auf welche Regierungsform würden sich die Regierten einigen? Eine Antwort auf diese Frage hängt natürlich stark davon ab, in welcher Ausgangssituation sich die Menschen befänden. Um sich hierüber Klarheit zu verschaffen, wenden die meisten Vertragstheorien einen argumentativen Trick an: Sie lösen den Staat gedanklich auf. Das heißt, sie entwerfen eine Skizze desjenigen Zustands, in dem sich die Menschen vorfänden, wenn es keine ordnende Regierungsgewalt gäbe. Das ist der sogenannte Naturzustand – eine Hypothese oder ein Gedankenexperiment. Freilich kann man über diesen Zustand geteilter Meinung sein, mit allerdings gewichtigen Konsequenzen: Denn je nachdem, wie die staatenlose Ausgangslage der Menschen konkret veranschlagt wird, dürften andere Probleme als dringlich und politisch lösungsbedürftig angesehen werden. Die Grenzen und Befugnisse der Regierung, der Zweck und die Aufgaben von Politik variieren somit in Abhängigkeit von dem jeweiligen Bild des Naturzustands, das als Ausgangspunkt für die Begründung von Herrschaftsverhältnissen in Szene gesetzt wird. Nimmt man an, dass die Menschen auch ohne Staat im Großen und Ganzen kooperationsfähig sind, kann man davon ausgehen, dass sie der Politik eher eine geringe Rolle zusprechen würden. Ihr ermangelte es dann schlicht an Notwendigkeit. Wird der Naturzustand hingegen als ein hochgradig konflikthaftes Szenario entworfen, dürfte der politischen Ordnungsmacht eine größere Bedeutung beigemessen werden. Ohne sie ginge dann kaum etwas.
Für Thomas Hobbes ist diese letztere Variante die wahrscheinlichere. In seinen Augen ist ein Zustand ohne Staatlichkeit ein Zustand ohne Sicherheit und Berechenbarkeit. Da es keine allgemein festgesetzten Regeln gäbe, könnte niemand wissen, was die anderen jeweils gerade im Schilde führten. Jeder und jede wäre primär damit befasst, für die eigene Sicherheit Vorsorge zu tragen und alle Mittel dafür zu verwenden, potentielle Bedrohungen auszuschalten, auf welchem Wege und mit welchen Konsequenzen auch immer. Ein solches Verhalten wäre dabei nicht einmal nur erlaubt, sondern sogar ausdrücklich geboten, da für die eigene Selbsterhaltung zwingend erforderlich. Im Effekt hätte ein solcher Zustand aber katastrophale Konsequenzen für alle. Die permanente Notwendigkeit, möglichen Übergriffen anderer zuvorzukommen, würde zu einer Spirale der Gewalt und der Machtanhäufung führen, die schließlich in einen Krieg aller gegen alle einmünden müsste. Um dieser hoch desaströsen Konsequenz zu entrinnen, bliebe den Menschen nichts anderes übrig, als sich untereinander per Vertrag darauf zu einigen, fortan nicht mehr ihre je subjektiven Urteile zum alleinigen Maßstab allen Handelns zu machen. Stattdessen übertrügen sie die Kompetenz dazu auf einen von ihnen eingesetzten Souverän, der damit beauftragt wäre, die allgemeinen Regeln und Normen des sozialen Miteinanders für alle verbindlich festzusetzen. Die Einzelnen hätten demgegenüber nichts mehr zu melden, sondern müssten sich fügen. Und da nach Hobbes nur die Furcht vor Strafe Menschen effektiv zu einem kooperativen Verhalten zu veranlassen vermag, könnte auch nur ein mit unbegrenzten Befugnissen und Gewaltmitteln ausgestatteter Machthaber eine befriedete Gesellschaft herbeiführen und aufrechterhalten. Die Sorge um Frieden und Sicherheit als den beiden Hauptzwecken von Politik lässt Hobbes zum Fürsprecher eines unbeschränkten Absolutismus werden. Individuell einbehaltene Schutzrechte und garantierte Freiheiten der Einzelnen sind gegenüber der geballten Macht des Souveräns nicht mehr zu reklamieren.xviii
Das sieht bei John Locke schon ganz anders aus. Seiner Ansicht nach wäre ein Zustand ohne allgemeine Regierungsgewalt nicht primär durch Kämpfe und Konflikte gekennzeichnet. Die Menschen hätten Wichtigeres zu tun, als einander wechselseitig zu belauern. Sie würden das Geschäft ihrer Selbsterhaltung nicht im konfliktiven Gegeneinander, mit misstrauischem Seitenblick auf die anderen, verfolgen, sondern in ausschließlicher Konzentration auf sich selbst und das Werk ihrer Hände. Arbeit und Gütererzeugung wären ihre primären Ziele. Weil die Menschen gegenseitig ihre Eigentumsrechte respektierten und zudem genug für alle vorhanden wäre, ginge dies so lange gut, wie keine allzu krassen Unterschiede entstünden. Mit der Einführung des Geldes würde sich dies jedoch ändern. Nun käme es zu Besitzanhäufungen und Kapitalakkumulation, was wachsende soziale Spannungen und Konflikte zur Folge hätte. Um diese zu verhindern, wäre eine allgemein das Recht verwaltende Staatsmacht vonnöten. Die Menschen einigten sich auf die Einsetzung einer Regierung, um ihre individuellen Rechte vor potentiellen Übergriffen zu schützen. Da der einzige Zweck des Staates die Erhaltung des Eigentums, das heißt der Freiheiten, des Lebens und des Besitzes der Einzelnen wäre, müssten seine Kompetenzen durchaus nicht so umfassend sein, wie es Hobbes noch anzunehmen geneigt war. Vor allem hätte er in den Grundrechten und -freiheiten der Einzelnen seine unüberwindliche Schranke, die zu schützen ja seinen einzigen Existenzzweck abgäbe. Locke votiert damit für eine konstitutionell begrenzte Regierung, bei der das Besitzbürgertum zwar in der parlamentarischen Gesetzgebung den Ton angäbe, primär aber wahrscheinlich am Erfolg privater Geschäfte orientiert wäre, zu deren Sicherung der Staat nicht mehr als ein notwendiges Übel ist. Politik steht hier ganz im Dienste von Eigentumsinteressen und privaten Präferenzen. Nicht zu viel Staat, lautet die Devise.xix
Wäre Rousseau mit den Überlegungen seiner kontraktualistischen Vorgänger einverstanden, hätte er sich wohl kaum die Mühe gemacht, eine eigene Version des Gesellschaftsvertrags zu verfassen.xx Aber er kritisiert Hobbes und Locke sowohl für bestimmte Prämissen ihrer jeweiligen Begründungszusammenhänge als auch für die institutionellen Konsequenzen, die sie je für sich (im Namen der Regierten) daraus abzuleiten können glauben. Mit dem letzten Punkt kommt nun auch die zweite der oben angeführten Kritikdimensionen ins Spiel: die Beanstandung der konkreten Verfassungsvorschläge, die seine Vorläufer als rechtmäßig zu legitimieren bestrebt waren. Rousseaus Einwände sollen im Folgenden in aller gebotenen Kürze skizziert werden.
An Hobbes kritisiert Rousseau auf Seiten der Prämissen vor allem sein negatives Menschenbild und die daraus abgeleitete Charakterisierung des Naturzustands. Dies war bereits ein zentrales Anliegen seiner bedeutenden Abhandlung über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen. Rousseau bemüht sich darin, ein alternatives Bild des vorgesellschaftlichen und noch nicht verstaatlichten Menschen zu zeichnen. Ein solcher Mensch hätte zwar durchaus ein primäres Interesse an seiner eigenen Selbsterhaltung; allerdings wäre sein diesbezügliches Streben zugleich durch das natürliche Gefühl des Mitleids gemildert. Zudem hätten die Naturmenschen gar keinen Bedarf, einander wechselseitig zu fürchten und zu unterjochen, da sie selbstgenügsam und autark lebten. Der Naturzustand wäre demnach eher ein Zustand des Friedens und der reziproken Gleichgültigkeit.xxi Hier ist Rousseau näher bei Locke als bei Hobbes. Potentielle Konfliktursachen ergäben sich erst durch gesellschaftliche Einrichtungen (allen voran derjenigen des Privateigentums), die aber im Zustand natürlicher Unabhängigkeit noch gar nicht vorhanden wären. Erst durch gesellschaftliche Kontakte und Bedürfnisse würden die Menschen so schlecht, wie sie Hobbes von Natur aus zeichnet.
Wichtiger für das Thema des Gesellschaftsvertrags ist jedoch Rousseaus Ablehnung des hobbesschen Vertragsmodells mitsamt seinen herrschaftsrechtlichen wie institutionellen Konsequenzen. Wir erinnern uns: Hobbes hatte von den Einzelnen die Preisgabe ihrer je individuellen Selbstbestimmungsrechte durch Übertragung derselben auf einen allmächtigen Souverän verlangt, dem fortan die alleinige Gesetzgebungskompetenz zukomme. Das sei im Dienst des Friedens tunlich. Rousseau kann einem solchen Akt hingegen keinerlei Sinn abgewinnen. Er widerspräche nicht nur der Vernunft, sondern auch der Menschlichkeit: „Auf seine Freiheit verzichten, heißt auf seine Eigenschaft als Mensch, die Menschenrechte, ja selbst auf seine Pflichten verzichten. Wer auf alles verzichtet, für den ist keine Entschädigung möglich. Ein solcher Verzicht ist mit der Natur des Menschen unvereinbar, und man entzieht, wenn man seinem Willen alle Freiheit nimmt, seinen Handlungen allen sittlichen Wert. Kurz, es ist eine nichtige und mit sich selbst in Widerspruch stehende Vereinbarung, auf der einen Seite eine unumschränkte Macht und auf der andern einen schrankenlosen Gehorsam festzusetzen.“xxii Man müsste es schon mit einem Volk von Verrückten zu tun haben, wenn man vorgibt, dass die Unterwerfung unter die willkürliche Herrschaft eines ungebundenen Gewalthabers eine ernsthafte Option darstellte. Aber: „Verrücktheit verleiht kein Recht.“xxiii Zentral jedenfalls ist, dass die Menschen nicht frei dazu sind, sich ihrer Freiheit vollständig zu entäußern. Dies hieße in den Augen Rousseaus, auf die spezifische Würde und Eigenart des Menschseins zu verzichten.xxiv Und eine solche Entmenschlichung sollte nicht zum Rechtfertigungsgrund von Politik erhoben werden!
Locke gesteht Rousseau zu, dass er die Entstehung von staatlich geordneten Verhältnissen weitestgehend zutreffend beschrieben habe. Die meisten Staaten seien tatsächlich in Reaktion auf soziale Spannungen und Konflikte entstanden, die aus der Einführung von Geldbeziehungen und Eigentumsunterschieden resultierten. Ihr Zweck bestehe damit de facto in der Aufrechterhaltung von privatrechtlichen Besitzverhältnissen. Aber auch hier gilt erneut: Tatsachen schaffen kein Recht. Wie immer Staaten faktisch entstanden sein mögen – Rousseau geht es nicht um die Erklärung ihrer tatsächlichen Genese (die Locke durchaus adäquat erfasst habe), sondern um die Frage, wie sie beschaffen sein müssten, um Legitimität beanspruchen zu können. Das jedenfalls ist das Thema seines Gesellschaftsvertrags. Und in dieser Hinsicht käme eine rechtfertigende Begründung politischer Institutionen, die von den Interessen einiger Besitzenden ausgeht, nachgerade einem Betrugsversuch gleich. Das hat Rousseau bereits in der schon erwähnten Abhandlung über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen unmissverständlich klargestellt. Hier wird ein Regierungsvertrag à la Locke in den folgenden entlarvenden Worten geschildert: „Da er [der Reiche] allein gegen alle stand, konnte er sich wegen des gegenseitigen Neides nicht mit seinesgleichen gegen die Feinde verbünden, welche die Hoffnung auf gemeinsame Plünderung aber ihrerseits vereinte. Der Reiche in seiner Bedrängnis entwarf schließlich den ausgedachtesten Plan, den jemals der menschliche Geist ausbrütete, nämlich zu seinen Gunsten sogar die Kräfte derer zu benutzen, die ihn angriffen, aus seinen Gegnern seine Verteidiger zu machen, ihnen andere Grundsätze einzuflößen und ihnen andere Einrichtungen zu geben, die ihm so vorteilhaft wurden, wie ihnen das Naturrecht zuwider war.“xxv Aus einer List, die die Besitzenden gegen die Masse der Besitzlosen anwenden, lässt sich aber keine Rechtmäßigkeit ableiten. Schlimm genug, dass die meisten wirklichen Staaten, Rousseaus Ansicht zufolge, tatsächlich der Logik einer solchen List zu folgen scheinen!
Wenn es so aber nicht geht, wie sollte man dann verfahren? Rousseaus Vorschlag besteht nun darin, mit der grundlegenden Prämisse der Vertragstheorien radikal Ernst zu machen. Als Ausgangspunkt fungiert hier ja die Annahme, dass nur solche Formen der politischen Herrschaft Legitimität beanspruchen können, die sich als Resultat einer freien Übereinkunft der Unterworfenen denken lassen. Wenn dem aber so ist – warum sollte dann das Prinzip der freiwilligen Zustimmung auf den einmaligen Akt der vertraglichen Einsetzung einer politischen Gewalt begrenzt werden? Könnte es nicht auch im nachmaligen politischen Entscheidungsprozess selbst eine zentrale Rolle spielen? Warum nicht aus der Idee virtueller das Gebot tatsächlicher Zustimmung machen? Für Rousseau scheint dies die einzig sinnvolle Konsequenz zu sein. Denn Freiheit ist, das lässt sich seiner Kritik an Hobbes entnehmen, kein veräußerliches Gut. Sie bildet vielmehr den eigentümlichen Wesenskern des Menschen und den Grund für seine spezifische Eigenart und Würde. Warum sollte man annehmen, dass es den Interessen frei geborener Individuen entgegen käme, sich dieser ihrer Freiheit (etwa zugunsten eines unumschränkten Machthabers) leichthin zu entledigen?
Hobbes und Locke konnten mögliche Gründe dafür angeben, indem sie die Menschen künstlich in eine Situation versetzten, die ihnen den Verzicht auf ihre Selbstbestimmungsrechte schmackhaft machen sollte. Aber auch dabei sind sie Rousseau zufolge nicht radikal genug vorgegangen. Ihre Bebilderungen des Naturzustands scheinen in seinen Augen eher die Problemlagen und Zwänge tatsächlicher Gesellschaften zu spiegeln als das Projekt einer voraussetzungslosen Konstruktion idealer politischer Institutionen voranbringen zu können. Ein Zustand, in dem die Menschen rücksichtslos nach Macht streben (Hobbes) oder ausschließlich auf den Erhalt und die Vermehrung ihres Privateigentums bedacht sind (Locke), erweckt den Eindruck, nicht viel mehr als ein bloßes Abziehbild der bestehenden Verhältnisse zu sein. Ihn zum Ausgangspunkt zu nehmen, mag daher zwar angemessen sein, wenn man diese Verhältnisse mit den passenden politischen Institutionen ausgestattet wissen will. Aber das ist eben nicht das Anliegen Rousseaus. Ihn interessiert nicht, welche politischen Einrichtungen unter den gegebenen Umständen zweckdienlich wären, sondern wie Institutionen überhaupt beschaffen sein müssten, um als legitim gelten zu können. Und um dies herauszufinden, erscheint es wenig sinnvoll, eine Ausgangslage zu fingieren, die von der Anlage ihrer Problemdynamiken her doch nur zu einer Bestätigung der faktischen Verhältnisse führen muss.
Man kann den Naturzustand auch anders bebildern. Das hat Rousseau in seiner Abhandlung über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen vorgeführt, wie wir bereits sehen konnten. Aber muss man das überhaupt? Wenn es um die Frage geht, welche politischen Institutionen von dem freien Willen ihrer Mitglieder ausgehend Rechtmäßigkeit beanspruchen können, ist die als natürlich fingierte Ausgangslage doch überhaupt nicht entscheidend. Sicher, man muss sich zusammentun, um überleben zu können. So viel steht auch für Rousseau fest. Allein ist man schwach, nur gemeinsam lassen sich etwaig auftretende größere Schwierigkeiten erfolgreich bewältigen.xxvi Aber muss man denn viel mehr voraussetzen? Rousseau jedenfalls tut dies, wenigstens in seinem Gesellschaftsvertrag, nicht. Denn als das zentrale politische Problem, das es zu lösen gelte, erscheinen ihm hier weniger die Sorgen und Nöte, mit denen sich die Menschen in einer fiktiven vorgesellschaftlichen Situation herumzuschlagen hätten. Das entscheidende politisch lösungsbedürftige Problem sieht er vielmehr in der gesellschaftlichen Verbindung selbst! Diese sollte so organisiert und eingerichtet werden, dass ihre konkrete Form die Freiheiten der Gesellschaftsmitglieder nicht begrenzt und beschränkt, sondern sie im Gegenteil erhält und befördert. Das ist jedenfalls die Schlussfolgerung, die Rousseau aus seiner Hochachtung vor der menschlichen Willensfreiheit zieht. Und um herauszufinden, wie sich von diesem Ausgangspunkt angemessene politische Institutionen begründen ließen, muss man keinen Naturzustand fingieren. Es reicht der Blick auf die Gesellschaft. Die Frage nach deren rechtmäßiger Verfassung kann daher mit Rousseau in die folgende Problemstellung überführt werden: „ ‚Wie findet man eine Form der Gemeinschaft, welche mit der ganzen gemeinsamen Kraft die Person und das Vermögen jedes ihrer Mitglieder verteidigt und schützt und durch die jeder einzelne, obgleich er sich mit allen vereint, doch nur sich selbst gehorcht und so frei bleibt wie vorher?‘ Dies ist das Grundproblem, dessen Lösung der Gesellschaftsvertrag ist.“xxvii Wie man der Formulierung entnehmen kann, geht es hier zwar auch um den Schutz des Individuums und seines Besitzes. Im Zentrum jedoch steht die Forderung nach einer Versöhnung von menschlicher Selbstbestimmung und gesellschaftlicher Verbindung.
Aber ist das überhaupt realistisch? Hatten wir nicht anfangs festgestellt, dass jede Form von sozialer Bindung immer auch gewisse Freiheitseinschränkungen mit sich bringen muss? Lässt sich der Anspruch auf individuelle Selbstbestimmung unter gesellschaftlichen Bedingungen überhaupt unverkürzt zur Geltung bringen? Nun – das hängt davon ab, was für ein Freiheitsverständnis man dabei voraussetzt! Wenn man das Wesen von Freiheit darin sieht, alles tun und lassen zu können, was man möchte, dann erscheint eine solche Form von Freiheit in der Tat mit sozialen Verbindungen generell inkompatibel. Aber das ist nicht das Verständnis, das Rousseau seinen Erörterungen zugrunde legt. Für ihn gilt vielmehr ganz im Gegenteil: „Wenn jeder tut, was ihm gefällt, tut er oft etwas, was andern mißfällt, und dies nennt man nicht einen freien Zustand. Die Freiheit besteht weniger darin, seinem Willen zu folgen, als vielmehr darin, dem anderer nicht unterworfen zu sein. Sie besteht außerdem darin, den Willen anderer nicht dem unsrigen zu unterwerfen.“xxviii Ein Gemeinwesen kann also nur dann als frei und somit legitim verfasst gelten, wenn sichergestellt ist, dass seine Mitglieder untereinander in keinerlei Herrschafts- und Knechtschaftsbeziehungen stehen. Niemand sollte dem willentlichen Zwang einer oder eines anderen ausgeliefert sein.
Nun hatten wir aber ebenfalls festgestellt, dass es zur Aufrechterhaltung eines kooperativen Miteinanders (zumal unter solch anspruchsvollen Bedingungen, wie sie Rousseau einzufordern bemüht ist) bestimmter allgemeinverbindlicher Regeln bedarf. Solche Regeln müssen von irgendwem verabschiedet werden. Gemeinhin ist das der Punkt, an dem eine politische Autorität ins Spiel kommt. Lässt sich deren Einsetzung aber überhaupt mit dem Gebot der Herrschaftsfreiheit in Einklang bringen? Muss man nicht davon ausgehen, dass ihre Existenz notwendigerweise Zwang und somit Unfreiheit auf Seiten der Regierten mit sich brächte? Dies wäre in der Tat der Fall, wenn die hoheitliche Befugnis zur Festsetzung von allgemeinverbindlichen Regeln einem Souverän zukäme, der darüber unabhängig von den Gesellschaftsmitgliedern entscheiden könnte. Aber Rousseau will ja das Prinzip der freiwilligen Zustimmung auch in diesem Zusammenhang zur Geltung bringen. Denn wenn die den Regeln Unterworfenen selbst über deren Gehalt bestimmen dürften, wenn also das Volk der Souverän wäre, sähe das Ganze schon anders aus! Wer sich selbst, aus freiem Willen, Regeln gibt, ist nicht unfrei, wenn er sich diesen in der Folge auch unterwirft. Rousseau bemüht sich daher in seiner Abhandlung über die Grundsätze des Staatsrechts, die Chancen und Bedingungen einer solchen Form von politischer Autorität argumentativ durchzuspielen. Er ist, aus Hochachtung vor dem Prinzip der Willensfreiheit, ein überzeugter Fürsprecher der Volkssouveränität.
3. Vom Individuum zum Volk. Freiheit und Vertragsschluss
Als Ausgangspunkt fungiert auch im Gesellschaftsvertrag die legitimitätsstiftende Grundfigur eines ursprünglichen Vertrags, den die Menschen miteinander schließen, um sich zu einem Gemeinwesen zu verbinden. Rechtmäßigkeit lässt sich einzig aus dem Prinzip der freiwilligen Zustimmung generieren. Die Bedeutung dieses Prinzips darf sich Rousseau zufolge aber nicht schon im einmaligen Begründungsakt politischer Institutionen erschöpfen. Vielmehr muss es den Geist dieser Institutionen selbst beseelen und in ihnen zum Ausdruck kommen können. Freie Individuen schließen sich aus freien Stücken zusammen, um danach nicht weniger frei zu sein als zuvor. Und der Sinn ihrer Freiheit soll vor allem darin bestehen, nicht dem einzelnen Willen eines oder einer anderen ausgeliefert zu sein (wie es umgekehrt gilt, niemand anderen dem eigenen Willen zu unterwerfen). Wie müsste ein gesellschaftsstiftender und -legitimierender Vertrag konkret beschaffen sein, um diesen Anforderungen Rechnung tragen zu können?
Rousseau fordert als erstes einen vollständigen Rechtsverzicht von allen am Vertragsschluss beteiligten Individuen. Sein Vertragsmodell verlangt „die vollständige Überantwortung [l'aliénation totale] jedes Mitglieds mit allen seinen Rechten an die Gesamtheit“xxix. Was immer die Menschen zuvor als rechtmäßig für sich in Anspruch nahmen, wird nun außer Kraft gesetzt. Das klingt härter, als es gemeint ist. Denn es heißt nicht, dass die Menschen auch in der Folge so rechtlos bleiben, wie es beim Eintritt in die Gesellschaft von ihnen verlangt wird. Es bedeutet nur, dass sie übereinkommen, alle Rechte und Pflichten fortan ausschließlich auf politischem Wege auszuhandeln und festzulegen. Niemand kann sich mehr auf natürliche Vorrechte und Ansprüche berufen. Überhaupt hat kein einzelner Mensch mehr die Befugnis, allein bestimmen zu dürfen, was alle ihm oder ihr schulden und wozu man einander wechselseitig verpflichtet ist. Ein unter diesen Voraussetzungen getroffenes Urteil würde aller Wahrscheinlichkeit nach nämlich höchst parteilich ausfallen.xxx Und wenn es als rechtlicher Anspruch gegenüber anderen Menschen durchgesetzt werden könnte, wären diese nicht länger frei. Sie würden dann den partikularen Wünschen eines oder einer Einzelnen unterworfen, die nicht die ihren sind. Der für sich selbst voreingenommene Einzelwille darf daher nicht den Maßstab für die Festlegung kollektiv verbindlicher Rechte und Pflichten abgeben. Alles muss vielmehr politisch entschieden werden. Und das ist nicht unbedingt eine schlechte Lösung, wenn sichergestellt werden kann, dass der politische Normsetzungsprozess fair und gerecht, das heißt zum Nutzen aller, verläuft. Sie ergibt sich jedenfalls als unmittelbare Konsequenz aus Rousseaus Weigerung, vorpolitische (also individuelle oder natürliche) Ansprüche zum Richtwert gesellschaftlicher Regeln und Normen zu machen.
Wenn aber nicht mehr der potentiell für sich selbst voreingenommene Einzelwille eines oder einer jeden je für sich den Maßstab für die Festlegung gesellschaftlicher Rechte und Pflichten abgeben darf, welche Richtschnur soll dann bei der politischen Verabschiedung von kollektiv verbindlichen Regeln des sozialen Miteinanders den Ausschlag geben? Diese Frage führt uns zu der zweiten, zentralen Bestimmung des von Rousseau vorgeschlagenen Vertragsmodells. Sie verdient es, hier in aller Ausführlichkeit zitiert zu werden: „Scheidet man […] vom Gesellschaftsvertrag alles aus, was nicht zu seinem Wesen gehört, so wird man sich überzeugen, dass er sich in folgende Worte zusammenfassen lässt: Jeder von uns stellt gemeinschaftlich seine Person und seine ganze Kraft unter die oberste Leitung des allgemeinen Willens, und wir nehmen jedes Mitglied als untrennbaren Teil des Ganzen auf. An die Stelle der einzelnen Person jedes Vertragsschließenden setzt ein solcher Gesellschaftsvertrag sofort einen Gesamtkörper, eine moralische Person, deren Mitglieder aus sämtlichen Stimmabgebenden bestehen, und der durch ebendiesen Akt seine Einheit, sein gemeinsames Ich, sein Leben und seinen Willen erhält.“xxxi
An dieser Formulierung sind einige Aspekte bemerkenswert. Zunächst geht Rousseau davon aus, dass der Zusammenschluss der Individuen eine Art von politischem Körper [corps moral et collectif] schafft. Man kann sich darunter in etwa das denken, was man üblicherweise mit den Begriffen Staatsvolk oder Nation zu assoziieren gewohnt ist. Ferner wird diesem Körper (höchstwahrscheinlich in Analogie zu menschlichen Körpern) ein eigener Wille zugesprochen, den Rousseau den allgemeinen Willen [volonté générale] nennt. Da der Begriff vielleicht nicht unmittelbar einleuchtend ist, dürften an dieser Stelle einige kurze Erläuterungen angebracht sein. Zunächst sollte man sich vor Augen führen, dass jedwedes Wollen stets ein Wollen von etwas ist. Es richtet sich auf ein bestimmtes Objekt der Begierde, das das Ziel seines Strebens darstellt. Ein Wille kann daher nur insofern als allgemein bezeichnet werden, als der Gegenstand, auf welchen er abzielt, ein allgemeiner ist. Alles andere ergäbe keinen Sinn. Anstatt also auf einen bloß partikularen Zweck aus zu sein, erstrebt ein als allgemein charakterisierter Wille etwas, das alle Menschen zugleich wollen können. Diesen geteilten Gegenstand des gemeinsamen Wollens bezeichnet Rousseau als Gemeinwohl [bien commun].xxxii Das Gemeinwohl gibt den Inhalt des allgemeinen Willens ab. Es ist dasjenige, worauf dieser Wille per definitionem aus ist. Von den Einzelnen zu verlangen, dass sie sich der Leitung des allgemeinen Willens unterstellen, heißt also zu fordern, dass sie sich in ihren Urteilen am Gemeinwohl orientieren (anstatt ihr nur individuelles Wohlergehen und ihren lediglich eigenen Nutzen in den Vordergrund zu stellen).
Blenden wir vorerst aus, wie weitreichend diese Forderung zur Orientierung am Gemeinwohl gemeint sein könnte und konzentrieren uns auf ihre Relevanz für den Prozess der politischen Entscheidungsfindung. In ihm spielen die zu einem Kollektiv zusammengeschlossenen Individuen selbst die ausschlaggebende Rolle. Denn anders als noch bei Hobbes und Locke wird im rousseauschen Vertragsmodell keine externe Instanz damit beauftragt, die politischen Angelegenheiten zu übernehmen. Die Souveränität verbleibt vielmehr in den Händen des Volkes. Was alle betrifft, muss auch von allen entschieden werden. Das ist die Konsequenz aus Rousseaus Anspruch, das Prinzip der freiwilligen Zustimmung nicht auf den legitimierenden Gründungsakt politischer Institutionen zu beschränken, sondern es im politischen Prozess selbst unmittelbar zur Geltung zu bringen. Die Forderung, dass sich die Einzelnen dem allgemeinen Willen unterstellen sollen, kann dann in diesem Zusammenhang nur bedeuten, dass sie sich bei der Beurteilung und Verabschiedung von politischen Entscheidungen am Wohle aller zu orientieren haben und nicht etwa private und egoistische Ziele zum leitenden Maßstab ihrer Erwägungen machen dürfen. Anstatt ihren individuellen Interessen und partikularen Neigungen Gehör zu schenken, sollen sich die Menschen, soweit es um die Festlegung der kollektiv verbindlichen Regeln und Normen des sozialen Miteinanders geht, ausschließlich daran halten, was allen zum Vorteil gereichen könnte und was für alle das Beste wäre. Das heißt nicht, dass es gar keine Sonderinteressen mehr geben dürfte; Rousseau spricht ausdrücklich davon, dass die politische Organisierung von Gesellschaften einzig aufgrund der Existenz von widersprüchlichen Einzelinteressen erforderlich sei.xxxiii Es heißt lediglich, dass diese Sonderinteressen nicht zum Maßstab der Gesetzgebung gemacht werden sollen. Hier sind keine egoistischen, sondern nur verallgemeinerungsfähige Interessen zugelassen.
Die Voraussetzung dafür ist, dass es überhaupt Gemeinsamkeiten in den unterschiedlichen Interessen der Menschen gibt: „Das Gemeinsame in diesen verschiedenen Interessen bildet das gesellschaftliche Band; und gäbe es nicht irgendeinen Punkt, in dem alle Interessen übereinstimmen, so könnte keine Gesellschaft bestehen. Einzig und allein nach diesem gemeinsamen Interesse [intérêt commun] muss die Gesellschaft regiert werden.“xxxiv Von den Menschen zu fordern, dass sie sich am Wohl der anderen orientieren sollen, kann ihnen nur unter der Voraussetzung zugemutet werden, dass sie sich dadurch nicht selbst beträchtliche Nachteile einhandeln. Und das ist allein dann zu garantieren, wenn ihre je eigenen Interessen nicht grundsätzlich mit denjenigen der anderen konfligieren. Sollten die Einzelnen ihre individuellen Ziele ausschließlich auf Kosten ihrer Mitmenschen erreichen können, dann würde die Beförderung des Wohls der anderen einer Selbstschädigung gleichkommen. Ein solches Verhalten kann aber von niemandem sinnvollerweise verlangt werden. Ein gewisser Einklang und eine strukturelle Gleichgerichtetheit der Interessenlagen aller Gesellschaftsmitglieder muss daher vorausgesetzt oder korrektiv hergestellt werden, wenn die Gemeinwohlorientierung eine realistische Option darstellen soll. Denn allzu dominante Interessengegensätze würden das soziale Band zerreißen und die von den Einzelnen verlangte Orientierung am Wohlergehen der anderen schon allein deswegen höchst unwahrscheinlich machen, weil dieses nicht widerspruchsfrei mit dem ihrigen zu vereinbaren wäre. Eine derart zerrissene Gesellschaft müsste sich in politischer Hinsicht auf so unsichere Prinzipien wie Altruismus und Opferbereitschaft stützen und dürfte wohl keine besonders lange Halbwertszeit besitzen. Die Existenz eines identifizierbaren Gemeininteresses gehört daher zu den notwendigen Bestandsbedingungen einer Gesellschaft, die auf der Gemeinwohlorientierung ihrer politisch aktiven Mitglieder fußt.
Unterstellen wir also mit Rousseau, dass diese Voraussetzungen erfüllt sind. Kann dann nach allem Gesagten davon ausgegangen werden, dass das ursprünglich anvisierte Ziel einer Versöhnung von individueller Freiheit und gesellschaftlicher Verbindung erreicht ist? Die Chancen dafür stehen zumindest nicht schlecht! Zwar werden den Vertragschließenden durchaus gewisse Freiheitseinschränkungen zugemutet. Sie müssen sich am Gemeinwohl orientieren. Sie dürfen, soweit es um die Festlegung von allgemeinverbindlichen Regeln und Normen des sozialen Miteinanders geht, ihre partikularen Interessen nicht zur einzig gültigen Richtschnur erheben. Aber nur auf diese Weise lässt sich das Prinzip der Selbstbestimmung unter den Bedingungen von Kooperation überhaupt sinnvoll zur Geltung bringen. Hier ist überindividuelle Zustimmung gefordert! Denn wenn ein parteiliches Einzelinteresse das Fundament einer allgemeinverbindlichen Regel abgäbe, wären dadurch all diejenigen, die dieses Interesse nicht teilen, zwangsläufig unfrei. Sie müssten sich einem fremden Willen fügen und hätten sich nach dessen Vorstellungen zu richten. Umgekehrt ist aber niemand unfrei, wenn er oder sie sich eine Regel auferlegt, die den Interessen aller entgegenkommt, weil eine solche Regel ja stets auch den je eigenen Interessen entspricht.
Aus diesem Grund ist die Forderung nach Gemeinwohlorientierung so wichtig. Ohne sie ließe sich das Prinzip der freiwilligen Zustimmung unter gesellschaftlichen Bedingungen gar nicht realisieren. Sie ist dessen logische Konsequenz. Denn nur wenn alle von einer Regel profitieren, können ihr auch alle widerspruchslos beipflichten. Die Voraussetzung dafür ist, dass es eben überhaupt bestimmte Überschneidungen zwischen den verschiedenartigen Interessen der Gesellschaftsmitglieder gibt. Ist das der Fall, dann kann man von ihnen auch verlangen, nur solche Maximen bei der Grundlegung von Gesetzen zuzulassen, die sich als verallgemeinerungsfähig erweisen. Dazu muss zwar jeder und jede das rücksichtslose Streben nach eigener Bedürfnisbefriedigung wenigstens ein Stück weit zurückstellen. Aber nur auf diese Weise ist gewährleistet, dass alle zusammen frei sein können und niemand den Egoismen der anderen aufgeopfert wird. Und daher lässt sich auch erst ein solcher Zustand mit Rousseau als ein wahrhaft freiheitlicher bezeichnen: „denn der Trieb der bloßen Begierde ist Sklaverei, und der Gehorsam gegen das Gesetz, das man sich selber vorgeschrieben hat, ist Freiheit.“xxxv Die Verbindung von freiwilliger Zustimmung und Gemeinwohlorientierung bildet das eigentümliche Grundgerüst des rousseauschen Gemeinwesens, in dem jeder und jede eben dadurch, dass er oder sie das Wohl der anderen im Auge hat, (auch) das eigene zu befördern vermag. Unter diesen Voraussetzungen kann eine Versöhnung von individueller Freiheit und gesellschaftlicher Kooperation als weitestgehend erreicht gelten. Denn niemand ist fremdbestimmt, wenn er oder sie sich einem Willen unterwirft, den sich alle unterschiedslos zu eigen machen und als den ihren ansehen können, weil er auf das Wohl sämtlicher Gesellschaftsmitglieder abzielt.
Aber sind diese Voraussetzungen denn ihrerseits realistisch? Könnten sie sich nicht vielleicht in moralischer Hinsicht als zu anspruchsvoll erweisen? Immerhin wird allen Gesellschaftsmitgliedern eine Gemeinwohlorientierung bei sämtlichen ihrer politischen Erwägungen und Entscheidungen abverlangt. Partikulare Standpunkte und egoistische Interessen dürfen hier keine Rolle mehr spielen. Darin besteht die unweigerlich zu erfüllende Ermöglichungsbedingung für eine Versöhnung von individueller Freiheit und gesellschaftlicher Kooperation. Kann aber davon ausgegangen werden, dass sich die Einzelnen überhaupt daran halten? Sicher, es handelt sich niemand einen unmittelbaren Nachteil ein, indem er oder sie sich am Gemeinwohl orientiert, da ja das Wohl jedes Gesellschaftsmitglieds im Gemeinwohl notwendig enthalten ist. Aber sehr wahrscheinlich gibt es direktere und einfachere Pfade zum je eigenen Wohlergehen als den mühsamen und anspruchsvollen Umweg über das Wohl aller anderen. Wie ist dann aber sicherzustellen, dass niemand eine egoistische Abkürzung präferiert, sondern alle weiterhin den kollektiven Nutzen im Blick behalten?
Eine Gewähr dafür könnte in diesem Zusammenhang das Prinzip der freiwilligen Zustimmung bieten. Solange dieses Prinzip unverkürzte Geltung zu beanspruchen vermag, sind parteiliche Sonderinteressen im gemeinsamen Gesetzgebungsprozess nämlich schlicht nicht besonders durchsetzungswahrscheinlich. Wenn alle den Regeln und Normen des gesellschaftlichen Miteinanders ohne Ausnahme beipflichten müssen, dürften nicht verallgemeinerbare Maximen schon allein deswegen ausscheiden, weil sie nicht von allen Menschen gleichermaßen bejaht werden können. Da es ihnen an der notwendigen überindividuellen Zustimmungswürdigkeit ermangelt, sind sie keine realistischen Kandidaten für Gesetze, die von allen beschlossen und verabschiedet werden. Das gilt natürlich nur solange, wie tatsächlich alle zustimmen müssen (also alle Entscheidungen konsensual getroffen werden) und wie davon auszugehen ist, dass sich die Gesellschaftsmitglieder nicht systematisch über den adäquaten Gehalt des Gemeinwohls täuschen (also keine parteilichen Regeln beschließen, weil sie irrtümlicherweise davon überzeugt sind, dass sie allen zugute kommen). Beide Voraussetzungen sind alles andere als unproblematisch und werden uns an späterer Stelle erneut beschäftigen.
Eine weitere Schwierigkeit wird von Rousseau selbst geäußert. Sie hat ihren Ursprung in den Suggestionen des Vertragsmodells. Nimmt man dieses Modell nämlich gleichsam beim Wort, dann scheint es eine Art zeitlicher Abfolge nahezulegen, die einen gesellschaftlichen Zustand auf einen vorgesellschaftlichen Status folgen lässt. Dies wäre im Falle von Rousseau insofern nicht unproblematisch, als der Vertragsschluss hier eine grundsätzliche Umorientierung von allen Individuen verlangt. Während sie zuvor vermutlich hauptsächlich an ihrem eigenen Wohlergehen interessiert gewesen sein dürften, sollen sie nach Eintritt in das Gemeinwesen ausschließlich das Wohl aller als Richtmaß akzeptieren. Allerdings kann eine solche Umorientierung von Menschen, die mit den Anforderungen einer kollektiven Lebensweise ja noch gar nicht vertraut sind, nur schwerlich erwartet werden. Denn wie sollten sie überhaupt wissen können, was für alle das Beste ist, wenn sie gerade erst beginnen, Erfahrungen mit einer gemeinschaftlichen Existenzform zu sammeln?xxxvi Rousseau sah sich deswegen geneigt, die Figur eines ursprünglichen Gesetzgebers in seinen Gesellschaftsvertrag mit aufzunehmen, der den frisch vergesellschafteten Individuen adäquate Gesetze unterbreiten soll (die sie freilich selbst anzunehmen oder abzulehnen die Wahl haben).xxxvii
Allerdings handelt es sich hierbei wohl eher um eine Missinterpretation des eigenen rechtfertigungstheoretischen Begründungsmodells. Denn der Vertragsschluss ist kein tatsächliches Ereignis in der geschichtlichen Zeit, sondern ein theoretisches Konzept, anhand dessen sich die potentielle Zustimmungswürdigkeit von gesellschaftlichen Einrichtungen bemessen lassen soll. Er stellt eine legitimationsstiftende Fiktion dar, die dazu dient, mit hinreichend überzeugenden Argumenten plausibel zu machen, welche Regierungsform sich die Regierten selbst geben würden, wenn sie die Wahl dazu hätten. Dass ein faktischer Vertragsschluss stattfindet, gehört nicht zu den notwendigen Unterstellungen des Modells. Er wäre für die normative Problemstellung auch gänzlich irrelevant. Gleichwohl zeugen Rousseaus Überlegungen zu der Figur des Gesetzgebers von einer gewissen Sensibilität für den anspruchsvollen Voraussetzungsreichtum seines Gesellschaftsentwurfs. Darauf wird abschließend zurückzukommen sein. Nun wollen wir uns zunächst den konkreten politischen Institutionen zuwenden, die durch den rousseauschen Gesellschaftsvertrag legitimationswirksam begründet werden.
4. Institutionen der Freiheit
Mit der grundlegenden und strukturgebenden politischen Institution des rousseauschen Gemeinwesens haben wir uns schon vertraut gemacht. Als leidenschaftlicher Verteidiger des Prinzips der individuellen wie kollektiven Freiheit plädiert der Verfasser des Gesellschaftsvertrags für das Modell der Volkssouveränität. Was alle betrifft, soll auch von allen gemeinsam entschieden werden. „Ich behaupte also, dass die Souveränität, die nichts anderes als die Ausübung des allgemeinen Willens ist, nie veräußert werden kann und der Souverän, der nichts als ein Gesamtwesen ist, einzig durch sich selbst vertreten werden kann. Die Macht kann wohl übertragen werden, aber nicht der Wille.“xxxviii Die Veräußerung der Souveränität an einen einzelnen Menschen scheidet damit aus. Sie ist nicht nur deshalb abzulehnen, weil sie ganz offensichtlich gegen das von Rousseau verlangte Gebot einer tatsächlichen Partizipation aller am Prozess der Gesetzgebung verstößt. Sie muss auch darum zurückgewiesen werden, weil unter ihrer Voraussetzung die Bedingung der Gemeinwohlorientierung nicht zweifelsfrei sichergestellt werden kann. So ist zwar keinesfalls grundsätzlich ausgeschlossen, dass auch ein alleiniger Machthaber bisweilen Regeln erlässt, die sämtliche Gesellschaftsmitglieder vorbehaltlos bejahen können, weil sie den Interessen aller entgegenkommen. Eine sichere Garantie für das beständige Eintreten dieses Falles gibt es unter solchen Umständen aber nicht. Und sich auf eine derart zufällige und willkürabhängige Übereinstimmung verlassen zu müssen, erscheint weder besonders vorausschauend noch sonderlich vernünftig. Dann wäre es doch besser, durch geeignete institutionelle Vorkehrungen von vorneherein dafür zu sorgen, dass legislative Abweichungen vom Gemeinwohl weniger wahrscheinlich werden.
Eine mögliche Vorkehrung könnte darin bestehen, die Gesetzgebung in die Hände gewählter Abgeordneter zu legen. Das wäre die parlamentarische Option. In ihrem Falle kann natürlich ebenso wenig wie bei einer Alleinherrschaft die Rede davon sein, dass hier tatsächlich sämtliche Gesellschaftsmitglieder eine aktive Rolle im Prozess der Gesetzgebung spielen. Sie beschließen die Regeln und Normen des sozialen Miteinanders ja nicht selbst. Aber sie wählen immerhin periodisch diejenigen Personen aus, die damit beauftragt werden. Und wenn man das Prinzip der freiwilligen Zustimmung nicht ganz so engstirnig interpretiert, dann ließe sich vielleicht argumentieren, dass es unter diesen Bedingungen wenigstens minimal erfüllt sein dürfte. Und mehr noch: Da eine parlamentarische Lösung die Abgeordneten durch das Medium der Wahlen an den Willen der Bevölkerung rückkoppelt, könnte man sogar die Annahme vertreten, dass hier auch die Bedingung der Gemeinwohlorientierung keine schlechten Realisationschancen besitzt. Denn die Wählerinnen und Wähler dürften eine erneute Wahl ihrer Volksvertretung nur dann in Betracht ziehen, wenn sie davon überzeugt sind, dass ihre Interessen bis dato angemessen vertreten wurden. Das sollte wiederum die Abgeordneten bereits aus Machterhaltungsgründen dazu motivieren, es mit der Orientierung am Gemeinwohl besonders ernst zu meinen. Alles in allem: Könnte also möglicherweise das Modell der parlamentarischen Repräsentation eine adäquate institutionelle Verwirklichung des Prinzips der Volkssouveränität (unter Bedingungen minimierter Partizipation) darstellen?
Rousseau lässt sich dazu nicht hinreißen. Er ist, jedenfalls in seinem Gesellschaftsvertrag, alles andere als ein überzeugter Parteigänger des Parlamentarismus.xxxix Eine bloß indirekt über die regelmäßige Wahl von Abgeordneten vermittelte Form der Partizipation erscheint ihm schon aus Gründen der eingeschränkten politischen Teilhabe ungenügend. Das Prinzip der freiwilligen Zustimmung duldet in seinen Augen keinerlei institutionelle Abschwächungen und Kompromisse, sondern muss im Gesetzgebungsprozess unverkürzt zur Geltung gebracht werden: „Jedes Gesetz, das das Volk nicht persönlich bestätigt hat, ist null und nichtig; es ist kein Gesetz.“xl Aber Rousseau geht noch weiter. Denn auch das Gebot der Gemeinwohlorientierung spricht für ihn gegen die parlamentarische Option. Dem Argument, dass sich durch gelegentliche Wahlen eine Rückbindung der Politik an die gemeinsamen Interessen aller sicherstellen ließe, kann Rousseau nicht beipflichten. Er ist vielmehr davon überzeugt, dass das Prinzip der parlamentarischen Repräsentation überhaupt nur unter Bedingungen Sinn ergibt, in denen die Gemeinwohlorientierung aller keine große Rolle mehr spielt. Denn nur Menschen, denen die kollektiv bedeutsamen Belange ihres Miteinanders nicht besonders wichtig erscheinen, würden Abgeordnete damit beauftragen, ihnen ihre politischen Angelegenheiten abzunehmen.
Rousseaus Ansicht zufolge sind dies Menschen, die ihren Lebenssinn vornehmlich in privaten Dingen suchen und die kein Interesse daran haben, sich mit dem auseinanderzusetzen, was alle gleichermaßen angeht und betrifft. Solche Menschen dürften aber keine guten Beraterinnen und Berater sein, wenn es um die Beurteilung politischer Geschäfte geht. Ihnen fehle es an dem dazu erforderlichen Sinn fürs Gemeinsame, an dem nötigen Gemeinsinn. Ohne eine politisch interessierte und engagierte Öffentlichkeit könne allerdings auch von einer wirksamen Kontrolle des parlamentarischen Geschehens keine Rede mehr sein. Und dadurch dürften auch hier die Anreize zur persönlichen Bereicherung zunehmen und die Orientierung am Gemeinwohl demgegenüber zurückgehen. Da hülfen auch keine gelegentlichen Wahlen mehr. Eine Gesellschaft, in der die Menschen in der Politik nur ein notwendiges Übel sähen, weil sie ihren Lebenssinn hauptsächlich im Privaten suchten – das sei eine Gesellschaft, der eine parlamentarische Lösung angemessen wäre. Sie entspricht aber nicht Rousseaus Ideal eines wohlgeordneten und im Politischen zentrierten freien Gemeinwesens. Für ihn gilt daher im Gegenteil: „Je vollendeter die Staatsverfassung ist, desto mehr überwiegen die öffentlichen Angelegenheiten in den Augen des Staatsbürgers die privaten. Es gibt dann sogar weit weniger Privatangelegenheiten, weil von der Summe des gemeinsamen Glücks ein weit beträchtlicherer Teil auf das des Einzelnen übergeht, und derselbe deshalb durch eigenes Streben weit weniger zu erringen braucht.“xli
Es führt also kein Weg daran vorbei. Nur wenn alle Menschen gemeinsam die Aufgaben der Gesetzgebung übernehmen, lässt sich mit Rousseau das Prinzip der Volkssouveränität als verwirklicht betrachten. Was alle betrifft, muss auch von allen entschieden werden. Das verlangt eine unverkürzte Interpretation des Prinzips der freiwilligen Zustimmung. Und auch um das Gebot der Gemeinwohlorientierung dürfte es in diesem Falle nicht schlecht bestellt sein. Denn nur solange alle den Regeln und Normen des Miteinanders beipflichten müssen, lassen sich die nicht verallgemeinerbaren Interessen und Maximen einzelner Individuen durch den kollektiven Gegendruck der anderen effektiv ausbremsen. Eine solche institutionelle Ausgestaltung erscheint in legislativer Hinsicht gemeinwohldienlicher als eine Veräußerung oder Vertretung von Souveränitätsbefugnissen. Daher sollte das Volk selbst sämtliche Gesetzgebungskompetenzen in seinen Händen behalten. Rousseaus Gesellschaftsvertrag verlangt die Einrichtung einer periodisch tagenden Volksversammlung, in der alle Gesellschaftsmitglieder gemeinsam die Regeln und Normen ihres sozialen Miteinanders abstimmen und sie in Form von kollektiv verbindlichen Gesetzen verabschieden. Die Gesetzesentscheidungen sollten dabei per Mehrheitsentscheid zustande gebracht werden, brauchen also in der Regel nicht konsensual zu erfolgen.xlii Auf die Schwierigkeiten, die sich aus Mehrheitsbeschlüssen ergeben können, wird weiter unten eingegangen. Vorerst soll dieser Aspekt noch ausgeblendet bleiben. Festhalten lässt sich an dieser Stelle jedenfalls, dass der allgemeine Wille weder veräußert (monarchisch gestaltete Legislative) noch vertreten (Parlamentarismus) werden darf, sondern sich aus den kollektiven Willensbildungsprozessen aller Gesellschaftsmitglieder speisen muss.
Das heißt indes nicht, dass es nach Rousseau gar keine vertretenden Körperschaften jenseits der gesetzgebenden Volksversammlung geben sollte. Er spricht vielmehr ausdrücklich davon, dass auch eine Regierung eingesetzt werden müsse.xliii Nur kommen dieser eben keinerlei Gesetzgebungskompetenzen zu. Ihre Aufgabe besteht nicht in der Verabschiedung der kollektiv bindenden Regeln und Normen des Miteinanders, sondern in der Sorge um deren Einhaltung und in der tätigen Umsetzung der durch sie vorgegebenen Direktiven. Sie bildet demnach die exekutive im Unterschied zur legislativen Gewalt, die ja in den Händen des Volkes selbst verbleiben muss. Da aber zur Aufrechterhaltung und Vollstreckung der Gesetze eine beständige Regierungstätigkeit notwendig ist, macht es wenig Sinn, die Gesamtheit der Bürgerinnen und Bürger auch noch damit zu belasten. Sie dürften ja mit der Aufgabe der Gesetzgebung schon genug zu tun haben und sollten sich hiervon nicht durch eine Beschäftigung mit spezifischen Umsetzungs- und Anwendungsfragen ablenken lassen. Daher erscheint es Rousseau in dieser Hinsicht durchaus sinnvoll, dass politische Beamte mit der Erledigung der Regierungsgeschäfte beauftragt werden. Aber auch das nur streng nach Vorschrift! Sie sollten weisungsgebunden agieren müssen und jederzeit nach Belieben abberufen werden können. Der ausführenden exekutiven Regierungsgewalt kommt demnach gegenüber dem gesetzgebenden legislativen Willen aller eine lediglich dienende und untergeordnete Rolle zu (wenngleich die Regierung gegenüber jeder Einzelperson die Einhaltung der Gesetze erzwingen kann). Die höchste Gewalt des Gemeinwesens hat einzig die in kollektive Hände gegebene Legislative inne. Auch das ist eine Konsequenz davon, dass alles in Übereinstimmung mit dem gemeinsamen Willen aller geregelt werden muss. Dennoch sieht Rousseau eine wenigstens rudimentäre Form der Gewaltenteilung zwischen Legislative und Exekutive vor.xliv