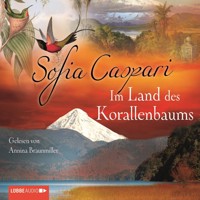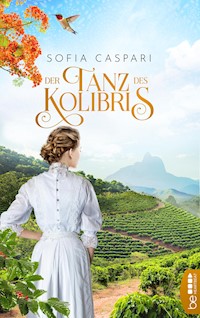6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: ARGENTINIEN-SAGA
- Sprache: Deutsch
Argentinien, 1876: Die jung verwitwete Annelie Wienand ist mit ihrer Tochter Mina aus Frankfurt am Main eingewandert, um ein zweites Mal zu heiraten. Doch ihre Ehe ist eine bittere Enttäuschung. Für die vierzehnjährige Mina sind einzig die Treffen mit dem Nachbarssohn Frank Lichtblicke in ihrem rauen Familienalltag. Doch eines Tages geschieht etwas Schreckliches, und Frank muss fliehen ...
»Ein intensives Leseerlebnis, das in eine völlig fremde Welt eintauchen lässt, ein großes Stück Geschichte vermittelt und sowohl vom Plot als auch von der Sprache her überzeugt.« HISTO-COUCH.DE
Mit ihrer fesselnden Auswandersaga entführt Sofia Caspari die Leserinnen und Leser in das Argentinien des 19. Jahrhunderts - in die Welt von Arm und Reich, Ehrbahren und Verruchten, Hassenden und Liebenden.
Band 1: Im Land des Korallenbaums
Band 2: Die Lagune der Flamingos
Band 3: Das Lied des Wasserfalls
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 667
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel der Autorin
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Stammbaum
Zitat
Erster Teil
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zweiter Teil
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Dritter Teil
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Vierter Teil
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Fünfter Teil
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechster Teil
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Epilog
Danksagung
Weitere Titel der Autorin
Im Land des Korallenbaums
Das Lied des Wasserfalls
Im Tal der Zitronenbäume
Der Tanz des Kolibris
Inselglück und Sommerträume
Die kleine Pension am Meer
Der Duft des tiefblauen Meeres
Über dieses Buch
Argentinien, 1876: Die jung verwitwete Annelie Wienand ist mit ihrer Tochter Mina aus Frankfurt am Main eingewandert, um ein zweites Mal zu heiraten. Doch ihre Ehe ist eine bittere Enttäuschung. Für die vierzehnjährige Mina sind einzig die Treffen mit dem Nachbarssohn Frank Lichtblicke in ihrem rauen Familienalltag. Doch eines Tages geschieht etwas Schreckliches, und Frank muss fliehen …
eBooks von beHEARTBEAT – Herzklopfen garantiert.
Über die Autorin
Sofia Caspari, geboren 1972, hat schon mehrere Reisen nach Mittel- und Südamerika unternommen. Dort lebt auch ein Teil ihrer Verwandtschaft. Längere Zeit verbrachte sie in Argentinien, einem Land, dessen Menschen, Landschaften und Geschichte sie tief beeindruckt haben. Heute lebt sie – nach Stationen in Irland und Frankreich – mit ihrem Mann und ihren zwei kleinen Söhnen in einem Dorf im Nahetal.
Sofia Caspari
DIELAGUNEDERFLAMINGOS
beHEARTBEAT
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2013 by Bastei Lübbe AG, Köln
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2022 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Melanie Blank-Schröder
Covergestaltung: Guter Punkt, München unter Verwendung von Motiven von © Dane Moore/iStock/Getty Images Plus; MarinaZakharova/iStock/Getty Images Plus; JackF/iStock/Getty Images Plus; Kateryna Upit/Shutterstock Images; RuudMorijn/iStock/Getty Images Plus; serkanmutan/iStock/Getty Images Plus; yotrak/iStock/Getty Images Plus; KathySG|Shutterstock Images
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7517-2176-9
be-heartbeat.de
lesejury.de
Julian und Tobias –
In der unendlichen Weite, die es nicht erlaubt,den Punkt zu bestimmen, wo die Welt zu Ende ist undwo der Himmel anfängt …
Domingo Faustino Sarmiento
(Wirtschaftspionier und Staatsmann)
Der Plan, den der damalige Kriegsminister und jetzige Präsident der Nation, General Julio A. Roca, 1879 so erfolg- und ruhmreich durchzuführen begonnen hat, muss überall zu Ende geführt werden.
Es darf keine, Grenzen mehr ( …) innerhalb des argentinischen Hoheitsgebietes geben; die Pfeile wilder Indios sollen uns nicht mehr behindern. Das argentinische Volk will frei von den Schatten solcher Barbarei sein.
Erster TeilEsperanza – Hoffnung
Esperanza, Santa Celia, San Lorenzo,Genua, Tres Lomas, Chaco
1876 bis 1878
Erstes Kapitel
Stocksteif stand Mina in ihrem Versteck. Durch den schmalen Spalt, den die Tür ihr ließ, konnte sie genauestens beobachten, was in der Küche vor sich ging. Der Fünfzehnjährigen stockte der Atem. Philipp, ihr Stiefbruder, war eben von draußen hereingekommen. Gerade noch rechtzeitig hatte sie ihn bemerkt. Im letzten Moment war sie in die kleine Vorratskammer geschlüpft. Die Blutspritzer auf seinem Gesicht und sein blutbeflecktes Hemd hinterließen ein flaues Gefühl in ihrem Magen. Gespenstisch beleuchtete die Öllampe auf dem Tisch Philipps gleichfalls blutverschmierte Finger. Kurz betrachtete er sie mit einem zufriedenen Gesichtsausdruck, dann griff er nach seinem Rock, der über einer Stuhllehne hing, und zog eine goldene Uhr aus der Tasche. Er lächelte breit, während die Uhr an der Kette sanft hin- und herpendelte. Entschlossen steckte er sie wieder weg und entblößte seinen breiten, muskulösen Oberkörper, indem er sein Hemd auszog. Das Lächeln auf seinem Gesicht verlor sich nicht, als er nun an den Eimer mit Frischwasser herantrat und prustend begann, sich Gesicht und Hände zu waschen. Mina sah, dass sich das getrocknete Blut löste und ihm, mit dem Wasser vermischt, in rötlichen Schlieren über Gesicht, Handrücken und Arme lief, bevor es auf den Boden tropfte. Mit Mühe unterdrückte das junge Mädchen einen Anflug von Übelkeit.
Hoffentlich entdeckt er mich nicht, fuhr es heiß durch sie hindurch, hoffentlich entdeckt er mich nicht.
Sicherlich hatte der Stiefbruder wieder einmal einen Unschuldigen verprügelt, jemanden, der neu in der Gegend war und keine Verbündeten hatte. Jemanden, dem deshalb niemand helfen würde. Mit Philipp Amborn oder seinem Vater Xaver legte sich niemand an.
»Mein Philipp«, so pflegte Xaver Amborn zu sagen, »hat einen kurzen Zündfaden. Jeder weiß das und beherzigt den Rat, ihn besser nicht zu reizen. So ist er eben, aber im Kern ist er ein guter Junge … Das war er immer. Mir war er stets treu.«
Die Hand auf den Mund gepresst unterdrückte Mina ein Stöhnen.
Er darf mich nicht sehen, bitte, lieber Gott, er darf mich nicht sehen.
Es war nicht das erste Mal, dass sie Philipp so nach Hause kommen sah. Neu war allerdings, dass er dieses Mal eine goldene Uhr in seinem Rock versteckt hielt. Heute, dachte Mina, ist er einen Schritt zu weit gegangen. Er hat gestohlen. Würde er ihr glauben, dass sie nichts gesehen hatte, nichts wusste und nichts sagen würde? Er darf mich hier nicht entdecken, schoss es ihr erneut durch den Kopf, er darf mich hier nicht sehen.
Sie wusste ja auch nicht, welcher Laune er war. Manchmal war es gar nicht nötig, ihn zu reizen. Dann schlug der Stiefbruder zu, weil er Spaß daran hatte, weil er gern sah, wenn andere Schmerzen litten. Das hatte sie als Erstes gelernt, kurz nachdem ihre Mutter Annelie und sie vor nunmehr fünf Jahren nach Esperanza gekommen waren. Philipps Äußeres, das dunkle kräftige Haar, das markante Gesicht, sein einnehmendes Lachen, die funkelnden Augen und der muskulöse Körper, täuschte nur zu leicht darüber hinweg, welcher Teufel in seinem Inneren schlummerte.
Der Stiefbruder betrachtete jetzt erneut seine Hände, schaute dann an sich hinunter. Offenbar schien er zufrieden mit dem, was er sah, denn im nächsten Moment griff er nach einem Tuch und rieb sich Gesicht und Oberkörper trocken. Dann überprüfte er sein Hemd, warf es endlich mit einem Seufzer zur Seite. Ganz offenbar war das Blut nicht das des Stiefbruders. Philipp war nicht verletzt, so viel konnte Mina aus ihrem Versteck erkennen.
Ein plötzliches Knarren ließ das junge Mädchen zusammenzucken. Die Haustür wurde aufgestoßen, und der Stiefvater trat ein. Er schien überrascht, seinen Sohn zu sehen, denn er blieb abrupt stehen.
»Du bist schon zurück?«
»Es gab einen Unfall«, beschied Philipp ihn knapp.
So, wie die beiden Männer dort standen, kamen sie Mina mit einem Mal vor wie Strauchdiebe, Renegaten, desperados. Aber warum erkannte das niemand? Warum waren Xaver und sein einundzwanzigjähriger Sohn immer noch angesehene Männer der Gemeinschaft? Warum galt ihr Wort in jedem Fall mehr als das Minas oder das ihrer Mutter? Warum war es nach fünf Jahren immer noch so, als seien sie gerade erst angekommen? Warum gab sich niemand die Mühe, hinter die Fassade zu schauen?
Mina sah, wie ihr Stiefvater die Stirn runzelte.
»So?«
»Meine Freunde und ich wurden angegriffen.«
Er lügt, dachte Mina und presste die Lippen aufeinander, er lügt.
Angesichts des ganzen Blutes wagte sie es kaum, sich vorzustellen, was mit dem Unglücklichen geschehen war, der Philipp heute begegnet war.
»Ist Mina schon zurück?«, fragte der Stiefbruder jetzt.
»Wieso?« Misstrauen schlich sich in Xavers Stimme.
»Hab sie heute mit Frank Blum gesehen.«
Philipps Stimme klang unbekümmert, doch Mina wusste genau, dass er eben einen seiner Giftpfeile gesetzt hatte.
»Hölle und Teufel, ich habe ihr doch streng verboten, sich noch einmal mit diesem nichtsnutzigen Lumpen abzugeben. Ich glaube, ich muss dem widerspenstigen Weib wieder einmal eine Lektion erteilen.«
Mina erschrak bei seinen harschen Worten so sehr, dass sie den Halt verlor und gegen die Tür der Vorratskammer stolperte. Die knarrte leise ob der unbeabsichtigten Bewegung. Wie auf ein Wort sahen Vater und Sohn in Minas Richtung, dann wechselten sie einen kurzen Blick miteinander.
»Mina, Süße«, rief Philipp, ein maliziöses Grinsen auf dem Gesicht, »bist du etwa da drin?«
***
Einige Wochen zuvor
Das Abendlicht goss seinen rotgoldenen Honig über die weite Ebene aus und verwandelte die Landschaft in ein Meer aus Gras, dessen Wellen in der Ferne gegen die hohen Berge schlugen.
»Bleib stehen, du verdammtes Balg!«, donnerte die Stimme ihres Stiefvaters hinter Mina her, doch das junge Mädchen rannte einfach weiter.
Rennend hatte Mina das Haus verlassen, und sie würde rennen, bis sie Xavers verhasste Stimme nicht mehr hörte. Wenn man sie in diesem Moment gefragt hätte, ob sie keine Angst vor ihrem Stiefvater habe, hätte Mina nur die Achseln gezuckt. Man konnte kein Leben führen, in dem man ständig Angst vor irgendetwas hatte, das sah sie an ihrer Mutter. Annelie Amborn, geborene Wienand, verwitwete Hoff, hatte viel zu viel Angst. Mina wollte keinesfalls werden wie sie. Später, wenn sie nach Hause zurückkehrte, würde Xaver sie selbstverständlich verprügeln, doch das kümmerte sie jetzt nicht. In diesem Augenblick, hier draußen, war sie frei wie ein Vogel. Das war alles, was zählte.
Als Mina weit genug gelaufen war, blieb sie stehen, breitete die Arme aus und lachte laut. Es war ein starkes, kräftiges Lachen. Manchen hätte es gewiss verwundert, denn es wollte so gar nicht zu ihrer zierlichen Gestalt passen. Doch sie hatte schon auf dem Schiff so manchen getäuscht. Mina hatte keine Angst gehabt – sie war auch bei starkem Wind an Deck geblieben. Sie hatte nie unter Seekrankheit gelitten, und sie hatte auch nie daran gezweifelt, dass sie ankommen würden, so wie mancher Mitreisende, der seine Zeit an Bord heulend und betend verbracht hatte.
Mina ließ die immer noch weit ausgebreiteten Arme sinken und rannte weiter. Manchmal, dachte sie, wünschte ich mir wirklich, einfach meine Flügel ausbreiten zu können und davonzufliegen. Aber sie war ein Mensch, dazu bestimmt, auf der Erde zu leben.
Abrupt verzögerte sie ihren Lauf und schaute sich um. Sie hatte ihren Treffpunkt, eine in der endlosen Weite kaum merkliche Vertiefung, erreicht. Frank, ihr bester Freund, war allerdings noch nicht da. Mit einem kleinen Seufzer ließ Mina sich auf dem Boden nieder. Sie war froh, dass ihr Stiefvater stets zu faul war, ihr mehr als ein paar Meter zu folgen. Ab und an hetzte er ihren Stiefbruder auf sie, doch der war an diesem Tag noch nicht zu Hause gewesen. Sie selbst hatte ihn mittags mit einem Mädchen tändeln sehen. Mina war sich sicher, dass es spät werden würde, bis er zurückkam. Sicherlich würde er sich im Laufe des Abends betrinken. Ja, sie hatte heute wirklich Glück, und sie wusste das zu schätzen.
Wieder blickte Mina auf die untergehende Sonne, die sich, einem Feuerball gleich, stetig dem Horizont näherte. Ein wenig Zeit würde Frank und ihr noch bleiben, bis es ganz dunkel wurde, nicht viel allerdings. Sie hoffte sehr, dass er bald kam.
Für einen Moment horchte sie in die Weite hinaus. Nicht wenige fürchteten sich davor, das Dorf um diese Uhrzeit noch zu verlassen. Manchmal durchstreiften Indios die Gegend – Tobas aus der weiter im Norden gelegenen Provinz Chaco beispielsweise -, stahlen Vieh oder entführten Frauen und Kinder. In besonders nah an den Indianergebieten liegenden Ortschaften standen die Häuser deshalb dicht beieinander und waren von einem soliden Palisadenzaun umgeben. Die Siedler dort trugen stets Waffen bei sich, auch bei der Feldarbeit. Jedes Jahr fand eine Strafexpedition in den Chaco statt. Dann zerstörte man ein paar tolderías, wie die Indianerdörfer genannt wurden, tötete ein paar Indios und machte Gefangene, die sich bald darauf im Dienste reicher Städter wiederfanden oder auf den Zuckerrohrfeldern rund um Tucumán.
An den Strafexpeditionen nahmen stets auch Minas Stiefvater und Stiefbruder teil, obwohl sie selbst noch niemals Opfer eines malón, eines Indianerüberfalls, geworden waren. Ihnen bereitete der Krieg Vergnügen. Sie liebten es, zu töten. Einmal hatte Mina zu fragen gewagt, wie man sich denn für ein Leid rächen könne, das einem gar nicht widerfahren sei. Die Antwort ihres Stiefvaters hatte sich noch Tage danach in Form einer erst rot, dann bläulich, später gelbgrün verfärbten Wange gezeigt. Den Nachbarn hatte sie sagen müssen, sie sei die Treppe hinuntergestürzt. Mina fröstelte unwillkürlich, zog unter dem Rock die Beine an und umklammerte ihre Knie mit den Armen.
»Wartest du schon lange?«, riss sie gleich darauf eine tiefe, warme Stimme aus ihren Gedanken.
Das junge Mädchen warf den Kopf herum und sprang auf. »Frank, endlich!«
»Du warst aber heute gar nicht vorsichtig. Was gibt es denn so angestrengt zu denken?«
»Ach, dies und das.«
Mina sah den Freund liebevoll an. Er war seit fünf Jahren, seit ihren ersten Tagen in diesem Land, ihr steter Begleiter gewesen, ihre einzige Hoffnung. Manchmal fragte sie sich, wo seine Kinderstimme geblieben war. Aber natürlich war Frank mit seinen siebzehn Jahren längst ein Mann, von dem man erwartete, dass er schwere Arbeit leistete. Kurz musste sie jetzt den Blick senken. Da war plötzlich wieder einer dieser seltsamen Gedanken, die sie neuerdings bei seinem Anblick überfielen, ein Bedürfnis, ihn anzufassen, seine warme Haut zu spüren, seinen so vertrauten Geruch einzuatmen.
Ich will ihn festhalten und nie wieder loslassen.
Es kostete Mina Kraft, den Kopf zu heben und Frank anzusehen. Sie wollte keinesfalls, dass er merkte, wie verwirrt sie war. Es machte sie unsicher.
»Wie war es heute?«
»Du meinst die Arbeit mit deinem Vater?«
»Nenn ihn nicht so!«, beschwerte Mina sich ärgerlich.
Frank zuckte die Achseln. »Entschuldige.« Er seufzte tief. »Na ja, die Arbeit war wie immer«, erwiderte er dann knapp.
Mina nickte verstehend. Sie sah, dass Franks einfache Kleidung staubbedeckt war. Auch sein Gesicht war schmutzig, doch seine fast schwarzen Augen funkelten übermütig. Diese Augen waren es gewesen, die ihr bei ihrer ersten Begegnung als Erstes aufgefallen waren. In einem Moment waren sie unergründlich, im nächsten schien der Übermut förmlich aus ihnen zu sprühen. Es waren Augen, in denen sie versinken wollte. Augen, die sie vor sich sah, wenn sie nicht schlafen konnte. Niemand hatte solche Augen, nur Frank.
Einen kurzen Moment später saßen sie nebeneinander in ihrer Senke, in ihrem Versteck. Franks Hand suchte Minas und umschloss sie. Eine Weile hockten sie schweigend da. Neuerdings mussten sie nicht immer sprechen, es genügte ihnen, einander nahe zu sein.
»Es wird bald sehr dunkel werden«, bemerkte Mina endlich. »Es war gerade Neumond.«
»Ich habe eine Laterne dabei«, erwiderte Frank ruhig und zeigte auf einen Beutel, den er achtlos neben sich auf den Boden gelegt hatte.
»Gestohlen?«
Mina sah den Freund prüfend von der Seite an. Franks dichtes dunkelblondes Haar hing ihm wieder einmal wirr ins Gesicht. Es erschien ihr immer, als wollte es sich nicht zähmen lassen. Jetzt strich er es mit einer Hand zurück. Seine dunklen Augen blitzten herausfordernd, als er ihren Blick erwiderte.
»Geliehen.« Er grinste.
»Von wem?«
Mina bemerkte, wie sich fast wie von selbst eine Falte zwischen ihren Augenbrauen bildete, während ihre hellbraunen Augen schmal wurden, wie die einer Katze kurz vor dem Sprung.
Frank runzelte die Stirn. Mit einer Hand schob er eine Strähne ihres kastanienbraunen Haars über ihre Schulter zurück.
»Ach, verdammt, Mina, ich will nicht immer buckeln, und ich will auch nicht immer vorsichtig sein. Ich habe niemandem etwas getan, ich habe niemandem Schaden zugefügt. Morgen ist die Laterne wieder an ihrem Platz. Versprochen. Niemand wird es bemerken.«
Mina schluckte die Warnungen hinunter, die ihr auf der Zunge brannten. Ein Frösteln überlief sie. Dann, nur einen Augenblick später, fühlte sie Franks Arm auf ihren Schultern. Sie erstarrte. Als Kinder hatten sie einander kennengelernt und waren gemeinsam erwachsen geworden. Berührungen dieser Art hatten sie bislang nie ausgetauscht, doch im nächsten Moment schon schmiegte Mina sich zum ersten Mal an Frank und überließ sich seiner Umarmung. Sie lauschte seinen ruhigen Atemzügen, genoss das Gefühl, das seine raue Hand, die sanft über ihren Oberarm streifte, auf ihrer Haut hinterließ.
Ich möchte ihn küssen, dachte sie.
»Küss mich«, flüsterte sie im nächsten Moment schon.
Erst zögerte er. Dann kam er ihrer Bitte nach. Der erste Versuch geriet ungelenk. Ihre Münder verfehlten einander, doch dann war es, als hätten sie nie etwas anderes getan. Sie schmeckten einander, tranken den Atem des anderen, suchten, berührten und erforschten einander mit den Lippen.
Ich liebe ihn, dachte Mina, als sie sich endlich voneinander lösten. Jetzt weiß ich es endlich, jetzt bin ich mir sicher.
Erneut saßen sie schweigend nebeneinander, hingen beide dem eben Erlebten nach. Gedankenverloren strich Mina sich mit einem Zeigefinger über den Mund.
»Sobald es uns möglich ist, gehen wir hier weg«, schnitt Frank ein Thema an, über das sie auch vorher und besonders in letzter Zeit häufiger gesprochen hatten.
Mina nickte, antwortete aber nicht. Wie oft schon hatten sie sich ausgemalt, diesen Ort hinter sich zu lassen, anderswo ein neues, ein eigenes Leben zu beginnen. Über eine Sache war Mina sich dabei allerdings noch nicht im Klaren. Auch jetzt wieder fuhr ihr dieser Gedanke durch den Kopf: Wie sage ich es Mutter? Sie muss mitkommen, ich kann nicht ohne sie gehen. Ich kann sie nicht allein bei diesen Teufeln zurücklassen.
Ich stürze von einem Elend ins andere, dachte Annelie Amborn nicht zum ersten Mal in ihrem neununddreißig Jahre währenden Leben, von einer Hölle in die nächste. Tränen schossen ihr in die Augen. Ihr Mann Xaver hatte sie beim Handgelenk gepackt und drückte jetzt unbarmherzig zu, so wie er es gern tat. Sie hatte sehr bald in ihrer Beziehung erkennen müssen, dass er es genoss, ihr Schmerz zuzufügen. Das erste Mal hatte sie das wenige Tage nach ihrer Hochzeit erfahren. Annelie richtete den Blick auf das Licht der Öllampe auf dem Tisch, als könne sie so entfliehen, konzentrierte sich auf die kleine Flamme, um den Schmerz und die Angst nicht zu spüren.
»Sag schon, wo ist das Luder? Ich finde es ja doch heraus. Du lässt ihr zu viel durchgehen, Annelie. Mina ist nicht mehr in dem Alter, in dem man sie umherstreifen lassen kann wie eine Wilde. Sie muss ihre Arbeit leisten, hier und jetzt, wie jeder, der etwas zu beißen will. Einen unnützen Esser können wir nicht gebrauchen. Einen unnützen Esser setzt man vor die Tür.«
Xaver wies mit der freien Hand auf das schmutzige Geschirr, das sich neben dem Spülstein stapelte. Fliegen umschwirrten einen abgenagten Knochen, an dem noch Fleischreste hingen. Vater und Sohn waren erst kurze Zeit zu Hause, und bereits jetzt sah es aus, als hätten Mina und sie den ganzen Tag lang die Hände in den Schoß gelegt. Obwohl Annelie das Abendessen noch nicht aufgetischt hatte, hatten sich beide schon vorab etwas zu essen genommen und bereits nach kurzer Zeit eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Dabei waren Mina und sie seit dem Sonnenaufgang auf den Beinen. Sie hatten geputzt, im Garten gearbeitet, die Milchkühe versorgt und zur Weide gebracht, Wasser geholt.
Und ich wollte doch nur, dass meine geliebte Mina wieder das Leben führen kann, das sie verdient.
Annelie zwang sich, nicht zu ihrem Stiefsohn hinüberzusehen, um ihn nicht unnötig zu reizen. Philipp saß in seinem Stuhl, zurückgelehnt. Die langen Beine hatte er so in den Raum gestreckt, dass man unweigerlich darüber zu stolpern drohte, wenn man an ihm vorbeimusste. Sein schwarzes Haar hing ihm bis auf die Schultern herab und hätte einen ordentlichen Schnitt verdient. Ein stoppliger Bart bedeckte sein kantiges Kinn. Auf eine verdorbene Art sah er sehr gut aus. Annelie wusste, dass schon viele Frauen darauf hereingefallen waren.
Seine Mutter, überlegte sie, muss sehr schön gewesen sein. Sie war vier Jahre vor ihrer und Minas Ankunft gestorben. Bei einem Sturz, hieß es.
»Wirst du mir schwören, ab jetzt besser auf dein Balg aufzupassen?«, knurrte Xaver sie noch einmal an und drückte die Finger nochmals zusammen.
Annelie nickte, während sie sich zitternd von ihrem Mann zu lösen suchte. Er bemerkte ihre zaghaften Versuche und hielt sie grinsend fester, bis er sie dann doch sehr plötzlich losließ. Ein letzter Stoß brachte sie ins Straucheln. Gerade noch konnte sie sich am Tisch festhalten.
Wie habe ich nur einmal denken können, für mich und Mina einen neuen Beschützer in ihm zu finden? Wie habe ich ihm nur unser Leben anvertrauen können?
Sie hatte alles falsch gemacht. Wie immer. Sie war eben dumm. Ihr Vater hatte Recht gehabt.
»So, und jetzt tisch endlich auf, Weib, und hör auf, Trübsal zu blasen, das ist ja nicht zum Aushalten. Los, los, mein Sohn und ich haben Hunger.«
Annelie beeilte sich, zum Herd zu kommen. Es gab Kartoffelklöße und großzügige Mengen an Fleisch. Sie gab den beiden Männern auf, nahm sich dann selbst etwas und wartete auf Xavers Tischgebet. Kaum war das Amen verklungen, stopfte sich Philipp auch schon den Mund voll. Fett triefte ihm über das Kinn, hier und da bekam auch sein Hemd etwas ab.
Warum nur, fuhr es Annelie durch den Kopf, habe ich die Anzeige damals gelesen? Warum nur bin ich hergekommen? Ich habe mein Leben ruiniert, aber noch unverzeihlicher ist, dass ich Minas Aussicht auf ein gutes Leben zerstört habe. Das werde ich nie wiedergutmachen können.
Ihre Mutter hatte sie noch gewarnt, hatte sie gemahnt, keine solch weitreichende Entscheidung zu treffen. Annelie erinnerte sich, wie sie nachmittags in Mainz bei ihren Eltern beim Kaffee gesessen hatte – bei echtem Bohnenkaffee, wie ihre Mutter immer betonte. Die Mutter hatte meist geschwiegen. Der Vater hatte, wie es sich vielleicht für einen Arzt gehörte, das Leben seiner Tochter schonungslos seziert.
»Nun«, hatte er irgendwann mit seiner Ehrfurcht gebietenden Stimme gefragt, »du bist jetzt drei Jahre Witwe, was gedenkst du zu tun, um deinen alten Eltern nicht weiter auf der Tasche zu liegen?«
Während ihr Vater so gesprochen hatte, hatte die Mutter angelegentlich an dem Spitzendeckchen, das auf dem Tisch lag, gezupft. Mina hatte still in einer Ecke gesessen und in einem Buch geblättert. Sie war schon früh ein sehr selbstständiges Kind gewesen.
Weil ich es nicht bin, dachte Annelie, weil ich nicht selbstständig bin, ist sie es. Ich bin ein armes, schwaches Weib und zu nichts nütze.
An dem Abend hatte sie die Anzeige gelesen, sie erinnerte sich genau: Ehefrau und Mutter gesucht. Einsamer Witwer …
Sie hatte sich sofort mit diesem fremden Mann verbunden gefühlt. Er war Witwer. Er war einsam … Das war sie doch auch. Sie war einsam. Sie hatte ihren Mann verloren. Sie hatte gefühlt, nein, sie hatte sich eingebildet, dass sie etwas mit diesem Mann gemeinsam hatte. Ihre Eltern waren gegen ihre Pläne gewesen, wie immer. Zum ersten Mal hatte sie sich gegen sie gestellt. Für Mina.
Ein Jahr und kaum zwei Briefe später waren Mina und sie auf dem Weg nach Argentinien gewesen. Die Reise war beschwerlich gewesen, aber der Gedanke an das Ziel hatte sie aufrecht gehalten. Es hatte sie die Übelkeit und die Angst ertragen lassen, die Angst vor der Schiffsreise genauso wie die vor der Fremde. Nach Wochen waren sie schließlich in Buenos Aires angekommen. Von dort aus waren sie auf dem Río Paraná weitergereist bis nach Rosario, und dann nach Santa Fe und dann …
»Was starrst du denn so? Hast du noch nie einen Mann essen sehen?«
Annelie senkte rasch den Blick, nicht ohne Philipps Grinsen zu bemerken. Aus irgendwelchen Gründen hatte sie sich ein niedliches kleines Kind vorgestellt, als sie die Anzeige gelesen hatte. Aber Philipp war bei ihrer Ankunft ein fast erwachsener Mann gewesen, mit strahlend blauen Augen, dunklem Haar und einem schon damals kräftigen, muskulösen Körper. Annelie schauderte, wenn sie an die Blicke dachte, die er neuerdings ihrer Tochter zuwarf.
»Der Junge lässt nichts anbrennen«, hatte sein Vater kürzlich stolz bemerkt, als Philipp von seiner neuesten Eroberung berichtete.
Auch Mina war gewachsen, seit sie angekommen waren. Das Mädchen verwandelte sich unaufhaltsam in eine junge Frau. Zwar war sie zierlich, aber ihre Formen, ihr Gang, ihr Betragen waren weiblicher geworden.
Ich muss sie besser beschützen, fuhr es Annelie durch den Kopf, ich muss sie besser beschützen, doch ich weiß einfach nicht wie.
Sie hatte zu viel Angst. Sie hatte schon immer zu viel Angst gehabt.
Frank hielt den Pflug in der Spur, während sein Vater vorn die Ochsen führte. Heiß brannte die Frühjahrssonne auf sie nieder. Auf der anderen Seite der Welt, das hatte ihm seine Mutter Irmelind erzählt, begann im März der Frühling, im Juni fing der Sommer an, der Herbst im September und der Winter im Dezember. Hier, in Argentinien, lagen die Jahreszeiten genau entgegengesetzt. Der Frühling begann im September, der Sommer im Dezember, der März war ein Herbstmonat, der Juni gehörte zum Winter.
Sie hatten die Felder der Familie Dalberg inzwischen fast alle gepflügt. Wenn sie sich noch etwas beeilten, würden sie am kommenden Tag endlich Zeit für den eigenen kleinen Acker finden.
Frank seufzte. Er tat diese Arbeit, seit er ein kleiner Junge war. Manchmal meinte er, er habe sie schon getan, bevor er sprechen gelernt hatte. Früher waren ihm die Ackerfurchen in jedem Fall höher erschienen. Mindestens alle zehn Schritte hatten sie ihn zum Stolpern gebracht. Weil er keine Hand frei hatte, blinzelte Frank einen Schweißtropfen beiseite. Der Schweiß lief ihm längst in Strömen über den Körper. Hemd und Hose klebten an seiner Haut. Der Gedanke an ein erfrischendes Bad im Fluss ließ ihn lächeln. Sein Vater lockte die Tiere mit einem Wechsel aus Brummen und Schnalzen voran. Von irgendwo hinter ihnen näherte sich Hufgetrappel.
Frank musste sich nicht umdrehen, um zu wissen, dass sich Xaver Amborn, der Vorarbeiter, näherte. Er hatte am Morgen schon nach dem Rechten gesehen und machte nun seine zweite Runde. Frank hoffte nur, dass Philipp ihn nicht begleitete.
Er spannte die Muskeln an und drückte den Pflug tiefer in den Ackerboden. Das Hufgetrappel wurde langsamer. Im nächsten Moment ritt der Reiter im Schritt an Frank vorbei, um das Pferd dann neben seinem Vater Hermann zum Stehen zu bringen. Frank hob den Kopf.
Er hatte Glück. Xaver war tatsächlich allein. Im nächsten Moment hörte Frank auch schon seine Stimme. Er kannte niemanden, der eine solch unangenehme, blecherne Stimme hatte. Flüchtig trafen Xavers Augen die seinen.
»Dein Sohn stellt meiner Tochter nach, Blum«, sagte Xaver jetzt und lächelte dabei, doch Frank hörte die unterschwellige Drohung wohl genauso heraus, wie es sein Vater tat. Der hielt die Ochsen an.
»Ich werde mit ihm sprechen, Herr Amborn«, antwortete er und nickte so unterwürfig, als wolle er sich vor dem Vorarbeiter verbeugen.
»Ich stelle Mina nicht nach«, fuhr Frank noch im gleichen Moment und ohne zu überlegen dazwischen. »Wir kennen uns schon lange. Wir sind befreundet.«
Langsam, als hätte er nicht ganz richtig gehört, drehte sich Xaver zu Frank und schenkte ihm ein halbes Lächeln.
»Freunde? Freundschaft zwischen einem Burschen wie dir und meiner Tochter? Du treibst dich Abende lang mit Mina herum, und das soll mir recht sein? Wir sind eine ordentliche Familie.«
»Wir sind befreundet«, wiederholte Frank. Ohne recht zu wissen, warum, senkte er den Kopf und sah zu Boden.
»Befreundet, ja?«, war wieder Xavers unangenehme Stimme zu hören. »Dir dürfte doch aufgefallen sein, dass meine Tochter kein kleines Kind mehr ist. Sie wird langsam eine recht ansehnliche junge Frau, nicht wahr? Tja, wer hätte das von der kleinen, mageren Kratzbürste gedacht?«
Frank schwieg. Für einen flüchtigen Moment erschien Mina vor seinem inneren Auge: ihre schlanke Gestalt, an der sich an den rechten Stellen Kurven auszuprägen begannen, ihr dichtes Haar, die unverwechselbar hellbraunen Augen.
»Wir werden einmal heiraten«, fuhr er leiser fort.
Xaver Amborn lachte laut auf. »Humor hat er, dein Sohn«, sagte er an Hermann gewandt, um sein Pferd gleich darauf dicht an den jüngeren Mann heranzuführen. »Und wer sagt dir, dass ich das erlaube? Ein Habenichts, wie du es bist? Nichts gegen dich, Hermann, aber du musst zugeben, dass ihr es nicht ganz so gut getroffen habt mit eurem bisschen Land.« Er schaute wieder zu Frank. »Tod und Teufel sage ich dir also, Frank«, Xaver spuckte aus. »Du und meine Tochter? Niemals!«
Frank ließ den Pflug los und trat instinktiv zwei Schritte zurück, doch Xaver drängte sein Pferd weiter vor, sodass der junge Mann nach einigen weiteren stolpernden Schritten zu Boden stürzte. Nur sehr knapp neben seiner Hand kamen die riesigen Hufe von Xavers Rappen zum Stehen.
»Ich rate dir noch einmal, lass die Finger von meiner Tochter, du dreckiger Hund, oder es wird dir schlecht ergehen.«
Frank antwortete nicht. Seine Finger gruben sich in den weichen, frisch gepflügten Boden. Am Rand, dort, wo der Weg verlief, wirbelte ein schwacher Windstoß Staub auf. Frank warf einen kurzen Blick in Richtung seines Vaters, doch der beschäftigte sich mit den Ochsen und tat, als sehe und höre er nichts.
Warum hilft er mir nicht?, dachte Frank. Warum verteidigt er mich nicht? Es war nicht das erste Mal, dass sich sein Vater nicht für ihn einsetzte, aber es schmerzte dennoch.
Xaver lenkte sein Pferd auf den Weg zurück. »Pflügt weiter, Männer«, rief er und trieb seinen Rappen an.
Frank starrte ihm hinterher. Die Wut, die plötzlich in ihm hochkochte, ließ ihn die Zähne fest aufeinanderbeißen.
»Hast du nicht gehört?«, blaffte Hermann. »Weiterarbeiten.«
Nicht zum ersten Mal fragte sich Frank, ob ihn sein Vater tatsächlich so sehr verachtete, wie es in diesem Moment den Anschein hatte.
Am nächsten Sonntag liefen Mina und Frank direkt nach dem Kirchgang getrennt voneinander davon, um sich an ihrem geheimen Platz zu treffen. Frank wirkte nachdenklich. Schon seit geraumer Zeit lag er nun schweigend auf dem Rücken und beschattete die Augen gegen die Sonne. Mit einem Seufzer ließ Mina sich ebenfalls zurücksinken. Dann rollte sie sich auf die Seite, stützte sich auf einen Ellenbogen und musterte Frank.
Spähte sie über seine Schulter hinweg, konnte sie einen der Tümpel sehen, die der Gegend um Esperanza ihren Namen gegeben hatten. Großes Wasserloch, so hatten die Indios der Pampa dieses Gebiet einst genannt. Stieg das Grundwasser an, dann wuchs sich die mit vielen einzelnen Wasserstellen durchsetzte Ebene zu einer riesigen zusammenhängenden Wasserfläche aus, und die landwirtschaftlichen Schäden waren immens.
Es ist sicher nicht leicht gewesen für die ersten Siedler, überlegte Mina.
Etwa zweihundert Familien, unter ihnen Franks Eltern, waren Anfang des Jahres 1856 in der Gegend eingetroffen. In Ermangelung anderer Materialien in der baumlosen Steppe hatten die ersten Kolonisten ihre einfachen Hütten aus in der Sonne getrockneten Erdschollen, adobes, errichten müssen. Sie hatten Wassergräben in den harten Pampaboden gezogen und von Hand Äcker angelegt.
Frank, der Nachzügler, war drei Jahre nach der Ankunft seiner Eltern in Argentinien geboren worden. Anders als Mina hatte er das deutsche Heimatland von Hermann und Irmelind Blum also nie kennengelernt. Wohl deshalb ließ Frank sich manchmal von Mina über die alte Heimat berichten. Und manchmal erzählte er ihr, was er von der beschwerlichen Reise seiner Eltern wusste. Auch wenn Mina und Frank an diesem Tag nicht lange in ihrem Versteck bleiben konnten – obgleich es Sonntag war, warteten auf sie beide zu Hause Aufgaben –, gab ihnen die gemeinsame Zeit Kraft. Schließlich verabschiedeten sie sich mit einem langen, zärtlichen Kuss voneinander.
»Vergiss mich nicht, ja?«, sagte Mina unvermittelt. »Vergiss mich nie.«
Frank zeigte sich nicht überrascht.
»Niemals«, antwortete er ernst.
In Gedanken versunken, die Hände vom Brotbacken teigverklebt, starrte Irmelind Blum durch das Fenster ihres kleinen Hauses nach draußen. Auch nach zwanzig Jahren in diesem Land konnten sie sich nichts Besseres leisten, doch ihr war das ohnehin gleich. Ein Teil von Irmelind war schon vor Jahren gestorben, wenige Tage bevor sie hier, in der sogenannten feuchten Pampa, eingetroffen waren. Nach besonders heftigen Regengüssen, wenn die Flüsse Paraná und Salado über ihre Ufer traten, wurde die Ebene überflutet. Davon hatte man ihnen vor der Abreise zu Hause allerdings nichts erzählt. In Argentinien gebe es gutes Land, war allenthalben gesagt worden, steppenartiges, fast baumloses Grasland, das zur landwirtschaftlichen Nutzung ebenso wie zur Viehwirtschaft einlade. Im Westen der Region gebe es niedrige Gebirge, sierras genannt, das Klima sei feucht, aber gemäßigt warm. Regen falle zu allen Jahreszeiten. Es hatte gut geklungen.
In der deutschen Heimat hatte es damals ja viel Gerede über die Auswanderung nach Südamerika gegeben. Die Verhältnisse waren schlecht gewesen, kaum einer hatte noch sein Auskommen gehabt. Also war ihr Mann Hermann nach Frankfurt gereist, zur Auskunftsstelle. Er hatte einen Vertrag mit einem Vertreter jenes Aaron Castellanos unterzeichnet, der den Anstoß für die Besiedlung des Nordens der Provinz Santa Fe gegeben hatte. Endlich hatte sich die Familie auf den Weg gemacht.
Castellanos … Irmelind würde diesen Namen nie vergessen.
Sein Angebot hatte verlockend geklungen: Zwanzig Hektar Staatsland hatte man jeder Familie versprochen, ein Häuschen, Saatgut, Vorräte, zwei Pferde, zwei Ochsen, sieben Milchkühe und einen Stier. Sogar ein Teil der Reisekosten war übernommen worden. Um den Rest bezahlen zu können, hatten die Blums eine Versteigerung organisiert. Das Haus mit Grundstück wurde gut verkauft. Nach der Anschaffung verschiedener Reiseutensilien und der Begleichung der Kosten für die Überfahrt war sogar etwas übrig geblieben.
Bis dahin, fuhr es Irmelind durch den Kopf, ist alles so glatt verlaufen, dass ich ganz misstrauisch wurde.
Und sie sollte Recht behalten mit ihren düsteren Vorausahnungen. In Dünkirchen hatten sie die Mármora, einen Dreimaster, bestiegen. Und da hatte das Unglück seinen Lauf genommen. Die Schiffspassage dauerte sechzig Tage. Es gab mehrere heftige Stürme. Vier Familien verloren dabei Kinder, die Blums selbst waren verschont worden. Doch das ungute Gefühl war geblieben.
In Buenos Aires hatten schließlich die Behörden die Landung nicht erlaubt, wegen des Krieges, der damals zwischen der Konföderation, also den zur Republik vereinigten Provinzen Argentiniens, und Buenos Aires, jener Provinz, die dabei nicht mitwirken wollte, tobte. Die Mármora musste zurück nach Montevideo. Von dort aus waren die Auswanderer zum Ort Martín García gebracht worden, und ab da ging es mit einem Flussdampfer weiter. Während dieser Fahrt, auf der sie in dem engen Schiffsraum wie Heringe zusammengepfercht waren, waren noch zwei junge Mädchen gestorben. Ein kleines Kind war über Bord gefallen und ertrunken. Mit Mühe nur hatte man die Mutter davon abhalten können, sich hinterherzuwerfen. Irmelind hatte der Anblick schier das Herz zerrissen.
Irmelind schloss für einen Moment die Augen.
Ich darf nicht daran denken, ich darf es nicht.
Zwanzig Jahre lebten sie nun schon in Argentinien, und doch erinnerte sie sich an den Tag der Ankunft, als sei es erst gestern gewesen. Wie fremd war ihr alles vorgekommen: die Landschaft, der Boden, die Pflanzen, der Himmel, die unendliche Weite und die große Anzahl fremdartiger, oft dunkelhäutiger Gestalten, die auf dem höhergelegenen Ufer hockten, um sie willkommen zu heißen.
Das sind unsere neuen Nachbarn, hatte sie immer wieder tonlos zu sich gesagt, unsere neuen Nachbarn, wie einen Rosenkranz hatte sie es wiederholt, den man auch immer und immer wieder betete.
Bald waren Reiter mit großen Karren herbeigekommen. Die Pferde, das hatte sie damals zum ersten Mal gesehen, waren direkt an der Deichsel mittels des Sattelgurts befestigt. Seltsam war ihr das vorgekommen, wenn nicht wie Tierquälerei. Auch das Verladen war auf ungewohnte Art vor sich gegangen. Planken waren zu ihrem Dampfer gelegt worden, dann hatten Einheimische über das bereitstehende Gepäck Lassos geworfen und es so an Land gezogen. In diesen ersten Augenblicken war Irmelind aus dem Staunen nicht herausgekommen.
Und dann war das Furchtbare passiert, das Unaussprechliche … und Claudius Liebkind trug daran die Schuld.
Nochmals wischte Irmelind sich mit dem Ärmel über die Augen. Obwohl sie sich auf der Reise angefreundet hatten, legten die Liebkinds und die Blums die weitere Strecke nach Esperanza getrennt voneinander zurück. Auf dem Weg waren zahlreiche Bewohner der am Wegesrand liegenden ranchos, wie man die kleinen Bauernhöfe in der Landessprache nannte, aufgetaucht. Frauen hatten frische Milch in ausgehöhlten Kürbissen, sogenannten Kalebassen, gereicht. Die kleinen Kinder unter den neuen Kolonisten waren vor den seltsamen Gefäßen zurückgeschreckt. Irmelind hatte dem kaum Beachtung schenken können. Sie hatte sich wie erstarrt gefühlt.
Auch während der ersten arbeitsamen Wochen und Monate hatte sie kaum Gelegenheit gehabt, über das Geschehene nachzudenken, sich ihrem Schmerz hinzugeben. Das neue Leben hatte sie alle vollkommen in Beschlag genommen. Kaum einer konnte auf die Gefühle des anderen achten. Sehr bald zeigte sich beispielsweise, dass das Vieh nicht so zahm war wie das in Europa. Band man die Tiere nicht fest, kehrten Kühe und Stiere einfach auf die Estancia zurück, auf der sie aufgewachsen waren, und mussten mühsam wieder eingefangen werden.
Doch im Laufe der Zeit spielte sich die Arbeit ein. Nach dem Frühstück wurden die Ochsen aufgejocht oder die Pferde angeschirrt und vor den Pflug gespannt. Wenn ein zweiter Mann fehlte, mussten auch die kleinsten Kinder ran. Irmelind hatte Fünfjährige die Pferde führen sehen, während sich der Vater angestrengt mühte, den Pflug in der Furche zu halten.
Damals hatte es viel Maisbrei gegeben, morgens, mittags und abends. Jeden Abend war für den nächsten Tag mühevoll neuer Mais zerstoßen worden. Danach hatte man beim Kohlenfeuer noch ein wenig geplaudert und war früh zu Bett gegangen. Für Lampenöl fehlte das Geld.
Auch an eine bislang ungewohnte Gefahr gewöhnte man sich zwangsläufig: Freie, noch auf die alte Art lebende Indianer durchstreiften die Gegend, sodass die Kolonisten sich gezwungen sahen, stets mit umgehängten Gewehren zu pflügen. Bei der Anlage der Behausungen achteten die Siedler darauf, je vier Häuser dicht beieinander zu errichten. Nachts stellten sie Wachen zum Schutz auf.
Doch mit den alteingesessenen argentinischen Nachbarn lief es ebenfalls nicht immer glatt. Das freundliche Willkommen wich bald Beschwerden über die Großzügigkeit, mit der die Regierung Ausländern Geschenke machte. Die Ansiedlung von Fremden in geschlossenen Kolonien führe zu einer gefährlichen Überfremdung des Landes, verlautete aus einer Debatte des argentinischen Senats. Der Beschluss erging, die Kolonisten zu trennen und auf verschiedene Dörfer zu verteilen. Die allerdings hielten aus und weigerten sich erfolgreich, als Pächter oder Tagelöhner fremdes Land zu bestellen oder sich auf andere Dörfer verteilen zu lassen. Nach diesem Erfolg waren bald weitere Familien aus Deutschland eingetroffen, unter den ersten die Amborns.
Irmelind runzelte die Stirn. Von Nachbarn hatte sie gehört, dass Frank neuerdings Probleme mit Xaver Amborn hatte. Aus irgendeinem Grund hatte Hermann es ihr nicht erzählt. Sie musste Frank unbedingt zur Vorsicht ermahnen. Mit den Amborns, das wussten alle, war nicht gut Kirschen essen. Schneller als alle anderen hatten sie ihren Weg gemacht. Man munkelte, das sei nicht mit rechten Dingen zugegangen. Während Irmelinds Familie nach Jahren immer noch in dem kleinen Häuschen, das sie gleich zu Anfang gebaut hatten, lebte, hatte Xaver es schon kurz nach seiner Ankunft zum Vorarbeiter bei den wohlhabenden Dalbergs gebracht. Sehr bald hatte er auch ein größeres Haus bauen können.
In all den Jahren hatte Irmelind selten mit Xaver Amborn gesprochen, häufiger mit Agnes, seiner ersten hübschen, netten und sehr fleißigen Frau, die nun schon über fünf Jahre tot war. Irmelind seufzte. Manchmal war ihr noch heute, als sehe sie Agnes in ihrem Garten. Immer hatte sie irgendeine Arbeit verrichtet. Den Garten und ihre Blumen hatte sie besonders geliebt. Wenn Irmelind und Agnes miteinander geredet hatten, war es Irmelind erschienen, als wolle Agnes ihr etwas anvertrauen, könne sich aber nicht dazu durchringen, es zu tun. Und dann hatte es eines Tages geheißen, sie habe sich bei einem Sturz das Genick gebrochen. Es gab einige, die sagten, auch das sei nicht mit rechten Dingen zugegangen. Nicht laut natürlich. Man sagte so etwas nicht laut über die Amborns.
Irmelind trat vom Fenster zurück, ging zum Tisch und beugte sich wieder über den Brotteig, den sie bald mit aller Kraft walkte und knetete. Am Morgen war Cäcilie Liebkind nach langer Zeit wieder einmal bei ihr gewesen. Irmelind konnte sich nicht erinnern, wann Cäcilie sie das letzte Mal besucht hatte. In jedem Fall war es sehr, sehr lange her gewesen.
»Claudius kommt zurück, Irmelind«, hatte sie aufgeregt hervorgebracht.
Irmelind hatte Cäcilie angestarrt. Für einen Moment war es, als stünde die Zeit still. Sie konnte sich einfach nicht rühren.
»Vielleicht will er euch sehen«, sagte Cäcilie vorsichtig. »Vielleicht möchte er sich entschuldigen. Es ist so lange her, vielleicht könnten wir einander …«
Cäcilie brach ab.
Weil sie das Wort nicht aussprechen kann, dachte Irmelind, weil sie weiß, dass sie es nicht aussprechen darf. Verzeihen kann nur ich, und ich will es nicht. Ich will ihn nicht sehen, und ich will ihm nicht verzeihen.
Ich verzeihe nichts, wollte Irmelind ausrufen, doch sie biss sich auf die Lippen, als sie den flehenden Ausdruck auf Cäcilies Gesicht sah.
»Er muss …«, begann sie also stattdessen und musste neu ansetzen, weil ihr Mund so trocken war, »… Claudius muss jetzt schon vierzig Jahre alt sein.«
»Ja.« Cäcilie senkte den Kopf.
»Habt ihr ihn manchmal besucht in letzter Zeit? Er hat wieder geheiratet, oder? Geht … geht es ihm gut? Er hat keine Kinder, oder?«
»Ja, er … Nein … Ach, Irmelind, ich …«
»Du musst nichts sagen, wir wollten das alle nicht. Es war ein Unfall oder etwa nicht? So etwas passiert. Gott gibt, Gott nimmt.« Irmelind trat zurück, bis sie im Türrahmen stand, streckte eine Hand aus und hielt sich dann an der Tür fest. »Würdest du mich jetzt bitte allein lassen, Cäcilie?«
Die Reise hatte Claudius Liebkind erschöpft. Er war es nicht mehr gewöhnt, so lange zu reiten. Bevor er sich zu seinen Eltern aufmachte, suchte er sein Hotel auf. Er nahm ein Bad, zog sich frische Kleidung an und aß eine Kleinigkeit. Antoinette, seine junge zweite Frau, die er bald nach dem Tod seiner ersten Frau Betty nur zwei Jahre zuvor geheiratet hatte, sagte neuerdings öfter, er müsse auf seine Linie achten. Dabei war es ihre gute Küche, die ihn hatte rundlich werden lassen. Er liebte ihre salzigen und süßen Leckereien. Und er hoffte darauf, dass sie ihr gemeinsames Glück bald mit einem Kind besiegeln konnten. Vor seiner Abreise hatte Antoinette Andeutungen gemacht. Vielleicht war sie endlich guter Hoffnung. Er wünschte es sich so sehr. Er hatte Kinder immer gemocht, hatte sich stets auch einen Bruder gewünscht und war doch der Einzige geblieben.
Claudius trat noch einmal vor den Spiegel. Sein Haar war dunkel vor Feuchtigkeit, sein Gesicht leicht gerötet, aber nicht mehr vor Anstrengung verzogen. Das Bad hatte ihm gutgetan. Er fühlte sich entspannt. Der Rücken und der Steiß schmerzten nicht mehr so stark.
Nach kurzem Überlegen entschied er sich, noch einen Spaziergang zu machen. Claudius verließ sein Zimmer, ging die Treppe zum Empfang hinunter, grüßte den Portier und trat auf die Straße hinaus. Nachdem er sich davon überzeugt hatte, dass sein Pferd gut versorgt war, machte er sich daran, sich ein wenig im Ort umzusehen. Er war lange nicht mehr in Esperanza gewesen. Nach dem furchtbaren Unfall vor zwanzig Jahren hatten ihm seine Eltern geholfen, andernorts sein Auskommen zu finden. Die Trennung war für sie alle schrecklich gewesen, denn sie hatten sich immer sehr nahegestanden. Danach war er noch ab und an zurückgekehrt, doch stets in großer Heimlichkeit und nur für kurze Zeit. Zu seiner zweiten Hochzeit hatte ihn seine Mutter zum letzten Mal besucht, der Vater hatte auf dem Hof bleiben müssen, auf dem es immer zu viel zu tun gab.
Claudius stellte fest, dass Esperanza weiter gewachsen war. Gut gekleidete Menschen flanierten auf den Straßen der Stadt. Größere und kleinere Kutschen fuhren an ihm vorüber, Reiter sprengten vorbei. Claudius sah Mütter mit ihren Töchtern, Söhne, die Schabernack trieben, junge Männer und Frauen, die einander verstohlen zulächelten. Er überlegte, ob er irgendwo einkehren sollte, um etwas zu trinken. Eigentlich war es ohnehin zu spät, um zu den Eltern zu reiten. Vater und Mutter arbeiteten auch in ihrem Alter noch hart und gingen gewöhnlich früh zu Bett. Ich werde sie besser morgen aufsuchen, überlegte er. Dann würde er auch zu Irmelind und Hermann Blum gehen. Er würde versuchen, endlich etwas von dem gutzumachen, was er in einem Moment jugendlichen Leichtsinns zerstört hatte.
Claudius blieb stehen und hing für einen Moment seinen Gedanken nach. Wie oft hatte er sich schon gewünscht, er könnte diesen einen elenden Augenblick in seinem Leben ungeschehen machen? Aber was geschehen war, war geschehen. Er hatte eine falsche Entscheidung getroffen und den Tod eines Menschen verschuldet. Vronis Tod.
Ein Schauder überlief Claudius, dann blickte er sich um. In Gedanken versunken hatte er nicht auf seinen Weg geachtet. Jetzt befand er sich in einer weniger schönen Gegend der Stadt. Hier flanierten keine Spaziergänger mehr, keine Jugendlichen liebäugelten miteinander, keine Matrone achtete mit Argusaugen auf das Benehmen ihres Schützlings. Ein unguter, fauliger Geruch lag in der Luft. In der Gosse schlief ein Indio in Lumpen seinen Rausch aus. An eine Hauswand gelehnt wartete eine Prostituierte auf Kundschaft. Eben stolperten ein paar Männer aus einer wenig einladend aussehenden pulpería, jener typischen Gaststätte, in der auch Lebensmittel verkauft wurden. Vor einem Haus, das offensichtlich ein Bordell beherbergte, hielt ein schwarzhaariger, kräftiger junger Mann zwei grell gekleidete und ebenso grell geschminkte Frauen im Arm, küsste mal die eine, mal die andere, während ihn seine Kumpane anfeuerten.
»He, was glotzt du denn so?«, knurrte plötzlich jemand.
Claudius fuhr zusammen, verstand erst jetzt, dass man ihn meinte, und wandte den Blick rasch ab, doch es war zu spät. Der junge Mann, der sich eben noch mit den beiden Frauen vergnügt hatte, schob die beiden nun in die Arme seiner Begleiter. Breitbeinig und mit drohender Miene kam er auf Claudius zu.
»He, ich rede mit dir, alter fetter Mann, was glotzt du so?«
»Entschuldigen Sie bitte, mein Herr, ich wollte Sie gewiss nicht stören.«
Claudius machte einen Schritt zurück, war sich jedoch unsicher, was er tun sollte. Er zögerte erneut.
Der junge Mann drehte sich derweil zu seinen Kumpanen hin und begann zu lachen. »Wollte mich nicht stören! Der Herr wollte mich nicht stören.« Sein Lachen klang falsch, dann nahm er Claudius auch schon wieder drohend in den Blick. »Bin ich es also nicht wert, dass man mit mir spricht?«
»Doch, ich …«
»Ja, was denn nun?«
Claudius wurde unbehaglich zumute. Er wich weiter zurück, doch nun tauchte einer der anderen Männer hinter ihm auf. Der zweite blockierte ihn seitlich. Der Wortführer stand direkt vor ihm. Die beiden jungen Frauen waren wie auf einen geheimen Wink hin verschwunden.
Vielleicht holen sie Hilfe, versuchte Claudius sich zu beruhigen, doch er wusste, dass er vergeblich hoffte.
Der erste Schlag traf ihn mitten ins Gesicht und ließ seine Nase knackend brechen. Der gleich darauffolgende schleuderte ihn in den Dreck. Ein Gemisch aus Blut und Rotz lief ihm in den Rachen, Blut tropfte aus Mund und Nase auf sein Hemd. Claudius versuchte aufzustehen, doch ein brutaler Tritt mit metallverstärkten Stiefeln warf ihn zurück auf den Boden. Er schrie auf. »Hilfe, so helft mir doch!« Doch ringsum blieb alles still. Niemand rührte sich. Noch einmal rief er um Hilfe.
»Maul halten!«, brüllte der junge Mann.
Dann trafen ihn weitere Tritte und Schläge. Anfangs versuchte Claudius noch, sich zu schützen, doch bald verließen ihn die Kräfte. Längst war sein ganzer Körper ein einziger pochender Schmerz.
»Hilfe«, gurgelte er kaum hörbar, »Hilfe! Will mir denn niemand helfen? Hilfe, Hi …«
Mina war an diesem Tag lange umhergestreift. Die meisten hielten ein solches Verhalten für zu gefährlich, doch das junge Mädchen konnte sich nichts Besseres vorstellen, als entführt zu werden. Kein Leben konnte schlimmer sein als die Hölle, in der sie lebte – noch nicht einmal die Aussicht, bei den Pampaindianern zu landen, von denen sie nur Schlechtes gehört hatte. Dieser südlich von Buenos Aires lebende Stamm, hieß es, gehöre zu den grausamsten aller Indianerstämme. Angeblich hielten sie ihre Frauen wie Sklaven und ließen sie schmutzige Lumpen tragen. Wenn sie nicht gerade auf der Jagd oder auf Raubzug waren, verbrachten die Männer ihre Zeit mit trinken, Glücksspiel und schlafen. Ein bitteres Lächeln malte sich auf Minas Lippen: Ganz offenbar gehörten der Stiefvater und ihr Stiefbruder zu den berüchtigten Pampaindianern.
Vorsichtig näherte sie sich nun ihrem Zuhause. Sie hatte ein Fenster eines der wenig genutzten Räume offen gelassen, das sie nun behutsam aufdrückte. Geschmeidig wie eine Katze kletterte sie hindurch und kam samtweich auf dem Boden auf. Sie hatte lange geübt, sich beinahe unhörbar zu bewegen und diese Kunst im Laufe der Zeit zur Perfektion gebracht. So schnell bemerkte sie keiner, wenn Mina es nicht wünschte.
Einen Moment lang blieb sie zur Sicherheit horchend in den Schatten stehen, doch alles blieb still. Fast schien es ihr, als sei das Haus leer. Als sie aus dem Zimmer trat, horchte sie erneut. Immer noch nichts. Die Küche lag bereits im Dämmerlicht, beleuchtet nur vom glutroten Schein aus dem Ofen. Im oberen Stockwerk waren jetzt Schritte zu hören, dann die Stimme ihrer Mutter.
»Mina, bist du das?«
»Ja, alles in Ordnung, ich wollte nur etwas trinken.«
Mina huschte in die Küche, trat zum Wasserkrug und schenkte sich einen Becher voll. Dann lehnte sie sich gegen den Spülstein und starrte Philipps Rock an, den dieser nachlässig über die Lehne eines Stuhls geworfen hatte. Durch das Fenster erspähte sie sein Pferd noch gesattelt und aufgezäumt im Hof. Offenbar war auch er gerade erst nach Hause gekommen.
Mina wandte sich wieder dem Rock zu. Sie hatte das Kleidungsstück an der leicht schiefen Naht erkannt, mit der sie einen Riss gestopft hatte. Philipp hatte ihr dafür die Lippen blutig geschlagen. Doch etwas weckte ihre Aufmerksamkeit, etwas schimmerte golden aus einer der Taschen hervor.
Mina stellte ihren Becher ab, ohne zu trinken, nahm den Rock ihres Stiefbruders hoch und zog den Gegenstand aus der Tasche.
Eine goldene Uhr! Sie riss die Augen auf. Das konnte nicht Philipps Uhr sein. Ihr Stiefbruder war stets in Geldnot. Niemals hätte er sich eine solche Uhr leisten können. Auch Xaver hatte ihm, bei aller Liebe zu seinem Sohn, bislang keine gekauft. Hatte er sie jemandem gestohlen? Philipp musste sie jemandem gestohlen haben!
Die Uhr in der Hand, drehte Mina sich um, trat an den Ofen heran und untersuchte im Feuerschein, ob auf der Rückseite etwas eingraviert war. CL, entzifferte sie mit einiger Mühe – ein verschnörkeltes C, das L schlang sich darum.
Von draußen näherten sich Schritte. Mina fuhr zusammen, stopfte die Uhr zurück in die Tasche. Gerade noch konnte sie den Rock wieder über die Stuhllehne werfen und in die Vorratskammer schlüpfen, da wurde auch schon die Tür aufgestoßen.
»Verdammt!«
Philipp stand in der Küche über den Vorratseimer mit Frischwasser gebeugt und spritzte sich prustend Wasser ins Gesicht. Seine Handknöchel schmerzten von den Schlägen, die er ausgeteilt hatte. Die Haut war aufgeschürft. Sein Hemd war voller Blut. Das Blut des Fremden, nicht seines. Der Fremde hatte geblutet wie ein abgestochenes Schwein. Philipp sah auf seine Stiefel. Auch die hatten etwas abbekommen. Er nahm sein Halstuch und wischte die hässlichen braunroten Flecken weg. Immer und immer wieder hatte er zugetreten. Während der Fremde anfangs noch geschrien hatte, hatte er später nur noch gewimmert und schließlich nichts mehr von sich gegeben. Er, Philipp, war wie in einem Rausch gewesen, aber es hatte ihm keine Erleichterung verschafft. Irgendwann war er von einem seiner Freunde zurückgerissen worden. Philipp, du bringst ihn ja um!, hatte der gerufen.
Da erst hatte er widerstrebend von seinem Opfer abgelassen, aber es war zu spät gewesen. Der gut gekleidete fremde Mann, der ohne Vorwarnung in sein Leben eingedrungen war, war längst tot. Keiner von ihnen hatte es bemerkt. Er war gestorben, einfach so. Was sollte man da machen …?
Er und seine Freunde hatten den Fremden im Dreck liegen lassen und sich davongemacht. Er würde nicht der Erste sein, den man tot in einer Gasse fand. Morgen würden sie sich wieder zum Kartenspiel treffen. Gesehen hatte sie niemand, und wer sie gesehen hatte, würde sicher nicht wagen, das Maul aufzureißen.
Ein neuerlicher Gedanke ließ Philipp grinsen, während er zusah, wie das Blut des Fremden von ihm heruntertropfte. Draußen waren schwere Schritte zu hören, dann wurde die Tür aufgestoßen, und sein Vater kam herein.
»Du bist schon zurück?«
»Es gab einen Unfall«, beschied Philipp ihn knapp.
»So?«
»Meine Freunde und ich wurden angegriffen.«
Xaver antwortete nicht.
»Ist Mina schon zurück?«, fragte Philipp dann.
»Wieso?« Wie er erwartet hatte, schlich sich Misstrauen in Xavers Stimme. Auf seine Weise war der Vater doch sehr vorhersehbar.
»Hab sie heute mit Frank Blum gesehen«, hieb Philipp genüsslich in dieselbe Kerbe.
»Hölle und Teufel, ich habe ihr doch streng verboten, sich noch einmal mit diesem nichtsnutzigen Lumpen abzugeben. Ich glaube, ich muss diesem widerspenstigen Weib eine Lektion erteilen.«
Ein Laut ließ Xaver und Philipp in Richtung der kleinen Vorratskammer schauen, dann wechselten Vater und Sohn einen kurzen Blick.
»Mina, Süße«, rief Philipp, »bist du etwa da drin?«
Sie hätten Wichtigeres zu klären, hatte er seinem Vater zugeraunt, deshalb hatte Xaver seine Stieftochter lediglich heftig geohrfeigt, nachdem sie Mina in der Vorratskammer ertappt hatten, und sie in die Scheune gesperrt. Dann waren sie beide ins Haus zurückgekehrt, saßen einander nun am Küchentisch gegenüber, eine Flasche Caña, Zuckerrohrschnaps, zwischen sich.
Philipp zögerte. Wie sollte er es dem Vater sagen? Es gab einen, der sich in letzter Zeit zu viel herausgenommen hatte, das wussten sie beide. Und dass Xaver nicht gut auf Frank zu sprechen war, war eben nur wieder zu deutlich geworden. Wenn er es gut anstellte, konnte er also zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.
Kurze Zeit später hatte er dem Vater sein Vorhaben erklärt. Xaver nickte und lächelte dann breit.
»Du bist mein Sohn«, sagte er, »wirklich und wahrhaftig mein Sohn.«
Etwas drang in Franks Unterbewusstsein, etwas Unangenehmes, das er zuerst nicht einordnen konnte: Schritte auf dem Holzboden, laute Stimmen, dann Geschrei, das Weinen seiner Mutter, die hilflose Stimme seines Vaters. Er fuhr hoch.
Das war kein Traum, das war die Wirklichkeit. Eben gerade waren Männer ins Haus seiner Eltern eingedrungen. Er konnte Xavers und Philipps Stimmen erkennen und die von einigen ihrer Handlanger und Stiefellecker.
»Geh aus dem Weg, Weib, wir müssen deinen Sohn mitnehmen«, war jetzt Xavers Stimme zu hören.
»Aber er hat nichts getan, Herr Amborn, Frank ist ein guter Junge. Er hat nichts getan. Er war den ganzen Abend hier.«
»Geh mir aus dem Weg, Irmelind, ich sag’s nicht noch einmal. Frank war mitnichten hier, das können meine Männer bezeugen, und jetzt nimm dir ein Beispiel an deinem Mann und mach Platz.«
»Komm, Irmelind«, war jetzt die Stimme des Vaters zu hören, »mach keinen Ärger.«
»Aber was wollt ihr denn von meinen Jungen?«
Offenbar war seine Mutter nicht so leicht bereit aufzugeben. Leise, ganz leise verließ Frank das Bett, zog rasch seine Hose an und schlich dann zur Tür, um durch den Spalt zu spähen. Sein älterer Bruder Samuel, der für ein paar Tage bei ihnen weilte, war jetzt ebenfalls aufgewacht und starrte ihn erstaunt an. Frank legte den Finger auf die Lippen. Die Stimmen wurden lauter.
»Frank hat einen Mann umgebracht, Irmelind. Es gibt Zeugen.«
»Das kann nicht sein. Er war hier, mein Frank war hier.«
»Doch, es ist die Wahrheit.« Durch den Spalt konnte Frank sehen, wie Philipp auf Irmelind zutrat und ein blutverschmiertes Hemd in die Höhe hielt. »Das haben wir draußen gefunden. Es ist Franks Hemd, wir haben uns erkundigt.«
Frank warf den Kopf herum. Wo war sein Hemd, wo …? Und dann fiel es ihm ein: Er hatte es nach der Feldarbeit gewaschen und zum Trocknen aufgehängt. Das dort konnte also tatsächlich sein Hemd sein.
»Aber …« Irmelind brach ab. »Glaubt mir doch, Frank würde keiner Fliege etwas zuleide tun. Er ist so ein guter Junge. So ein Hemd tragen hier doch viele, ich …«
Jetzt mischte sich Hermann ein. »Wen soll er denn getötet haben? Jemanden, den wir kennen?«
»Nun …« Xavers Gestalt verdeckte für einen Moment die seines Sohnes. »Claudius Liebkind ist offenbar heute in Esperanza eingetroffen und liegt nun erschlagen auf der Polizeiwache.«
Frank hörte, wie seine Mutter einen Schrei ausstieß. Philipp trat hinter dem Rücken seines Vaters hervor.
»Du wusstest davon, Irmelind, nicht wahr? Du hast es ihm gesagt, ja? Cäcilie hat dir erzählt, dass Claudius kommen wollte, um sich mit euch zu versöhnen …«
Irmelind stieß einen neuerlichen gequälten Schrei aus.
»N … nein«, stotterte sie dann, »ich habe, ich habe nichts und niemandem …«
Frank hatte genug gehört. Lautlos stahl er sich an seinem verwirrten Bruder vorbei zum Fenster, öffnete es vorsichtig und stieg ebenso lautlos hinaus. Gott sei Dank hatte offenbar keiner der Trottel daran gedacht, die Umgebung des Hauses zu bewachen. Unbehelligt konnte er sich davonmachen. Wenig später hatte ihn die Weite des Landes geschluckt.
Mina blinzelte ins graue Morgenlicht, als der Stiefvater die Tür zum Schuppen am nächsten Tag öffnete. Sie hatte Philipp und ihn am Vorabend zurückkehren hören, offenbar stockbetrunken, und sofort gewusst, dass man sie an diesem Abend nicht mehr befreien würde. Auf ihre Mutter zu hoffen war ebenfalls vergebens. Annelie liebte ihre Tochter, aber sie hatte zu viel Angst, um ihrem Mann zuwiderzuhandeln. Es war nicht die erste Nacht, die Mina in der Scheune verbrachte. Sie hatte sich daran gewöhnt. Ein Rascheln, ein Fiepen oder ein anderes, nicht einzuordnendes Geräusch schreckten sie gewiss nicht mehr.
»Na, Töchterchen, gut geschlafen?« Xaver lachte blechern auf.
Ich bin nicht deine Tochter, wollte Mina ausspucken, doch sie beherrschte sich im letzten Moment. Im Schatten seines Vaters trat Philipp durch die Tür. Der Stiefbruder grinste sie so anzüglich an, dass ihr mit einem Mal angst und bange wurde. Xaver klopfte seinem Sohn auf die Schulter.
»Ich muss los, Junge, wird ein langer Tag.«
»Ja, Vater, ich komme auch gleich.«
Philipp sah Xaver einen Moment nach. Dann sah er Mina an. Wieder grinste er. Im nächsten Moment schon stand er ganz dicht bei ihr. Er nahm eine Strähne ihres Haars und wickelte sie sich um die Handfläche, bis Mina vor Schmerz die Zähne aufeinanderbeißen musste. Doch niemals würde sie ihm die Genugtuung geben, in seiner Gegenwart Angst oder Schmerz zu zeigen.
»Mina, kleine Mina, weißt du es schon? Dein Bock hat sich aus dem Staub gemacht.«
»Wer?« Mina blinzelte die verräterischen Tränen weg.
»Frank. Frank Blum hat einen Menschen getötet und ist vor dem Arm des Gesetzes geflohen.«
Der Schrecken fuhr wie ein heißer Strahl durch Mina hindurch, und doch gelang es ihr, ihre Gefühle weiterhin nicht zu zeigen.
»Frank hat niemanden getötet«, widersprach sie mit fester Stimme.
»Frag seine Eltern, liebste Mina, er ist fort. Würde ein Unschuldiger fliehen? In jedem Fall bist du jetzt allein. Jetzt bin nur noch ich da, um dir Lust zu verschaffen, meine Süße.«
Mina überlief ein Schauder. Mit einem Mal erinnerte sie sich der Blicke, die ihr Philipp seit geraumer Zeit zuwarf.
»Du bist schön«, sagte er, immer noch grinsend.
»Lass mich los!«, zischte sie ihn an.
Philipp lockerte seinen Griff ein wenig. Dann packte er Mina plötzlich beim Nacken. Er zwang ihr Gesicht nahe an seines heran.
»Wie war das?«
»Lass mich los!«
»Küss mich.«
»Niemals.«
»Wir sind Bruder und Schwester. Komm, gib mir einen schwesterlichen Kuss, Kleine.«
Mina versuchte, ihr Gesicht zur Seite zu drehen. Es wollte ihr nicht gelingen. Philipps Mund näherte sich. Seine Lippen berührten die ihren, seine fordernde Zunge drängte sich in ihren Mund. Sie wollte am liebsten ausspucken, als er endlich von ihr abließ, doch er drückte ihr den Kiefer so zusammen, dass sie den Mund nicht öffnen konnte.
»War das nicht schön, mein Täubchen? Denk daran, dein Bock ist weg. Du hast jetzt nur noch mich, und ich bin ohnehin die bessere Wahl.«
Philipp ließ sie unvermittelt los.
Mina stolperte von ihm weg. »Verschwinde, du Scheusal!«
»Immerhin bin ich kein flüchtiger Mörder.«
»Frank ist kein Mörder.«
»Er ist geflohen, Kleine. Er ist geflohen, nachdem er den Mörder seiner Schwester getötet hat. Rachemord nennt man das, es wäre nicht der erste auf dieser Welt, liebste Mina.«
Mina schüttelte sich innerlich. Hatte Philipp etwa Recht? Hatte Frank tatsächlich einen Mord begangen? Aber er hatte seine Schwester doch nie kennengelernt, er kannte die Geschichte nur von seinen Eltern. Konnte ihr Frank …?
»Gewöhn dich an den Gedanken, ab jetzt bist du allein.«
Mina zuckte unwillkürlich zusammen, sie konnte nichts dagegen tun. Mit einem Mal war ihr eiskalt.
Claudius ist tot.