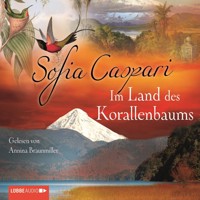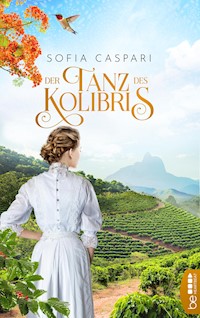Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Audio Media Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Liebe stärker als das Schicksal
Italien, 1859: Die neunzehnjährige Pauline muss mit ihrem Vater Hals über Kopf aus Sizilien fliehen, nachdem dieser den Patron der Region betrogen hat. Auf der Überfahrt nach Brasilien lernen sie die Familie Hartung kennen, die ihrem bescheidenen Leben im Hunsrück den Rücken gekehrt hat. Pauline und Jonas Hartung fühlen sich zueinander hingezogen, doch das Schicksal und Paulines Vater haben andere Pläne ...
Eine fesselnde Familiengeschichte vor der farbenprächtigen Kulisse Brasiliens - für Fans von Sarah Lark und Elizabeth Haran.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel der Autorin
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Zitat
Prolog
Erster Teil Messina 1858 bis 1859
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Zweiter Teil Auf nach Brasilien 1857 bis 1859
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Dritter Teil In der Ferne 1859
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Vierter Teil Verlorene Träume 1859
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Fünfter Teil Ein neues Leben 1860 bis 1861
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Sechster Teil Entscheidungen 1862 bis 1863
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Epilog
Danksagung
Weitere Titel der Autorin
Im Land des Korallenbaums
Die Lagune der Flamingos
Das Lied des Wasserfalls
Der Tanz des Kolibris
Inselglück und Sommerträume
Die kleine Pension am Meer
Der Duft des tiefblauen Meeres
Über dieses Buch
Eine Liebe stärker als das Schicksal
Italien, 1859: Die neunzehnjährige Pauline muss mit ihrem Vater Hals über Kopf aus Sizilien fliehen, nachdem dieser den Patron der Region betrogen hat. Auf der Überfahrt nach Brasilien lernen sie die Familie Hartung kennen, die ihrem bescheidenen Leben im Hunsrück den Rücken gekehrt hat. Pauline und Jonas Hartung fühlen sich zueinander hingezogen, doch das Schicksal und Paulines Vater haben andere Pläne …
eBooks von beHEARTBEAT – Herzklopfen garantiert.
Über die Autorin
Sofia Caspari, geboren 1972, hat schon mehrere Reisen nach Mittel- und Südamerika unternommen. Dort lebt auch ein Teil ihrer Verwandtschaft. Längere Zeit verbrachte sie in Argentinien, einem Land, dessen Menschen, Landschaften und Geschichte sie tief beeindruckt haben. Heute lebt sie – nach Stationen in Irland und Frankreich – mit ihrem Mann und ihren zwei kleinen Söhnen in einem Dorf im Nahetal.
Sofia Caspari
IMTAL DERZITRONEN-BÄUME
beHEARTBEAT
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2022 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Melanie Blank-Schröder
Landkarte: Reinhard Borner
Covergestaltung: Guter Punkt, München unter Verwendung von Motiven von © KathySG/Shutterstock; © ASIFE/iStock/Getty Images Plus; © flik47/iStock/Getty Images Plus; © Tatiana Dyuvbanova/iStock/Getty Images Plus; © Shaiith/iStock/Getty Images Plus; © MarinaZakharova/iStock/Getty Images Plus; © Denira777/iStock/Getty Images Plus; © Charcom/iStock/Getty Images Plus
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7517-2178-3
be-heartbeat.de
lesejury.de
Für Tobias, Julian und Benjamin.Wir sind angekommen. Die Reise geht weiter.
Ich fühle mich von einer tiefen Ehrfurcht durchdrungen, wenn ich die wunderbaren Ergebnisse der freien Arbeit betrachte. Noch vor Kurzem war hier eine Einöde, nur von wilden Tieren bevölkert, heute ist dieser Boden im Besitz der zivilisierten Menschen, durch die Anstrengung einer Rasse, in der Energie und Religion leben.
António Homem de Mello 1868über die deutschen Kolonienvon Rio Grande do Sul
Prolog
Ein durchdringender Schrei zerriss die Stille des sehr frühen Märzmorgens. Er zeugte von einem Menschen in äußerster Not. Von einem Moment auf den anderen sträubten sich Pauline die Nackenhaare. Irgendwo ganz fern wurde ein Fensterladen geschlossen. Ein blechernes Geräusch war zu hören, dann wieder nichts. Außer dieser schrecklichen Stille. Es war ganz deutlich – wer etwas gehört hatte, wollte nicht wissen, was geschah. Niemand würde sich einmischen.
Pauline fühlte einen kurzen, heftigen Schauder über ihren Rücken laufen. Unvermittelt blieb sie stehen, doch ihr Vater zog sie unerbittlich weiter.
»Gregorio!«, flüsterte sie. »Gregorio …« Sie sah ihren Vater an. »Was ist mit ihm? Wir müssen zurück. Gregorio braucht unsere Hilfe.«
»Unmöglich.« Valentin Jordan schüttelte den Kopf. »Wir können nicht zurück, Pauline, wir können es nicht. Auch wenn wir es noch so sehr wollten. Es ist zu gefährlich.«
Wieder zerrte Valentin an der Hand seiner Tochter. Sein fester Griff schmerzte. Die junge Frau stolperte, doch der Vater fing sie auf, bevor sie stürzen konnte.
»Pass doch auf«, herrschte er sie an, so wütend und so voller Angst, wie sie es gar nicht von ihm kannte. »Reiß dich zusammen!«
Pauline erwiderte nichts. Zum ersten Mal in ihrem Leben spürte sie ganz deutlich, dass ihr sonst so unbekümmerter Vater kurz davorstand, die Nerven zu verlieren.
»Ich habe gestern Nacht mit zwei Engländern gesprochen. Sie wollen heute noch los«, teilte er ihr jetzt unvermittelt mit. Als hätte es den herzzerreißenden Schrei und diese entsetzliche Stille danach nicht gegeben. »Sie haben gesagt, das Schiff, mit dem sie nach Frankreich reisen, könnte uns mitnehmen, aber sie warten sicher nicht auf uns.«
»Uns mitnehmen?« Pauline wollte wieder stehen bleiben, doch Valentin ließ es nicht zu. »Aber warum, Vater?«, fragte sie fassungslos. »Was hast du vor? Sollen wir etwa von hier fort? Weg aus Messina? Was ist mit unseren Sachen, was mit dem Geschäft?«
»Ich …« Zum ersten Mal seit Längerem sah Valentin seine Tochter richtig an, wich ihrem Blick dann aber wieder aus. »Mach dir keine Sorgen, ich habe alles geregelt, Kind.«
Pauline riss sich von ihrem Vater los und blieb wie angewurzelt stehen. »Alles geregelt? Was hast du geregelt, um Himmels willen? Was ist mit Gregorio, was haben sie ihm angetan? Hast du etwas damit zu tun?«
Die junge Frau versuchte, ihrem Vater ins Gesicht zu sehen, doch es wollte ihr nicht mehr gelingen. Er schaute den Weg entlang, den sie gehen mussten, um zum Hafen zu gelangen, als beträfe ihn nichts anderes.
»Ich kann dir nicht sagen, was mit ihm ist, Pauline, weil ich es nicht weiß. Ich weiß nur, dass wir dringend von hier fortmüssen. Verstehst du das nicht? Sie sind hinter uns her!«
»Wer ist hinter uns her?«
Valentin schwieg einen Moment. »Warum fragst du?«, wollte er dann wissen. »Du weißt es doch sicher, oder etwa nicht?«
»Signor Fabris.« Pauline sprach den Namen aus, ohne zu zögern.
Valentin nickte nur.
Die junge Frau leckte sich über die mit einem Mal furchtbar trockenen Lippen, stolperte einige Schritte weiter und blieb dann erneut stehen. »Du hast das alles geplant?«
»Ich … Ich kann dir darüber jetzt nicht mehr sagen.« Der Vater sah sie flehentlich an. »Komm mit, Pauline, vertrau mir. Ich wollte immer nur dein Bestes. Du wirst alles später erfahren, später, wenn die Zeit gekommen ist.«
Pauline schüttelte den Kopf. »Aber Gregorio … Was hast du Gregorio angetan?«
Valentin erstarrte. »Nichts, du meine Güte. Du müsstest mich doch gut genug kennen …«
Ja, Pauline kannte ihren Vater und gerade deshalb … Sie kam nicht dazu, den Gedanken zu Ende zu führen, denn Valentin erwachte aus seiner Erstarrung und zerrte sie einfach weiter. Dieses Mal duldete er keinen Widerstand. Paulines Kraft reichte nicht, sich zu wehren. Sie musste ihm gehorchen, ob sie nun wollte oder nicht.
Wenig später erreichten sie den Hafen und den Segler der Engländer. Außer ihnen wollten noch zwei ältere Männer mit dem Schiff fahren, das die Reisenden nach Marseille bringen würde, von wo aus sie weiteren Abenteuern entgegensahen. Offenbar war man auf Paulines und Valentins Kommen vorbereitet. Keiner an Bord, auch die italienische Besatzung nicht, fragte bei der Begrüßung, warum sie so wenig Gepäck bei sich trugen – Valentin nur eine leichte Reisetasche, Pauline einen Stoffbeutel, in dem sich ihre Malutensilien und eine Mappe mit Bildern befanden, sonst gar nichts.
Kaum waren Vater und Tochter auf Deck, suchte Valentin sich einen ruhigen Platz und bedeutete seiner Tochter, sich zu ihm zu setzen. Pauline schüttelte den Kopf. Sie blieb stehen und schaute zum Land zurück, als nun die Leinen gelöst wurden.
Die Fahrt aus dem Hafen verlief reibungslos, die junge Frau schenkte ihr kaum Aufmerksamkeit. Paulines Augen blieben auf die Hafenmauer gerichtet, auf den Platz, der an diesem frühen Morgen noch kaum bevölkert war, und dann sah sie ihre Verfolger kommen. Ihr Herz klopfte, als sie Gregorio zwischen ihnen ausmachte. Durch die Entfernung konnte man seine Gesichtszüge nicht erkennen, doch seine Bewegungen waren ihr vertraut. Die Männer an seiner Seite erkannte Pauline nicht, sie sah nur, dass sie Gregorio jetzt auf die Knie zwangen. Ein erstickter Schrei entfuhr ihr, und sie schlug die Hand vor den Mund.
»Gregorio!«
Pauline klammerte sich so fest an das Geländer der Reling, dass die Knöchel ihrer Finger weiß hervortraten. Im nächsten Moment stand ihr Vater neben ihr, umfing die Tochter mit seinen kräftigen Armen, barg ihr Gesicht an seiner Brust. Einen kurzen Augenblick ließ sie ihn gewähren, dann versuchte sie, sich aus Valentins Griff zu befreien.
»Ich muss das sehen.«
»Nein, das musst du nicht.«
Pauline holte zitternd Atem. »Was … was tun sie?«, fragte sie dann mit bebender Stimme. »Was machen sie mit ihm?«
»Sie tun ihm nichts, Pauline. Sie werden ihm nichts tun. Er ist Fabris’ Neffe.«
Pauline versuchte nicht noch einmal, sich umzudrehen. Sie hatte zu viel Angst vor dem, was sie sehen würde. Wie erstarrt verharrte sie, das Gesicht an der Brust des Vaters geborgen.
Taten sie ihm wirklich nichts? Konnte sie Valentin glauben? Doch er war ihr Vater. Wem sonst konnte sie glauben, wenn nicht ihm?
Erster TeilMessina1858 bis 1859
Erstes Kapitel
Sechs Monate zuvor …
Pauline hatte kein gutes Gefühl, obgleich Gregorios warme Hand die ihre fest umklammert hielt. Immer wieder nickte der junge Sizilianer ihr aufmunternd zu. Je näher sie allerdings dem Haus Santino Fabris’ kamen, desto unruhiger wurde die junge Frau.
Eigentlich war es ein so schöner Tag. Die Sonne brannte vom strahlend blauen Himmel, obwohl sich der Sommer schon dem Ende zuneigte. Signor Fabris, Gregorios Onkel, saß auf der Veranda des prächtigen Hauses der Familie, von dem aus man einen überwältigenden Ausblick auf die Umgebung hatte. Er ging wohl eben mit seinem Verwalter Francesco Moli die Geschäftspapiere durch. Gregorio, erinnerte sich Pauline in diesem Moment schaudernd, hatte einmal gesagt, sein Onkel sei gewiss nicht mit Freundlichkeit zum größten Zitronenplantagenbesitzer der Gegend geworden, sondern mit List, Tücke und Brutalität. Nein, eigentlich wollte sie diesem Mann, der sich so freundlich gab, von dem sie aber dennoch schon so viel Grausames gehört hatte, nicht gegenübertreten. Was ging ihn die Beziehung zwischen ihr und seinem Neffen an? Sie konnte doch vorerst Gregorios und ihr Geheimnis bleiben. Sie war erst achtzehn Jahre alt. Und war es in diesem Alter nicht schön, Geheimnisse zu haben?
Offenbar hatte Pauline ihren Schritt unwillkürlich verlangsamt, denn Gregorio lächelte sie ermutigend an. Sie liebte Gregorios Lächeln, und gewöhnlich beruhigte es sie, aber daran konnte sie jetzt keinen Gedanken verschwenden.
»Wir sollten es ihm vielleicht noch nicht sagen.« Pauline warf erneut einen hastigen Blick auf die Veranda.
Signor Fabris hatte die beiden jungen Leute entweder noch nicht bemerkt oder er interessierte sich nicht für sie.
Gregorio blieb stehen. »Aber wir haben doch so lange darüber gesprochen. Wir waren uns einig, Pauline. Er muss endlich von uns erfahren. Warum nicht jetzt? Warum später? Ich bin nicht sein Sohn. Ich sage dir, es wird für ihn ohnehin nicht wichtig sein, wen ich einmal heirate.«
Dass er das Wort »heiraten« erwähnte, jagte Pauline einen wohligen Schauder über den Rücken. Die junge Frau wandte den Blick in die Weite, er verlor sich auf den türkisblauen tanzenden Wellen des Mittelmeers.
»Ich bin mir einfach nicht sicher«, sagte sie dann leise.
Sie schaute Gregorio an, versank gleich in den Tiefen seiner dunklen Augen. Gregorio hatte ein ebenmäßiges Gesicht, eine schmale Nase und wie gemeißelt wirkende Wangenknochen. Bei ihrer ersten Begegnung hatte er sie an die antiken Statuen erinnert, die ihr Vater so sehr liebte. Gregorio war das Ebenbild einer dieser Statuen, und Pauline konnte sich nicht vorstellen, dass Santino Fabris nichts mit seinem wunderbaren Neffen vorhatte. Gregorio war gewiss ein Pfund, mit dem sich wuchern ließ.
Dank seines Onkels hatte der junge Mann die besten Verbindungen. Außerdem war er ihm zu Dank verpflichtet, denn Santino hatte ihn als Waise bei sich aufgenommen. Niemand in der Familie Fabris konnte Entscheidungen an Santino Fabris vorbei treffen. Das war unmöglich. Sollte ihr das wirklich bewusster sein als Gregorio selbst?
Gregorio legte sanft die Hand auf Paulines Rücken und nötigte sie auf diese Weise weiterzugehen. Als sie Santino Fabris fast erreicht hatten, beugte sich Francesco Moli plötzlich zu dem Plantagenbesitzer hinüber und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Fabris hob den Kopf.
»Gregorio! Mein liebster Neffe.« Er sah Pauline an. »Und die bezaubernde Signorina Jordan. Ich hoffe doch, Ihr Vater hat bald wieder eine Lieferung für mich? Diese wunderbaren Skulpturen versüßen mir den Tag.«
»Signor Fabris!«
Pauline nickte Gregorios Onkel, der nun von seinem Neffen mit Küssen auf die Wangen begrüßt wurde, höflich zu. »Ich bin mir sicher, dass mein Vater bald wieder etwas Passendes für Sie hat. Soweit ich weiß, hat er kürzlich Nachricht von einer neuen Ausgrabung erhalten.«
Signor Fabris lächelte wohlwollend. »Setzt euch doch, Kinder!«, sagte er dann und wies auf zwei Stühle am einen und anderen Ende des großen Tisches. Die beiden jungen Leute folgten seiner Aufforderung.
»Lassen Sie uns etwas Limonade bringen, Moli, und eine Granita für jeden. Sie nehmen doch eine Granita, Signorina Jordan?«
»Danke, Onkel«, sagte Gregorio, bevor Pauline antworten konnte.
Wenig später stand die einem Sorbet ähnliche Süßspeise, die Pauline erst hier auf Sizilien kennengelernt hatte, auch schon vor ihnen. Mit einem zierlichen Silberlöffel probierte sie etwas von der halb gefrorenen Masse aus Zuckersirup und frischem Zitronensaft – gewöhnlich eine willkommene Erfrischung an heißen Tagen. Es schmeckte köstlich.
Alles im und am Haus des Plantagenbesitzers wirkte erlesen und zeugte von gutem Geschmack, doch Pauline kam nicht umhin, erneut daran zu denken, wie er zu diesem Reichtum gekommen war. Von Gregorio wusste sie, dass Santino Fabris nach und nach mehrere Zitronenanpflanzungen und Gärten in seinen Besitz gebracht hatte, die zwar immer noch von ihren ehemaligen Besitzern bewirtschaftet wurden, ihnen aber nicht mehr gehörten. Keiner der kleineren Bauern hatte sich ihm widersetzen können. Wer es doch versucht hatte, war früher oder später von Fabris’ Männern besucht worden. Mancher hatte danach wochenlang nicht mehr auf seinem Land arbeiten können. Einer, der sich dennoch geweigert hatte, sich von seinem Besitz zu trennen, war zum Krüppel geschlagen worden und hatte sich schließlich das Leben genommen.
Während Pauline ihre Granita löffelte, begannen Gregorio und sein Onkel ein Gespräch. Unruhig wartete die junge Frau darauf, dass Gregorio von ihnen beiden zu reden begann, doch ihr Freund hatte offenbar anders entschieden. Zumindest erst mal sprach er über Alltägliches.
»Mein Neffe sagt, Sie seien gemeinsam spazieren gegangen?«, erkundigte sich Fabris jetzt bei ihr.
Pauline kämpfte gegen ein plötzliches Unwohlsein an. Ein Spaziergang … Klang das nicht verräterisch? Würde Signor Fabris seine Schlüsse ziehen? Sie schluckte.
»Gregorio hat mir einige hübsche Orte gezeigt, die sich zu malen lohnen würden«, antwortete sie vorsichtig und hoffte, dass nur ihr auffiel, wie ungewöhnlich rau ihre Stimme klang.
»Ach ja, stimmt, Sie malen ja. Lassen Sie mich Ihre Bilder doch einmal sehen, vielleicht finde ich ja Gefallen an einem.«
Fabris nahm Pauline nun fest in den Blick. Sein Lächeln wirkte freundlich und erreichte doch seine Augen nicht.
Niemals würde ich das zulassen. Ich verkaufe meine Bilder nicht an …
Die junge Frau konnte ihren Gedanken nicht beenden, denn Signor Fabris sprach schon weiter.
»Es wird Ihnen sicherlich einmal schwerfallen, einen Mann zu finden, Signorina Jordan. Natürlich habe ich gehört, dass Künstler ihren Neigungen nachgehen müssen. Es ist ihnen … was soll ich sagen … ein inneres Bedürfnis, ihre Ideen auf die Leinwand zu bringen. Sie können nicht anders, als sich in Bildern auszudrücken. Stimmt das, Signorina Jordan?«
»Ich …« Pauline fehlten die Worte.
Gregorio räusperte sich, als wollte er sich einmischen, doch noch bevor er etwas sagen konnte, fuhr Santino Fabris fort.
»Gregorio, geh bitte ins Haus und warte auf Signor Pasquale und seine Tochter. Sie haben sich für heute angekündigt. Signorina Jordan, ich muss mich leider auch zurückziehen, die Arbeit wartet. Ich hoffe, Sie bald wieder bei uns zu sehen. Und sagen Sie Ihrem Vater, dass ich wirklich gespannt auf neue Ware bin.«
Pauline nickte und stand auf. »Ich werde es ihm ausrichten.«
Gregorio erhob sich ebenfalls und kam um den Tisch herum. Er zögerte einen Moment lang, doch als sein Onkel ihm einen eindringlichen Blick zuwarf, nickte er Pauline nur zum Abschied zu und verschwand dann in Richtung Haus.
Signor Fabris wandte sich wieder an Pauline. »Bleiben Sie ruhig noch. Genießen Sie den Ausblick und Ihre Granita.«
Pauline schüttelte den Kopf. »Es ist spät«, sagte sie. »Mein Vater wartet sicherlich schon auf mich. Ich habe wohl ein wenig die Zeit vergessen.«
Die Granita würde ihr jetzt ohnehin nicht mehr schmecken.
Pauline fand ihren Vater hinter der Verkaufstheke in seinem Kunst- und Antiquitätenladen, der sich direkt an die gemeinsame kleine Wohnung anschloss. Valentin bemerkte seine Tochter zuerst nicht, so sehr war er in Gedanken versunken. Als sie näher trat, erkannte sie die zierliche römische Statuette in seiner Hand, die er kürzlich erworben hatte, weil er, wie er ihr gestanden hatte, gleich Hals über Kopf in sie verliebt gewesen war. Auch jetzt wieder betrachtete er sie aufmerksam.
Pauline kannte diesen Blick nur zu gut. Es würde ihrem Vater wie immer schwerfallen, sich von diesem Exemplar zu trennen, dabei waren Einnahmen bitter nötig Sie lebten schon mehr als bescheiden – häufig genug war Schmalhans in letzter Zeit ihr Küchenmeister gewesen, weil Valentin nicht verkaufen wollte oder das Geld verspielte. Dabei hatte er ihr schon vor einiger Zeit fest versprochen, das Würfeln, Kartenspielen und Wetten sein zu lassen.
Die Spielsucht war es auch gewesen, die Vater und Tochter damals nach Süden getrieben hatte – fort aus Deutschland, durch die Schweiz und Italien bis nach Sizilien.
Ob wir wohl je wieder in die Heimat zurückkehren können?
Pauline nahm den Umhang von ihren Schultern und legte ihn sich über den Arm. Zwei Jahre waren seit der Flucht vergangen, und trotzdem sehnte sie sich bereits nach weniger heißen Sommern und kälteren Wintern mit Schnee und Eis. Hier in Messina, wo sie seit einem halben Jahr weilten, gab es gewiss keinen Winter wie zu Hause. Sie sehnte sich auch nach der vertrauten Sprache, nach den Freundinnen, nach der Unbeschwertheit, die ihr Leben einmal ausgemacht hatte, und die mit dem Tod der Mutter zu Ende gegangen war. Danach war nichts mehr gewesen wie zuvor – der Vater war kein fröhlicher Hallodri mehr, verteidigt von seiner vergötterten Frau, sondern nur noch ein für die Schwiegereltern verantwortungsloser Kerl, der die geliebte Tochter in den Tod getrieben hatte.
Pauline machte ein paar Schritte in den Raum hinein, und Valentin fuhr endlich aus seinen Gedanken hoch. Er legte die kleine Statue behutsam auf dem Tisch ab.
»Ach, Kleines, da bist du ja.« Er kam auf sie zu, nahm sie überschwänglich in den Arm, küsste sie auf beide Wangen wie immer, wenn er einen guten Kauf getan hatte. »Geht es dir gut, Töchterlein?«
Seine Augen, in der Farbe den ihren so ähnlich, funkelten, und Pauline erkannte nicht zum ersten Mal, was ihre zarte blonde Mutter zu diesem Mann mit dem kastanienbraunen Haar hingezogen hatte. Sie waren unterschiedlich gewesen wie zwei Seiten einer Medaille, wie Licht und Schatten, Feuer und Luft. Dass die Eltern sich dennoch oder gerade deshalb geliebt hatten, daran hatte nie ein Zweifel bestanden – ein Umstand, den die Großeltern mütterlicherseits nicht hatten erkennen wollen.
»Ja, es geht mir gut. Danke, Papa.« Pauline löste sich aus Valentins Umarmung. »Ich bringe nur rasch meinen Umhang hinein. Soll ich uns etwas zum Abendessen bereiten?«
»Tu das.« Valentin kehrte zur Verkaufstheke zurück, zog eine der Schubladen auf und nahm einige kleine Münzen heraus. »Ich habe einen Bärenhunger, wie ich gerade bemerke. Unsere Vorräte sind allerdings aufgebraucht. Würdest du uns rasch etwas holen?«
Pauline nickte und ließ das Geld in ihrer Rocktasche verschwinden, zog den Umhang wieder über und war schon an der Tür, als sie sich doch noch einmal umdrehte. Ihr Vater betrachtete die kleine Statue erneut mit großer Aufmerksamkeit. Pauline wurde mit einem Mal unerklärlich kalt.
Valentin fuhr fort, die neue Lieferung zu säubern, zu begutachten und zu verstauen. Bald merkte er, dass es zu dunkel geworden war, und er verfolgte durch das Fenster, wie die abendlichen Sonnenstrahlen die Gasse vor seinem Geschäft in glutrotes Licht tauchten. Oft geriet er um diese Tageszeit in eine wehmütige Stimmung. Dann dachte er an seine Schwiegereltern, die gut situierte Arztfamilie aus Koblenz, an seine Mutter, die immer versucht hatte, ihn zu schützen, und es irgendwann nicht mehr vermocht hatte, weil der Sohn jeden Kredit verspielte. Hatte er ihr, der ehrbaren Witwe, Schande gemacht? Ja vermutlich hatte er das …
Und Paulines Mutter, seine geliebte Hannah? Würde sie noch leben, wenn er nicht nur an sich gedacht hätte? Wie von selbst bewegte Valentin sich zu seinem Schreibtisch, öffnete eine Schublade und entnahm ihr seinen letzten Brief an sie, den Brief, der nur noch eine Tote erreicht hatte. Natürlich hatte er nicht ahnen können, dass sie so schnell sterben würde – Hannah hatte nie verlauten lassen, dass es ihr schlechter ging –, aber er warf sich heute noch vor, dass er nicht bei ihr gewesen war. Er war in Paris gewesen und hatte eine Glückssträhne am Spieltisch gehabt. Er war überzeugt, endlich seine Schulden begleichen und die Behandlung ihrer Lungenbeschwerden bezahlen zu können. Noch mitten in der Nacht hatte er ihr den Brief geschrieben: Alles wird gut, meine liebste Hannah, ich kann es nicht erwarten, Dir endlich in die Arme zu fallen.
Doch da war es schon zu spät gewesen. Ein Fieber hatte seine von der Krankheit ohnehin geschwächte Frau binnen Stunden dahingerafft. Bei seiner Rückkehr hatte er den Brief neben ihrem Totenbett gefunden, dort, wo seine Schwiegereltern ihn wie eine Anklage für ihn hinterlassen hatten. Am nächsten Tag hatten sie ihm eröffnet, dass sie vor Gericht durchsetzen würden, ihm den Umgang mit seiner Tochter zu verbieten, doch das hatte er nicht zulassen wollen. Kurz entschlossen war er mit Pauline geflohen, und er hatte nie den Eindruck gehabt, dass sie seine Entscheidung bedauerte. Doch er war sich nicht sicher, was sie zu seinen neuen Plänen sagen würde, wenn sie davon erfuhr …
Ein Klopfen an der Tür ließ Valentin zusammenfahren.
»Es ist offen!«, rief er, gespannt, wer zu dieser späten Stunde noch etwas kaufen wollte.
Der Mann, der nun den Laden betrat, jagte ihm einen Schreck durch die Glieder.
»Signor Tricomi!«, sagte Valentin dennoch freundlich. Was er dachte, sprach er nicht aus.
Ich muss dem Steinmetz sagen, dass er nie wieder herkommen soll.
Pauline umfasste die wenigen Münzen in ihrer Rocktasche fester. Jetzt über ein schmackhaftes Abendessen für sich und ihren Vater nachzudenken würde sie hoffentlich von den düsteren Gedanken über Signor Fabris abbringen. Außerdem hatte sie tatsächlich Hunger. Einen Moment dachte sie voller Wehmut an die reich gedeckten Sonntagstische bei den Großeltern. Damals hatte Pauline sich nicht vorstellen können, jemals Hunger zu leiden. Inzwischen hatte das Leben sie eines Besseren belehrt, und sie wusste, wie es sich anfühlte, wenn sich der Magen vor Hunger zusammenkrampfte.
Pauline erreichte ein Haus, vor dem ein alter Mann einen Tisch aufgestellt hatte, auf dem er Zitronen feilbot. Er schaute sie erwartungsvoll an, als sie ihren Schritt auch nur ein wenig verzögerte. Zitronen, das hatte Pauline sehr bald nach ihrer Ankunft gelernt, waren in Sizilien hochgeschätzte Heil- und Lebensmittel. Winter- und Sommerzitronen unterschieden sich in Form, Farbe, Aroma und Saftqualität, aber so gern sie dem alten Mann auch eine Freude gemacht hätte, Zitronen würden weder ihrem Vater noch ihr zum Abendbrot genügen. Im nächsten Laden erstand sie ein Brot, ein paar Eier, Tomaten, Oliven und einen halben Liter Ziegenmilch. Es würde kein warmes Essen geben, aber der Vater und sie würden auch nicht hungrig zu Bett gehen müssen.
Zweites Kapitel
Sie hatten sich das einfache, aber köstliche Essen am Abend zuvor schmecken lassen. Die Tomaten und die Oliven, im Süden gereift, schienen voller Sonne zu stecken. Irgendwann, nachdem sie beide gesättigt gewesen waren, hatte Valentin seine Gitarre geholt und am offenen Fenster sitzend gespielt. Pauline hatte dazu gesungen, ein Passant auf der Straße vor dem Haus war stehen geblieben und hatte mit eingestimmt. Eine Weile hatten sie gemeinsam musiziert.
Der Vater spielte selten Gitarre, doch wenn er es tat, war es wunderbar. Es erinnerte die junge Frau stets daran, wie er zuweilen abends an ihrem Bett gesessen und ihr Schlaflieder vorgesungen hatte. Manchmal sah sie die Eltern miteinander, sah, wie der Vater einen Arm um die zarte Mutter legte und sie voller Liebe ansah. Oft, wenn die Eltern geglaubt hatten, sie schliefe schon, hatten sie sich sogar geküsst. Ganz innige Küsse waren es gewesen, voller Liebe und Zuneigung.
Irgendwo begann jetzt vor dem Fenster ein Vogel zu zwitschern, doch Pauline wollte die Augen noch nicht öffnen. Zu wohlig war das Gefühl, im Bett zu liegen, wo es warm war und man sich seinen Träumen hingeben konnte. Pauline genoss den Moment, wenn sie in der Schwebe zwischen Schlafen und Erwachen dem Leben draußen lauschen konnte. Sie hatte gut geschlafen. Der erste Gedanke gleich nach dem Aufwachen galt wie jeden Morgen Gregorio. Auch mit geschlossenen Augen sah sie ihn vor sich, sein hübsches Gesicht, die dunklen Haare und Augen. Mit geschlossenen Augen fiel es ihr leicht, sich vorzustellen, wie sie seine warme Haut berührte, sich an ihn schmiegte. Paolina nannte er sie oft, Paolina … Das klang viel hübscher als Pauline. Als sie daran dachte, Gregorio zu küssen, wurde es Pauline warm. Sie atmete schneller, konnte und wollte das Bild nicht loslassen. Irgendwann würde es so weit sein. Wenn sie heirateten, würden sie sich ganz nah sein. Pauline errötete bei manchen der Gedanken an Gregorio, doch sie waren zu schön, um davon abzulassen: Gregorio zu küssen, seine Hände auf sich zu spüren, zart wie ein Windhauch auf der Haut, seinen Duft in sich aufzunehmen, ihn einfach nur anzusehen, allein die Vorstellung raubte ihr den Verstand.
Dem Vogel, der vor ihrem Fenster sang, gesellten sich andere hinzu. Die Nacht war vorüber, der Tag brach unerbittlich an. Obgleich es noch früh am Morgen war, wie Pauline der Stand der Sonne verriet, nachdem sie die Augen geöffnet hatte, entschied sie sich jetzt doch aufzustehen. Sehr leise erhob sie sich, um den Vater nicht zu wecken, der in einer Kammer schlief, die lediglich durch eine dünne Bretterwand von ihrer getrennt war. Pauline überlegte, Brot für das Frühstück zu kaufen und sich weiter den schönen Gedanken an Gregorio hinzugeben. Wenn sie zurückkam, war der Vater gewiss auch aufgestanden, und sie konnten gemeinsam den Tag beginnen.
Valentin blieb an diesem Morgen noch einen Moment länger in seinem Bett liegen und starrte gegen die dunklen Holzbalken der Decke. Obgleich Pauline sich bemüht hatte, ganz leise zu sein, war es ihr doch nicht gelungen. Vielleicht war es aber auch so, dass es da ein unsichtbares Band gab, das ihn mit seiner Tochter vereinte, ein Band, das er gewiss nie missen wollte.
Valentin stieß einen Seufzer aus und ließ die Beine unter der Bettdecke hervorgleiten. Kurz schauderte er – innerhalb der dicken Mauern des Hauses war es früh am Morgen noch kühl –, dann setzte er die nackten Füße auf den Boden und stand kurz entschlossen auf. Er gähnte, während er auf das Fenster zutappte und den hölzernen Laden aufstieß, der quietschend gegen die Hausmauer schlug.
Vom Meer her strichen die ersten Sonnenstrahlen über die Stadt und tauchten sie in ein warmes gelbes Licht. Im Hafen warteten Tagelöhner auf Arbeit, Fischer sortierten ihren Fang. Einer begutachtete sein Netz, an dem es offenbar etwas zu flicken gab.
Valentin reckte und streckte sich ausgiebig und schlüpfte dann rasch in die Kleidung, die er am Abend zuvor auf den Stuhl, der neben seinem Bett stand, gelegt hatte, wusch sich Gesicht und Nacken und kämmte sich die Haare. Auf dem Weg in den Laden warf er einen kurzen Blick in die Küche, doch es fand sich wieder einmal nichts Essbares dort.
Er war nicht überrascht. Sie lebten in den letzten Tagen nicht zum ersten Mal von der Hand in den Mund, und natürlich war Pauline eben erst zum Einkauf aufgebrochen. Valentin schenkte sich einen Becher Wasser ein, trank und spülte damit den pelzigen Geschmack aus seinem Mund. Dann ging er in das Geschäft hinüber, das er erst in ein paar Stunden öffnen würde. Am frühen Morgen kamen ohnehin keine Kunden.
Valentin fröstelte, während er seinen Platz hinter der Verkaufstheke einnahm und die Schublade unter der Kasse öffnete. Er starrte die beiden identischen Figürchen stumm an. Tricomi, der Steinmetz, hatte wirklich ganze Arbeit geleistet. Die kleinen Statuen waren auf den ersten Blick nicht zu unterscheiden. Valentin nahm eine in die Hand und musterte sie noch einmal eingehend. Doch, er war sicher, dass nur Eingeweihte den Unterschied erkennen würden. Signor Fabris würde ihn gewiss nicht bemerken. Er würde zahlen, und Valentin blieb einfach im Besitz dieses wunderbaren Kleinods.
Valentin legte die Kopie vorsichtig wieder zurück. Sobald er Signor Fabris die Fälschung verkaufte, würde er allerdings einen gefährlichen Weg beschreiten, auf dem es kein Zurück gab. Er wusste, wozu Signor Fabris fähig war, niemals durfte dieser von dem Betrug erfahren.
Sorgsam schob Valentin die Schublade wieder zu. Seine Hände zitterten. Mit einem tiefen Seufzer schloss er die Augen und atmete tief durch, um seine Nerven zu beruhigen. Noch war nichts geschehen, doch war er sich sicher, dass sich sein Leben sehr bald ändern würde.
Wenn er nur hätte erkennen können, auf welche Weise.
Nach dem gemeinsamen Frühstück mit ihrem Vater machte sich Pauline zu ihrem täglichen Spaziergang auf. Es war ihr bereits kurz nach ihrer Ankunft in Messina zur Gewohnheit geworden, mit ihren Malutensilien die Gegend zu erkunden. Darauf hatte sie sich schon gefreut, als sie früh am Morgen erwacht war. Zu malen bedeutete Entspannung und Erholung, das war schon so gewesen, als sie noch ein kleines Mädchen gewesen war und den Pinsel kaum hatte halten können. Und weil ihr Vater das wusste, kaufte er ihr die teuren Leinwände, auch wenn manches Abendessen dann karg ausfiel. Manchmal murrte ihr Vater allerdings, wenn sie so allein durch die Gegend stromerte, wie er es nannte, und betonte, dass sie eine junge Frau im heiratsfähigen Alter sei, der man solches nicht mehr zugestehen könne. Aber bisher hatte er ihr die Ausflüge auch nicht ausdrücklich untersagt.
Paulines Ziel war der nahe Messina gelegene Kapuzinerberg, von dem aus man einen guten Blick auf die Meerenge, die Stadt, ihren Hafen und die Küste genießen konnte. Im Rhythmus ihrer Schritte schlugen Farben und Leinwand in dem selbst genähten Stoffbeutel gegen ihren Rücken. Es war immer noch recht früh am Morgen, und Pauline fröstelte, während sie die Straße entlangschritt. Sie war froh, in letzter Minute doch noch nach ihrem Umhang gegriffen zu haben.
Heute war sie allein – Gregorio war im Auftrag seines Onkels unterwegs; wenn sie es richtig verstanden hatte, ging es um die Pflege alter Beziehungen –, und sie hing deshalb mehr als sonst ihren Gedanken nach. Immer noch waren nur wenige Leute unterwegs. Bauern brachten ihr Gemüse und ihre Milch in die Stadt, Mägde kauften für ihre Herrschaften ein. Die Fischer im Hafen boten wie jeden Tag ihren Fang an.
Zum Stadtrand hin schritt Pauline energischer aus, und ihr wurde etwas wärmer. Als der Aufstieg begann, ließ sie den Umhang über der Brust auseinandergleiten. Sie fror nicht mehr. Eine Weile konzentrierte sie sich nur darauf zu gehen. Endlich, als sie den höchsten Punkt fast erreicht hatte, blieb sie stehen und sah aufs Meer.
Wie immer musste sie bei diesem Anblick an den Tag ihrer Ankunft in Messina zurückdenken. Die Stadt hatte damals im schönsten Sonnenglanz dagelegen und den Vater und sie freundlich empfangen. Noch vom Schiff aus hatte Valentin seine Tochter auf die herrlichen Quallenschwärme aufmerksam gemacht. Die Medusen waren wie Fabelwesen durchs Wasser geschwebt. Wenig später war ein Schmetterling auf dem Ärmel ihrer Bluse gelandet, ein untrügliches Zeichen des sich nahenden Landes.
Aufmerksam hatte Pauline die Palazzata in Hafennähe betrachtet. Die Stadt dahinter sah aus, als lehnte sie sich an die aufgetürmte Hügelreihe, auf deren zwei Spitzen die beiden die Stadt beherrschenden Forts Gonzaga und Castellaccio thronten. Hinter diesen wiederum stiegen die höheren Gebirge der sizilianischen Nordostküste auf, von denen es hieß, sie seien im Winter mit Schnee bedeckt.
Im hinteren, dem höchsten Teil der Stadt, das erfuhren Pauline und ihr Vater in den ersten Wochen in Messina, lag San Gregorio, ein von prächtigen Orangengärten umgebenes Kloster. Auf der Mitte der Landzunge, zu der Paulines Blick jetzt wanderte, ragte der Leuchtturm auf, gegenüber befand sich die Quarantäneanstalt und am Ende der Landzunge das Fort Salvatore.
An Bord des Schiffes waren sie damals dem Besitzer eines Hotels begegnet, auch er war ein Deutscher, der sie bis an Land begleitet hatte. An seiner Seite waren sie von den üblichen Zollschikanen verschont geblieben. Valentin hatte sich als trauernder Witwer nebst Tochter vorgestellt, was ja nicht mal der Unwahrheit entsprach, und so hatte der Mann ihnen ein günstiges kleines Dachkämmerchen vermietet.
Das Hotel du Nord – von hier oben konnte Pauline das Dach des Gebäudes erkennen – lag unmittelbar am Hafen und hatte einen gleichfalls sehr freundlichen Eindruck gemacht. Es war eines der Häuser der Palazzata, wie die stattliche Reihe gleich hoher, imposanter, durch Säulen gestützter Prachthäuser hieß, die sich wie ein einziger großer Palast am westlichen Kai des Hafens entlangzog. Dass nicht nur der Besitzer des Hotels, sondern auch die Angestellten Deutsche waren, hatte die ersten Tage sehr erleichtert, denn des Italienischen oder besser des Sizilianischen waren Vater und Tochter zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausreichend mächtig gewesen.
Vom Fenster ihres Dachkämmerchens aus hatte man eine herrliche Aussicht über den Hafen und die Meerenge weithin bis zur kalabrischen Küste gehabt. Dein Großvater, mein guter Schwiegervater, hatte Valentin damals einmal zu Pauline gesagt, wäre jetzt wohl sehr zufrieden mit mir. Wir leben sehr ökonomisch.
Zum Entsetzen der gesitteten Einwohner Messinas hatte der Vater fast jeden Morgen im Hafenbecken ein Bad genommen, etwas, was man auf Sizilien höchstens im Juli und August tat. Nach wenigen Wochen dann hatte Valentin verlauten lassen, dass er vor Ort mit Kunst und Antiquitäten zu handeln gedenke, und sich nach einem geeigneten Ladenlokal umgesehen. Gewundert hatte sich Pauline darob nicht, ihr Vater hatte sich stets für Schätze aus früherer Zeit, insbesondere der Antike, interessiert und war außerdem immer für eine Überraschung gut.
Ein Santino Fabris hatte Valentin Jordan schließlich Geschäft und Wohnung vermittelt. Und so hatte Pauline Gregorio kennengelernt.
Drittes Kapitel
»Du warst noch nie fort aus Messina, Gregorio? Noch nicht einmal mit deinem Onkel zusammen?«
Pauline hob erstaunt die Augenbrauen. Sie hatte Gregorio eine Weile nicht sehen können, denn sie und ihr Vater hatten eine Reise gemacht, die sie nach Palermo, der Hauptstadt Siziliens, geführt hatte. Signor Fabris hatte Valentin beauftragt, neue Kunstschätze zu suchen, und der Vater war erfolgreich gewesen.
Gregorio schüttelte nur den Kopf. Sie hatten sich im Schatten einiger Fässer zusammengekauert, wo man sie auf den ersten Blick nicht sehen konnte. Die eigentlich wenigen Tage, die sie einander nicht gesehen hatten, waren Pauline wie eine Ewigkeit vorgekommen. Für einen Moment wandte die junge Frau den Blick ab und schaute auf das Hafenbecken hinaus. Sie hatte es sich angewöhnt, kurz vor Sonnenuntergang noch ein wenig zum Kai hinunterzugehen, um sich dort am schwindenden Licht und dem beruhigenden Plätschern der Wellen zu erfreuen. Wann immer Gregorio Zeit hatte, trafen sie sich hier heimlich.
»Wie ist es denn in Palermo?«, fragte er jetzt und strich Pauline eine Haarsträhne aus dem erhitzten Gesicht.
Sie war gerannt, um schneller bei ihm zu sein und nicht zu viel der gemeinsamen Zeit zu vertun, denn plötzlich hatte sie das Gefühl überkommen, ihnen bliebe vielleicht nicht mehr so viel davon.
Pauline sah Gregorio wieder an, während sie gleichzeitig darüber nachsann, was sie von der Reise erzählen sollte, die ihren Vater und sie in die Stadt an der Nordküste geführt hatte.
»Es ist herrlich«, setzte sie endlich, noch etwas unschlüssig, an. »Ich habe ja schon einiges gesehen, seit Vater und ich Deutschland verlassen haben, das weißt du«, sie bemerkte, dass Gregorio geradezu an ihren Lippen hing und fühlte sich gleich sicherer, »aber Palermo liegt gewiss an einer der schönsten Küsten. Auch die Umgebung ist atemberaubend: das Kap Zafferano, der Monte Pellegrino … Mein Vater nennt ihn übrigens den beeindruckendsten Berg der Erde.«
Gregorio nickte nachdenklich. Wieder spürte sie seine Hand warm und rau und sehr flüchtig an ihrem Gesicht. Hier am Hafen gab es einfach zu viele Zeugen, was, wenn Pauline ehrlich war, auch einen gewissen Reiz ausmachte.
»Das hört sich wirklich wunderbar an«, sagte der junge Sizilianer jetzt. Dann seufzte er. »Ich würde das alles auch so gern sehen. Messina ist schön, sehr lebendig, aber es gibt doch so viel mehr kennenzulernen …«
»Und wenn du deinen Onkel einfach einmal begleitest?«, fragte Pauline und runzelte die Stirn.
Gregorio löste den Blick von ihr und schaute in die Ferne. »Ich glaube nicht, dass er das möchte«, sagte er langsam.
»Aber er kann doch nicht einfach vollkommen über dich bestimmen«, platzte es aus Pauline heraus. Sie hielt kurz inne. »Du bist jetzt ein Mann«, ergänzte sie dann leise.
Gregorio hob die Schultern, gab aber keine Antwort.
»Und das?«, fragte er nach einer Weile und deutete auf die kleine Zeichnung, die sie während der Reise angefertigt und ihm mitgebracht hatte. »Was stellt das dar?«
Pauline betrachtete das Blatt und versank in Erinnerungen. »Die Normannenburg König Rogers«, sagte sie schließlich.
Sie hatte die gemeinsame Reise mit ihrem Vater, auf der es ihnen an nichts gemangelt hatte, wirklich sehr genossen. Zum ersten Mal seit Langem hatte sie das Gefühl gehabt, Valentin wieder näherzukommen. Das Vertrauen, dessen Verlust sie erst auf der Reise bemerkt hatte, war zurückgekehrt. Er war wieder ein richtiger Vater für sie gewesen. Sie hatten den Tropengarten der Fürstin Butera besucht, den Monte Pellegrino mit der Conca d’oro, den normannischen Prachtdom von Monreale. Valentin war so entspannt gewesen wie schon lange nicht mehr seit ihrem überstürzten Aufbruch von zu Hause. Sie hatten zwar nicht über den Tod ihrer Mutter gesprochen, was sich Pauline so sehr wünschte, aber sie hatte den Eindruck gehabt, dass es nicht mehr lange dauern würde, bis der Vater so weit war. Der Rückweg hatte sie durch das Inselinnere geführt, das Pauline, anders als das Küstengebiet, außerordentlich wüst und öde, zum Teil sogar sehr langweilig vorgekommen war. Nur aus kahlen Hügeln und Schwefelminen bestand es, aber so hatte es Santino Fabris’ Auftrag eben gewollt. Der Vater träumte nun davon, auch noch Syrakus und Taormina zu besuchen, vorerst schien diese Möglichkeit jedoch in weiter Ferne zu liegen. Zuerst musste wieder einmal eine neue Lieferung an Plastiken für Signor Fabris abgeliefert werden.
Valentin hatte getrunken, als Pauline an diesem Abend nach Hause kam. Das tat er in letzter Zeit öfter, wenn er Heimweh hatte, und Pauline verspürte nicht zum ersten Mal einen schmerzhaften Stich. Der Vater lallte kaum merklich, als er sie begrüßte, inzwischen vertrug er einiges mehr an Alkohol. Sie versuchte, sich nichts anmerken zu lassen, wusste ohnehin nicht, wie sie mit dem Vater, wenn er in diesem Zustand war, umgehen sollte. Sie mochte es überhaupt nicht, wenn er betrunken war.
»Guten Abend, Papa!«, sagte Pauline also ruhig, während sie die Verschnürung ihres Umhangs aufnestelte.
Sie bemerkte, wie Valentin versuchte, sich von seinem Platz zu erheben, es dann aber doch unterließ. Er unterdrückte einen Rülpser, fuhr mit den Fingerspitzen über die kleinen Skulpturen, die vor ihm auf dem Küchentisch lagen. Manche erschienen Pauline auf den ersten Blick recht ähnlich, aber warum sollten sie sich auch nicht ähneln? Sie stellten ja alle Götter und Kaiser und was auch immer dar. Pauline betrachtete sie also nicht näher. Skulpturen waren ihres Vaters und Signor Fabris’ Steckenpferd, vielleicht hatte sie aus diesem Grund das Bedürfnis, sich von ihnen fernzuhalten. Signor Fabris war ihr, wenn sie ehrlich war, einfach unheimlich.
Valentin stand auf, ging in den Laden und verstaute die kleinen Kostbarkeiten in der Schublade unter der Kasse. Als er zurückkam, setzte er sich wieder und räusperte sich.
»Weißt du überhaupt, Liebes, was diese Reise in mir ausgelöst hat? Gewiss haben wir wunderbare Dinge gesehen, aber das hat in mir doch nur meine Liebe zu unserem unvergleichlichen Vaterland gestärkt. Dort gibt es vielleicht keine Lorbeeren, keine Myrten, keine Palmen und Pinien. Keine Opuntien und Agaven wachsen an unserem schönen Rhein, über den sich auch kein ewig blauer Himmel spannt. Wir kennen auch kein unsäglich dunkelblaues Meer, aber wir haben doch den unersetzlich grünen Wald, das frische Moos darinnen und die sprudelnden Quellen, die zwitschernden Vögel, den unvergleichlich herrlichen Wechsel der Jahreszeiten … Das alles fehlt hier. Und sag, ist es nicht ein trauriges Land? Ach, ich hätte wirklich nicht gedacht, dass mir der Sommer einmal so unerträglich sein könnte …«
Valentin suchte nach Paulines Blick und wies, als die Tochter nicht reagieren wollte, auf einen Brief, den Pauline jetzt erst bemerkte. Sie erkannte die Schrift ihres Vaters und die Adresse ihrer Großeltern. Das Schreiben war offenbar ungelesen zurückgeschickt worden.
»Zwölf Tage hin und zurück«, sagte er mit mehr Ruhe, als sie erwartet hatte. »Mit dem Expressdampfer.«
Bei den letzten Worten bebte seine Stimme. Einen Augenblick sagte er weiter nichts, dann räusperte er sich erneut. »Weißt du, Kind, wie sehnsuchtsvoll ich manchmal den luftigen Wolken nachschaue, die dem lieben Norden zueilen? Und als ich heute am Hafen war, da habe ich diesem englischen Dampfer nachgesehen, der aufs Meer hinausfuhr, und wäre so gern an Bord gewesen. Ach, Pauline, wie willens wäre ich, jetzt nach Hause zu fahren, mich meinem Schwiegervater zu Füßen zu werfen und meine Mutter zu fragen, ob es ihr gut geht!« Er ließ den Kopf unvermittelt auf die verschränkten Arme fallen.
Pauline wartete einen Moment, ob Valentin noch etwas sagen würde, doch er schwieg.
»Papa?«, fragte sie schließlich.
Valentin hob nur eine Hand. »Lass mich allein«, hörte sie ihn dann sagen. »Lass mich … lass mich einfach allein.«
Am nächsten Morgen hatte Valentin das Bett noch vor der Tochter verlassen. Er kehrte gerade von seinem Bad zurück, als Pauline in die Küche kam. Hemd und Hose waren feucht, von seinem kräftigen, störrischen Haar tropfte Wasser auf seine Schultern herab. Im Arm hielt er ein frisches, duftendes Brot, ein Paket Kaffeebohnen und Eier. Als wäre am Abend zuvor nichts geschehen, grüßte er seine Tochter überschwänglich mit Küssen auf die Wangen, bevor er sich an den Herd stellte und sich daranmachte, das Frühstück zu bereiten. Er wirkte entspannt und geradezu beschwingt. Die Ruhe ihres Vaters ließ es zu, dass auch Pauline das gemeinsame Essen genoss.
Nein, an diesem Morgen war sie sich sicher, dass die Gedanken, die ihr am Abend zuvor das Einschlafen erschwert hatten, unnötig gewesen waren. Ihr Vater war ein guter Mann. Er hatte seine Fehler, aber er war ein guter Mann, der niemandem etwas Böses wollte. Sie hoffte sehr, dass die Eltern ihrer Mutter dies eines Tages verstehen und es Valentin und ihr ermöglichen würden, nach Hause zurückzukehren. Dann würde sie ihre Freundinnen wiedersehen und das Leben leben, das einmal vor ihr gelegen hatte, ein Leben, von dem sie gefürchtet hatte, es könnte zu langweilig werden. Wie dumm war sie gewesen …
Nach dem Frühstück zog Valentin sich sofort in den Laden zurück. Als Pauline ihn fragte, ob er ihr später einen Spaziergang mit Gregorio erlaube, stimmte er lächelnd und ohne Umschweife zu. Pauline war perplex, wie leicht er es ihr machte, begab sich dann jedoch rasch auf den Weg. Sicher hatte der Vater verstanden, dass er seiner Tochter trauen konnte. Vielleicht aber schämte er sich auch ein wenig wegen des vorhergehenden Abends.
Viertes Kapitel
Pauline hörte Gregorio dicht hinter sich atmen und spürte ihr Herz schneller schlagen. Sie war froh, dass der junge Sizilianer sie hinauf zur Fiumara San Michele begleitete, aber jetzt fiel es ihr auf einmal schwer, sich auf die schöne Umgebung zu besinnen und Motive auszuwählen, die sie malenswert fand. Immer wieder während des beschwerlichen Aufstiegs huschten ihre Gedanken fort.
Gregorio kletterte jetzt an ihr vorbei den steilen Abhang hoch, der dicht mit Eichengebüsch und Erdbeerbäumen zugewachsen war, und nahm dann ihre Hand, um sie zu sich hinaufzuziehen. Nicht zum ersten Mal durchlief es sie heiß und kalt. Gregorio hatte einen guten Charakter, er war so liebenswert. Die Frau, die ihn einmal heiraten würde, konnte sich wirklich glücklich schätzen.
Ich werde ihn nicht heiraten können.
Paulines Lippen zitterten unwillkürlich. Warum kam ihr dieser Gedanke ausgerechnet jetzt? Sie konnte doch nicht wissen, was die Zukunft brachte. Und hatten sie beide nicht schon über die Hochzeit geredet? Gregorio hatte sogar mit seinem Onkel sprechen wollen, sie hatte ihn allerdings gebeten, noch zu warten. Irgendwie verspürte sie zu viel Angst. Pauline presste die Lippen unwillkürlich aufeinander, froh, dass Gregorio den Blick just in diesem Moment auf die Stadt zu ihren Füßen richtete.
»Danke, dass ich dich begleiten durfte«, sagte er. »Danke, dass du mich überredet hast. Ich glaube, wir Einheimischen wissen viel zu wenig zu schätzen, in welchem Paradies wir hier leben.«
Er sah sie jetzt wieder an, und Pauline war mehr als erleichtert, die Beherrschung zurückerlangt zu haben. Gregorio lächelte zärtlich. Sie erwiderte sein Lächeln und ließ es dann zu, dass er sie näher zu sich hinzog.
Damit haben wir noch keine Grenze überschritten. Es ist alles gut.
Eine Weile genossen die beiden jungen Leute gemeinsam schweigend den Blick hinab auf Messina, das gegenüberliegende Kalabrien und die Meerenge, die von der Anhöhe aus wie ein mächtiger Strom aussah. Vom Fenster des Hotelzimmers aus hatte Pauline damals täglich die Dampfer in den Hafen einfahren sehen. In diesem Augenblick erst bemerkte sie, wie sehr sie den Anblick vermisste, seit sie in die Wohnung hinter dem Geschäft eingezogen waren.
»Es ist wunderschön«, pflichtete sie Gregorio bei.
Sie spürte, wie er ihre Hand drückte. Dann führte er sie zu einem größeren Stein hinüber, hieß sie, sich zu setzen, um kurze Zeit später mit ein paar der purpurroten, aromatischen Beeren des Erdbeerbaums zurückzukehren. Gregorio nahm eine der Früchte, und einen Moment lang schien es, als wollte er sie ihr geben, doch er zögerte, und dann bewegte Pauline ihr Gesicht wie von selbst auf seine Hand zu und ließ es zu, dass er ihr die Frucht in den Mund steckte. Seine Finger berührten ihre Lippen. Ihre Augen hielten sich aneinander fest. Ihre Gesichter rückten näher zueinander, und dann küssten sie sich – zuerst noch etwas ungeschickt, doch mit jedem Atemzug mutiger.
»Paolina, liebste Paolina …«, murmelte Gregorio.
Pauline verdrängte den Gedanken an Signor Fabris und an ihren Vater. Sie wollte gern ein gutes Kind sein, aber sie liebte Gregorio. Sie liebte ihn, und sie gehörten zusammen. Warum verstand sie das erst jetzt?
An diesem Abend befürchtete Pauline, der Vater werde ihr gewiss ansehen, was geschehen war, doch als sie nach Hause kam, war gerade eine neue Sendung Kunstschätze gekommen, und Valentin war noch damit beschäftigt, sie auszupacken. Ohne Umschweife setzte Pauline sich zu ihm und half ihm. Mit ruhiger Hand und einem Pinsel befreite sie die neu hereingekommene Ware von Staub und Erde. Der Vater tätschelte ihr die Schulter.
»Du machst das sehr gut, mein Mädchen, wirklich sehr gut.«
»Ist das neue Ware für Signor Fabris?«, erkundigte sie sich.
Valentin zögerte kurz, bevor er antwortete. »Ja, allerdings«, sagte er dann.
Nicht zum ersten Mal, wie Pauline jetzt bemerkte, hörte sie deutliches Bedauern in seiner Stimme. Sie streichelte über seine Hand. Ja, sie hatte inzwischen verstanden, dass er lieber andere Kunden hätte, solche, die auf ehrliche Art und Weise und mit sauberen Händen ihr Geld verdienten, aber was sollten sie tun? Von irgendetwas mussten sie beide leben. Auch der Vater wusste das.
Fünftes Kapitel
Als der Herbst begann, schlug das Wetter um. Sehr bald schon regnete es beständig, und Pauline bekam eine erste Vorstellung davon, wie das Leben im sizilianischen Winter sein würde. Sogar der Schiffsverkehr wurde vom anhaltend schlechten Wetter beeinträchtigt. Der Himmel war jetzt zumeist düster und wolkenverhangen. Das Meer erschien nicht mehr blau und glatt, sondern graugrün und aufgewühlt. Hin und wieder brauste ein wilder Sturm aus dem Norden heran. Die Gebirge rings um Messina hüllten sich in dichten Nebel.
Nach dem langen, heißen Sommer genoss es Pauline anfangs, sich richtig nass regnen zu lassen. Danach kam sie allerdings stets schlotternd nach Hause und musste sich in eine Decke gehüllt vor den Kamin kauern, um sich aufzuwärmen. Valentin schürte das Feuer mehrmals am Tag.
»Dass du mir nur nicht krank wirst«, murmelte er. »Ich brauche dich doch.«
Pauline genoss die Fürsorge ihres Vaters. Auch wenn das Wetter jetzt zunehmend schlechter wurde, setzte sie ihre Spaziergänge fort. Die täglichen Ausflüge blieben weiterhin die einzige Möglichkeit, mit Gregorio zusammen zu sein. Sie waren immer vorsichtig und achteten streng darauf, von niemandem gesehen zu werden.
An diesem Abend waren sie noch einmal zu einem ihrer liebsten Aussichtspunkte hinaufgestiegen. Sie hatten Glück, der Wind hatte die Wolken vertrieben, und es regnete ausnahmsweise nicht. Die kalabrische Küste schimmerte in einem wundervollen Blau. Pauline arbeitete an einem Aquarell, Gregorio saß neben ihr und sah ihr ruhig zu. Normalerweise mochte Pauline es nicht, beim Malen beobachtet zu werden. Bei Gregorio war das anders. Bei Gregorio war alles anders.
Das Farbenspiel der herrlichen Gebirgsumgebung Messinas, dachte Pauline unvermittelt, ist in dieser Jahreszeit noch beeindruckender als im Sommer. Sie seufzte, versuchte, die Farbenpracht auf die kleine Leinwand zu bannen, doch es wollte ihr einfach nicht gelingen. Unzufrieden runzelte sie die Stirn. Gregorio bemerkte ihre Unruhe, sagte aber nichts. Dass er wusste, wann es besser war zu schweigen, liebte sie an ihm. Nach einer Weile verstaute sie ihre Malutensilien mit einem weiteren tiefen Seufzer.
Nur wenig später ging der Mond auf und beleuchtete weithin mit seinem Licht die Küste. Gregorio und Pauline kauerten sich Arm in Arm nebeneinander und genossen die Nähe. Nach einer Weile löste Pauline sich aus Gregorios Umarmung, drehte sich zu ihm um und musterte sein geliebtes Gesicht in den Abendschatten. Gregorio zögerte nur einen Moment, dann beugte er sich vor und küsste sie zärtlich. Es war zu einer lieben Gewohnheit geworden.
In den nächsten Wochen wurde es kalt. Der Mont’aspero, der sich über eine Woche lang hinter Wolken und Nebel versteckt hatte, lag mit einem Mal im schönsten weißen Schneekleid da. Valentin und Pauline arbeiteten nun täglich gemeinsam im Laden.
Eines Morgens war der Vater wieder einmal besonders betrübt. Reglos stand er am Schaufenster und schaute gedankenversunken nach draußen auf das erwachende Leben Messinas. Knarrende Holzkarren rumpelten über das Straßenpflaster, Kinder riefen, Hunde bellten und sogar eine meckernde Ziege konnte man hören. Irgendwann wandte er sich wieder seiner Tochter zu. Der Ruf eines Vogels war zu hören, und ein Schatten huschte über Valentins Gesicht. Er räusperte sich.
»Weißt du, dass es mir heute umgekehrt geht wie den Zugvögeln, die der Beginn der dunkleren Jahreszeit instinktiv nach Süden treibt, Kind? Ich möchte jetzt jeden Tag mehr in den verschneiten Norden eilen, wo doch allein unsere wahre Heimat ist. Der Norden ist unsere Heimat. Ist es nicht so?«
Pauline biss sich auf die Lippen. Sie wusste nicht, wie sie reagieren sollte, wenn der Vater solcher Stimmung war, und es ärgerte sie auch, denn es war letztendlich doch seine Schuld, dass sie hier waren. Manchmal wollte sie ihm sagen, dass es Zeit war, dafür die Verantwortung zu übernehmen. Aber dann sah sie die Traurigkeit in seinem Blick, und sie konnte ihm die Wahrheit nicht kundtun. So half sie schweigend, eine neue Lieferung antiker Statuetten für den Verkauf fertig zu machen.
Ende Dezember jagte ein wilder Sturm regenschwere schwarze Wolken über die Gebirge, ließ jedoch am letzten Tag des alten Jahres nach, sodass Kalabriens Berge am Silvesterabend in purpurrotem Licht herüberstrahlten. Der Hafen Messinas war festlich geschmückt, die Seeleute herausgeputzt, die Schiffe am Kai bunt beflaggt. Die Ankunft des neuen Jahres wurde mit Salutschüssen gefeiert.
Pauline spazierte Arm in Arm mit ihrem Vater am Hafen entlang, sah den kleinen Booten zu, die das spiegelglatte Wasserbecken durchkreuzten, und genoss es, an der Seite eines solch stattlichen Mannes zu gehen, denn was immer sie auch von ihrem Vater und seinen Schwächen wusste – er war und blieb ein gut aussehender Mann.
Im nächsten Jahr werde ich nicht mehr hier sein, schoss es Pauline durch den Kopf, ohne dass sie sagen konnte, woher dieser Gedanke kam. Doch sie war sich ganz sicher.
Sechstes Kapitel
Ende Januar war es im Gegensatz zu der deutschen Heimat schon frühlingshaft warm, und man bekam einen ersten Vorgeschmack auf die wärmere Jahreszeit. Anfang Februar wurde Messinas größtes Kirchenfest gefeiert, mit dem man an das furchtbare Erdbeben erinnerte, das 1783 fast die ganze Stadt zerstört hatte und dessen Spuren noch teilweise sichtbar waren. Im Gewühl der Feiernden und Schaulustigen waren auch Pauline und Gregorio unterwegs. Sie versuchten, sich unter den Menschen, die sich um sie her tummelten, so unsichtbar wie möglich zu machen. Überall waren Stimmen zu hören; die unterschiedlichsten Sprachen vermischten sich miteinander. Reisende aus aller Herren Länder schienen anlässlich des Festes gekommen zu sein. Die Frauen beteten und bekreuzigten sich unablässig, während ihre Kinder vor Vergnügen laut kreischend Nachlaufen spielten. Die Männer standen in Gruppen zusammen und diskutierten mit ernsten Mienen miteinander.
Pauline nahm kurz verstohlen Gregorios Hand, während sie einige Reisende beobachtete, die sie bereits unten am Hafen als Deutsche ausgemacht hatte. Sie hätte ihnen zu gern ein wenig zugehört, hätte einiges dafür gegeben, einmal wieder die Muttersprache vernehmen zu können, doch sie war zu weit entfernt.
Gregorio, dem Paulines sehnsüchtiger Blick nicht entgangen war, zog sie im nächsten Moment schon übermütig in eine schmale Seitengasse. Auch hier vernahm man den Lärm des Festes, jedoch etwas gedämpfter, und sie hatten einen Augenblick für sich.
Er wies mit dem Kopf in Richtung Hafen.
»Kennst du sie?«
Pauline schüttelte den Kopf. »Nein.«
Solche, die sich den Ätna anschauen wollen, den Stromboli, antike Stätten, fügte sie stumm hinzu, solche, die auf den Pfaden Friedrichs II. wandeln wollen.
Gregorio runzelte die Stirn. Einerseits beneidete er die Reisenden, die man täglich am Hafen sah, um ihre Möglichkeit, ein Stück mehr von der Welt kennenzulernen, andererseits konnte er nicht nachvollziehen, warum man die Heimat freiwillig verlassen wollte …
Nun, jeder verlässt sie ja nicht ganz freiwillig …
Pauline beobachtete, wie Gregorio erneut zu den Deutschen hinüberspähte. Glücklich sah er aus und entspannt. Seine Locken hätten vielleicht einen neuen Schnitt verdient, aber es gefiel ihr, wie sie so ungebärdig um seinen Kopf standen, sicherlich berührten sie bald die Schultern. Ab und zu fing sich der Schein einer zu früh entzündeten Fackel in seinen dunklen Augen und gab seiner sonnengebräunten Haut einen rötlichen Schimmer.
»Es kommen immer mehr Deutsche nach Messina«, sagte Gregorio jetzt unvermittelt. »Fast kann man schon von einer Kolonie sprechen. Bald wirst du Deutschland gar nicht mehr vermissen …«
Er drehte sich wieder zu ihr und lachte sie an. Pauline lehnte sich an die Mauer, legte den Kopf etwas zurück gegen den harten Stein.
Würde das so sein? Würde sie Koblenz und den Rhein eines Tages nicht mehr vermissen? Ein Teil von ihr sehnte sich danach, mit diesen Deutschen zu sprechen, der andere wollte sich ihnen nicht offenbaren. Sie wollte nicht lügen, und das würde sie gewiss tun müssen, wenn sie diese Menschen auf sich aufmerksam machte.
Kurz schloss Pauline die Augen, nahm Gregorios vertrauten, so geliebten Duft wahr. Sie würde ihn nie wieder missen wollen. »Gregorio«, sagte sie und zupfte an seinem weißen Hemdsärmel. Zur Feier des Tages hatte er sich festlich angezogen.
Als sie die Augen wieder öffnete, näherte Gregorio sein Gesicht dem ihren. Pauline spürte, wie sie unruhig wurde, und wie sie sich doch zugleich nichts mehr wünschte, als von ihm geküsst zu werden, weil ihr seine Küsse die Angst nahmen und das Unbehagen und weil seine Küsse sie fühlen ließen, dass alles gut war.
Aber sollen wir es wagen, hier, wo uns jeder entdecken könnte, wo Santino Fabris sicherlich zahlreiche Augen und Ohren hat, um über alles Bescheid zu wissen?
Ja, und noch einmal ja, dachte Pauline, denn ich will nicht, dass Gregorios Onkel über mein Leben bestimmt.
Entschlossen trat sie einen kleinen Schritt vor und bog den Kopf in den Nacken. Gregorio verstand sie ohne Worte, küsste sie schnell und doch so zärtlich.
Ohne ein weiteres Wort nahmen sie einander bei den Händen und kehrten in die Menge zurück. Sie eilten an den Deutschen vorbei, tauchten in einer Gruppe junger Leute unter, die sich ans Wasser gesetzt hatten und sich immer wieder lachend nass spritzten. Auch Gregorio lachte, und Pauline freute sich daran. Wenig später löste er sich von ihr, nahm Anlauf und setzte elegant über drei Fässer hinweg, die am Kai standen und darauf warteten, von ihrem Besitzer abgeholt zu werden. Sie applaudierte ihm, und er nahm sie in die Arme und wirbelte sie durch die Luft. Pauline war so glücklich wie noch nie in ihrem Leben.
Sie sahen beide den Mann nicht, der sich hinter einem Fischstand verborgen hatte und sie nicht mehr aus den Augen ließ.
Als Gregorio Pauline nach Hause brachte, wartete Valentin offensichtlich schon auf sie, denn er öffnete die Tür, als die beiden jungen Leute noch nicht einmal geklopft hatten. Sie standen davor, unschlüssig, wie sie sich voneinander verabschieden sollten.
»Bringen Sie mir also meine Tochter doch noch zurück?«, sagte Valentin hart anstelle einer Begrüßung.
»Papa«, Pauline spürte, wie sie errötete, »es ist doch noch früh.«
Valentin schaute sie einen Moment an, dann zwang er ein Lächeln auf sein Gesicht und wandte sich Gregorio zu. »Sie verstehen sicher, dass ich meine Tochter gern bei mir weiß«, sagte er.
»Nur zu gut.«
Gregorio wagte es dennoch, Pauline einen kurzen, liebevollen Blick zuzuwerfen, verbeugte sich vor ihrem Vater und machte sich davon.
Pauline wusste, dass sie seinen letzten Kuss vermissen würde, bis sie an diesem Abend endlich eingeschlafen war.
Pauline war verwirrt, als ihr Vater sie früh am nächsten Morgen weckte. Ein Blick zum Fenster zeigte ihr, dass die Sonne kaum aufgegangen war und sich bislang nur als blass schimmerndes Farbenspiel von hellem Blau, Lila und Rosina zeigte. Valentin war bereits vollständig angezogen. Er trug einen Sonnenhut in der Hand und einen Proviantbeutel über der Schulter und lächelte sie an.
»Lass uns etwas hinausgehen«, sagte er, »wie früher. Heute Morgen werde ich ohnehin kein Geschäft machen. Die Menschen wollen nach dem Fest gestern ausschlafen, und das möchte ich nutzen, um ein wenig Zeit mit meiner lieben Tochter zu verbringen.«
Pauline schlüpfte unter der Decke hervor. Im Haus war es noch kühl, sodass sie sofort eine Gänsehaut bekam. Außerdem fühlte sie sich noch schläfrig, hatte sie doch am Abend zuvor lange gebraucht, bis sie zur Ruhe gekommen war.
Der Vater lief hinaus. Wenig später hörte sie ihn vor der Tür rumoren. »Bist du bald so weit?«
»Hm.«
Pauline gähnte. Tatsächlich war sie bereits in Unterwäsche und Kleidung geschlüpft, hatte die Strümpfe angezogen und beugte sich eben vor, um die festen Schuhe zu schnüren. Ihre Gedanken schweiften ab. Wie würde es mit Gregorio und ihr weitergehen? Wann würden sie ihre Liebe zueinander offenbaren müssen, und was würden die Folgen sein?
Als der Vater und sie das Haus verließen, berührten die ersten Sonnenstrahlen das Pflaster. Eine Frau trug einen Korb vom Hafen herauf, vielleicht hatte sie frischen Fisch für das Mittagsmahl gekauft.
Paulines und Valentins Weg führte sie zunächst ein Stück die Hauptstraße entlang. Wenig später würden hier Frauen mit ihrer Handstickerei vor den Haustüren sitzen und auf die aus den Bergdörfern kommenden Wagen mit frischer Ware warten – Gemüse, je nach Jahreszeit, Käse und Eingelegtes. Eine offen stehende Tür gewährte den Blick in einen schönen Innenhof, in dem gerade ein paar Ziegen gemolken wurden, deren frische Milch man sogleich kaufen konnte, wie einige wartende Frauen ihnen zuriefen. Pauline und ihr Vater beschlossen nach kurzem Zögern, sich eine Flasche füllen zu lassen.
Ohne sich abzusprechen, nahmen sie den steilen Weg hinauf zum Kloster San Gregorio, von dem aus man einen wunderbaren Ausblick hatte, ein Ort, den sie beide liebten. Danach ging es noch weiter den Berg hinauf. Während des anstrengenden Aufstiegs sprachen Vater und Tochter nur wenig miteinander. Pauline verlor sich in Gedanken an die Spaziergänge, die sie früher gemeinsam in der Heimat gemacht hatten, entlang des Rheins und hinauf zu verfallenen Burgen, wo der Vater ihr Geschichten von unglücklichen Frauen, holden Burgfräulein und mutigen Rittern erzählt hatte.