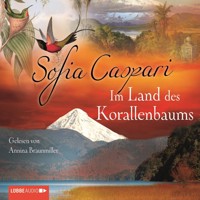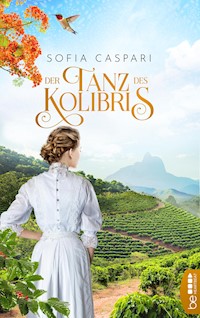4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: ARGENTINIEN-SAGA
- Sprache: Deutsch
In diesem Frauen-Roman entführt die Schriftstellerin Sofia Caspari den Leser in das Argentinien des 19. Jahrhunderts. Die historische Erzählung beginnt im Sommer 1863 mit einer Schiffsreise: Die jungen Deutschen Anna Weinbrenner und Viktoria Santos lernen sich auf der Überfahrt nach Buenos Aires kennen. Zwei Frauen in der Fremde Argentiniens Beide Frauen sind auf dem Weg zu ihren Ehemännern, diese sind bereits vorausgereist. Viktorias Mann haben dringende Geschäfte schon früher zu seiner Estancia im Norden Argentiniens geführt. Annas Familie hingegen konnte die Kosten für die gemeinsame Überfahrt nicht aufbringen. Trotz ihrer unterschiedlichen gesellschaftlichen Stellung freunden sich die Frauen an. In dem fernen Land, das für die Reisenden mit großen Hoffnungen und Träumen verbunden ist, trennen sich ihre Wege. Beide Frauen sind erst einmal auf sich allein gestellt. Doch Viktorias vermeintlich rosige Zukunft gestaltet sich anders als erhofft und Anna erwartet bei der Ankunft eine schreckliche Nachricht...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 845
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Zitate
Erster Teil
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Zweiter Teil
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Dritter Teil
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Vierter Teil
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Fünfter Teil
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Sechster Teil
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Siebter Teil
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Achter Teil
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neunter Teil
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Epilog
Danksagung
Über die Autorin
Sofia Caspari, geboren 1972, ist bereits mehrfach nach Mittel- und Südamerika gereist, wo auch ein Teil ihrer Verwandtschaft lebt. Längere Zeit verbrachte sie in Argentinien, dessen Menschen, Landschaften und Geschichte sie tief beeindruckt haben. Heute lebt sie – nach Stationen in Irland und Frankreich – mit ihrem Mann und ihrem Sohn in einem kleinen Dorf im Nahetal.
Sofia Caspari
IM LANDDESKORALLEN-BAUMS
Roman
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur
Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen.
Copyright © 2011 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Melanie Blank-Schröder
Textredaktion: Margit von Cossart, Bergisch Gladbach
Covergestaltung: Kirstin Osenau unter Verwendung von Motiven von © Shutterstock: Oleg Golovnev | Helen Hotson | Morphart Creations ; © akg-images/Universal Images Group ; © Ildiko Neer/Trevillion Images
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-8387-1053-2
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für Julian und Tobias,
Wie soll ich mich doch darein finden,
Das alles dann nicht mehr zu sehn?
Wie werd ich es noch überwinden,
Von Haus und Hof hinwegzugehn!
Hier zog ich ein, als wir uns freiten,
Und dachte: Dies ist nun mein Haus;
Hier bleib ich meinem Mann zuseiten,
Bis man mich trägt als Leich hinaus.
(Unbekannt, 1847)
Regieren heißt Bevölkern!
(Juan B. Alberdi, arg. Politiker, 1852)
In Amerika gibt es keine Fremden.
Bei uns ist das anders.
Erster TeilFerne Ufer
April 1863 bis März 1864
Erstes Kapitel
Dumpf schlug das Wasser gegen das Holz des Schiffsrumpfs. In einem Moment warf sich das Schiff in das Wellental hinab, dann erklomm es den nächsten Wellenkamm und ächzte dabei wie ein lebendiges Wesen. Am Vortag hatte der Wind gedreht, gegen Morgen war er heftiger geworden. Am Bugspriet stehend hielt Anna Weinbrenner sich mit aller Kraft fest. Gischt spritzte ihr ins Gesicht, während sie hinab in die blaue, schaumgekrönte Tiefe starrte.
Ich darf nicht loslassen, schoss es ihr durch den Kopf, ich darf nicht loslassen.
Bitterer Speichel drang ihre Kehle hinauf. Nicht zum ersten Mal auf dieser Reise war ihr zum Speien übel. Im nächsten Wellental wurde Anna mit Wucht gegen die Reling geschleudert. Schmerzhaft drückte sich das Holz gegen ihren Brustkorb und raubte ihr den Atem. Der Aufschrei blieb ihr in der Kehle stecken.
O nein, ich hätte niemals hier hinausgehen dürfen, nicht bei diesem Wetter.
Sie kannte die Anweisungen: Wenn ein Sturm drohte, hatten die Passagiere unter Deck zu bleiben!
Anna biss die Zähne aufeinander. Aber sie hatte den Gestank in den Quartieren des Zwischendecks, jenen wabernden Dunst nach Schweiß, ungewaschenen Körpern, verdorbenen Nahrungsmitteln, Erbrochenem und Kot, der sich bei schweren Wettern noch verstärkte, einfach nicht mehr ausgehalten. Und draußen im aufkommenden Sturm, der einem nach Tagen der Flaute eher willkommen war, hatte sie dann die Schönheit des Augenblicks gebannt: die tanzenden, schimmernden Wellen, die sich noch nicht allzu hoch getürmt hatten, wie mit Abertausenden von Schaumsternen gekrönt.
Anna schüttelte sich. Längst war sie vollkommen durchnässt. Wieder musste sie den Würgereiz bezwingen. Niemals hatte sie sich vorstellen können, dass das Wetter so schnell umschlagen würde. Sie war doch eben erst an Deck gekommen, entschlossen, frischen Atem zu schnappen und der Enge des Schiffsbauchs zumindest kurz zu entkommen. Nun hatte sie den rechten Augenblick versäumt, um aus eigener Kraft zurückzugelangen.
Wieder stürzte das Schiff in ein Wellental, wieder erklomm es den nächsten Kamm und fiel mit umso größerer Macht hinab. Wenn nicht bald jemand kam und ihr half, dann konnte ihr nur noch Gott helfen.
Anna starrte ihre Hände an, die Fingerknöchel zeichneten sich weiß ab, so sehr klammerte sie sich an ihrem Halt fest. Kräftige, arbeitsame Hände waren es, und doch nicht stark genug, um sie zu retten. Eine neue Welle durchnässte ihren Rock, doch kein Angstschrei kam mehr über Annas Lippen. Der Schweiß, den ihr die Anstrengung auf die Stirn getrieben hatte, mischte sich mit dem Salzwasser. Die Windböen trieben ihr die Tränen in die Augen. Mühsam hob Anna den Kopf und versuchte zum Horizont zu schauen, aber sie konnte einfach keine Grenze mehr ausmachen zwischen Himmel und Erde.
Hatte es eben geblitzt? Gleich ließ sie ein Donnerschlag zusammenfahren. Noch einmal blitzte und donnerte es. Dann, von einem Moment auf den anderen, schüttete es wie aus Eimern.
Ich habe Angst, dachte Anna, ich habe so furchtbare Angst. Mit jedem Atemzug zitterten ihre Beine mehr. Die Menschen, die ihr nahestanden, kamen ihr mit einem Mal in den Sinn, ihre Arbeitgeberin, Frau Bethge, ihre beste Freundin Gustl. Alle hatten sie sie vor dieser Reise gewarnt.
Eine neue Welle warf sie nach vorn. Dieses Mal schrie Anna doch. Wenn ich über Bord gehe, schoss es ihr durch den Kopf, werde ich auf immer fort sein. Ich bin allein, niemand wird mich auf diesem Schiff vermissen. Wie lange wird meine Kraft noch reichen?
»Hilfe!«, schrie sie, »Hilfe, so helft mir doch!«
Doch der heulende Sturm schluckte ihre Worte. Ganz fern, über das Brausen des Windes hinweg, hörte sie eine Glocke, dann Stimmen, kaum wahrnehmbar. Annas Arme zitterten. Ich werde über Bord geschleudert werden, durchfuhr es sie mit schmerzhafter Gewissheit, ich werde meine Familie niemals mehr wiedersehen. Ich werde sterben.
Aber ich will nicht sterben.
Anna öffnete den Mund, um nochmals zu schreien. Mit neuer Wucht prallte sie gegen die Bordwand. In kurzer Folge stürzte das Schiff nun herab und erhob sich wieder, neigte sich knarrend mal zur einen, mal zur anderen Seite.
»Hilfe!«
Der Sturm schluckte ihren Schrei einfach. Nichts, man hörte sie einfach nicht. Annas Lippen bebten. Tränen quollen aus ihren Augen. Lieber Gott, hilf mir, betete sie stumm, ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben.
Als das Schiff ins nächste Wellental hinabstürzte, konnte Anna sich nicht mehr halten. Sie wurde gegen die Bordwand geschleudert, dann verlor sie den schwankenden Boden unter ihren Füßen. Während sich das Schiff erneut zur Seite neigte, rutschte Anna über das Deck. Sie wollte die Augen schließen, doch sie konnte es nicht. Unter ihr wartete nur noch die Tiefe des Atlantiks. Wild hämmerte das Herz in ihrer Brust. Als sie dieses Mal zu schreien versuchte, kam nur ein Krächzen hervor.
Jetzt kann ich noch nicht einmal mehr auf mich aufmerksam machen, dachte sie, jetzt werde ich sterben.
Doch dann bäumte sich etwas in ihr auf. Nein, sie wollte nicht sterben. Anna nahm alle Kraft zusammen – und dann schrie sie noch einmal aus voller Kehle.
»Hilfe, Hilfe, so helft mir doch!«
»Himmel, Herrschaftszeiten, was haben Sie sich nur dabei gedacht?«
Die fremde Stimme war das Erste, was Anna wahrnahm, das Nächste war das Schwanken einer Lichtquelle rechts von ihr. Sie kniff die Augen zusammen, schluckte mühsam. Der Geschmack in ihrer Mundhöhle war bitter-säuerlich, doch die schlimmste Übelkeit war vorüber. Instinktiv fuhr sie sich mit dem Handrücken über die Lippen.
Ich bin nicht tot. Ganz offenbar bin ich nicht tot. Aber wo bin ich?
Anna fühlte feines Leinen unter ihren Fingerspitzen. Sie lag also nicht auf ihrem Lager mit der groben Decke, die sie schon am ersten Tag mühsam mit Meerwasser zu reinigen versucht hatte und die seitdem feucht und salzverklebt war, jedoch weiterhin stank; nicht mehr so bestialisch wie am Anfang zwar, aber doch immerhin. Nein, diese Bettwäsche hier duftete sogar. Ihr Kleid dagegen haftete feucht an ihrem Körper. Sie fühlte sich so schrecklich schwach.
»Und?«, war erneut die fremde Stimme zu hören. Eine Männerstimme.
Anna drehte den Kopf in die Richtung, sah, geblendet vom Licht einer Öllampe, eine große dunkle Gestalt vor sich aufragen.
In welche Lage hatte sie sich nun nur wieder gebracht? Wo war sie, um Himmels willen?
Annas Unbehagen nahm zu. Verstohlen blickte sie sich um. Offenbar befand sie sich in einer der Kajüten der besser gestellten Reisenden.
Was mache ich hier? Wie bin ich hierhergekommen, und warum bin ich nicht achtsamer gewesen?, fragte sie sich. Weil es da unten im Quartier stinkt wie in der Hölle, gab sie sich gleich selbst die Antwort. Sie versuchte, mehr von dem Mann zu erkennen, doch das Licht blendete sie.
Ich muss aufstehen, durchfuhr es Anna, ich muss von hier fort. Bedank dich und geh wieder nach unten. Sie versuchte, sich aufzurichten, die Beine über den Bettrand zu schieben, um sich zu erheben, doch sie geriet sogleich ins Schwanken.
»Langsam, langsam«, ließ sich der Fremde hören. »Sie waren ohnmächtig. Sie müssen sich schonen.«
Unfug, sagte eine Stimme in Annas Kopf, ich habe mich noch nie schonen können. Sie richtete sich mit aller Kraft auf und hielt sich am Bettrahmen fest. Die Stimme des Mannes klang kultiviert. Er sprach seine Worte mit Bedacht aus, so wie Frau Bethge und ihre Familie es taten.
»Ich bin sicherlich keine der Damen, mit denen Sie gewöhnlich zu tun haben«, tat sie kund.
»So, sind Sie das nicht?« Der Mann klang belustigt.
Anna wollte etwas entgegnen, musste aber innehalten, weil sich mit einem Mal alles drehte. Auch die Bewegungen des Schiffes nahm sie stärker wahr als sonst. Sie biss sich auf die Unterlippe.
»Setzen Sie sich doch wieder, bitte.« Der fremde Mann trat endlich ins Licht, streckte ihr eine Hand entgegen. Jung, dunkle Haare, registrierte Anna in dem Moment, als er auf sie zukam, eine hochgewachsene, eher zu schlanke Gestalt. »Setzen Sie sich«, wiederholte er. »Ich bitte Sie darum.«
Anna fühlte, wie sie auf einen gepolsterten Hocker gedrückt wurde. Der Mann nahm eine Teekanne vom Tisch. Im nächsten Augenblick hielt sie eine feine Porzellantasse in der Hand. Stumm starrte sie in die blass goldfarbene Flüssigkeit darin.
»Tee«, sagte der Mann, als er ihre Verwirrung wahrnahm, und setzte sich nunmehr selbst auf den Bettrand.
Anna starrte ihn an. Er lächelte. Seine Kleidung war hochwertig, wenn er sie auch mit einer gewissen Nachlässigkeit trug, als lege er keinen Wert darauf. Sein leicht gelocktes Haar war seitlich gescheitelt. Eine widerspenstige Strähne war ihm in die Stirn gefallen.
»Aber …« Anna holte tief Luft. »Ich kenne Sie«, platzte sie dann heraus. »Ich kenne Sie!«
Der junge Mann zögerte eine Augenblick. »Wirklich?«, entgegnete er dann.
Bremerhaven, einige Wochen zuvor
Der dunkelhaarige junge Mann fiel Anna auf, weil er mit dem Rücken zum Land stand und aufs offene Meer schaute. Während die anderen Passagiere zum Hafen sahen, um einen letzten Blick auf ihre Heimat und ihre Lieben, die ihnen zuwinkten, zu erhaschen, Arme und Reiche Seite an Seite, hielt er sich fern von allen.
Wahrscheinlich, dachte Anna im ersten Moment, ist er mir nur aufgefallen, weil ich auch niemanden habe, dem ich Adieu winken kann.
Zwei Tage zuvor war sie mit der Eisenbahn gekommen, die Bremen und Bremerhaven seit dem letzten Jahr miteinander verband, und dann hatte sie erstmals vor dem Schiff gestanden, auf dem sie die nächsten Wochen verbringen sollte, einerseits froh, andererseits von Angst erfüllt. Da es die Ebbe abzuwarten galt, hatte sie die Zeit genutzt, ihre Vorräte nochmals zu kontrollieren und so gut als möglich aufzustocken. Sie hatte sich eine Seegrasmatratze besorgt und Blechgeschirr, bevor sie zu den Wartenden zurückgekehrt war. Eine einsame Harfenistin hatte sich da unter die Auswanderer gesellt, und die mutigeren Reisenden zu einem Tänzchen verführt, während die Verzagten, bleich und ohne sich zu regen, inmitten ihrer Habe gesessen hatten.
Kurz wurde Annas Blick starr. Sie hatte diesen Moment des Aufbruchs herbeigesehnt, und nun rangen in ihr Gefühle von Wehmut und Hoffnung miteinander. Doch was ließ sie schon zurück? Nichts und niemanden. Auch sie konnte sich beherzt umdrehen und nicht mehr zurückblicken. Keine Freundin, kein Verwandter stand dort unten am Ufer und winkte. Kein Taschentuch wehte ihr ein Lebewohl.
Ihre Familie war ihr schon vor Monaten, im Dezember 1862, vorausgereist. Für sechs Schiffspassagen und Proviant hatte das Geld damals gereicht. Die hatte Heinrich Brunner, ihr Vater, bei einem Auswanderungsagenten gekauft, und einige Wochen später hatte er sich mit Annas Mutter Elisabeth, der sechs Jahre jüngeren Schwester Lenchen, den älteren Brüdern Eduard und Gustav sowie Annas Mann Kaleb Weinbrenner, auf den Weg an die Küste gemacht – nach Bremerhaven, dem Hafen, von dem man viel Gutes gehört hatte.
Anna hatte sich schon lange vor Bremerhaven von allen verabschiedet. Die beste Freundin Gustl hatte sie in Bingen zurückgelassen, bevor sie allein den langen Weg nach Norden angetreten hatte. Gustl mit ihren dicken blonden Zöpfen und dem dunklen Lachen, das irgendwo tief aus ihr herauszukommen schien.
Seit sie beide sechs Jahre alt geworden waren, waren Gustl und sie keinen Tag getrennt gewesen. Anna stiegen, wie so oft, die Tränen in die Augen beim Gedanken an die Freundin. Werde ich sie je wiedersehen, dachte sie, je wieder von ihr hören oder auch nur lesen?
Und er? Anna musterte den Mann in seinem braunen Reiseanzug. Sein Gesicht war schmal, das markante Kinn jedoch zeugte von Entschlossenheit. Die Seeluft zauste an seinem Haar, eine Locke fiel immer wieder hartnäckig in die Stirn. Er lächelte, während er sich nun zum Ufer drehte. War dort doch jemand, der auf ihn wartete? Nein, schon ließ er den Blick über die anderen Passagiere auf dem Schiff wandern, über die Feingekleideten und die Zerlumpten, die doch alle ihr Glück drüben machen wollten. Amerika machen, so nannte man das.
Anna schaute zum Hafen zurück. Die Kosmos, die sie in die Neue Welt bringen sollte, war kein großes Schiff, längst gab es größere. Und wenn dieses auch einige Kajüten für die bessergestellten Passagiere auf dem Oberdeck aufwies, so würden die meisten über die nächsten Wochen wohl enger beieinandersitzen müssen, als es ihnen lieb sein mochte. Ach, was war das für ein Tumult gewesen, als die Passagiere das Schiff erstmals betreten hatten. Was für ein Lachen, Greinen, Schreien und Krakeelen. Überall hatten Kisten, Kästen und Säcke im Weg gestanden oder gelegen, von den Matrosen mit saftigen Flüchen bedacht. Anna dachte an die Mutter mit ihren zwei Kindern, die erst einmal in Seelenruhe in all dem Trubel etwas aßen, da der Arzt ihnen geraten hatte, den Magen immer ein wenig gefüllt zu halten, um der gefürchteten Seekrankheit zu entgehen. Mit einiger Mühe waren die Kajütspassagiere, zu denen auch der junge Mann zählte, von den Zwischendeckreisenden getrennt worden. Dann war der Kampf um die Kojen losgegangen.
Anna hatte sich der Magen zusammengezogen, als sie das Zwischendeck zum ersten Mal betreten hatte, einen Raum von etwa elf Schritt Länge und neun Schritt Breite, dabei sechs Fuß hoch, und auf beiden Seiten mit Kojen versehen, immer zwei übereinander. Überrascht hatte sie außerdem feststellen müssen, dass sich weit mehr Leute unter Deck drängten als angekündigt.
Gegen vier Uhr hatte die Kosmos abgelegt. Während sich am Vortag der Wind ungnädig gezeigt hatte, waren die Vorzeichen dieses Mal gut. Schon bald würde ihr Heimatland ihren Blicken entschwinden. Für die nächsten Wochen war dieses Schiff ihr Zuhause, und wenn sie ehrlich war, hatte sie höllische Angst davor. Anna schluckte. Mit beiden Armen umklammerte sie den Beutel mit ihren wenigen Habseligkeiten und die Seegrasmatratze, um ein plötzliches Zittern zu unterdrücken. Sie spürte, wie sich das Blechgeschirr an ihrem weichen Bauch abdrückte.
Diese wenigen Dinge in ihren Armen waren das Einzige, was sie noch besaß. Alles andere hatte Anna aufgegeben, ein paar Kleinigkeiten verschenkt, das verkauft, was ein wenig Geld brachte, wie schon die Eltern im Vorjahr alles Entbehrliche in einer Auktion veräußert hatten. Um den Schiffsakkord, die Schiffskarte, zu kaufen, hatte sie sich die Finger wund und den Rücken krumm gearbeitet und jeden Kreuzer, den sie entbehren konnte, beiseitegelegt. Den Rest des Geldes hatte Frau Bethge beigesteuert – als Dank für Annas Unterstützung bei der Hochzeit ihrer jüngsten Tochter Cäcilie.
»Amerika machen«, stieß Anna zwischen ihren halb geschlossenen Lippen hervor.
Ja, auch sie wollte ihr Glück. Mit dem Kirchturm von Langenwarde entschwand das letzte Stück deutsche Küste ihrem Blick. Wie der junge Mann drehte sie sich nun mit dem Rücken zum Land.
Dort drüben wartete ihre Familie auf sie und mit ihnen die Neue Welt. Anna starrte auf das Meer hinaus, bis ihre Augen zu tränen begannen. Das Schaukeln des Schiffes wurde nun stärker. Ein kurzer Schauder überlief ihren Körper. Mit einem Mal stieg eine Angst in ihr hoch, die sich kaum bezähmen lassen wollte. Sie umklammerte ihren Beutel fester und blickte flüchtig um sich. Aber hier gab es nichts, an das sie sich halten konnte. Und was erwartete sie wohl in dem fremden Land? Vielleicht hätte sie die Reise als Abenteuer empfunden, wenn sie noch jünger gewesen wäre, aber sie war nun schon dreiundzwanzig Jahre alt.
Hatte sie die richtige Entscheidung getroffen?
»Sie kennen mich? Ich kann jetzt leider nicht sagen, dass ich mich erinnere.«
Aus seinen strahlend blauen Augen blickte ihr Retter sie fragend an. Anna reckte sich, um die Tasse mit einem leisen Klirren auf dem kleinen Tisch der Kajüte abzustellen, und versuchte zum zweiten Mal, mit Schwung zum Stehen zu kommen.
»Es ist nicht wichtig«, sagte sie und wusste nicht, warum ihre Stimme zitterte.
»Aber ich würde schon gerne wissen, woher wir uns kennen«, beharrte der junge Mann. »Außerdem haben Sie ja gar nichts getrunken.«
»Wir kennen uns nicht, Herr …«
»Meyer. Julius Meyer aus Hamburg, entschuldigen Sie bitte die Unhöflichkeit. Mit wem habe ich das Vergnügen?«
»Anna Weinbrenner aus … aus Bingen, Herr Meyer.« Anna schluckte. »Es ist nur … Ich habe Sie am Abfahrtstag gesehen. Als alle zum Land hinschauten, haben Sie zum Meer hingeblickt, und ich habe mich gefragt, ob Sie auch niemanden haben, der Ihnen …«
Noch während sie sprach, fühlte Anna die Röte in ihre Wangen steigen. Sie brach ab. Was dachte sie sich nur? Warum plapperte sie hier, wie ihr der Schnabel gewachsen war? Mit einem Wildfremden noch dazu, denn sie kannte diesen Julius Meyer doch gar nicht.
Weil etwas Vertrautes an ihm ist, sagte eine Stimme in ihrem Kopf, weil es ist, als würde ich ihn schon ewig kennen.
»Unfug«, murmelte sie.
»Wie bitte?« Julius Meyer schaute sie erstaunt an. »Was haben Sie gesagt?«
»Nichts.« Anna trat einen Schritt auf die Tür zu. »Ich muss jetzt wirklich gehen«, sagte sie. »Ich habe Ihre Hilfe schon viel zu lange in Anspruch genommen.«
»Ach was«, beharrte Julius und stand ebenfalls auf. »Sie sind ohnmächtig geworden. Ich will erst sehen, dass Sie sich vollständig erholt haben.«
»Ich habe mich vollständig …« Das Schiff schlingerte. Anna verlor den Halt und strauchelte, im letzten Augenblick fing Julius sie auf. Sein Körper war fest und warm. Sie roch Tabak und Seife. Hastig machte sie sich von ihm los. »Entschuldigen Sie bitte«, stieß sie hervor und errötete schon wieder wie ein junges Mädchen.
Julius lächelte sie an. »Es ist nichts passiert«, sagte er und deutete auf den gepolsterten Hocker neben dem Tisch. »Setzen Sie sich wieder, ruhen Sie sich noch einen kleinen Moment aus, ich bitte Sie. Und trinken Sie endlich ein Tässchen von meinem guten Darjeeling. Dann – und nur dann – lasse ich Sie gehen.«
Anna gab nach und setzte sich, für die nächsten Atemzüge schwieg sie. Während sie mit unruhigen Fingern ihren einfachen blauen Rock ordnete, schaute sie sich verstohlen um. Das also war eine Kajüte. Sie legte eine Hand auf einen Fleck an ihrem Jackenärmel. Wie unaussprechlich schäbig sie doch aussah verglichen allein mit der Ausstattung dieser kleinen Kammer. Sie trug ihre besten Kleider, aber diese nahmen sich gegen die gepflegte Einrichtung von Julius Meyers Unterkunft einfach nur grob aus. Wie sie roch, wollte sie sich gar nicht erst ausmalen. Gelegenheiten zum Waschen hatte es bisher nur wenige gegeben. Rasch tastete Anna nach dem Knoten, der ihr dickes braunes und leider vom Salzwasser verklebtes Haar bändigte.
»Und?« Julius reichte ihr erneut die Teetasse. Offenbar war er nicht gewillt aufzugeben. Anna nahm einen kleinen Schluck. Der Tee schmeckte ungewohnt, leicht malzig. Bisher hatte sie nur das Kräutergebräu ihrer Mutter getrunken. »Wohin wird Sie die Reise führen?«, fragte er.
Anna holte tief Luft. »Ich bin auf dem Weg nach Buenos Aires.« Sie schaute in Julius Meyers Augen und wusste nicht recht, warum sie die nächsten Worte hinzufügte. »Zu meinem Ehemann.«
Bei gutem Wetter, und so es der Kapitän erlaubte, verbrachten die Reisenden ihre Zeit gerne an Deck. Bis auf wenige Ausnahmen – ein älterer Mann schien fest entschlossen, die Schiffsfahrt weitgehend schlafend in seiner Koje zu verbringen – ließ sich gewöhnlich niemand die Gelegenheit entgehen, frische Luft zu schnappen. Auch an diesem Tag hatte sich ein buntes Völkchen an Deck versammelt, suchte sich seinen beengten Platz zwischen dem Kajütengang und den Schafställen, die mit hundert und mehr Böcken angefüllt waren. Die Schafe waren nicht die einzigen Tiere an Bord. Es gab auch achtzig Hühner sowie drei Schweine, die, vom Kapitän freigelassen, jeden Morgen einen Spaziergang über Deck machten.
Neben dem fünfundzwanzigjährigen Julius Meyer reisten zwei junge Kaufleute auf der Kosmos, außerdem ein Naturkundler, Maler und Weltreisender, wie er sich vorgestellt hatte, namens Theodor Habich, der neue Pflanzen zu entdecken hoffte, der Geograph Paul Claussen, dessen Ausrüstung die Kinder an Bord in Staunen versetzte und der jeden weißen Fleck auf der Landkarte als persönliche Beleidigung empfand, und der wortkarge rothaarige Jens Jensen mit der blassen Haut, der als Beruf stolz Müßiggänger angab. Daneben gab es Kleinbauern wie die Prenzls mit ihren sechs Kindern oder die reicheren Wielands, die nur zwei Kinder hatten, und denen im Übrigen der Ratschlag des Arztes nichts gebracht hatte, denn auch sie hatten in den ersten zwei Wochen immer wieder ihr Essen von sich gegeben. Dazu fanden sich Tagelöhner, Dienstmägde und Knechte und noch einige mehr, von denen Anna nichts wusste, Männer und Frauen, jüngere und ältere, Kinder und sogar Greise.
In Bremerhaven war diese zufällige Reisegesellschaft erstmals zusammengekommen. 1827 von der Hansestadt Bremen gegründet, wurde Bremerhaven rasch zu einem Auswandererhafen von Ruf. Die Bremer Schiffe galten als sicher. Mit dem 1848 errichteten Auswandererhaus hatten auch die weniger Vermögenden die Möglichkeit, vor der Abfahrt zu günstigen Preisen eine saubere Unterkunft zu erhalten.
Wie lange die Reise letztendlich dauern würde, wusste allerdings keiner so genau.
»Sechzehn Wochen«, hatte Theodor Habich mit Überzeugung gesagt, und die meisten Passagiere tendierten dazu, dem erfahrenen Reisenden Glauben zu schenken.
»Und wenn der Kahn seine menschliche Fracht ausgespuckt hat, dann lädt der Kapitän Weizen, Mais, Baumwolle, Tabak, Silber, und was die Neue Welt noch so hergibt, bringt's nach Europa, und der Reeder verdient sich dick und fett«, hatte Jens Jensen knurrend hinzugefügt und war wieder in Schweigen verfallen.
Bald ging das Gerücht, der Jensen sei einer, der vor der Obrigkeit fliehe, ein Demokrat womöglich. Jens Jensen selbst sagte dazu, wie zu erwarten, nichts. Er war, daran erinnerte sich Anna, als einer der Letzten an Bord gekommen. Kurz darauf hatten sie abgelegt.
Von der Wesermündung hatte die Kosmos Kurs auf die offene Nordsee genommen. Bald war die See unruhiger geworden. Zum ersten Mal hatte Anna mit etwas zu tun gehabt, das sich Seekrankheit nannte. Sie war nicht die Einzige gewesen, die sich würgend in den Nachttopf übergeben hatte.
Wenigstens hatte sie die Übelkeit so teilnahmslos werden lassen, dass sie kaum mehr auf die Schauergeschichten der Matrosen hören konnte. Manche dieser Seebären waren nämlich wahre Großmäuler, die den Landratten mit Erzählungen vom gefährlichen englischen Kanal, von Orkantiefs in der Biskaya und starken Strömungen Angst zu machen versuchten. Bedauerlicherweise gestattete es einem die Krankheit oft nicht, sich einen passenden Platz zum Erbrechen zu suchen, sodass es zuweilen den unglücklichen, jedoch ob der schrecklichen Übelkeit ebenso gleichgültigen Nachbarn traf.
Mit Mühen und doch glücklich hatten sie den Kanal passiert. Jemand hatte Anna auf die beiden Leuchttürme von Dover aufmerksam gemacht und auf die englische Kreideküste, die von ferne wie aus Schnee geformt aussah. Vorbei war es gegangen an den für die Strandräuberei berüchtigten Scilly-Inseln, und in der Biskaya hatten sie tatsächlich den ersten schweren Sturm erlebt, um dann auf den Spuren des Nordostpassats die südliche Route einzuschlagen.
Seit mehr als einem Monat war die Kosmos nun schon unterwegs, und auch die, die gerne an Deck gingen, dort schliefen oder aßen, verbrachten gezwungenermaßen einen Großteil ihrer Zeit in jenen engen Kojen im Zwischendeck. Eine Koje war für fünf Personen eingerichtet. Zählte eine Familie wie die der Prenzls mehr Mitglieder, so wurden die überzähligen in der nächsten Koje untergebracht. Zwischen den Kojen waren Kisten und Koffer gestapelt. Mancher Reisende hatte zudem Wäsche zum Trocknen aufgehängt, was ein Übriges dazutat, die Enge noch drangvoller werden zu lassen.
Gegen sechs Uhr morgens wurde geweckt. Man kleidete sich an, entleerte das Nachtgeschirr und sammelte Gegenstände ein, die über Nacht ihren angestammten Platz verlassen hatten. Ein Steward überwachte das Säubern der Räume. Manchmal wurde das Zwischendeck, um die Luft zu verbessern, mit Wacholderzweigen oder Teer ausgeräuchert.
Zum Frühstück reichte man Getreidekaffee, Tee und Brot. Der Speiseplan der einfachen Reisenden sah die schweren Schiffskekse und Schwarzbrot vor, so hart, dass man es erst mit dem Hammer entzweischlagen musste und dann einweichen, um sich nicht die Zähne auszubeißen. Außerdem gab es Hülsen- und Trockenfrüchte, Getreidebrei, manchmal Speck, Salzfleisch, Pökelfleisch, Bratfische und Hering. Obwohl jedem Reisenden laut Verordnung pro Tag zweieinhalb Liter Süßwasser zur Verfügung standen, betonte Jens Jensen, dass keiner von ihnen jemals so viel erhalten hatte.
»Aber unter dem Duckmäuservolk«, höhnte er dann, bevor er wieder in sein übliches Schweigen verfiel, »gibt es ja keinen, der sich dagegen wehren würde.«
Allen Schwierigkeiten und aller Enge zum Trotz war das Zwischendeck schon bald, und insbesondere bei schlechtem Wetter, zu ihrer aller Wohnstube geworden. Hier saß man beisammen, erzählte oder musizierte, aß und trank. Hier schwoll zu solchen Zeiten der Lärm an, das Lachen, Toben, und Kindergeschrei. Und hier hatte sich auch eins der Prenzl-Kinder eine Ohrfeige eingehandelt, bis sich Frieda Prenzl mit ihrer kleinen quadratischen Gestalt vor dem Übeltäter, einem vierschrötigen Mann namens Michel Renz aufbaute und ihn anfuhr, nur sie habe das Recht, ihre Kinder zu strafen. Frieda aber, das wussten alle, schlug ihre Kinder nie.
Leichter war's trotz allem, wenn das Wetter gut war. Nach einer Flaute von drei Tagen nach dem großen Sturm war an diesem Tag endlich wieder Wind aufgekommen. Während einige Passagiere auf den Planken in der Sonne beieinandersaßen, denn bis auf eine Bank und wenige Stühle, die meist von den Kajütspassagieren in Beschlag genommen wurden, gab es keine Sitzgelegenheiten, andere schweigend über das Deck flanierten oder mit dem Nachbarn schwatzten und sich beim neuesten Bordklatsch entspannten, jagten die Kinder hintereinander her oder spielten Verstecken zwischen den Tauen. Ein paar nutzten die Gelegenheit, Bohnenkaffee gegen Alkohol zu tauschen. Julius Meyer spielte Schach gegen den Geographen Paul Claussen.
Mit dem Ärmel ihrer Bluse wischte sich Anna den Schweiß von der Stirn. In den letzten Tagen war es schrecklich heiß gewesen, schwüler, als sie es je zuvor erlebt hatte, aber man gewöhnte sich an vieles: an Übelkeit und schlechtes Essen, an zu viele Menschen und zu wenig Raum, an nächtlichen Lärm, daran, sich auf einem schwankenden Schiff zu bewegen, ohne den Halt zu verlieren oder auf dem meist feuchten Deck auszurutschen, und eben auch an zu große Hitze.
Heute hatten die Stewards getrocknete Pflaumen, etwas Butter und Mehl ausgegeben. Langsam aß Anna eine der süßen Früchte nach der anderen und trank immer wieder in kleinen Schlucken Wasser dazu.
Während sich andere Passagiere zuweilen über die Eintönigkeit des Speiseplans beschwerten, störte Anna sich nicht daran. Sie war es von zu Hause nie anders gewohnt gewesen. Von Julius Meyer wusste sie zwar, dass der Kapitän auch größere Mengen Tee, Kakao und Honig sowie kleinere Mengen an Wein und Bier an Bord hatte, die jedoch waren, ebenso wie das mitgeführte Frischfleisch, für den Tisch der Kajütspassagiere bestimmt, und es ließ sie gleichgültig. Reisende wie die Wielands hatten sich selbst mit einem großzügigen Vorrat an Wurst, Speck, Käse und sogar Marmelade bedacht, den Frau Wieland mit Argusaugen bewachte.
Anna beobachtete Frieda Prenzl, die ihren Pflaumenvorrat in eine Blechschüssel gab, Butter und Mehl und ein Ei hinzufügte, das sie mit dem ihr eigenen Geschick irgendwo aufgetrieben hatte. Energisch knetete sie die Mischung und formte eine Teigrolle von etwa einer halben Elle Länge daraus, die schließlich in einem Kessel mit heißem Wasser gegart werden sollte.
»Bei uns gibt's heute Pflaumenstrudel«, rief sie fröhlich-resolut aus.
Anna lachte. Frieda ließ sich einfach von nichts die Laune verderben, doch nicht allen Reisenden ging das so. Je länger sie unterwegs waren, desto häufiger kam es zu Streit, und auch jetzt wieder wurden Stimmen in der Nähe lauter. Manchmal hatte Anna ein ungutes Gefühl dabei, auf so engem Raum mit so vielen Leuten zusammen zu sein, ohne auch nur die geringste Möglichkeit zur Flucht. Der Gedanke trieb ihr ein Lächeln auf das Gesicht. Sie steckte die letzte Pflaume in den Mund. Flucht – das war ja nun wirklich albern. Vor wem oder was sollte sie fliehen müssen?
Zweites Kapitel
»Das ist mein Platz.«
Anna zuckte zusammen. Woche um Woche seit jenem Sturm, der sie fast das Leben gekostet hatte, hatte sie dieses Plätzchen am späten Nachmittag aufgesucht. Manchmal war sie Julius Meyer begegnet. Manchmal hatten sie kurz miteinander gesprochen. Manchmal hatten sie einander nur zugenickt. Häufig war sie nach einem solchen Treffen mit jenem seltsamen Gefühl, das sie nicht benennen konnte, zurück zu ihrem Lager geeilt.
Sie drehte sich um. Nur wenige Schritte entfernt von ihr stand eine recht große, gertenschlanke Frau, deren Taille atemberaubend eng geschnürt war und die eine imposante Krinoline ihr Eigen nannte. Auf dem gescheitelten, im Nacken zusammengenommenen blonden Haar der Dame saß ein kleiner Strohhut, der unter dem Kinn mit einem blauen Band befestigt worden war. Stumm starrte Anna ihr Gegenüber an. Ein herausforderndes Lächeln auf den rosigen Lippen, trat die Frau einen Schritt näher. Bevor sie noch wusste, was sie tat, hatte Anna unsicher die Hände von der Reling gelöst.
»Das ist mein Platz!«, wiederholte die Blonde mit fester Stimme.
Anna musste sich auf die Lippen beißen, um sich nicht gewohnheitsmäßig zu entschuldigen.
Dies hier ist nicht Frau Bethge, ermahnte sie sich selbst, dies ist nicht deine alte Arbeitgeberin. Ich habe genauso viel Recht, hier zu stehen, wie diese Fremde. Wir sind beide Passagiere, haben beide für die Fahrt bezahlt.
Trotzdem wandte sie sich ab, während sie schon fieberhaft überlegte, ob und wo ihr diese Dame schon einmal aufgefallen war. Die ersten paar Schritte entfernte sie sich mit gesenktem Blick, dann straffte sie den Rücken. Sie würde gehen, aber sie wollte nicht vergessen zu betonen, dass sie jedes Recht gehabt hatte, dort zu stehen.
»Anna Weinbrenner?«, rief da eine nur zu bekannte Männerstimme.
Julius … Anna beschleunigte ihren Rückzug. Sie wollte ihm nicht entgegentreten, während die andere Frau zugegen war. Diese Frau und er passten zueinander. Sicherlich kannten sie sich, waren sich in den Räumlichkeiten begegnet, die den Bessergestellten vorbehalten waren. Eilig strebte sie um die nächste Ecke. Die Stimmen hinter ihr wurden mit einem Mal lauter. Meyer und die Fremde sprachen tatsächlich miteinander. Der Wortwechsel klang heftig. Anna blieb stehen und horchte, konnte jedoch ärgerlicherweise keines der Worte ausmachen. Sie überlegte, ob sie sich umdrehen sollte, doch schon im nächsten Moment erweckte Geschrei auf dem Deck weiter vorne, nahe des Bugspriets, ihre Aufmerksamkeit. Manchmal machten sich die Matrosen, die gerade am Steuerruder standen, den Spaß, das Schiff schnell gegen die Wellen zu wenden und die am Bug Stehenden mit einem kalten Meeresguss zu beschenken, doch jetzt ging es wohl um etwas anderes.
»Diebe, Diebe, ich wurde bestohlen!«
Anna reckte den Hals. Einige ihrer Mitreisenden hatten sich schon in kleinen Gruppen gesammelt und redeten aufgeregt aufeinander ein. Die Stimme gehörte zu jenem vierschrötigen Mann mit Namen Michel Renz, der damals eines der Prenzl-Kinder geschlagen hatte. Das Gesicht wutrot, stemmte er die Hände in die Seiten. Frau Wieland, die in den letzten Tagen wieder arg unter Seekrankheit gelitten hatte, hielt ihre zwei heulenden Kinder mit den Armen umschlungen.
»Wer hat etwas gesehen?«, rief ein drahtiger Mann mit hohen, pockennarbigen Wangenknochen und blassblauen Augen.
»Ich weiß nicht, es ging so schnell«, piepste eines von Friedas kleinen Blondschöpfchen.
Eine Bewegung hinter einem Stapel alter Seile weckte mit einem Mal Annas Aufmerksamkeit. Ein schmaler, dunkelhaariger Junge, den sie zuvor noch nie gesehen zu haben meinte, versteckte sich dort. Sie wollte eben rufen, da schaute der Pockennarbige unvermittelt zu ihr hinüber. Anna überlief es kalt. Piet Stedefreund hieß der Mann, fiel ihr jetzt ein, ein Freund von diesem Michel. Wo der eine war, war der andere nie weit. Annas Mund klappte zu. Piet starrte sie immer noch an. Noch nie zuvor hatte sie solch gefühllose Augen gesehen. Der Mann ließ sie schaudern.
»Hast du etwas gesehen?«, rief er ihr jetzt zu.
Anna zwang sich, nicht zum Versteck des Jungen hinzusehen. Vielleicht war es nicht recht, was er getan hatte, aber sie konnte sich nicht überwinden, ihn zu verraten. Michel, dessen Gesicht immer noch wutrot war, sah jetzt ebenfalls zu ihr hinüber. Er war ihr schon mehrmals unangenehm aufgefallen. Bei jeder Essensausgabe drängte er sich nach vorn, Schwächeren nahm er ab, was ihm mundete. Wenn Piet und er Langeweile hatten, suchten sie Streit, und wehe demjenigen, der dann in ihre Fänge geriet. Anna schluckte trocken.
»Nein.« Sie schüttelte den Kopf, froh darüber, dass ihre Stimme fest klang.
»Anna?«
Anna zuckte zusammen und drehte sich dann langsam um. Julius Meyer stand direkt hinter ihr.
»Herr Meyer.«
Sie deutete ein Kopfnicken an, das Julius Meyer mit einem Zucken der Mundwinkel quittierte. Sie konnte sich einfach nicht überwinden, ihn ebenfalls beim Vornamen zu nennen. Er war zu vornehm, war kein einfacher Reisender, wie sie es war. Seine Welt war nicht die ihre, das durfte sie nicht vergessen.
»Warum sind Sie weggelaufen?«, fragte er.
»Ich bin nicht …«
»Ich weiß, dass Viktoria Furcht einflößend wirken kann«, fuhr er ungerührt fort, »aber sie beißt gewiss nicht.« Er lachte. »Darf ich Sie also bitten, sich wieder zu uns zu gesellen?«
Viktoria heißt die Fremde also, fuhr es Anna durch den Kopf, und ich habe Recht gehabt, er kennt sie. Sie wollte den Kopf schütteln, da bot ihr Julius Meyer schon seinen Arm an. Hitze stieg in ihre Wangen, als sie sich bei ihm unterhakte, froh, dem wütenden Michel und seinem unheimlichen Freund Piet entkommen zu können. Den ganzen Weg zurück hielt sie den Kopf gesenkt. Erst kurz bevor sie Viktoria erreichten, sah sie entschlossen auf.
Viktoria stand an der Reling, den Kopf zur Seite gewandt, und blickte auf das offene Meer hinaus. Der Wind zerrte an den Bändern ihres Strohhuts. Ein paar feine Strähnen ihres Haars hatten sich gelöst, wie flirrende Goldfäden wehten sie ihr ins Gesicht. Kurz sah Anna an der jungen Frau vorbei zum Horizont, wo Meer und Himmel untrennbar miteinander verschmolzen.
»Delfine«, rief Viktoria da aus. Julius Meyer ließ Annas Arm sofort los und eilte an ihre Seite.
»War nur ein Spaß.« Die blonde Viktoria lachte ihm mitten ins Gesicht.
Noch ein paar Schritte, und Anna hatte die beiden erreicht. Dieses Mal musterte Viktoria sie freundlicher. Ihre graublauen Augen funkelten übermütig.
»Viktoria Santos«, stellte sie sich vor und streckte Anna die Rechte entgegen. Ihr Griff war zupackender, als Anna erwartet hatte.
»Anna Weinbrenner«, erwiderte sie.
»Julius hat noch gar nichts von Ihnen erzählt.«
Viktoria hielt Annas Hand noch einen Moment länger fest, um sie dann sehr plötzlich loszulassen.
»Das tut mir leid, von Ihnen auch nicht«, parierte Anna.
Wortlos schaute Viktoria sie für einen Augenblick an, dann lachte sie hell auf.
»Ich freue mich, Sie kennenzulernen, Anna Weinbrenner. Ich bin mir sicher, wir werden uns gut verstehen.«
Bald wusste Anna nicht mehr, wie es gewesen war, allein zu reisen. Mit der gleichaltrigen Viktoria und Julius – sie sprachen sich nun vollkommen ungezwungen mit Vornamen an – gab es so viel zu entdecken, so viel zu erfahren, so viele unglaubliche Geschichten zu erzählen, dass sie die gemeinsamen Stunden an Deck bald jeden Tag dringlicher herbeisehnte. In dieser Zeit konnte Anna ihre grobe Kleidung vergessen, die beim Versuch, sie mit Seewasser notdürftig zu säubern, ganz steif geworden war. In dieser Zeit war es einerlei, dass sie nur ein Blechgeschirr, eine einfache Matratze aus Seegras, die Kleidung, die sie am Leib trug, und den Winterumhang ihr Eigen nannte.
Eines Tages lud Julius Anna und Viktoria in seine Kajüte zum Tee. Anna hatte ablehnen wollen, Viktoria war beim Gedanken daran, etwas vielleicht nicht Verbotenes, aber möglicherweise Anrüchiges, in jedem Fall aber Unkonventionelles, zu tun, sofort Feuer und Flamme gewesen und hatte kein »Nein« gelten lassen. Julius hatte versprochen zu berichten, was er über das Ziel ihrer Reise wusste.
»Der erste Europäer, ein Spanier namens Juan Díaz de Solís«, begann er, »hat den La Plata Anfang des 16. Jahrhunderts erreicht. Über elf Jahre später ist der venezianische Entdecker Sebastian Cabot, angelockt von sagenumwobenen Erzählungen über ein an Silberschätzen reiches Königtum, im Dienste der spanischen Krone ins Landesinnere vorgestoßen, jedoch ohne das ersehnte Edelmetall zu finden. Wenige Jahre darauf ist es dann zu Pedro de Mendozas Aufgabe geworden, das sagenumwobene Land am Silberfluss für die Krone zu erschließen. Die größte Flotte – sechzehn Schiffe und tausendsechshundert Seeleute -, die bis dahin nach Amerika entsandt worden war, hat sich auf den Weg gemacht. Mendoza gründete die Siedlung, aus der später Buenos Aires werden sollte, und nannte sie zu Ehren der heiligen Maria und wegen der an der La-Plata-Mündung herrschenden frischen Meereswinde Puerto de Nuestra Señora Santa María del Buen Ayre. Doch auch dieses Unternehmen stand unter keinem guten Stern: Auf der südlichen Halbkugel ging der Sommer zur Neige, und die Ernährungslage wurde kritisch. Indianer belagerten den Stützpunkt, Hunger und Krankheit breiteten sich aus.« Viktoria und Anna sogen hörbar Luft ein. »Es heißt, die letzten Überlebenden hätten ihre toten Kameraden verspeist«, endete Julius mit gesenkter Stimme.
»Wie furchtbar«, hauchte Viktoria, während Anna wortlos schauderte.
Julius fuhr fort zu erzählen. »1573 ist eine weitere Expedition unter dem Befehl des erfahrenen Offiziers Juan de Garay in Asunción gestartet, die den Río Paraná nunmehr stromabwärts fuhr. Acht Jahre später gründete Garay an der Stelle, die 1541 von den Überlebenden der Expedition Mendozas aufgegeben worden war, neuerlich die Stadt Buenos Aires. Mit dieser Gründung war die spanische Herrschaft am La Plata endgültig. Es hatte fast sechzig Jahre gedauert.« Julius hob die Kanne. »Noch etwas Tee?«, fragte er.
Viktoria schüttelte den Kopf. Anna hielt ihm ihre Tasse hin. Während sie das feine Porzellan in ihrer Hand betrachtete, musste sie mit einem Mal an ihren Vater denken und seine verzweifelte Wut darüber, dass einem die Arbeit in der Heimat zu wenig zum Leben ließ und zu viel zum Sterben. Früher hatten sie einmal einen Bauernhof besessen, doch das Land war durch Generationen der Erbteilung klein geworden, bis man keine Familie mehr darauf ernähren konnte. Auch der Nebenerwerb war letztendlich durch den Fortschritt sinnlos gemacht worden und hatte zu wenig Geld eingebracht – was hatte es da noch genutzt, wenn die Mutter, die Schwester Lenchen und sie Abend für Abend genäht hatten, es war trotzdem immer weiter bergab gegangen. Und dann hatte einer sich erinnert, dass schon einmal einige Familien aus Bingen ins Silberland aufgebrochen waren, um in Santa Fe, am unteren Lauf des Río Paraná, eine neue Heimat zu finden.
Anna starrte durch das Bullauge, das einen verschwommenen Blick nach draußen ermöglichte: Argentinien, Silberland – klang das nicht wie ein Versprechen? Doch was verbarg sich dahinter? Was würde ihnen dieses Land wirklich bringen?
Drittes Kapitel
Julius stand an der Reling und blickte über die weite Wasserfläche hinweg. Das Wetter auf dem Meer wechselte schnell. Sonnenschein folgte auf Regen. An einem Tag mussten wegen zu viel Wind die Segel gerefft werden, am nächsten konnte es schon wieder windstill sein und nichts mehr ging voran. Seit einigen Tagen nun hatte der Wind wieder einmal abgenommen, und heute breitete sich die Wasserfläche beinahe spiegelglatt vor ihm aus. Manch einer hatte die Stirn sorgenvoll gerunzelt. Es herrschte Windstille, unerträgliche Windstille, und in der Mannschaft – das hatte Julius bemerkt – war die Stimmung gereizt. Nichts mehr ging voran, auch auf Deck war kaum eine Bewegung festzustellen.
Das Schiff befand sich nunmehr auf Äquatorhöhe – vor einigen Tagen hatte unter großem Beifall und unter Einsatz von Teer und Seife die Äquatortaufe stattgefunden, bei der auch mit Wasser nicht gespart worden war. Jetzt hatte die Kosmos die so genannten Rossbreiten erreicht. Mit unbarmherziger Macht brannte die Sonne auf das Schiff nieder. Eine bleierne, drückende Schwüle lag über dem Deck, und wer nicht arbeiten musste, suchte irgendwo Schatten, um der Hitze zu entkommen. So still war es, dass es schien, die Kosmos sei zu einem Geisterschiff geworden. Dabei hatten sie vor Tagen noch ein anderes Schiff getroffen; ein denkwürdiges Schauspiel in einer solchen Wasserwüste. Erst war das fremde Schiff etwa einen Büchsenschuss entfernt gewesen, wenig später war es in nur dreißig Schritt Entfernung an ihnen vorbeigezogen. Die Flagge hatte es als Amerikaner ausgewiesen. Man hatte einander zugewinkt, und manch einer hatte noch über diese Begegnung gewispert, als der glänzende weiße Punkt längst am Horizont verschwunden war.
In jedem Fall war an diesem Tag der Himmel kräftig blau. Nur wenige Schleierwolken waren am Firmament auszumachen. Unschlüssig drehte Julius das Buch, das er sich aus der Kajüte mitgenommen hatte, in den Händen. Er hatte den Reisebericht, der ihm das fremde Land, in das er reiste, näherbringen sollte, noch in Hamburg erstanden.
Argentinien, das Silberland, Río de la Plata, der Silberfluss. Julius seufzte. Sein Vater hatte ihn von der Reise abbringen wollen, das Geld hatte ihm seine Mutter heimlich geliehen, er schwor sich, es ihr auf Heller und Pfennig zurückzuzahlen. Für einen Moment erschien ihr Gesicht vor seinem geistigen Auge. Würde er sein Wort wohl halten können? Sicher, er war nicht sonderlich verlässlich gewesen in den letzten Jahren, hatte viel getan, was den Vater gegen ihn aufgebracht hatte, aber das würde sich ändern. Er war ein Kaufmannssohn, er kannte das Geschäft, hatte sich die Hörner abgestoßen. Und Anna hatte Recht: Silberland, Silberfluss – klangen nicht schon diese Namen wie ein Glücksversprechen? Kurz musste er schmunzeln.
Als vor einigen Tagen ein paar Frauen nach Süßwasser verlangt hatten, denn bei Salzwasser wollte das Seifen wenig nutzen, hatte ihnen einer der Matrosen grinsend beschieden: »Ach was, lasst die Flecken doch im Zeug. Einmal an eurem Bestimmungsort, legt ihr es dann einfach in den Fluss. Ohne dass ihr euch abmüht, ist es in einer halben Stunde silberrein – oder wie hätte der Silberstrom sonst seinen Namen bekommen?«
Julius verstaute das Buch in der Rocktasche und zog unruhig die Taschenuhr hervor, um die Uhrzeit zu überprüfen. Wo die jungen Frauen nur blieben, oder wollten sie einfach in Viktorias großzügiger Kajüte bleiben? Das konnte er sich nicht vorstellen. Schließlich war am Tag zuvor mittags eine Gruppe von Schweinswalen am Schiff vorbeigezogen, und sowohl Anna als auch Viktoria hatten sich beeindruckt gezeigt – und erpicht darauf, weitere solcher Beobachtungen zu machen. Haifische waren mittlerweile schon häufiger zu sehen gewesen, und einige Passagiere und Besatzungsmitglieder versuchten ihr Glück beim Fang.
Der junge Kaufmann suchte in seinen Rocktaschen nach einer Zigarre und entzündete sie sorgsam mit einem Zündholz. Konzentriert schmauchte er die ersten Züge. Dann ließ er noch einmal den Blick über das Deck schweifen, beobachtete Herrn Prenzl mit seinen Söhnen, die aufgeregt aufeinander einsprachen, sah eine junge, hochschwangere Frau aufs Meer hinausstarren.
Warum waren sie alle hier? Wer hatte sie zum Träumen gebracht? Waren sie von Reiseagenten angesprochen worden, oder hatten sie selbst einen solchen angesprochen? Was erwartete sie dort drüben? Würde sich erfüllen, was sie sich erhofft hatten?
»Man braucht doch nichts als ein paar starke Arme und einen Kopf voller Ideen«, rief jetzt einer der jungen Kaufleute lachend aus, »dann können auch die kühnsten Träume wahr werden.«
Ein paar stimmten ihm zu. Viele Gesichter blickten ernst drein. Der fehlende Wind hatte sich drückend auf einige Gemüter gelegt, und auch der Kapitän musterte den Horizont öfter als gewöhnlich.
Seufzend drehte Julius sich wieder zu der spiegelblanken Wasserfläche. Am ersten Tag mochte ihm Anna Weinbrenner nicht aufgefallen sein, jetzt aber konnte er sie nicht mehr vergessen. Sein ganzes Leben lang hatte er nur Mädchen wie Viktoria gekannt. Niemals hatte sein Weg den einer Anna Weinbrenner gekreuzt, und wenn er ehrlich war, er hätte sich auch kaum dafür interessiert.
War sein Leben nicht vorgezeichnet gewesen? Der Einstieg in das Geschäft des Vaters, die Heirat mit einer wohlhabenden Erbin, Kinder, vielleicht Liebe oder die Erfüllung des sexuellen Triebs in Etablissements, über die Männer prahlten und von denen die Damen errötend und hinter vorgehaltener Hand sprachen.
Julius schmauchte noch ein paar Züge seiner Zigarre, blies Ringe in die Luft. Seine Eltern hatten sogar schon eine junge Frau ausgesucht gehabt, die Tochter eines Geschäftspartners. Später hätte man dann beide Firmen zum Ruhm beider Familien zusammenlegen können. Er schnalzte verächtlich: Geld und Reichtum, Ansehen und »was die Leute denken« – das, und nur das, war wichtig gewesen für César und Ottilie Meyer.
Nun ja, es war wichtig für seinen Vater gewesen, denn seine Mutter hatte ihm vertraut, sonst wäre er jetzt nicht auf dem Schiff. Sie hatte ihm Geld geliehen, hatte sich gegen den Vater gestellt, und damit war alles anders gekommen. Zum ersten Mal fuhr es Julius durch den Kopf, dass seine Mutter eine mutige Frau war.
Ob sich das Entsetzen über die sitzen gelassene Braut gelegt hatte? Wie ein Dieb hatte er sich nach Bremen abgesetzt, um ein Schiff von Bremerhaven aus zu nehmen und nicht von Hamburg, wo der Vater seine Spione hatte. Ob es den Vater Geld gekostet hatte, die Familie der Braut zu entschädigen?
Julius nahm neuerlich einen Zug von seiner Zigarre. Das wird er mir nie verzeihen, dachte er. Wenigstens hatte ihm seine Braut verziehen, als er sie von seinem Vorhaben informierte, denn die hatte ihn ohnehin nicht heiraten wollen. Nein, er konnte nicht sagen, was ihn dazu gebracht hatte, die Pläne seines Vaters zu durchkreuzen. Vielleicht war es ein Streit zu viel gewesen, den der alte Patriarch vom Zaun gebrochen hatte. Eine weitere Drohung, die Julius nicht hatte hinnehmen wollen.
César Meyer hatte Prinzipien, und er hasste es, wenn man seinen Vorstellungen zuwiderhandelte. Aber aus Julius Meyer war irgendwann ein Mann geworden, der es seinerseits hasste, sich alles sagen lassen zu müssen. Deshalb hatte er das Haus seines Vaters verlassen, deshalb hatte er die Gelegenheit beim Schopf gegriffen, als er von den Möglichkeiten in Südamerika gehört hatte, und sich eingeschifft.
Julius verschränkte die Arme vor der Brust. Was würde der Vater wohl sagen, wenn er ihn jetzt so sehen könnte? Würde er sagen: Das wird nichts, komm zurück, ich gebe dir alles, was du brauchst? Seine Augen verengten sich. Aber er wollte nichts von seinem Vater. Er wollte seinen eigenen Weg gehen, und wenn es dann so weit war und er Erfolg gehabt hatte, würde er seiner Mutter das geliehene Geld zurückzahlen und dem Vater stolz entgegentreten.
In gewisser Weise, befand Julius, waren Anna und er in einer ähnlichen Lage. Beide wussten sie nicht, was das Leben drüben für sie bereithielt.
Viertes Kapitel
Viktoria saß auf dem Bettrand, stellte die bestrumpften Füße auf den Sitzhocker und bewegte die Zehenspitzen. Eben noch hatte sie eine Schlingerbewegung des Schiffs aus dem Gleichgewicht gebracht, seit den Morgenstunden dieses neuen Tages wehte wieder ein kräftigerer Wind.
»Dein Mann ist dir also auch vorausgereist?« Viktoria beugte sich vor und umfasste ihre Füße. »Warum?«
Sie wartete einen kurzen Moment, zu kurz, um Anna die Möglichkeit zu geben zu antworten. Dann ließ sie ihre Füße wieder los und setzte sich gerader auf.
»Mein Humberto jedenfalls konnte einfach nicht länger warten. Er musste nach Hause. Sein Vater besitzt eine große Estancia in der Nähe von … Himmel«, Viktoria schüttelte halb lachend, halb ärgerlich den Kopf, »ich kann mir den Namen einfach nicht merken. Sie liegt im Nordwesten. Jedenfalls musste Humberto zurück, um seinem Vater zu helfen. Der alte Herr ist einfach nicht mehr der Jüngste, und auf so einer großen Estancia gibt es offenbar immer viel Arbeit.« Sie reckte den Nacken. »Mama wollte zuerst nicht, dass ich allein reise, aber ich konnte Papa überreden. Nachdem ich ihnen dann telegrafierte, dass ich Julius getroffen habe, waren sie sicher vollkommen beruhigt.«
Anna musste sich auf die Lippen beißen, um nicht zu fragen, woher genau Julius und Viktoria einander kannten. Sie waren so vertraut miteinander, wie sie es mit den beiden, trotz aller Zeit, die sie miteinander verbrachten, bestimmt nie sein würde.
Ein neuerliches Schlingern brachte die beiden jungen Frauen aus dem Gleichgewicht. Lachend hielt sich Viktoria mit beiden Händen an der Bettkante fest.
Sie lacht viel, dachte Anna, als gäbe es nichts, worum man sich sorgen musste. Aber wahrscheinlich hatte sich Viktoria tatsächlich niemals um irgendetwas sorgen müssen. Jedenfalls schien sie nie gedrückter Stimmung zu sein, und der Vorrat an Geschichten um versunkene Städte, Seejungfrauen und fliegende Holländer ging ihr ebenfalls nicht aus.
Anna unterdrückte einen Seufzer und dachte an Kaleb, ihren Mann, der ihr vorausgereist war, und an jenen letzten Tag, an dem sie sich zum Abschied geliebt hatten. Anders als sonst hatten sie nicht in der drangvollen Enge des kleinen Bauernhauses miteinander geschlafen, ständig darauf bedacht, niemanden zu stören oder gar zu wecken, sondern in einer Scheune, ein Ort, den Kaleb für sie beide ausgesucht hatte. Es war sehr kalt gewesen, und zuerst war es Anna schwergefallen, sich zu entspannen, aus Angst, der Besitzer könne kommen, doch mithilfe Kalebs sanfter dunkler Stimme war es schließlich gelungen. Ob Kaleb sich sorgte, weil er seine Frau hatte zurücklassen müssen? Anna blickte nachdenklich in das Licht von Viktorias Öllampe, die mit den Wellenbewegungen schwankte.
Aber es hatte ja keine andere Möglichkeit gegeben. Es hatte ja nichts genutzt, mit dem Schicksal zu hadern. Ihr Vater und ihr Mann hatten den Weg in die Neue Welt antreten müssen, um denen, die noch folgten, den Weg zu ebnen. Ihre Mutter und ihre jüngere Schwester hätte man niemals allein zurücklassen können, die Brüder, die keine Arbeit mehr gehabt hatten, ebenso wenig. Frau Bethge, für die Anna gearbeitet hatte, hatte dagegen versprochen, gut auf Anna aufzupassen. Die Entscheidung war richtig gewesen. Anna hatte keine Furcht gehabt, und da noch Geld für eine Überfahrt gefehlt hatte, auch gar keine andere Wahl.
Und doch, fragte sie sich jetzt nicht zum ersten Mal ängstlich, was sie in der Neuen Welt erwarten mochte. Es gab so viel Gerede. Die so genannten Estancias, von denen auch Viktoria ihr berichtet hatte, sollten größer sein als der größte Bauernhof, den sie kannte. In der Pampa, einem weiten Grasland bei Buenos Aires, gab es so viele Rinder und Pferde, dass man sie kaum zählen konnte. Auch die Ärmsten, hieß es, aßen dort jeden Tag Fleisch. In den Bergen, zur chilenischen Grenze hin, förderte man den begehrten Salpeter. In Bolivien fand sich Silber, das über das argentinische Hochland an die Küsten gebracht wurde. Auf den Mutigen, hieß es, warte das Glück.
Für einen Moment schaute Anna Viktorias knöchelhohe Stiefel an, die mit einer langen Reihe von perlenartigen Knöpfen verschlossen wurden und die ihre Besitzerin achtlos in eine Ecke der Kajüte geworfen hatte. Da Viktorias Mundwerk selten still stand, hatte Anna mittlerweile einiges über die mitreisenden Kajütspassagiere erfahren. Einer der Kaufleute war angeblich ein Betrüger auf der Flucht vor dem Gesetz, zwei weitere Frauen waren auf dem Weg zu ihren Ehemännern. Der Geograph Paul Claussen hoffte darauf, den südlichsten Punkt der Welt zu erreichen.
Einige Wochen noch, dachte Anna, dann würde ihre gemeinsame Reise zu Ende sein. Längst hatten sie den größten Teil der Strecke hinter sich gebracht. Sie hatten Madeira und die Azoren passiert, waren in mehrere Stürme geraten, um dann in der Nähe des Äquators bei Windstille liegen zu bleiben. Sie hatten Jamaika von Ferne gesehen, während die Hitze das Pech aus den Fugen hatte tropfen lassen. Einmal war ein Schiffswrack an ihnen vorbeigetrieben, das Gerippe von Muscheln besetzt, und hatte sie alle daran erinnert, auf welch gefährlicher Fahrt sie sich befanden. Sie hatten herrlich ruhige Abende auf dem Schiff verlebt, zu denen die See im Licht des sternenübersäten Himmels gefunkelt hatte. Manchmal hatte Anna jedoch Bäume vermisst. Manchmal hatte sie sich gewünscht, aus dem Verdeck möge ein blühender Apfelbaum emporwachsen.
»Hörst du das?«
Anna blickte auf, als Viktoria nunmehr mit einem kleinen Freudenlaut aufsprang, und runzelte die Augenbrauen.
»Na«, Viktoria wies auf die Uhr in ihrer Kajüte, »Julius kommt.« Sie wandte sich an ihr Mädchen: »Käthe, sorg bitte für Tee und Gebäck.«
Wenig später stand Julius tatsächlich vor ihnen. Mit eleganter Geste wies Viktoria ihm einen Schemel zu, während sich Anna mit ihrem bald unsicher in Richtung Tür zurückzog. Sie war die Frau eines einfachen Landarbeiters. Zu Gelegenheiten wie dieser war ihr das nur zu deutlich. Unter halb gesenkten Lidern hervor beobachtete sie Julius und Viktoria. Julius hatte offenbar einen Spaziergang an Deck gemacht. Sein Haar war zerzaust. Auf seiner Kleidung konnte man Salzränder ausmachen, denn der Wellengang war stärker, seit der Wind wieder kräftig wehte. Schmunzelnd blickte er auf Viktorias Füße.
»Sie empfangen mich ohne Schuhe, meine Dame? Was wird Humberto Santos aus Salta wohl dazu sagen?«
Viktoria warf Julius einen langen Blick unter ihren geschwungenen Wimpern hervor zu. Ihr Mund formte sich zu einem allerliebsten Lächeln.
»Mein Mann liebt mich, so wie ich bin, Herr Meyer«, sagte sie dann und zwinkerte Julius zu. »Würdest du mir bitte aufhelfen?«, bat sie ihn im nächsten Moment und streckte ihm die Hand hin.
Sie flirtet mit ihm, schoss es Anna durch den Kopf. Sie ist eine verheiratete Frau und flirtet mit einem fremden Mann.
»Etwas Tee?«, flötete Viktoria dann, wieder ganz höhere Tochter, und fügte hinzu: »Salta, wie kannst du dir diesen Namen nur merken?«
»Salta …« Julius nahm die Tasse entgegen. »Einfach wie Salz auf Englisch und dann noch ein A dran. Aber du hast sicherlich Französisch gelernt, nicht wahr?«
»Mais oui.« Viktoria lächelte Julius an. »Zucker?«
Als sie ihm die Zuckerdose reichte, berührten sich ihre Hände. Anna bemerkte, wie sie sich versteifte, fühlte mit einem Mal Neid in sich aufsteigen, der sie verwirrte. Was sollte das, war sie nicht mehr zufrieden mit dem, was sie hatte? Sie war immer stolz auf das gewesen, was sie mit eigener Hände Arbeit hatte erreichen können; war stolz gewesen auf Kalebs Geschicklichkeit. Was ging nur in ihr vor?
»Noch ein Biskuit für Sie, Frau Weinbrenner?«, fragte Käthe und reichte Anna die Schale.
Halb blind griff Anna zu und steckte sich das Plätzchen in den Mund. Sie kaute, doch sie schmeckte nichts. Entschlossen rief sie sich Kaleb ins Gedächtnis, in jenem Moment, als er sie ungelenk zum Abschied geküsst hatte, an jenem letzten Tag in der Scheune. Sie durfte nicht denken, was sie jetzt dachte. Sie durfte Julius nicht ansehen und das denken.
Es war Viktoria, die sie aus den Gedanken riss.
»Anna, ich habe eine Idee.«
»Aber natürlich geht das!« Viktoria stemmte die Hände in die Hüften und begutachtete Käthes Arbeit. »In diesem Kleid wirst du überhaupt nicht auffallen. Herrlich, das wird ein Heidenspaß! Julius wird Augen machen.«
Sehnsüchtig schaute Anna zur Tür. Viktoria hatte den jungen Kaufmann zurück in seine Kajüte geschickt, als sie auf die Idee gekommen war, Anna eines ihrer Kleider anziehen zu lassen. Zu unschicklich wäre es gewesen, ihn dabei zuschauen zu lassen. Mit dem Einfall, Anna mit zum Dinner zu nehmen, welches der Kapitän für seine vornehmeren Gäste für den Abend angesetzt hatte, war sie etwas später herausgerückt, und wie so oft hatte sie kein »Nein« akzeptiert.
Anna sah an sich herunter. Natürlich hatte sie manchmal davon geträumt, eines von Viktorias schönen Kleidern zu tragen – das himmelblaue mit dem Blütenmuster in dunklerem Blau vielleicht, oder jenes in schimmerndem Braun mit dem kleinen weißen Stehkragen, aber sie hatte doch immer gewusst, dass diese Wünsche nie wahr werden würden, und das war auch gut so. Träume waren nicht da, um in Erfüllung zu gehen. Sie unterdrückte einen Seufzer.
Viktoria beugte sich über ihre Reisetruhe und holte ein Paar Schuhe nach dem anderen hervor, die sie nacheinander betrachtete und dann achtlos zur Seite warf.
Käthe wird einiges aufzuräumen haben, bis das hier endlich vorbei ist, dachte Anna. Unsicher berührte sie den grünen Seidenstoff ihres Kleides. Dann setzte sie sich vorsichtig auf den Bettrand, was mit dem eng geschnürten Korsett nur in absolut aufrechter Haltung möglich war, und atmete flach. Unglaublich, sich vorzustellen, dass Viktoria so etwas jeden Tag trug. Offenbar hatte sie gelernt, nicht zu atmen. Anna legte die Hand auf die feste Stelle, hinter der sich ihr Bauch befand.
»Deine Haare können aber nicht so bleiben.« Viktoria schüttelte den Kopf. »Das sieht so bäurisch aus.«
Anna errötete. Ob Viktoria wusste, wie verletzend manche ihrer leicht dahingesagten Äußerungen waren? Sie war immer stolz auf ihr Haar gewesen. Es hatte nicht viel Schönes in ihrem Leben gegeben, doch ihr Haar hatte ihr stets Freude bereitet. Und Kaleb liebte es. Wie gern hatte er seine Hände darin vergraben. Einen Moment lang war es wieder Sonntag, und Anna lag rücklings auf einer Sommerwiese und starrte in den blauen Himmel hinauf, während Kaleb ihr offenes Haar wie einen Fächer um sie ausgebreitet hatte.
Es ist nicht nur braun, hatte er mehr als einmal gesagt, es ist braun und rot und goldfarben. Anna schluckte.
»Was willst du ihnen denn über meine Herkunft sagen?«, fragte sie mit trockenem Mund.
Was über meine rauen Hände?, fügte sie in Gedanken hinzu.
Als habe Viktoria sie gehört, reichte sie Anna ein Paar feiner Handschuhe.
»Da fällt mir schon etwas ein. An Fantasie hat es mir noch nie gemangelt.«
»Aber jeder weiß, dass ich im Zwischendeck reise.«
Und wenn man es nicht weiß, fügte Anna still hinzu, dann wird man es riechen. Zwischendecksgestank, so hieß es doch. Man würde sie fraglos sofort enttarnen und dem Gespött preisgeben. Lachend schob Viktoria derweil eine andere Tasche beiseite, in der sie gekramt hatte, und legte etwas auf den Tisch.
Allgemeine Modezeitung, las Anna stumm. Auch Frau Bethge hatte gerne darin geblättert, während sich ihre Töchter stets auf die gewagtesten Kreationen verstiegen hatten.
Viktoria schlug mehrere Seiten um und deutete auf eine Abbildung. »Diese Frisur dort müsste ihr gut stehen, nicht, Käthe? Anna hat so unglaublich dicke Haare.«
Etwa eine halbe Stunde später hatte Käthe ihr Werk vollendet, und Anna wagte noch nicht einmal mehr, ihren Kopf zu berühren, als Viktoria ihr den Spiegel hinhielt. Sie sah tatsächlich aus wie die Frau auf der Abbildung. Ihre Haare waren, auf eine Art, wie es Anna nie gelingen wollte, sauber gescheitelt und im Nacken zu einem Knoten zusammengenommen worden. Auf einer Seite steckte eine zartrosa Blüte. Dazu hatte Käthe dezentes Rouge und Lippenrot aufgetragen. Aus dem Spiegel blickte Anna jemand an, der ihr fremd war.
Im dunklen Gang standen die beiden jungen Frauen wenig später noch einen Moment lang beieinander. Anna konnte den eigenen schnellen Atem hören. Sie versuchte, ihre rechte Hand aus Viktorias festem Griff zu ziehen.
»Ich gehe besser. Ich halte das für keine gute Idee.«
»Himmel, sei doch kein Spielverderber. Es wird Spaß machen, glaub mir.« Viktoria dachte nicht daran, loszulassen. »Du siehst wunderschön aus, ganz wie eine von uns. Du wirst gar nicht auffallen. Pass nur auf, man wird dich heiraten wollen.«
»Ich bin verheiratet.«
»Nun sei kein Griesgram, das weiß ich doch.« Viktoria schlug kurz die Augen nieder und schaute Anna dann bittend an. »Bitte«, flehte sie, »es ist so schrecklich langweilig auf diesem Kahn, und ich habe es mir so schön vorgestellt. Ich will dir doch nichts Böses, Anna, nur ein bisschen Spaß. Das wird ein Heidenspaß werden, du wirst schon sehen. Gib es zu, du wolltest doch schon immer solch ein Kleid tragen?«
»Aber«, begehrte Anna noch einmal schwach auf.