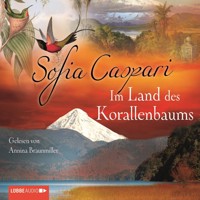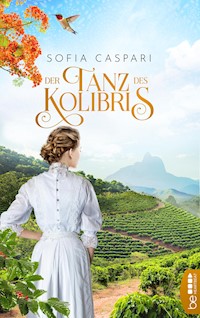6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: ARGENTINIEN-SAGA
- Sprache: Deutsch
Argentinien, 1897: Clarissa und Javier feiern ihren ersten Hochzeitstag mit einem Ausflug an die Iguazu-Wasserfälle. Doch der wunderschöne Tag endet schrecklich: Javier stirbt und Clarissa stürzt in den reißenden Iguazu.
Zur gleichen Zeit befindet sich der junge Arzt Robert Metzler auf einer Expedition durch den Dschungel. Am Flussufer findet er die ohnmächtige Clarissa. Robert bringt die Frau, die sich an nichts erinnern kann, zur Farm seiner Eltern, um sie dort gesund zu pflegen. Er ahnt nicht, dass Clarissa noch lange nicht in Sicherheit ist ...
Mit ihrer fesselnden Auswandersaga entführt Sofia Caspari die Leserinnen und Leser in das Argentinien des 19. Jahrhunderts - in die Welt von Arm und Reich, Ehrbahren und Verruchten, Hassenden und Liebenden.
Band 1: Im Land des Korallenbaums
Band 2: Die Lagune der Flamingos
Band 3: Das Lied des Wasserfalls
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 666
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel der Autorin
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Stammbaum
Zitate
Erster Teil
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Zweiter Teil
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Dritter Teil
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Vierter Teil
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Epilog
Danksagung
Weitere Titel der Autorin
Im Land des Korallenbaums
Die Lagune der Flamingos
Im Tal der Zitronenbäume
Der Tanz des Kolibris
Inselglück und Sommerträume
Die kleine Pension am Meer
Der Duft des tiefblauen Meeres
Über dieses Buch
Argentinien, 1897: Clarissa und Javier feiern ihren ersten Hochzeitstag mit einem Ausflug an die Iguazu-Wasserfälle. Doch der wunderschöne Tag endet schrecklich: Javier stirbt und Clarissa stürzt in den reißenden Iguazu.
Zur gleichen Zeit befindet sich der junge Arzt Robert Metzler auf einer Expedition durch den Dschungel. Am Flussufer findet er die ohnmächtige Clarissa. Robert bringt die Frau, die sich an nichts erinnern kann, zur Farm seiner Eltern, um sie dort gesund zu pflegen. Er ahnt nicht, dass Clarissa noch lange nicht in Sicherheit ist …
eBooks von beHEARTBEAT – Herzklopfen garantiert.
Über die Autorin
Sofia Caspari, geboren 1972, hat schon mehrere Reisen nach Mittel- und Südamerika unternommen. Dort lebt auch ein Teil ihrer Verwandtschaft. Längere Zeit verbrachte sie in Argentinien, einem Land, dessen Menschen, Landschaften und Geschichte sie tief beeindruckt haben. Heute lebt sie – nach Stationen in Irland und Frankreich – mit ihrem Mann und ihren zwei kleinen Söhnen in einem Dorf im Nahetal.
Sofia Caspari
DAS LIEDDESWASSERFALLS
beHEARTBEAT
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2014 by Bastei Lübbe AG, Köln
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2022 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Melanie Blank-Schröder
Landkarte: Reinhard Borner
Covergestaltung: Guter Punkt, München unter Verwendung von Motiven von © Boonyachoat/iStock/Getty Images Plus; MarinaZakharova/iStock/Getty Images Plus; atosan/iStock/Getty Images Plus; FooTToo/iStock/Getty Images Plus; KathySG/Shutterstock Images; yumehana/iStock/Getty Images Plus; yotrak/iStock/Getty Images Plus; Passakorn_14/iStock/Getty Images Plus
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7517-2177-6
be-heartbeat.de
lesejury.de
Für Julian und Tobias –unsere Reise geht weiter …
Buenos Aires ist dazu bestimmt,das Paris Südamerikas zu werden …
José Luro
Tango ist die Luft, das Leben,die Liebe oder die Trauer.Tango ist alles.
Carlos Matheos
Erster Teil
Cambio de vida – Veränderung
Iguazú, Río Paraná, Villa Veinticinco de Mayo,Santa Ana, Buenos Aires, Los Aboreros,auf der Britannia
1898 bis 1899
Erstes Kapitel
Bei den Iguazú-Wasserfällen
Clarissa konnte nicht sagen, wie lange sie schon bis zur Taille im tosenden Wasser hing. Verzweifelt klammerte sie sich an den tief hängenden Ästen eines Baumes fest, doch ihre Kräfte schwanden zunehmend. Sosehr die junge Frau auch kämpfte, sie konnte sich nicht mehr halten. Und dieses Mal, das wusste sie, war es endgültig. Sie würde loslassen, der Fluss würde sie unerbittlich in seine Tiefen hinunterziehen und nie wieder hergeben.
Clarissa schloss die Augen. Sofort waren die schrecklichen Bilder zurück, die für immer in ihr Gedächtnis eingebrannt sein würden: der Ausflug mit Javier zu den Wasserfällen, die fremden Männer, die plötzlich aufgetaucht waren und auf sie, Clarissa, geschossen hatten – um doch Javier zu treffen.
Wie sie in den Fluss gelangt war, konnte sie nicht sagen, nur noch, dass der mächtige Iguazú sie sofort mit sich gerissen hatte. Bis es ihr dann gelungen war, nach diesen Ästen zu greifen. Ein Schluchzen löste sich aus Clarissas Kehle, unhörbar im Gebrüll des Wassers.
Javier ist tot … Welchen Sinn macht es da noch weiterzuleben? Warum lasse ich nicht einfach los?
Ihr Herz wollte sich doch nur fortstehlen zu Javier, allein ihr Körper verweigerte ihr diesen Wunsch, ihr verräterischer Körper kämpfte unerbittlich ums Überleben.
Lange werde ich nicht mehr durchhalten …
Noch während Clarissa dieser Gedanke durch den Kopf fuhr, lösten sich ihre Finger. Sie tauchte unter, schluckte Wasser, kämpfte sich panisch hustend wieder nach oben. Der Fluss riss sie unerbittlich mit sich wie ein Stück Treibholz.
Warum bin ich nicht getroffen worden? Warum bin ich noch hier? Ich will bei Javier sein.
Doch sie hielt den Kopf weiter aus dem Wasser. Sie war eine gute Schwimmerin. Womöglich war das ihr Verhängnis …
Clarissa drehte sich auf den Rücken, erblickte einen Streifen Himmelblau zwischen einem Blätterdach aus vielfachen Grüntönen. Grün, grün, grün – in allen Schattierungen. Grün gefilterte Sonnenstrahlen.
Was wird mit meinen Eltern geschehen? Werde ich sie wiedersehen?
Ein Strudel wirbelte sie herum und zog sie unter die Wasseroberfläche. Sie schlug und trat um sich, schoss endlich wieder nach oben, rang nach Atem, hustete und spuckte, dachte an das Blut, das sie besudelt hatte, Javiers Blut.
Morgen wären sie ein Jahr verheiratet gewesen, ein schwieriges, aber auch ein glückliches Jahr.
Wieder schwappte Wasser über ihr Gesicht. Wieder spuckte und hustete sie. Clarissa war völlig erschöpft, ihre Gedanken bewegten sich schwerfällig.
Javiers Lächeln … seine Wärme. Seine festen Arme um meinen Körper … Nie, nie wieder.
Und plötzlich … Da war mit einem Mal etwas Festes unter ihren Füßen … Boden, schlammiger, von Steinen durchsetzter Boden … Der Geruch modernder Blätter, hier und da eine Berührung, rascher als ein Atemzug. Fische? Doch welche? Und dann sah sie es. Die Strömung hatte sie ans Ufer getrieben. Der Fluss gab sie frei.
Wo bin ich?
Clarissa schloss die Augen. Die Uferböschung, sie musste hinaufrobben … Doch sie war so unendlich müde. Ihre Gedanken flatterten wie wilde Vögel umher, mischten Vergangenes mit der Gegenwart: Javier, die Gesichter ihrer Eltern, Don Jorge, die Arbeit auf dem elterlichen rancho, dem kleinen Bauernhof in der Provinz Entre Ríos. Schüsse, die das Wasser rings um sie aufpeitschen ließen.
Ich will leben.
Nochmals nahm Clarissa alle Kraft zusammen und schob sich ein weiteres Stück die Böschung hinauf. Dann ließ sie den Kopf auf die Arme sinken. Nur ihre Füße wurden jetzt noch vom Flusswasser umspült. Moder und Feuchtigkeit drangen in ihre Nase, ein ihr nicht unbekannter Geruch nach Leben und Tod. Clarissa drehte mühsam den Kopf zur Seite, um besser atmen zu können. Alles war plötzlich so schwer. Ihre Wange schmiegte sich in den Schlamm. Riesige Bäume wuchsen in nächster Nähe, Geräusche vermischten sich miteinander: das Rauschen des Wassers, Vögel, Brüllaffen … der tiefe Wald der Iguazú-Wasserfälle …
Clarissa sah dunkel glänzende Wassertropfen auf den Pflanzen neben sich, meinte, Spinnen und anderes Getier zu erkennen und einen leuchtend bunten winzigen Frosch. Die Hitze des Regenwaldes war so drückend, so allumfassend. Das Wasser auf ihrer Haut mischte sich mit ihrem Schweiß. Sie kannte diese große Hitze, sie war immer vor ihr ins Haus geflüchtet. Wie schnell man sich an solche Annehmlichkeiten gewöhnte.
Ich will schlafen, fuhr es ihr durch den Kopf, nur noch schlafen … Ich bin so erschöpft, so furchtbar, so wahnsinnig erschöpft.
Ein neues Rascheln … Da war etwas, das durch das Gebüsch schlich und dabei doch kaum ein Geräusch verursachte. Mit allerletzter Kraft stemmte Clarissa sich nach oben, sah etwas Geflecktes, das sich seiner Umgebung perfekt anpasste. Bernsteinfarbene Katzenaugen, ein Geruch, der, wie sie jetzt erfasste, schon da gewesen war, bevor sie den Jaguar schattengleich aus dem Unterholz gleiten sah.
Robert Metzler lenkte seinen Wallach Silberfuchs nur mit den Schenkeln, während er sich bemühte, die Blechdose zu öffnen, die ihm seine Mutter Elsbeth in die Satteltasche gesteckt hatte, damit er sie immer wieder mit frischem Proviant füllen konnte. Er hatte sich entschieden, während des Reitens zu essen, wollte kein bisschen seiner ohnehin knapp bemessenen Zeit verlieren, denn zu bald schon musste er nach Rosario zurückkehren, wo er lebte und eine gut gehende Arztpraxis betrieb.
Vier Tage zuvor war er früh am Morgen vom rancho seiner Eltern aus aufgebrochen. Sein Ziel lag nicht mehr so weit entfernt, aber man wusste hier oben nie, wie der Zustand der Wege war. In der vergangenen Nacht hatte er in einer ihm bekannten pulpería übernachtet, jener typisch argentinischen Mischung aus Schenke und Einkaufsladen, die in diesem Fall sogar über einen weiteren Raum und einige Betten verfügte. Er freute sich auf sein kleines Abenteuer. Mindestens einmal im Jahr reiste er für einige Wochen hierher in den tiefen Urwald, in das Grenzgebiet zwischen Paraguay, Argentinien und Brasilien, um sich dem Studium der Tier- und Pflanzenwelt zu widmen.
Für einen Moment hielt Robert jetzt in seinen Bemühungen, die Blechdose zu öffnen, inne und beobachtete einen der unzähligen vielfarbigen Schmetterlinge, die durch die schwere, feuchte Luft tanzten. Sonnenstrahlen, die durch das an dieser Stelle nicht vollkommen dichte Blätterdach fielen, brachten die hellbraunen Haare des jungen Mannes zum Schimmern. Seine dunkelbraunen Augen wurden schmaler, als er nun einem besonders schönen Morphofalter hinterherblickte, der ihn in seiner metallisch blauen Färbung an ein taumelndes Stück Himmel gemahnte.
Robert sah sich um, beobachtete den Wald links und rechts des schlammigen Weges. Dichte Farne wuchsen hier, und Bromelien grüßten mit ihrer Farbenpracht, darüber erhoben sich Baumriesen, deren Brettwurzeln als Stütze für eine Vielfalt von Kletterpflanzen dienten. Ameisen- und Eisenholzbäume mit dunkelgrünen Blättern, die sich im Herbst leuchtend orangerot bis violett verfärben, ragten in den Himmel, Orchideenbäume und der Lapacho, den man auch Baum des Lebens nennt und der von Mai bis August, je nach Art, rosarote, gelbe und weiße Blüten trägt. Aus der Ferne drangen mit einem Mal die Rufe von Brüllaffen zu Robert herüber. Etwas musste sie aufgescheucht haben, um diese Zeit hielten sie eigentlich Mittagsruhe.
Nun, vielleicht hatte eines der Tiere eine Raubkatze entdeckt, von denen einige durch die Wälder der Umgebung streiften. Mit dem Jaguar, dem Puma und dem Ozelot hatte ihn sein Freund Jacy vom Volk der Guaraní, einem Indio-Stamm, der im Grenzgebiet heimisch war, bekannt gemacht. Jacy und Robert waren zusammen aufgewachsen. Jacys Familie hatte die seine nach ihrer Ankunft in der Neuen Welt unterstützt. Robert dachte gern an diese Zeit zurück. Jedes Mal, wenn er aus dem Schmutz und Gestank Rosarios herkam, fühlte er sich frei – wie damals, als Jacy und er noch durch die Wälder in der Nähe seines Elternhauses gestreift waren.
Es raschelte. Robert sah das helle Fell, die lang gezogene Schnauze und den langen geringelten Schwanz eines Nasenbären im Blättergrün. Er beobachtete ihn eine Weile, dann widmete er sich erneut seiner Blechbüchse, die wenig später endlich nachgab: Brot, das er in der pulpería gekauft hatte, und der letzte Rest Räucherwurst von zu Hause, dazu ein Päckchen Yerba-Mate, den herben Tee, den man in Argentinien so gern mit viel Zucker gesüßt trank und den er sich am Abend am Lagerfeuer zubereiten würde. Er liebte das Ritual, er würde es genießen, auch wenn er allein war – die calabaza, das birnenförmige Behältnis, aus dem der Tee getrunken wurde, und die bombilla, der Trinkhalm aus Metall mit seinem typischen kleinen Sieb, befanden sich gut verstaut in seinem Gepäck.
Robert lächelte. Er bedauerte, dass er an diesem Tag den letzten Rest seines Proviants vertilgen würde. Seine Mutter liebte es, ihren Jungen zu umsorgen, wenn der seine Eltern besuchte. Was viel zu selten geschah, wie sie ihn sanft zu rügen pflegte.
»Es ist einfach ein gutes Stück von Rosario hinauf nach Villa Veinticinco de Mayo«, führte er dann jedes Mal an, lächelte und fügte hinzu: »Ich besuche euch doch, sooft ich kann.«
»Wie läuft die Praxis?«, wechselte der Vater in solchen Momenten gern das Thema.
Auch er vermisste seinen Sohn, auch ihm fehlte die helfende Hand, die in arbeitsreichen Zeiten durch einen Knecht ersetzt werden musste, aber er sprach nicht gern darüber.
»Gut, sehr gut«, antwortete Robert, während ihn seine Eltern ehrfurchtsvoll anstarrten.
Er wusste, dass es dieser Moment war, in dem sie sich ins Gedächtnis riefen, dass ihr Sohn eine Arztpraxis in Rosario führte. Ihr Junge, das Kind einfacher Bauern. Keiner der Metzlers hatte sich je vorstellen können, dass einer von ihnen Mediziner werden würde. Und er galt als freundlicher, geschickter Arzt. Mancher behauptete, dass die Damenwelt Rosarios Dr. Metzler besonders gern aufsuche. Robert pflegte solche Behauptungen allerdings stets mit einem Lachen zurückzuweisen, er machte sich in jedem Fall wenig Gedanken darum.
Robert hob die geräucherte Wurst an seine Nase. Der Duft war unverkennbar und brachte Kindheitserinnerungen zurück. Mit Appetit, aber langsam und bedächtig, begann er zu essen. Seit seiner Kindheit war Robert es gewöhnt, sich zu beschränken, und auch heute benötigte er nicht viel zum Leben, worauf er stolz war. Seine Eltern bauten Tabak an und Gemüse für den Eigenbedarf. Mit der Ernte der wilden Yerba aus den umliegenden Wäldern verdienten sie sich ein kleines Zubrot. Robert dachte an die Anlagen, die sich in Villa Veinticinco de Mayo mittlerweile mit der Verarbeitung und Verschiffung der Yerba-Ernte befassten. Die kleine Siedlung wuchs stetig.
Robert kaute langsam und nachdenklich. Nach einer Weile verstaute er den Rest seines Essens in der Blechbüchse und schob sie zurück in die Satteltasche. Jetzt freute er sich zuerst einmal darauf, Jacy wiederzusehen, denn wie immer würde Robert sein Pferd bei dessen Hütte unterstellen und dann zu Fuß weiter in den tiefen Dschungel vordringen. Ohne Pferd war man dort wendiger. Nachdenklich schaute Robert in die Ferne. Der Gedanke, im Dschungel von Misiones nach Heilpflanzen zu suchen, war ihm seltsamerweise erst gekommen, als er schon begonnen hatte, als Arzt zu praktizieren. Und es war natürlich Jacy gewesen, von dem er erfahren hatte, was diese geheimnisvolle Welt den Menschen bot: Blätter, die man gegen Unwohlsein kaute, Rinde, die gegen Fieber eingesetzt werden konnte, Kräuter gegen Husten und so vieles mehr. Er hatte bereits mit uña de gato, der Katzenkralle, experimentiert, die sich gut für ein Leiden einsetzen ließ, das meist ältere Männer befiel und zu häufigem Harndrang führte. Das Rezept dazu wurde in der Familie des Freundes schon seit Generationen weitergegeben, ebenso jenes für einen Hustensaft aus der caraguata, einer der Ananas ähnlichen, aber sehr stacheligen Bromelienart, und den Blättern des Ambay-Baumes. Epazote, den wohlriechenden Gänsefuß, setzte Robert bereits erfolgreich zur Bekämpfung von Parasiten ein.
Auch wenn er sich als Junge nicht dafür interessiert hatte, erkannte der Neunundzwanzigjährige den Reichtum des Waldes, und dies nicht nur wegen seiner großen Anzahl an Tieren, wegen des Yerba-Mate oder der verschiedenen Holzsorten, nach denen weiße Geschäftsleute sich die Finger leckten.
Wenig später erreichte Robert Jacys Hütte, an der er Silberfuchs wie verabredet zurückließ. Jacy schien unterwegs zu sein. Mit leisem Bedauern setzte er seinen Weg fort.
Als er fast sein Ziel erreicht hatte – einen Baum, von dem ihm Jacy in einem Brief erzählt hatte –, schreckte ihn ein ungewöhnlicher Laut auf, der zu den Geräuschen der Wildnis nicht passte. Es war ein menschlicher Laut, ein Angstlaut, ein gequälter Ruf.
Robert zögerte keinen Augenblick. Kurz horchte er, ob das Geräusch noch einmal zu hören war, dann schlug er auf gut Glück den Weg in Richtung Fluss ein. Er war sich sicher, dass der Laut von dort gekommen war, und er hoffte, dass er denjenigen finden würde, der ihn ausgestoßen hatte. In dieser Gegend nannte man den Dschungel nicht umsonst El Impenetrable, den Undurchdringlichen. Wer sich hier verirrte, hatte kaum eine Chance, gefunden zu werden.
Der letzte Gedanke hieß Robert seine Schritte noch einmal beschleunigen, so gut es die Umgebung zuließ. Umgestürzte Bäume lagen im Weg, Wurzeln griffen nach seinen Knöcheln wie Hände mit überlangen Fingern. Manchmal musste er Äste mit der Machete abschlagen, um weiterzukommen.
Wenig später hatte er das Flussufer erreicht. Robert erstarrte. Auf der anderen Seite des hier recht schmalen Nebenarms des Río Iguazú lag eine reglose Gestalt. Über ihr kauerte ein Jaguar und betrachtete den Störenfried aus seinen aufmerksamen Katzenaugen.
Robert handelte sofort. Er wusste, dass der Fluss an dieser Stelle nicht besonders tief war, das Wasser würde ihm allerhöchstens bis zur Hüfte gehen. Blitzschnell warf er sein Gepäck ab und sprang mit Gebrüll auf die Raubkatze zu. Wie erhofft, erschrak das Tier und ließ von seiner Beute ab. Ein paar Schritte wich der Jaguar zurück, dann zögerte er.
Robert spürte, wie das Adrenalin durch seine Adern schoss, während er die Arme hob und die Großkatze erneut anbrüllte. Sie fauchte aufgebracht, wandte sich dann aber glücklicherweise um und war einen Moment später lautlos im Dschungel verschwunden.
Robert sah dem Jaguar aufmerksam hinterher, bis er sicher war, dass er nicht zurückkommen würde, dann kniete er sich neben die Gestalt am Ufer. Eine Frau, wie er sich jetzt vergewissern konnte. Sie war noch jung, lag auf der Seite, eine Wange in den Uferschlamm gepresst, die Augen fest geschlossen. Ihre Kleidung war nass, ebenso ihre Haare. Ein paar Strähnen waren ihr in das – wie man trotz des Schmutzes sehen konnte – fein geschnittene blasse Gesicht gefallen. Robert schätzte sie auf Anfang zwanzig.
Er musste schlucken, als er die fleckige Bluse bemerkte, die sie trug. Blut? Hatte der Jaguar sie etwa verletzt? War er doch zu spät gekommen? Er näherte sich ihrem Gesicht. Nein, die Fremde atmete ruhig, kaum merklich, aber sie atmete. Sie musste kurz nach ihrem Hilfeschrei das Bewusstsein verloren haben, vielleicht als sie den Jaguar erblickt hatte.
Robert drehte die junge Frau behutsam auf den Rücken. Ihre Augenlider flatterten kurz, sie öffnete die Augen jedoch nicht. Er tastete nach ihrem Puls, der zu seiner Beruhigung gleichmäßig war. Dann suchte er eine Stelle, wo er ihr aus großen Blättern ein Lager bereitete. Als er sie hochhob, wandte sie den Kopf mit einem kläglichen Seufzer gegen seine Brust. Der Seufzer war der letzte Laut, den er für die nächste Stunde von ihr hörte.
Robert spürte, dass ihn die Frau seit geraumer Zeit heimlich beobachtete, ließ sich aber nichts anmerken. Ihre Ohnmacht war nicht tief gewesen. Ihre Bewegungen hatten das recht bald gezeigt. Weil er sie nicht allein lassen wollte, sammelte er in der allernächsten Umgebung einige Früchte, darunter ein paar Paradiesnüsse und Tukanfrüchte, und richtete alles, zusammen mit dem Rest seiner eigenen Vorräte, auf einer Unterlage aus runden Blättern an. Irgendwann verbarg die Fremde ihre Blicke nicht mehr, und Robert nahm das zum Anlass, sie ebenfalls anzuschauen. Er räusperte sich.
»Guten Tag, ich bin Robert Metzler«, sagte er auf Spanisch. »Wie geht es Ihnen, Señorita?«
Er sah, wie sie mit ihren schmalen Händen zuerst flüchtig ihre Kleidung berührte, sich dann durchs Haar fuhr und die Schlammspuren auf ihrem Gesicht betastete.
»Ich … ich weiß es nicht«, entgegnete sie nach einigem Zögern.
Kurz löste sie den Blick von seinem Gesicht und sah sich um. Sie wirkte nicht überrascht, nur ein wenig fassungslos. Dann schaute sie ihn wieder an.
»Wie heißen Sie?«, fragte Robert. »Wie sind Sie hierhergekommen?«
»Ich … Clarissa … ich …«, stammelte sie, »… ich heiße Clarissa Kra … Kramer und ich … Ich weiß nicht, wie ich hierhergekommen bin.« Sie schaute sich nochmals um, und jetzt schien ihr bewusst zu werden, wo sie sich befand. »Nein, ich weiß es nicht … Ich weiß es wirklich nicht. Wo bin ich? Wie bin ich um Gottes willen hierhergekommen?«
»Sie befinden sich im argentinisch-brasilianischen Grenzgebiet von Misiones, im Dschungel«, hörte Robert sich antworten.
Er wusste nicht genau warum, aber er kam sich seltsam dabei vor, so mit ihr zu reden. Mittlerweile schloss er aus, dass sie zu einer der Siedlungen gehörte, die sich in der Gegend befanden. Doch wenn sie nicht von dort kam, woher kam sie dann? Was war das nur für eine Situation, in die er da geraten war? Hier im Wald zu sitzen, mit einer Frau, die nicht wusste, wie sie hergekommen war … Weit und breit hatte er kein Boot bemerkt. War sie hergeschwommen? Er konnte sich das nicht erklären.
Robert musterte die junge Frau eingehend. Sie war tatsächlich sehr hübsch, und wie er schon bemerkt hatte, trug sie hochwertige, praktische Kleidung, wie man sie anhatte, wenn man im Dschungel unterwegs war. Aber sie war doch gewiss nicht allein gewesen? Was war mit ihrer Begleitung geschehen?
Nun, vielleicht irrte er sich auch. Es gab heutzutage die seltsamsten Entwicklungen – dazu gehörten Frauen, die allein durch die Weltgeschichte reisten. Robert wusste zwar nicht, was er davon halten sollte, wollte sich aber nicht anmaßen, darüber zu urteilen.
Er räusperte sich. »Nun, Sie scheinen in jedem Fall unverletzt zu sein, Señorita Kramer. Ich hoffe, Sie verzeihen mir, dass ich mich davon überzeugt habe. Das Blut auf ihrer Bluse hat mich beunruhigt.«
»Blut?«
Von einem Moment auf den anderen wurde sie kalkweiß.
»Ja, Blut«, bestätigte Robert. »Mit wem waren Sie unterwegs? Ist einem Ihrer Begleiter etwas geschehen? Wurden Sie von einer Raubkatze angegriffen?«
Ihr Blick irrte von ihm weg. Ihre Lippen bewegten sich, und für einen kurzen Augenblick erschien es ihm, als erinnerte sie sich an etwas, doch sie sagte nichts.
Er wollte sie nicht weiter bedrängen. Wenn sie sich tatsächlich nicht erinnerte, dann war sie sicherlich verängstigt, vielleicht sogar verstört …
»Ich bin Arzt«, erklärte Robert in entschuldigendem Tonfall. »Deswegen habe ich Sie untersucht … Sie müssen nicht denken, dass ich …«
Er brach ab, als er ihren Blick bemerkte, der sich nun wieder voll und ganz auf ihn richtete – ein unergründlicher Blick voller Traurigkeit, den er sich nicht erklären konnte.
»Das ist schon in Ordnung«, sagte sie langsam, als fiele ihr jedes Wort schwer. »Ganz gewiss, das ist in Ordnung. Ich habe Ihnen wirklich sehr zu danken. Ohne Sie … Ich weiß nicht, was geschehen wäre, wirklich, ich …« Clarissa Kramers Blick schweifte in die Ferne, dann holte sie tief Luft. »Wie bin ich nur hierhergekommen?«
Sie stärkten sich mit Früchten und Nüssen, dem Brot und der restlichen Wurst und brachen dann auf. Inzwischen wusste Robert zumindest, dass Clarissa Kramer Deutsch sprach, was man nicht mehr von allen sagen konnte, die einen deutschen Namen trugen. Gemeinsam mit ihr dauerte es doppelt so lange als allein, zu Jacys kleinem Holzhaus zu gelangen, ihr langer Rock behinderte sie. Sie war es offenbar auch nicht gewöhnt, lange Strecken zu laufen. Zum Schluss stützte sie sich schwer auf ihn, und Robert spürte bald, wie ihm der Schweiß unablässig über den Rücken rann. Manchmal musste er salzige Tropfen aus den Augen blinzeln.
Robert war erleichtert und Clarissa vollkommen erschöpft, als sie endlich den Rand des Urwalds erreichten. Jetzt ging es nur noch über eine Wiese und am Garten vorbei. Silberfuchs, der am Wegrand hinter einem Zaun graste, wieherte, als er seinen Herrn bemerkte. Hinter Jacys Hütte stieg Rauch auf. Offenbar war Jacy in der Außenküche.
Gott sei Dank, er ist da, fuhr es Robert durch den Kopf. Im nächsten Moment wieherte sein Pferd erneut und lockte damit auch Jacy hinter dem Holzhäuschen hervor. Der Freund verharrte mit einem verblüfften Ausdruck auf dem Gesicht. »Robert …« Jacy nickte ihm grüßend zu und betrachtete dann neugierig die Frau an Roberts Seite.
»Das ist Clarissa Kramer«, antwortete Robert an ihrer Stelle. »Señorita Kramer, das ist mein guter Freund Jacy.«
Robert spürte, wie sich Clarissa erst bei seinen Worten etwas entspannte. Was macht ihr nur solche Angst?, fragte er sich. Dass sie sich fürchtete, spürte er deutlich, und diese Furcht hatte während ihrer gemeinsamen Wanderung durch den Urwald noch zugenommen. Erinnerte sie sich inzwischen an etwas? Wusste sie vielleicht wieder, was ihr geschehen war?
»Guten Tag, Señorita Kramer«, sagte der junge Guaraní freundlich.
»Ich habe Señorita Kramer am Fluss gefunden«, erklärte Robert weiter. »Sie weiß nicht, wie sie dorthin gekommen ist. Sie …«
»Ah!« Jacy musterte die junge Frau interessiert, aber kurz genug, um sie nicht in Bedrängnis zu bringen. »Hättest du vielleicht einen Kittel oder ein Hemd für die Señorita?«, fragte Robert. »Señorita Kramers Bluse ist …«
»Ich habe es schon gesehen.« Jacy runzelte die Stirn. »Natürlich habe ich ein Hemd, auch Wasser zum Waschen, Essen und ein Nachtlager für euch, mein Freund. Es ist gewiss zu spät, um heute noch zu deinen Eltern aufzubrechen.«
Robert nickte dankbar. »Du hast Recht. Das ist es wirklich. Ich danke dir.«
Jacy ging offenbar davon aus, dass er die junge Frau sofort zu seinen Eltern bringen würde. Jacys Fähigkeit, seine Gedanken zu lesen, verwunderte ihn schon längst nicht mehr.
Der Freund brummte etwas Unverständliches und verschwand dann in seiner Hütte. Wenig später kam er mit einem einfachen Hemd zurück. Clarissa zog sich zurück, um sich rasch umzukleiden. Ihr Rock war während der gemeinsamen Wanderung etwas getrocknet, die Bluse aber würde sich nicht auf die Schnelle säubern lassen, das Blut ließ sich vielleicht gar nicht mehr auswaschen.
Robert folgte Jacy indes schweigend zu der Feuerstelle, die sich hinter der Hütte befand. Das Essen, ein Gericht aus Reis und Bohnen, war schon fertig, und es war genügend da, es blieb nur, zwei weitere Teller auf den Tisch zu stellen. Die junge Frau kehrte so rasch zurück, dass die beiden Männer gar nicht dazu kamen, sich über die Fremde auszutauschen.
Clarissa, die kaum etwas aß, zog sich bald in eine von Jacys Hängematten zurück. Als Robert kurze Zeit später nach ihr schaute, war sie eingeschlafen. Einen Moment blieb er noch neben ihr stehen und betrachtete sie – ihr feines Gesicht, die langen Wimpern und das glatte silberblonde Haar. Sie war hübsch. Bisher hatte er sich diesen Gedanken versagt, aber irgendetwas war da an ihr, das ihn anzog. Was hatte sie nur in den Dschungel verschlagen? Und was war dort geschehen? Robert hoffte, es bald herauszufinden.
Nach einer Weile – Robert konnte sich nur schwer von der jungen Frau trennen – kehrte er zu Jacy zurück. Schweigend saßen die Freunde vor der Hütte und tranken Mate. Robert füllte die calabaza immer wieder mit heißem Wasser auf und sie nahmen abwechselnd einen Schluck mit der bombilla, so, wie es Brauch war.
»Du hast sie am Fluss gefunden?«, fragte Jacy endlich.
Robert schreckte aus seinen Gedanken auf. »Ja.«
Jacy drehte die Kalebasse in den Händen, bevor er weitersprach. »War irgendjemand in der Nähe?«
»Nein, natürlich nicht. Sonst hätte ich sie nicht hergebracht.«
Jacy reichte Robert die Kalebasse zurück, doch der trank nicht.
»Weißt du, ich habe sie zuerst nur gehört. Sie rief irgendetwas, vielleicht war es auch nur ein Schreckenslaut. Das kann ich nicht sagen. Ich rannte los und …« Er schüttelte den Kopf. »Als ich sie erreichte, stand ein Jaguar direkt über ihr. Sie muss schon seinen Atem gespürt haben.« Er schauderte bei der Erinnerung, bevor er fortfuhr. »Ich habe ihn verjagt. Sie war ohnmächtig, wie lange genau, kann ich nicht sagen.«
Robert schwieg und nahm dann doch noch einen Schluck Mate. »Hast du ihre Kleider gesehen?«, fragte er unvermittelt.
»Ja.«
»Sie ist gewiss keine Mate-Sammlerin«, fuhr Robert nachdenklich fort. »Und sie kann auch zu keiner der Siedlungen gehören. Ich wüsste jedenfalls von keiner, die dort nahe genug läge, sodass sie sich verlaufen haben könnte. Ganz bestimmt kommt sie auch aus keinem der Holzfällerlager, die Frauen dort sind viel gewöhnlicher …«
Jacy quittierte die letzten Worte seines Freundes mit einem amüsierten Grinsen. »Es sind Prostituierte«, präzisierte er.
»Die nächsten Orte oder gar Städte sind auch viel zu weit entfernt«, fuhr Robert ungerührt fort, »und …«
»Vielleicht hat sie einen Ausflug zu den Fällen gemacht«, bemerkte Jacy.
Im Jahr 1892 war die Gegend um die Wasserfälle von Iguazú erstmals kartografiert und damit dem Dunkel des Vergessens entrissen worden, nachdem der spanische Konquistador Álvar Núñez Cabeza de Vaca diesen Ort bereits 1541, auf der Suche nach dem geheimnisvollen Reich der Inka, als erster Europäer erreicht hatte. Cabeza de Vaca hatte den tosenden Fällen damals den Namen Salto de Santa Maria gegeben. Der Name Iguazú hatte seinen Ursprung in den Guaraní-Wörtern y für Wasser und guasu für groß.
»Ein Ausflug an die Fälle?« Robert schüttelte den Kopf, doch Jacy ließ sich nicht beirren.
»Ich halte das für die einzige Möglichkeit, nachdem wir alles andere ausgeschlossen haben. Sie war bei den Fällen, und sie war sicherlich nicht allein dort. Wer hat sie also begleitet, und was ist mit ihm geschehen? Das Blut auf ihrer Bluse … Du wirst es herausfinden müssen, Freund, wenn dir etwas an ihr liegt.«
»Wenn mir etwas an ihr liegt?«
Jacy lächelte nur. Robert starrte nachdenklich vor sich hin. Etwas sagte ihm jedoch, dass der Freund Recht hatte. Clarissa Kramer war in keinem Fall allein gewesen. Wo aber waren ihr Begleiter oder ihre Begleiter geblieben? Und warum hatte sie sie mit keinem Wort erwähnt? Waren sie verwundet worden von einem Tier, an den glatten Felsen abgestürzt? Was hatte Clarissa mitansehen müssen? Was gar getan? Nein, den letzten Gedanken wollte er nicht zulassen!
Robert stellte die calabaza vor sich auf den Tisch und seufzte. »Ich werde es herausfinden, mein Freund.«
Jacy zögerte und blickte dann ernst drein. »Ich hoffe, du bist vorsichtig.«
Roberts Augen verengten sich. »Warum sagst du das?«
Jacy kam nicht zum Antworten, denn hinter ihnen war ein Geräusch zu hören. Die Männer wechselten einen Blick.
»Waren das Schritte?«, fragte Robert dann.
»Ich weiß es nicht«, gab Jacy hörbar besorgt zurück. »Ich habe nicht darauf geachtet. Unser Gespräch hat mich gefangen genommen.«
Robert stand auf. »Ich schaue besser mal nach.«
In der Hütte war es mittlerweile dunkel geworden. Es dauerte einen Augenblick, bis Robert sich an die Lichtverhältnisse gewöhnt hatte. Clarissa lag in der Hängematte, die sanft hin- und herschaukelte. Vom Nachtwind? Oder schlief sie unruhig auf der sicherlich ungewohnten Lagerstatt? Ihre Augen waren geschlossen. Robert wandte sich noch in der Tür um und ging zurück.
Clarissa bemerkte erst, dass sie die Luft angehalten hatte, als sie keuchend neuen Atem schöpfte. Sie hatte es gerade noch rechtzeitig von der Tür zurück in die Hängematte geschafft, bevor Robert Metzler dort aufgetaucht war. Wer war dieser Mann nur, der sie im Wald gefunden und hergebracht hatte? Zuerst war sie ihm nur dankbar gewesen, doch konnte sie ihm überhaupt trauen? Sie wusste rein gar nichts von ihm oder diesem Jacy. Sie war ihnen vollkommen ausgeliefert.
Zweites Kapitel
Robert und Clarissa bereiteten am frühen Vormittag des nächsten Tages ihren Aufbruch vor und hofften, den rancho der Metzlers spätestens in sieben Tagen zu erreichen. Nach einem raschen Frühstück, bestehend aus Maisbrei und Mate, luden sie Roberts Gepäck auf einen Karren, den sie bei einem Cousin am Río Paraná abgeben konnten, so war der erste Teil der Strecke gesichert. Silberfuchs wurde, wie immer etwas unwillig, zum Kutschpferd. Mit nur einem Reittier würden sie zu lange brauchen.
Während Jacy und Robert das Pferd vor den Karren spannten, sprach Robert dem Tier beruhigend zu, doch es tänzelte, suchte unablässig zur Seite auszubrechen und bewegte seinen Kopf ruckartig hin und her. Jacy überließ ihnen zwei Decken, mit denen Clarissa den Karren auslegte.
Jacy umarmte Robert zum Abschied. »Pass auf dich auf, mein Freund, und komm bald wieder«, sagte er. »Grüß deinen Vater Guaraciaba von mir.«
»Gern.« Robert lächelte.
Guaraciaba, Haare der Sonne, diesen Namen hatten die Guaraní Carl, Roberts heute grauhaarigem, einst weizenblondem Vater gegeben.
Jacy wandte sich an Clarissa. »Auch Ihnen alles Gute, Señorita. Ich hoffe, Sie erinnern sich bald daran, was Ihnen widerfahren ist, und finden zu den Ihren zurück.«
»Ich … danke«, antwortete Clarissa knapp, auch wenn es für einen Moment fast so ausgesehen hatte, als wollte sie mehr sagen.
Was wohl, fuhr es Robert durch den Kopf, was wollte sie uns sagen? Doch vorerst blieb keine Zeit, weiter nachzudenken. Silberfuchs warf den Kopf hoch und forderte seine ganze Aufmerksamkeit. Wahrscheinlich würde es wieder seine Zeit dauern, bis sich das Tier an seine neue Aufgabe gewöhnt hatte, weshalb er sich für den Anfang gut konzentrieren musste. Silberfuchs war nicht das beste Zugpferd, und Robert hätte ebenfalls eine andere Form der Fortbewegung bevorzugt. Immerhin, suchte er den Vorteil zu sehen, kann sich Clarissa während der Fahrt auf dem Karren ausruhen.
Am Morgen war ihm wieder aufgefallen, wie erschöpft sie noch war, obgleich ihr körperlich eigentlich nichts fehlte. Ihre Erschöpfung rührte also offenbar von etwas anderem. Was hatte sie nur so nachhaltig verstört? Und warum, falls sie sich doch erinnerte, wollte sie nicht davon erzählen?
Obgleich er sie zuerst als unsinnig abgetan hatte, sann Robert nun auch über Jacys Warnung nach. Hat er Recht? Muss ich dieser jungen Frau misstrauen, die sich mit jeder gemeinsamen Minute mehr in mein Herz stiehlt? Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass irgendeine Gefahr von ihr ausgeht. Sie wirkt so unschuldig. Im hellen Tageslicht konnte er jetzt auch ihre Augenfarbe erkennen, ein tiefes Blau, das je nach Lichteinfall braune und grüne Einsprengsel zeigte. Sie war so unglaublich schön. Sie kam ihm vor wie ein Schmetterling, der gerade geschlüpft war und sich in voller Anmut zeigte.
Robert seufzte. Er war stets ein nüchterner Mann gewesen, der für seinen Beruf und seine Forschungen lebte. Nun war er drauf und dran, sich Hals über Kopf zu verlieben. Er war zu solchen Gefühlen bisher nicht in der Lage gewesen und wusste wirklich nicht, was er davon halten sollte.
Er warf Clarissa einen kurzen Blick zu. Sie saß seit ihrem Aufbruch reglos auf der Fläche des Karrens und starrte schweigsam vor sich hin. Eine Zeit lang fuhren sie weiter, ohne ein Wort zu wechseln. Der von feuchtem Laub bedeckte Weg und das widerspenstige Pferd forderten alle Aufmerksamkeit. Ab und an musste Robert sogar absteigen, um Silberfuchs zu führen. Dann wieder fuhren sich die Räder im nassen Untergrund fest, und sie mussten beide schieben. Zwischen den hohen Bäumen begleitete sie stetig ein Streifen Himmelblau, während die Sonne höher und höher stieg. Schon bald nach Sonnenaufgang war es warm geworden, jetzt stieg die Temperatur noch deutlich an. Die Luftfeuchtigkeit lastete drückend wie eine zu warme Decke auf ihnen. Als die Sonne an ihrem höchsten Punkt stand, lenkte Robert den Wagen zu einer schattigen Stelle am Wegrand. Beide nahmen sie auf dem Karren Platz. Robert und Clarissa schlossen erschöpft die Augen. Die Rufe der Brüllaffen, die am Morgen noch durchdringend zu hören gewesen waren, verstummten endgültig. Hin und wieder ließ sich noch der kurze Warnruf eines Vogels hören. Doch nicht jeder ruhte. In unmittelbarer Nähe führte eine Straße Blattschneiderameisen vorbei, es hatte den Anschein, als wandelten grüne Blätter über den Weg. Auch ein paar Schmetterlinge taumelten von Blüte zu Blüte.
Robert spähte nachdenklich in den Wald hinein. In der Nähe des Weges war er nicht so dicht, aber nur wenige Schritte weiter schon bildeten Laub, Stämme, Büsche und Lianen jenen undurchdringlichen Urwald, der seine Kindheit wie ein stetes verlockendes Geheimnis begleitet hatte. Er schaute wieder zu Clarissa, deren Atemzüge ihm zeigten, dass sie ebenfalls nicht schlief. Einen Augenblick zögerte er noch, dann gab er sich einen Ruck. Er musste einfach versuchen, mehr zu erfahren.
»Wissen Sie zumindest, ob Sie aus dieser Gegend kommen, Señorita?«
Clarissa öffnete die Augen, doch sie antwortete nicht gleich. Robert spürte, wie sich ein kleines unsicheres Lächeln in seine Mundwinkel stehlen wollte. Er wollte ihr ja wirklich nicht zu nahe treten. Er wollte sie auch nicht bedrängen, eigentlich …
Vielleicht geht es dich nichts an?
Clarissa setzte sich auf. Ihre großen Augen richteten sich auf ihn, als sie ihm endlich Antwort gab. »Es … Es tut mir leid, ich bemühe mich ja, aber ich weiß es wirklich nicht.«
»Das muss Ihnen nicht leidtun. Sie werden sich schon noch erinnern.«
Robert versuchte, seiner Stimme einen beruhigenden Klang zu geben. Kurz hielten sich ihre Augen aneinander fest. Für einen Moment meinte er etwas Vertrautes zu spüren. Ein blitzartiges Gefühl, sich im Gegenüber zu erkennen, und er fragte sich, ob ihr das auch so ging. Sein Herz schlug schneller. Ihm wurde warm, auf eine andere Art, als er es gewöhnt war. Das war keine Hitze, die die Sonne hervorrief, ein Feuer oder ein Ofen. Am liebsten hätte er sie jetzt berührt, zu gern gewusst, wie sich ihre Haut anfühlte, genau in diesem Augenblick. Er musste sich zwingen, den Blick von ihr loszureißen, wollte er nicht ungebührlich erscheinen.
»Ich … hm …« Robert sprang vom Karren hinunter und machte sich daran, in seinem Gepäck zu wühlen. »Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten, Señorita?« Jetzt hatte er sich endlich wieder im Griff und wagte aufzublicken.
Clarissa schenkte ihm ein kleines höfliches Lächeln. »Danke, ich bin wirklich durstig.«
Als Robert der jungen Frau die Kalebasse mit Wasser reichte, berührten sich ihre Finger, und wieder durchfuhr es ihn wie ein Schlag. Robert ließ das Behältnis so rasch los, dass es Clarissa fast entglitten wäre. Dann rückte er ein paar Schritte vom Wagen ab und räusperte sich.
»Ruhen Sie sich noch ein wenig aus, ich werde schauen, ob ich etwas Essbares für uns auftreiben kann.«
Clarissa nickte, die Kalebasse zwischen ihren schlanken Fingern drehend. Er war schon ein Stück zwischen den Bäumen verschwunden, als ihn ihre Stimme noch einmal aufhielt.
»Aber Sie gehen nicht weit fort, Señor Metzler, ja? Sie kommen bald wieder?«
Ein Lächeln erhellte kurz Roberts Gesicht, bevor er sich umdrehte. Hieß das, dass sie ihm doch ein wenig vertraute, wenigstens ein kleines bisschen? Er schaute sie forschend an, dann nickte er.
»Natürlich, ich bleibe in der Nähe. Sie können sich ganz sicher fühlen.«
Clarissa blickte dem jungen Mann hinterher, bis seine Gestalt zwischen den Bäumen nicht mehr auszumachen war. Ja, auch sie kannte diesen Wald, auch sie war mit ihm aufgewachsen. Natürlich erinnerte sie sich. Sie hatte den ständigen Kampf ihrer Eltern ja miterlebt, die ihren kleinen rancho jeden Tag mit aller Kraft gegen den unerbittlich vorrückenden Urwald verteidigt hatten. Denn so war das in diesen Gegenden. Der Wald forderte einem so viel Disziplin ab.
Clarissa dachte daran, wie ihr Vater sie als kleines Mädchen einmal auf die Knie genommen hatte – damals, als sie lieber hatte spielen wollen, anstatt ihrer Mutter im Garten zu helfen –, um ihr eindringlich zu erklären, dass der Dschungel alles unerbittlich zurücknehme, was sie sich mühevoll aufgebaut hatten, wenn sie ihm auch nur ein einziges Mal die Oberhand ließen.
»Und wenn wir später hier weggehen?«, hatte sie ihn gefragt, denn das hatte sie von anderen gehört. Irgendwann war der Urwaldboden ausgelaugt, man verließ den Ort, der einem Heimat geworden war, und schaute nicht mehr zurück. »Wenn wir hier eines Tages weggehen, Papa, was passiert dann?«
Er hatte sie ernst angeblickt und traurig ausgesehen. Sie hatte gewusst, dass er kämpfen würde, damit dies nicht passierte.
»Auch dann nimmt sich der Wald alles zurück.«
Einen Moment lang hatte sie versucht, sich das vorzustellen. Sie hatte sich vorgestellt, wie Büsche, Bäume und andere Pflanzen den sorgsam gepflegten Garten ihrer Mutter überwucherten. Sie hatte die Lianen vor sich gesehen, die sich um ihr kleines Haus ranken würden, und während sich das Bild noch vor ihrem inneren Auge gefestigt hatte, war sie aufgesprungen, um ihrer Mutter zur Seite zu stehen. Ihr Vater hatte sie danach nie mehr dazu auffordern müssen. Einige Jahre später waren sie dann doch weggegangen – weit, weit weg, zu einem Ort, an dem die Hölle und das Paradies ganz dicht nebeneinanderlagen.
Mit einem Ruck fuhr Clarissa aus ihren Gedanken.
Was ist mit den Eltern, fuhr es ihr durch den Kopf, geht es ihnen gut? Muss ich mir Sorgen machen? Dass sie nicht in der Lage war, eine Antwort auf diese Fragen zu finden, schmerzte und beunruhigte sie.
Im nächsten Augenblick ließ sie ein Geräusch den Kopf heben, doch es war nicht noch einmal zu hören, so angestrengt sie auch horchte. Was war es gewesen? War sie etwa nicht mehr allein in dieser Wildnis? Waren andere Menschen da? Aber wem sollte sie hier begegnen?
Die Gegend war so dünn besiedelt, dass man nur selten auf einen anderen traf, und die Tiere waren vorsichtig genug, Abstand zu halten, sah man einmal von den neugierigen Nasenbären ab, die es hier häufig gab. Was, wenn sie doch verfolgt wurde? War das möglich? Konnte jemand wissen, wo sie war? Weit war sie ja noch nicht gekommen …
Clarissa richtete sich auf und horchte noch einmal. Wie viel Zeit war mittlerweile wohl vergangen? Und wo war Rob … Señor Metzler? Was sollte sie tun, wenn ihm etwas geschehen war, wenn er einfach nicht zurückkam? Der scheue Jaguar mochte sich vielleicht nicht an den Karren heranwagen, doch was war, wenn Dr. Metzler in sein Reich eindrang? Würde die Raubkatze dann angreifen?
Clarissas Hände begannen zu zittern. Nein, sie durfte sich nicht ihrer Angst überlassen, sie musste etwas tun. Mit einem Satz sprang sie vom Wagen und spähte, zuerst noch zögerlich, in den Wald hinein. Von ihrem Standpunkt aus konnte sie nichts erkennen. Die Bäume standen dicht beieinander, schattig, grün. Vorsichtig trat sie in den Wald. Ein Ast zerbrach krachend unter ihren Füßen, ein Vogel flog kreischend auf. Sie schrak zusammen wie vom Donnerschlag eines heftigen Gewitters. Die Blätter, die unter ihren Füßen raschelten, die Äste und Zweige, die unter ihrem Gewicht zerbrachen, dröhnten überlaut in ihren Ohren. Doch Schritt für Schritt wagte Clarissa sich weiter vor.
Bald erkannte sie allerdings, dass der Urwald zu dicht wurde, um ohne Machete voranzukommen. Von Robert Metzler sah sie immer noch keine Spur. Kein menschlicher Laut war zu hören. Unschlüssig blieb sie stehen. Die Geräusche um sie herum schienen noch lauter zu werden und noch unheimlicher. Die Angst überrollte sie so plötzlich wie eine Welle, die man nicht kommen sah, spülte etwas in ihr hoch, an das sie sich nicht erinnern wollte. Clarissa begann zu zittern, schauderte wie in einem Anfall von Schüttelfrost.
Diese schrecklichen Bilder … Die Männer … Ihre brutalen Stimmen … Ich will das nicht mehr sehen. Ich will das nicht mehr hören …
»Clarissa …«, vernahm sie plötzlich eine Stimme hinter sich. »Señorita …«
Mit einem Schrei wirbelte sie herum, verlor den Halt und stürzte in die Arme Robert Metzlers. Sie klammerte sich an ihn, und er hielt sie fest, und plötzlich schossen Tränen der Erleichterung in ihre Augen. Es war bei allem Misstrauen doch gut, ihn zu spüren, gut zu wissen, dass man nicht allein war.
»Ich …«, stammelte sie, wollte sich gleich von ihm losmachen und dann doch wieder nicht. »Ich habe Sie vermisst, Señor Metzler. Sie waren so lange fort, und ich wollte sehen …«
»Ich hätte nicht so lange fortbleiben sollen«, pflichtete er ihr ernst bei.
»Waren Sie denn erfolgreich?«
»Ja, ich …«
Sie bemerkten erst jetzt, dass sie sich immer noch aneinander festhielten. Robert ließ Clarissa abrupt los. Sie spürte einen Anflug des Bedauerns. Wie auch immer man es benennen wollte: In seinen Armen hatte sie sich sicher gefühlt.
Die weitere Fahrt verlief schweigend. Ein jeder von ihnen hing seinen Gedanken nach. Abends mussten sie im Freien nächtigen. Das Gefühl der Verbundenheit, das Clarissa bei Robert Metzlers Berührung verspürt hatte, verflog wieder. Erleichterung machte neuer Angst Platz. Sie konnte ihm einfach nicht trauen. Sie konnte es nicht.
Ich werde nie wieder jemandem trauen, nach allem, was passiert ist.
Am nächsten Tag ging es kurz vor dem Morgengrauen weiter. Robert wollte die frühen Morgenstunden, die Zeit, in der die feuchte Hitze weniger drückend war, nutzen, um ein gutes Stück Weg hinter sich zu bringen. Sie waren beide froh, als sie an diesem Abend die pulpería, erreichten, in der Robert auf dem Weg zu Jacy schon einmal übernachtet hatte. Sie würden dort nicht nur schlafen, sondern auch ihre Getränke-und Essensvorräte auffrischen können.
Bei ihrer Ankunft fuhr Robert sofort zu den Stallungen und übergab Pferd und Wagen an einen der Gehilfen. Er kannte den Besitzer der pulpería als verlässlichen Mann und war deshalb sicher, sein Hab und Gut am Folgetag unbeschadet wieder vorzufinden.
Clarissa, die in den letzten Stunden sehr ernst gewesen war, lächelte zaghaft, aber Robert spürte auch wieder deutlich ihr Misstrauen. Was war es, was sich erneut zwischen sie geschoben hatte? Doch so angestrengt er auch nachdachte, er wusste es einfach nicht.
Clarissa schien seine Unsicherheit bemerkt zu haben, denn sie räusperte sich mit einem Mal. »Sie müssen mich für sehr unhöflich halten …«
»Nein, das tue ich nicht«, beeilte Robert sich, sie zu beruhigen. »Machen Sie sich keine Sorgen, Señorita Kramer, Ihre Erinnerung wird ganz sicher zurückkommen.«
Er sah, wie sie kurz zögerte, dann lächelte sie ihn erneut und etwas freundlicher an. Gemeinsam gingen sie auf den Eingang der pulpería zu. Robert zog die Tür auf, um Clarissa höflich als Erste hindurchzulassen. Als wäre das ein Rendezvous, fuhr es ihm durch den Kopf. Dann schalt er sich einen albernen Kerl.
Drittes Kapitel
Carlos und sein jüngerer Bruder Rafael befanden sich seit dem frühen Nachmittag in der verdreckten pulpería am Río Paraná. Die vorangegangene Nacht hatten sie im Stall übernachtet und sich zum Frühstück ein kräftiges Stück Fleisch gegönnt. Seitdem war nichts geschehen. Rafael beobachtete den Älteren eingehend. Schon eine ganze Weile lehnte Carlos nun an der Wand, die Beine so in den Raum gestreckt, dass man achtgeben musste, nicht darüber zu stolpern. Kleidung und Stiefel wiesen ihn als Gaucho aus. Er war einer, der niemals zu Fuß lief und mit dem nicht zu spaßen war. Rafael hatte den Eindruck, dass Carlos Streit suchte. Das war schon immer Carlos’ Vorgehensweise bei schwierigen Angelegenheiten gewesen. Aber er hatte natürlich Recht. Ihr Auftrag war gründlich schiefgegangen.
Die Vorstellung, ihrem Auftraggeber Don Jorge in ein paar Tagen gegenübertreten zu müssen, behagte auch ihm selbst nicht. Nachdem sie zunächst sehr zügig geritten waren und dann ein Stück des Wegs auf dem Fluss hinter sich gebracht hatten, zögerten sie nun beide. Keiner von ihnen musste es aussprechen, sie wussten nur, dass sie bereits länger als nötig in diesem Loch verweilten. Hier betranken sich Gauchos und Flussschiffer, hier verspielte man das Wenige, was man hatte, beim Karten- oder Würfelspiel oder beim taba, dem allseits beliebten Wurfspiel. Auch jetzt waren unaufhörlich die begeisterten Rufe der Spieler zu hören, die darauf wetteten, ob der im Spiel verwendete Knochen wohl auf die Vorderseite oder auf die Rückseite fallen würde.
Rafael spuckte endlich den Zahnstocher aus, auf dem er schon seit geraumer Zeit kaute. »Wir hätten ihn nicht dortlassen dürfen, sage ich.«
Carlos richtete sich auf, schwieg aber. Die Augen zu Schlitzen verengt, setzte er das Glas caña an, jenen süßen, feurigen Zuckerrohrschnaps, den sie sich beide gern schmecken ließen, lieber jedenfalls als den blassen holländischen Gin. Dann ließ Carlos ein Knurren hören.
»Um Leichen zu transportieren, ist die Strecke zu weit. Außerdem ist es zu warm, verdammt. Ihn an Ort und Stelle zu vergraben war das Beste«, murrte er und sah seinen Bruder scharf an. »Oder wolltest du Don Jorge vielleicht den stinkenden Leichnam seines geliebten Sohnes übergeben?« Der drohende Unterton in Carlos’ Stimme war nicht zu überhören.
»Don Jorge wird seinen Sohn sehen wollen«, beharrte Rafael.
Carlos leerte sein Glas, beugte sich vor und knallte es auf den Tisch. »Hör mit dem dummen Geschwätz auf, Kleiner. Was wir getan haben, war richtig.«
Rafael schwieg einen Augenblick. »Wir müssen sagen, dass er ins Wasser gestürzt ist«, sprach er dann seine Überlegungen aus.
»Genau«, erwiderte Carlos.
»Wir sitzen trotzdem in der Klemme«, bohrte Rafael weiter.
»Darüber können wir später nachdenken.« Carlos ließ sich einen neuen caña bringen.
»Aber …«
»Halt’s Maul, Kleiner.«
Rafael schluckte die Erwiderung hinunter. Der fünf Jahre ältere Carlos war seit ihrer Kindheit stets der Anführer gewesen, auch jetzt, da sie sich an jeden verkauften, der genug zahlte, war das noch so. Carlos war nicht der Hellste, aber er schüchterte durch seine Brutalität ein. Rafael dagegen hatte ein fast kindliches Aussehen. Seine Augen waren von einem unschuldigen Säuglingsblau. Seine blonden Haare lockten sich um sein rundes Gesicht wie die eines Engels in der Kirche, was ihm den Beinamen Angelito, Engelchen, eingebracht hatte. Doch dies hatte ihm schon mehr als einmal zum Vorteil gereicht. Die meisten schätzten ihn vollkommen falsch ein. Auch Carlos.
Rafael verbarg das bösartige Lächeln, das sich auf seine Lippen stehlen wollte, hinter seinem eigenen Glas caña. Nein, er wusste nicht mehr, wie viele Menschen er schon getötet hatte. Anfänglich hatte er für jeden eine Kerbe in seinen Pistolenknauf geritzt. Doch irgendwann hatte er damit aufgehört. Es waren zu viele geworden. Und Javier Monadas Tod hatte ohnehin keine Kerbe verdient, denn der war nicht beabsichtigt gewesen.
Nun, wenigstens kehrte auch das Weib nicht zurück. Die hübsche Clarissa hatten sie töten wollen, Carlos hatte sogar beabsichtigt, sie sich vorher zu nehmen, aber die Sache war schiefgegangen.
Rafael trank, hielt dann ebenfalls das Glas hoch und ließ sich nachfüllen. Unglaublich, das Weib war einfach in den Fluss gesprungen … Oder gefallen? Ach, was auch immer, Carlos hatte sie jedenfalls nicht haben können.
»Vielleicht hätten wir sie wieder aus dem Wasser zerren sollen …«, murmelte er nachdenklich.
»Ach, Angelito, wie denn?«
Carlos schüttelte den Kopf, mit jenem nachsichtigen Ausdruck auf dem Gesicht, der den Jüngeren fuchsteufelswild machen konnte. Eines Tages, schoss es Rafael durch den Kopf, werde ich ihn noch einmal umbringen dafür.
»Sie ist ganz sicher auch tot. Mehr wollte Don Jorge nicht. Wir …«, Rafael konnte förmlich sehen, wie Carlos überlegte, »… wir erzählen ihm einfach, dass das Weib am Tod seines Sohnes schuld ist.«
Rafael antwortete nicht. Das würde niemals klappen. Er kannte Don Jorge. Es würde noch einiges zu bedenken geben, bevor sie wieder bei ihrem Auftraggeber anlangten. Irgendwie musste er Mittel und Wege finden, sich selbst aus der Schusslinie zu bringen.
Carlos beugte sich unvermittelt zu ihm hinüber. »Ach, wir schaffen das, wir sind doch die Videla-Brüder. Wir halten zusammen wie Pech und Schwefel oder etwa nicht?«
»Natürlich, Bruder.«
Rafael grinste. Maare de Dios … Wenn Carlos davon ausging, dass er seinem Angelito vertrauen konnte, dann war er wirklich unaussprechlich dumm.
Rafael erhob sich, trat vor die pulpería und ließ seinen Blick über das weite Land schweifen. Er ahnte nicht, dass Clarissa zur selben Zeit nur einen Tagesritt entfernt war.
Viertes Kapitel
Als Clarissa und Robert am Morgen des vierten Tages von Jacys Cousin aufbrachen, um die restliche Strecke per Boot auf dem Río Paraná zurückzulegen, hatte Robert den Eindruck, dass keiner von ihnen in der vorausgegangenen Nacht viel geschlafen hatte. Am Vorabend hatte Clarissa die Flecken auf ihrer Bluse bearbeitet, die sie nun wieder anstelle von Jacys Hemd trug. Robert hatte ihr ein leichtes gewebtes Schultertuch gekauft, mit dem sie die schlimmsten Stellen verbergen konnte, und eine Tasche, in der sie zukünftig ihre Habseligkeiten aufbewahren konnte. Auf dem ersten Stück ihrer Bootsreise lehnte Clarissa stumm an der Reling und starrte in das dichte Blättergrün hinüber, das das Flussufer säumte, als gäbe es dort irgendwo etwas zu sehen. Sie war, wie meist, vollkommen in Gedanken, und da Robert einfach nicht wusste, wie er sie ansprechen sollte, unterließ er es. Schweren Herzens warf er nur hin und wieder einen Blick auf sie und kümmerte sich um Silberfuchs, dem die Bootsfahrt sichtlich nicht behagte. Die junge Frau wirkte noch blasser als an den vergangenen Tagen ihrer gemeinsamen Reise. Sie hatte dunkle Ringe unter den Augen, wohl vom Schlafmangel und von der Anstrengung.
Warum sprach sie nicht über das, was ihr geschehen war? Wenn sie ihm nicht traute, wie konnte er ihr dann trauen? Er kannte sie schließlich nicht. Er wusste nicht mehr von ihr, als dass er sie im Wald gefunden hatte. Allein.
Hinter ihm war jetzt ein Geräusch zu hören. Im nächsten Moment gesellte Clarissa sich zu ihm. Ihre Nähe verwirrte ihn wieder einmal. Dagegen konnte er nichts tun.
»Es tut mir leid, Señor Metzler. Sie müssen mich tatsächlich für eine furchtbare Reisebegleitung halten, aber ich habe in der vergangenen Nacht sehr schlecht geschlafen«, sagte sie, während sie sorgsam ihren Rock glatt strich.
Robert musste sich räuspern. »Nein, das tue ich nicht. Außerdem hat unsere gemeinsame Reise einen … nun ja …«, Robert schaute konzentriert zum anderen Ufer, um die junge Frau nicht ansehen zu müssen, »… recht ungewöhnlichen Anfang genommen.« Er war froh, dass in seiner Stimme keine Unsicherheit, geschweige denn etwas von dem Misstrauen zu hören war, das ihn überfallen hatte. »Geht es Ihnen jetzt besser, Señorita Kramer?«, erkundigte er sich dann.
»Ja, danke.« Aus den Augenwinkeln sah er, dass ihre Hände bei diesen Worten ein wenig zitterten. Im nächsten Moment verschränkte sie sie fest ineinander. »Ist es noch weit?«, fragte sie dann.
»Nein, aber etwas dauert es natürlich noch.«
Robert runzelte die Stirn und überlegte, wie lange wohl noch, er konnte es nicht mit Sicherheit sagen.
»Kommen Sie aus dieser Gegend?«, hörte er sie fragen.
»Ja.« Robert bewegte die Schultern. Warum sollten sie nicht darüber sprechen? So lernte man einander kennen. War es nicht so? »Meine Eltern gehörten wohl zu den ersten Deutschen, die dieses Fleckchen Land besiedelten. Inzwischen sind weitere Siedler hinzugekommen – vielleicht wissen Sie, dass in Misiones günstig Land verkauft wird.« Er sah sie erstmals wieder richtig an. Sein Herz schlug nicht mehr so schnell wie eben noch.
Clarissa schüttelte den Kopf und zuckte die Achseln. »Nein, weiß ich nicht.«
»Es sind immer noch wenige«, fuhr Robert fort. »Man sagt, nicht jeder ist für den Tropenlandbau geschaffen. Meine Eltern wohnen in der Nähe von Villa Veinticinco de Mayo, einer aufstrebenden Siedlung, die vom Mate-Handel lebt, wie man sagt.«
Clarissa lächelte zaghaft. »Ja, ich kann mir vorstellen, dass der Landbau hier nicht leicht ist«, sagte sie leise.
Robert blickte sinnend in die Ferne, wo sich ein Weg zwischen dichtem Grün zu verlieren schien. Nun, seine Eltern hatten es jedenfalls geschafft. Sie hatten schwere Rückschläge erlebt und waren beinahe gescheitert, und doch hatten sie sich immer wieder aufgerafft. Und sie hatten zu den Ersten gehört, die sich von den Guaraní hatten helfen lassen, und rasch gute Freundschaften mit den Ureinwohnern geschlossen. Er war stolz auf sie.
»Die Wurst, die ich versuchen durfte«, fuhr sie fort, »stammte die von Ihren Eltern?«
»Von meiner Mutter.« Robert nickte bekräftigend und warf ihr einen kurzen, forschenden Seitenblick zu. Er bemerkte, dass Clarissa lächelte. »Sie ist eine gute Wurstköchin, nicht wahr?«
Er mochte es, wenn sie lächelte. Sie sah dann noch schöner aus, und er hatte den Eindruck, dass sie einander plötzlich näher waren, als wären sie doch Vertraute, die sich schon lange kannten.
»Wissen Sie, einmal im Jahr kaufen meine Eltern ein Schwein«, beschloss Robert weiterzuerzählen, denn worüber sollten sie auch sonst sprechen, und schweigen wollte er nun nicht mehr.
Der Gedanke, dieses zarte und, wie er zugleich fürchtete, flüchtige Gefühl der Gemeinsamkeit gleich wieder zu verlieren, behagte ihm nicht. In diesem Moment spürte er kein Misstrauen, weder bei sich noch bei ihr. Er räusperte sich.
»Das Tier führt dann ein gutes Jahr lang ein glückliches Leben bei ihnen, bevor es geschlachtet und sofort verarbeitet wird, was in der Wärme ja unumgänglich ist.«
Clarissa nickte. »Das gibt sicher jedes Mal ein Fest.«
»Kennen Sie so etwas?«, hakte er nach.
Robert bemerkte seinen Fehler sofort. Ihr Gesichtsausdruck war nicht mehr weich und entspannt wie eben noch.
»Nein«, sagte sie dann zurückhaltender, kaum merklich zögernd. »Ich dachte es mir. Ich … Ich glaube, ich habe davon gehört.«
Robert entschied, nicht weiter in sie zu dringen. Er versuchte, unbefangen zu klingen. »Jedenfalls wird die ganze Nachbarschaft eingeladen. Es gibt Kesselfleisch, kräftig mit Zwiebeln und Knoblauch gewürzt. Die alten Lieder und Tänze aus der Heimat werden gesungen und getanzt. Manchmal bringt auch einer der Jungen, den es, wie mich, in die Stadt verschlagen hat, einen neuen Tanz oder ein neues Lied mit, und bald geht es dann auf Deutsch, Polnisch, Spanisch und sogar Portugiesisch durcheinander.«
Flüchtig dachte er daran, dass die Alten ihre jeweilige Landessprache noch häufig nutzten, während sich die Kinder oder spätestens die Enkel in der neuen Heimat und der neuen Sprache ungleich geschickter bewegten. Die wenigsten, ob Alt oder Jung, dachten allerdings an eine Rückkehr in die alte Heimat. Das neue Land hatte ihnen allen viel abverlangt, viele hatten es sich Stück für Stück erkämpfen müssen. Das wollte kaum einer mehr aufgeben. Man war einfach ein Kind der Tropen geworden, das große Hitze und heftigen Regen, wie es ihn hier häufig gab, bewältigte, ohne mit der Wimper zu zucken.
»Bringen Sie auch manchmal einen neuen Tanz oder ein Lied mit?«, ließ sich Clarissa hören.
»Ich bin kein guter Tänzer«, wehrte Robert ab.
»Sie leben aber doch gern hier, oder?«, fragte sie dann.
Robert räusperte sich.
»Hm, diese Gegend ist mir und meinen Eltern Heimat geworden, und ich wurde ohnehin hier geboren. Ich kenne es nicht anders.«
Er lächelte sie an und ganz plötzlich fühlte er sich ihr wieder nah – ein verwirrendes Gefühl. Hatte er sich gerade noch gefragt, wie seine Eltern wohl auf Clarissa und ihre Geschichte reagieren würden, so sah er darin jetzt keine Schwierigkeit mehr. Er hatte sie im Wald gefunden, ihr vielleicht das Leben gerettet. So einfach war das.
»Würden Sie … Könnten Sie vielleicht darüber schweigen, wo Sie mich genau gefunden haben, bis ich mich besser daran erinnere, was überhaupt geschehen ist? Ich komme mir so seltsam vor.«
»Natürlich«, hörte Robert sich mechanisch antworten, obwohl er zugleich nach dem Grund dieses merkwürdigen Ansinnens fragen wollte. Sein Misstrauen war genauso schnell wieder zurück, wie er es überwunden geglaubt hatte.
Fünftes Kapitel
Sie waren immer noch an diesem gottverlassenen Ort, weil Carlos sich plötzlich doch nicht dazu hatte überwinden können weiterzureiten. Rafael verzog seinen Mund zu einem höhnischen Grinsen, während er die Brüste der jungen Frau massierte, die sich auf seinen Schoß gesetzt hatte. Sie war nicht besonders hübsch, und sie stank, als hätte sie noch nie etwas von der Existenz von Wasser gehört, aber eine Frau blieb eine Frau, und ihm pochte es zwischen den Beinen.
Carlos ist ein verdammter Schwächling, fuhr es ihm durch den Kopf, während dieser sich mit schweren Schritten näherte.
»Rafael, Angelito«, dröhnte Carlos’ Stimme neben ihm.
»Was denn?«, murrte der Jüngere, denn er schenkte gerade einer weiteren, viel hübscheren jungen Frau ein Lächeln, und die erwiderte es. Vielleicht würde es ja doch noch ein guter Vormittag werden.
»Rafael, hör doch!«
»Was denn?«
»Das Weib lebt.«
»Das Weib lebt?«, echote Rafael.
Er ließ die puta auf seinem Schoß abrupt los. Sie geriet ins Rutschen, schimpfte wie ein Rohrspatz und schlang dann sofort wieder die Arme um seinen Hals. Rafael stieß sie von sich, was sie mehr als empörte. Wahrscheinlich war er ihr erster Kunde heute, und sie hatte sich große Hoffnungen gemacht. Er konnte es ihr nicht verdenken, sie war wirklich sehr gewöhnlich.
»Was sagst du da, Carlito?«
»Hast du mich nicht verstanden?« Carlos runzelte ungeduldig die Stirn.
»Doch.«
Nur schwer bezähmte Rafael seine plötzlich aufschäumende Wut. Er hatte stets die schnellere Auffassungsgabe gehabt. Carlos war lediglich der Stärkere gewesen, ein Stier, der ohne Sinn und Verstand auf ein Ziel losgerannt war. Mehr nicht. Er hasste es, wenn Carlos mit ihm sprach, als wäre er nicht bei klarem Verstand.
»Ich weiß es einfach, das Weib lebt«, flüsterte Carlos heiser. »Ich fühle das, verstehst du? Ich fühle es einfach … Mierda!«
Er knallte sein Glas auf den Tisch. Dann krallten sich seine Finger so sehr um das Gefäß, dass Rafael kurz befürchtete, es müsste unter Carlos’ eisenhartem Griff zerspringen.
»Aber warum?«, fragte Rafael. »Warum sollte sie überlebt haben? Sag schon!«
Carlos bleckte die Zähne. Seine Finger umklammerten das Glas immer noch.
Er hat Angst, dachte Rafael mit einem Mal, mein Bruder, der feige Bastard, hat Angst. Dabei ist das Wichtigste jetzt, einen kühlen Kopf zu bewahren.
Carlos trank wieder, sodass Rafael seinen Adamsapfel hüpfen sah.
»Nein, ich weiß, dass sie lebt«, fuhr der ältere Bruder fort. »Ich hatte heute Nacht so einen seltsamen Traum, Angelito.«
»Einen Traum?« Rafael verdrehte die Augen.
Die Hure hatte es sich mit einer gewissen Hartnäckigkeit erneut auf seinem Schoß bequem gemacht und war dabei, sein Hemd aufzuknöpfen. Dann küsste sie seine Brust. Rafael ließ es geschehen. Manchmal amüsierte ihn der Aberglaube seines Bruders, manchmal nicht, vor allem dann, wenn es darum ging, klar bei Verstand zu bleiben.
Carlos nahm noch einen Schluck und stellte sein Glas ab.
»Zwei riesige Spinnen kämpften miteinander«, setzte er mit heiserer Stimme an. »Das Weibchen fraß das Männchen und …« Er raufte sich die Haare. »Verdammt, was tun wir, wenn Don Jorge davon erfährt?«
Der Bruder hatte von zwei Spinnen geträumt, dieser arme Tropf. Rafael zog die Stirn kraus. Wie hatte er nur zulassen können, dass Carlos sich als Anführer aufspielte, dieser Muskelprotz mit dem Verstand eines Nandus. Am liebsten hätte Rafael aufgelacht, stattdessen wiegte er bedenklich den Kopf. Er würde Carlos in Sicherheit wiegen, bis er selbst den ersten Stich setzen konnte. Dann war es vorbei mit Carlos’ Zeit als Anführer, dann würde er das Ruder übernehmen … Bis dahin … Er lächelte wieder.
»Nun … wir müssen uns etwas überlegen, solltest du Recht behalten, Carlito. Wir brauchen einen Plan.«
Sechstes Kapitel
»Jacy grüßt Guaraciaba«, sagte Robert, nachdem sein Vater und er eine Weile schweigend die Kalebasse hatten kreisen lassen, so wie sie es immer taten, während sie Neuigkeiten austauschten, wenn Robert auf dem rancho seiner Eltern eintraf.