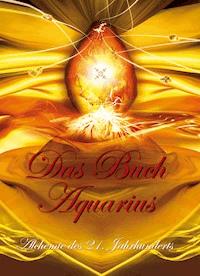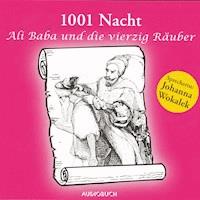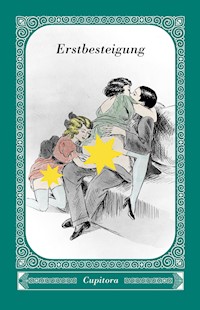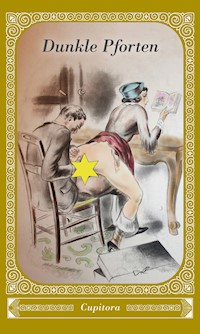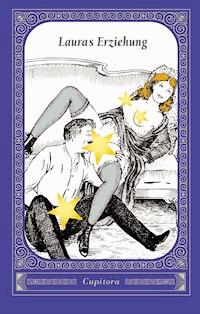Ein anstößiger Roman nach einem klandestinen Privatdruck in Kleinstauflage aus Amsterdam von 1920, versehen mit annähernd 30 eindeutigen Zeichnungen.
Das E-Book Die Lasterbrücke wird angeboten von Cupitora und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Sex, Porno, pornographische Zeichnungen, lüstern, geil
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 141
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Lasterbrücke
Ein lüsterner Roman von Albert Pawil
Ein anstößiger Roman nach einem klandestinen Privatdruck von 1920, versehen mit vielen eindeutigen Zeichnungen.
eISBN 978-3-95841-731-1
© 2017 by Cupitora in der BEBUG mbH, Berlin
ERSTESKAPITEL
Als ich die verräucherte kleine Kneipe betrat, die zu unserem gemeinsamen Treffpunkt ausersehen war, sah ich, dass der Stammtisch kein Stammtisch alter Herren zum Verbleiben, sondern einer von jungen und jüngeren Studenten zum gegenseitigen Antreffen vor den Exkursionen in das nächtliche Straßburg – schon recht stattlich besetzt und in mächtiger Bewegung begriffen war.
Ich schüttelte eine Anzahl zerstreut hingehaltener Hände fast zugleich und hörte die erregte Stimme des Japaners, den ich schon von Leipzig her kannte, in seinem nicht ganz richtigen Deutsch lebhaft sagen:
»Und ich erkläre Ihnen, nicht wir Asiaten sind unsittlich oder – ich sage lieber – unzüchtig, sondern Ihr Europäer. Ihr behandelt das Weib als einen Gegenstand Eurer Lust, als eine Sache!«
»Mulieres homines non sunt« (Frauen sind keine Menschen), warf einer ein, »war der Standpunkt der Renaissance.«
»Ja, ein bequemer Standpunkt! Das ist Eurer, das ist der Standpunkt Eurer Kraftmenschen! Aber der Asiate sucht die Blüte seines Herzens, das Erhöhtwerden seiner Gedanken und Seelenkraft, die Erhebung seines Selbstbewusstseins im Spiegel der anderen Seele. Er ist kein Spießer, der ›den Beischlaf vollzieht‹, wie Eure geistreiche Polizeisprache sagt. Der Frau ist er mit seiner gesammelten Kraft ein Mensch, der in ihren Armen zu erhöhtem Lebensgefühl erweckt wird. Unsere Teehäuser sind keine Bordelle!«
»Wie wäre es«, sagte eine nachdenkliche Stimme, »wenn wir die Debatte in einen Experimentalvortrag verwandelten, gewissermaßen im Laboratorium. Das heißt, wir gehen zur Fischergasse und betrachten die Substrate der Lust unter den eben besprochenen Gesichtspunkten, wobei Herr Saito seine These zu verteidigen haben wird, während wir Europäer opponieren.«
Der Vorschlag kam manchem zu überraschend, die Stunde schien zu früh, um die Stätten aufzusuchen, die mancher von uns nur betrat, wenn er viele Hemmungen mit Alkohol beseitigt hatte.
Andere lockte die psychologische Aufgabe und der als schlagfertig bekannte Geist dessen, der den Vorschlag gemacht hatte, und von dem man annehmen konnte, dass er als stärkster und erster Opponent auftreten würde und möglicherweise den Satz des Japaners ad absurdum führen würde, wenn er eine geeignete Partnerin fände.
Der Weg zur Fischergasse von der kleinen Kneipe am Kleberplatz ist nicht weit. Ehe wir noch Übriggebliebenen uns über die Form unseres Auftretens klargeworden waren, sahen wir schon das Palais Rohan sich im Strom spiegeln. Wir kehrten in das Haus ein, das vor allen anderen den Ruf der gepflegtesten Auswahl hatte.
Der große »Salon« im Erdgeschoss war leer. Es erschienen der Zahl der unseren entsprechend sechs Damen in bunten Hemden, mit Strümpfen und Schuhen, deren älteste nicht über zweiundzwanzig und deren jüngste vielleicht siebzehn Jahre alt war. Sie waren begleitet von einem schönen und elegant bekleideten Mädchen von Ende Zwanzig, das die Wirtin spielte. Die Annäherung geschah ganz zwanglos und das Zielbewusstsein, das sich in den Blicken und Schritten der Mädchen bei ihrer Annäherung ausprägte, schien den Satz des Japaners nicht gerade zu bestätigen.
Wenn sie sich dauernd als Sache behandeln fühlen mussten, so war es merkwürdig, dass sie mit mehr Sicherheit als wir ihre Auswahl trafen und uns eigentlich völlig dirigierten. Dem Japaner fiel die große Brünette zu, die mir zuerst aufgefallen war, und die wie es schien, die schönste Figur von allen hatte, fleischig und geschmeidig. Mir die ganz Junge. Ein großes, schlankes Mädel mit hochangesetzten kleinen, aber festen jungfräulichen Brüsten.
Das Grammophon begann zu spielen, die Flaschen erschienen und verschwanden mit geheimnisvoller Eile, und der wissenschaftliche Ernst unserer Exkursion schien völlig vergessen, als ein Teil der Paare aus dem Salon verschwanden. Es blieben nur der Japaner, sein Opponent, ein Mediziner und ich mit unseren Mädchen zurück. Alles war so schnell vonstattengegangen, dass der Zweck der Übung völlig aufgegeben schien.
Da sagte der Mediziner, der bisher sehr schweigsam gewesen war und die Liebkosungen seiner Partnerin, einer Polin, wie es schien, nur zerstreut geduldet hatte aus einigem Nachdenken erwachend: »Es wäre in Ordnung, wenn wir jetzt alle auf ein Zimmer gingen!«
Mir war das nicht ganz recht, denn ich hatte den Wunsch, meine verdorbene Sinnlichkeit oder, besser gesagt, meinen misshandelten Geschlechtsapparat von sachkundiger Hand in Ordnung bringen zu lassen.
Um diese Äußerung verständlich zu machen, muss ich etwas weiter ausholen und etwas aus meinem jüngst verbrachten Leben erörtern.
Ich war noch nicht lange in Straßburg und war aus Leipzig, wo ich das vorhergehende Semester belegt hatte, muss ich gestehen, geflohen. Geflohen vor einem erotischen Abenteuer, das mich zu zerstören drohte.
Das kleine Mädchen, das ich in Leipzig kennen gelernt hatte, und das mit ihren knappen siebzehn Jahren noch so unschuldig war, dass ich sie mit Küssen, Berührungen, Zungenarbeit und Gewöhnung an unzüchtige Worte erst in monatelanger Arbeit in sturmreifen Zustand bringen musste. Weil ich sie nicht durch zu intensiven Angriff abschrecken wollte, hatte ich mich dabei so weit gebracht, dass ich beim Küssen schon entlud und um den Enderfolg besorgt war. In der ersten Nacht passierte es mir, als ich sie so langsam ganz nackt ausgezogen hatte – wie süß war dieser weiche, blonde Körper – dass ich, ehe ich sie selber in Erregung gebracht hatte, auf ihren schönen Leib entlud, und der Ekel, den ihr der unerwartete Anblick des warmen und klebrigen Zeuges auf ihrer Haut verursachte, hatte mir für diesen Abend die Tour vermasselt.
Es gelang mir, sie in der Silvesternacht, die ein paar Tage später war, zu entjungfern. Die Szene war furchtbar. Sie war sehr eng gebaut und ich hatte mich durch reichlichen Punschgenuss mit Nelken in eine Art Raserei versetzt. Ich richtete ein kleines Blutbad an und sie wimmerte wie ein kleines Tier. Aber gerade das Wimmern regte mich unheimlich auf. Ich zitterte vor Gier, als ich immer tiefer stieß, und entlud wie ein Wasserfall, je mehr mich die enge Scheide presste, wenn ich tiefer eindrang. Sie biss mich zuletzt vor Schmerz ins Gesicht, schrie laut auf und schlug mich mit beiden Händen, dass mir das Blut aus der Nase lief. Ich ließ mich nicht stören und spritzte in langen Stößen meinen Samen in ihre gequälte Scheide.
Plötzlich fühlte ich, wie sie erschauderte und zusammenzuckte. Sie nahm plötzlich die tobenden Hände und legte sie um meinen Hals und küsste mich in das blutende Gesicht mit einer noch trotz aller Zungenküsse nie bewiesenen Innigkeit. Und einen Augenblick schwanden ihr die Sinne. Während sie so da lag, machte ich sie und mich sauber und sprach sie dann an. Sie wachte auf und sagte leise: »Komm her und sieh mich nicht an! Du bist ein Tier, höre, ich kann weiter nichts sagen, aber ich habe trotzdem gar keinen Widerwillen gegen Dich!«
Ich machte die sonderbare Entdeckung, dass sie durch weiteren Verkehr die Lust am Schmerz immer mehr entdecke. Als nach einigen Malen meine Besuche bei ihr noch immer so schmerzvoll ausfielen und die Annäherung meines Gliedes an ihre Scheide ihr Schmerzen und dadurch den Orgasmus brachte, verfiel sie auf den Gedanken, mir zu sagen: »Ich sollte sie dort nur küssen und mit der Zunge hineinstoßen.« Ich gestehe, dass ich in meiner stets neuen Gier gern darauf einging, zum Teil aus Mitleid mit ihren Schmerzen. Ich benetzte dann einen Finger, den ich ihr in den Popo bohrte.
Der Geruch ihrer Scheide, die sich leicht unter meinen Küssen füllte, erregte mich dann so, dass die ganze Sache gewöhnlich mit einer Rohheit meinerseits endete. Ich bohrte ihr dann den oder die Finger so tief in ihren Hintern, dass sie vor körperlichem Unbehagen zu stöhnen und zu schwitzen anfing.
Mich bringt nichts so sehr in Erregung wie der Geruch der Haare, der Scheide und des Schweißes, des Angstschweißes der Kreatur, die die gewaltsame Veränderung ihrer Natur ahnt. Dieser Geruch lähmt alle Hemmungen des Mannes, wie der Geruch des erregten Mannes die Frau, oder noch mehr das unberührte Mädchen wie ein Blitzschlag betäubt.
Wenn ich dann so weit war, nahm ich sie trotz ihrer Schmerzen vor und stieß mit aller Brutalität in die zu enge Scheide und riss sie jedes Mal ein wenig ein oder ich schlug sie mit einer Gerte, bis es mir und ihr kam. Ich mochte es ihr nicht sagen, dass sie mein Glied in die Hand nehmen oder es lutschen sollte, was sie ja öfter tat, aber nie wenn es am nötigsten war.
Durch diese Art von Onanie wurde ich allmählich ganz nervös, umso mehr als der Zustand ihrer Scheide mit regelmäßigen Krämpfen jeden richtigen Verkehr unmöglich machte.
Ich war nach jedem Zusammensein unbefriedigter als vorher, ja ich büßte fast die Tätigkeit der langen und gesunden Erektion ein.
Die Folge dieser allmählich so verhängnisvoll gewordenen Exzesse, war ich noch immer bemüht, zu beseitigen, und ich hatte mir vorgenommen, wenn je, dann unbedingt nur auf normalen Weg zu verkehren und keinen Genuss zu suchen, der bei mir so viele moralische Minderwertigkeitsgefühle zurückließ.
Es sollte zunächst wenigstens ganz gutgehen.
ZWEITESKAPITEL
Während meiner Gedanken an Leipzig und die dortigen Ereignisse waren die Angelegenheiten in meiner Umgebung ziemlich weit vorgeschritten.
Man hatte den Salon verlassen und war über eine enge Wendeltreppe in ein großes Zimmer gekommen, in dem zwei, wie ich feststellte, saubere Betten standen und ein Chaiselongues. Auf dem Weg dahin, den ich in Gedanken zurücklegte, war die Kleine, die sich mir angeschlossen hatte und noch recht wenig Beachtung von meiner Seite gefunden hatte, in die Toilette getreten. Sie hatte mich hinter sich hergezogen und sagte, ich sollte mit ihr zusammen pinkeln gehen.
Sie legte ihr buntes Hemdkleid ab und setzte sich nackt rittlings auf den Sitzrand. Ich sollte mich auf ihre Schenkel setzen, mein Glied herausnehmen (ich war noch völlig angezogen) und ihr gegen den Leib pissen, meine Hände sollte ich gegen ihre Scheide halten.
Da ich noch weiter keine Zärtlichkeiten mit ihr getauscht hatte, küsste ich sie dabei, und sie verstand sehr nett, ihre Zunge zu gebrauchen, sodass mir unter der feuchten Liebkosung ziemlich warm wurde und infolgedessen mein Strahl fast ihre Brust traf.
Ich fand diese Liebkosung – den örtlichen Verhältnissen Rechnung tragend – als feierliche Eröffnung der Beziehung ganz amüsant und angebracht, war aber recht erschrocken, als ich meine Hände wieder sah. Sie waren ganz rot vor Menstruationsblut.
Ratlos sah ich sie eine Weile an. Das Mädel, sie hatte mir inzwischen verraten, dass sie Eva hieß, fing an zu lachen und sagte mit einem ganz geilen Gurren:
»Ja, ich habe den Roten! Aber dann bin ich am allerwildesten! Sonst mache ich mir nicht viel aus den Männern. Du musst mich in den Roten vögeln!«
Ehrlich gesagt, ich war weder sehr überrascht gar angeekelt. Es wäre mir viel peinlicher gewesen, wenn sie mir gesagt hätte, ich sollte mich heute des Wunsches, der mir vorschwebte, entschlagen.
DRITTESKAPITEL
Als ich in das Zimmer trat, waren meine beiden Freunde und die Mädels ganz nackt um einen runden Tisch voll Flaschen und Gläser versammelt. Das Gespräch aus der Weinstube war wieder aufs Tapet gekommen und machte die Köpfe warm, hielt aber die fleischliche Vereinigung noch auf. Ich hatte wenig Lust dazubleiben und wäre lieber mit Eva auf einem anderen Zimmer allein geblieben, aber es sollte ja das Verhalten der Mädchen untersucht werden.
Die Polin Marianne und Lucy, die Braune, waren fröhlich beschäftigt, die Gläser zu füllen.
Das unvermeidliche Grammophon war auch da. Ich hatte mich nolens volens auch ausgezogen und wir tanzten nackt um den Tisch.
Eva, dieses halbe Kind, hielt beim Tanzen meinen Piephahn fest, mit dem Erfolg, dass er bald mächtig hochstand. Ich fühlte jetzt ein großes Bedürfnis zu ficken und sagte ihr das leise.
»Ficken? Ja, hurra! Wir fangen an! Wir vögeln!«
Ehe ich mich versah, lag ich mit ihr im Bett, sie zog die Beine an und steckte meinen steifen Pimmel selber in ihr nasses Loch. Ich war ganz geil auf das Mädel, da mich der Geruch ihres Blutes erregte. Das Vögeln ging mit einem Geräusch vonstatten, als wenn man ins Wasser patscht.
Die Wirkung auf die anderen Paare war erheblich. Der Japaner hatte sich mit unterschlagenen Beinen auf die Chaiselongue gehockt und hieß seine Lucy, sich ebenso vor ihn zu setzen. Dann musste sie langsam zu ihm hin rutschen, sich auf seine gekreuzten Schenkel schwingen und ihn mit ihren Beinen umschlingen, dann schob er ihr sein Glied von unten herein. Ich konnte nur ganz flüchtig hinsehen, aber ich stellte noch fest, dass er ihren Oberkörper nach hinten bog und ihren Leib von sich abschob, damit beide seinen großen und dicken Pint langsam auf- und abfahren sehen konnten.
Ich war infolge, der aus doppelter Quelle gespeisten Feuchtigkeit, bei Eva öfter aus der Bahn geraten und hatte das Bett, den Körper Evas und meine Hände tüchtig besudelt in dem Bemühen, den sicheren Hafen wieder zu gewinnen.
Was die Polin mit ihrem Liebsten machte, konnte ich nicht sehen, ich hörte sie aber stöhnen.
Inzwischen war Eva zweimal fertig geworden und mir war es einmal gekommen. Sie sprang nach einer kurzen Verständigung aus dem Bett, um sich zu waschen.
Als der Japaner das junge, schlanke Mädel so blutbefleckt aus dem Bett springen sah, stieß er sein Weib weg und stürzte sich, ich weiß nicht, ob nicht aufgrund eines fatalen Irrtums, auf sie, warf sie zurück und bohrte ihr seinen Schwanz in wahrer Geschlechtswut ein. Auf meinem Bett! Ich muss sagen, dass ich den japanischen Sitten – wenigstens was diesen Fall anlangt – wenig Geschmack abgewinnen konnte.
Ich sah mich blutbefleckt und mit schlappem Schwanz der ebenso beleidigten Lucy gegenüber.
Der Anblick des vögelnden Japaners und, als ich mich umsah, das Bild, das der Mediziner mit der Polin darbot, erregten mich wieder. Die Polin saß auf dem Bidet, sie waren, wie es schien, eben fertig geworden. Ihr Partner hielt den Irrigator hoch und sie machte bei dem Einlaufen des Wassers ein ganz verzücktes Gesicht; sie schien zu onanieren. Ich näherte mich Lucy und fühlte, wie ihre Haut kühl und weich war. Besonders die Kühle am Po war so angenehm, dass es mir steif wurde, wie bei einem Pferd.
Lucy berührte mich ganz mädchenhaft zart, und nach wenigen Griffen von ihr in die Gegend meiner Hinterbacken und in den Hintern, führte sie mein Glied in ihre Scheide. Mit dem Tausch war ich sehr zufrieden. Die Kühle der Haut und ihr weiches Fleisch machten mich fast betäubt. Ich verfiel in eine schlafähnliche Erschöpfung, in der ich aber meine rhythmische Betätigung nicht unterbrach. Leider weiß ich von diesem Liebesakt nicht mehr viel; es war wie eine Verzauberung, ohne dass ich sagen konnte, wodurch dieser Rausch herbeigeführt wurde. Es schien daran zu liegen, dass die Umarmung Lucys so wunderbar weich und zart war und ihre Zärtlichkeit so beruhigend.
VIERTESKAPITEL
Allzu früh wurde ich zur rauen Wirklichkeit zurückgeweckt durch die krakeelende Stimme des Mediziners, der der Polin ein Klistier zu geben wünschte. Ob seine Trunkenheit oder ob Perversität (die Perversität des angehenden Klinikers) ihm diesen Wunsch eingab, konnte ich, wenigstens zunächst, nicht ausmachen. Der Wunsch stieß auf allgemeinen Widerstand der Männer.
»Wenn wir die Mädchen nicht dahin bringen, dass sie sich wie ein paar leblose Stücke Fleisch behandeln lassen, werden wir unsere Behauptung von ihrer Anpassungsfähigkeit nicht beweisen können«, sagte er.
»Ganz falsch«, belehrte ihn Saito, »ihre Anpassungsgabe kann nur in freiwilliger Hingabe ihrer Person an unsere Wünsche bestehen, nicht in der freiwilligen Erniedrigung, die die Deine auszeichnet.«
»Also«, sagte ich, »lassen wir diese Geschichten, sie sind doch ekelhaft. Und schließlich regen sie mich noch weiter auf«, fügte ich hinzu: »Ich möchte eine kleine Weile Ruhe haben!«
Mit diesen Worten hatte ich einen Heiterkeitserfolg und sah mit Befriedigung, dass man sich wieder an den Tisch setzte und trank.
Dieser Unglücksmensch kam aber von seiner Idee nicht ab. Als er das erste Glas Wein trank, sagte er wieder, man müsste diesen weißen Bordeaux aus dem Leib eines Weibes schlürfen.
»Ich werde den Darm Mariannes einwandfrei, wissenschaftlich einwandfrei reinigen und ich flöße ihr dann eine Flasche Bordeaux ein, die sie uns einzeln in den Mund scheißt.«
Die Mädchen benahmen sich tumultuarisch, sie lachten laut, liefen umher und schrien: »Ein Arschfreier! Ein Arschlutscher! Los, Wein her! Wir kriegen den Wein in den Hals gekackt!« Und so weiter.
Es ist sehr schwer, die folgende Szene zu beschreiben: Die Mädels waren alle einverstanden und boten sich alle an. Es blieb bei Marianne, die sich schon in malerischer Haltung auf das Sofa geschwungen hatte. Sie lag auf der rechten Seite und zog ihren linken Oberschenkel hoch heran.
Nach meinem Gefühl hätten für diese Figur aus der Barockerotik besser die Gestalt Lucys und eine alte große Klistierspritze gepasst. Mein historisches Gewissen trieb mich an, darüber nachzudenken, wie oft wohl die alten Mauern des benachbarten Palais Rohan diese lockende Attitüde mögen gesehen haben.
Alles war bereit zu helfen und die mehrfache Ausspülung des Darmes ging exakt wie im Operationssaal einer großen Klinik vonstatten. Bei der ersten Ladung war Marianne mit einem großen Fäkalienberg auf dem Nachttopf niedergekommen, der in der Hitze des Gefechts eine Weile im Zimmer blieb. Mir wurde ein bisschen schlecht und ich rauchte krampfhaft Zigaretten.
Die anderen Ausspülungen gingen ohne weitere Benachteiligungen meiner Geruchsnerven vor sich.