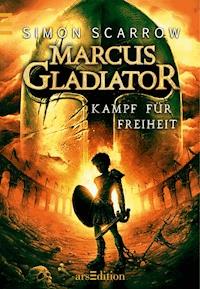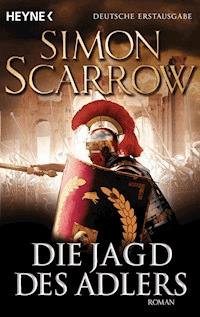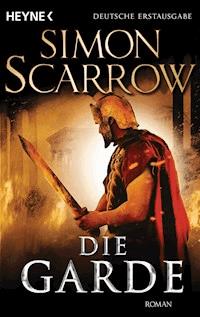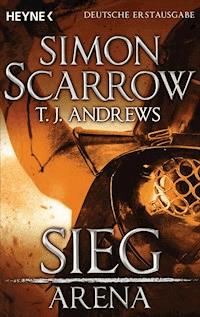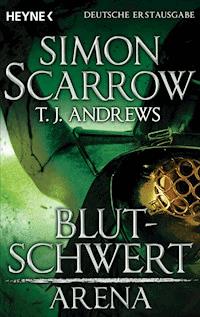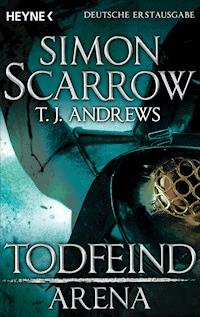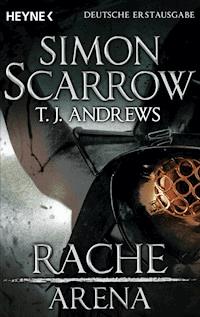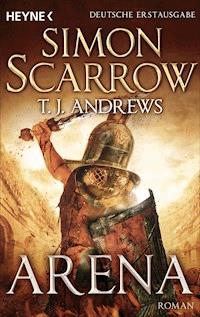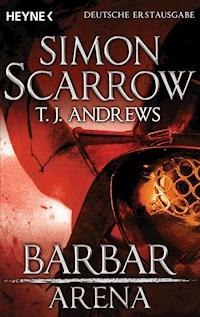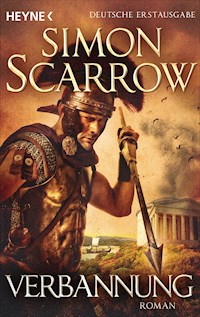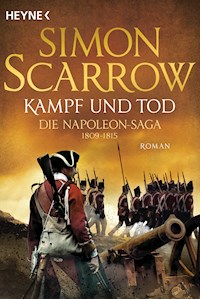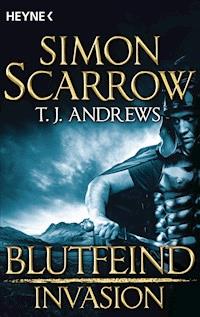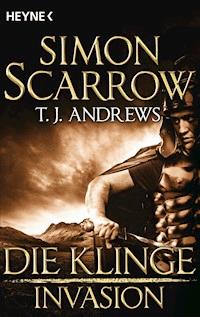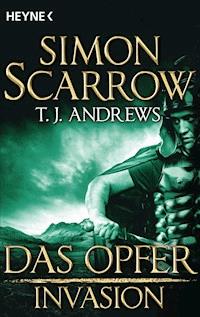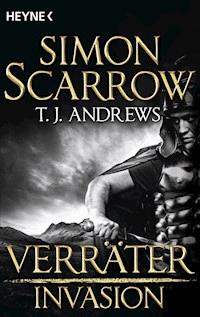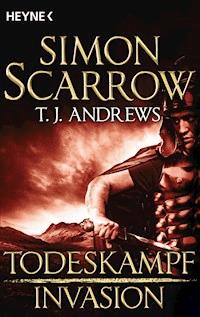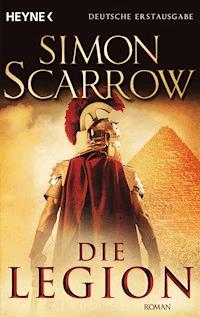
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Rom-Serie
- Sprache: Deutsch
Gewaltige Schlachten im Schatten der Pyramiden
Der ehemalige Gladiator Ajax wurde aus Kreta vertrieben und macht nun Ägypten unsicher. Seine Überfälle auf Flottenstützpunkte und Handelsschiffe stellen eine Bedrohung für die Stabilität des römischen Imperiums dar, da sich seine Männer als Römer ausgeben und so den Hass der Bevölkerung auf die Besatzungsmacht schüren. Die beiden erprobten Kämpfer Cato und Macro werden von Ägyptens Statthalter damit beauftragt, sich der 22. Legion anzuschließen und Ajax zur Strecke zu bringen, bevor das Land endgültig verloren ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 654
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Simon Scarrow
Die legioN
Roman
Aus dem Englischen von Barbara Ostrop
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Für Ahmed (den Anführer der Engel) und Mustafa (den Auserwählten)
Die Organisation der römischen Legion
Der Zweiundzwanzigsten Legion gehörten rund fünfeinhalbtausend Mann an. Die Basiseinheit war die achtzig Mann starke Centurie, die von einem Centurio befehligt wurde, als dessen Stellvertreter der Optio fungierte. Die Centurie war in acht Mann starke Unterabteilungen gegliedert, die sich im Lager einen Raum und im Feld ein Zelt teilten. Sechs Centurien bildeten eine Kohorte, und zehn Kohorten bildeten eine Legion; die Erste Kohorte hatte jeweils doppelte Stärke. Jede Legion wurde von einer hundertzwanzig Mann starken Kavallerieeinheit begleitet, unterteilt in vier Schwadronen, die als Kundschafter und Boten Verwendung fanden. Die Ränge in absteigender Folge lauteten folgendermaßen:
Der Legat war ein Mann aristokratischer Herkunft, gehörte aber in Ägypten nicht wie in den anderen Provinzen dem Senatorenstand an. Der Legat befehligte die Legion mehrere Jahre lang und hoffte darauf, sich einen Namen zu machen, um so seine anschließende Karriere als Politiker zu fördern.
Beim Lagerpräfekten handelte es sich um einen erfahrenen Veteranen, der zuvor oberster Centurio der Legion gewesen war und die Spitze der einem Berufssoldaten offenstehenden Karriereleiter erklommen hatte.
Sechs Tribune taten als Stabsoffiziere Dienst. Dies waren Männer Anfang zwanzig, die zum ersten Mal in der Armee dienten, um administrative Erfahrung zu sammeln, bevor sie untergeordnete Posten in der Verwaltung übernahmen. Anders verhielt es sich mit dem Obertribun. Er war für ein hohes politisches Amt bestimmt und sollte irgendwann eine Legion befehligen.
Die sechzig Centurionen sorgten in der Legion für Disziplin und kümmerten sich um die Ausbildung der Soldaten. Sie waren aufgrund ihrer Führungsqualitäten handverlesen. Der ranghöchste Centurio befehligte die Erste Centurie der Ersten Kohorte.
Die vier Decurionen der Legion kommandierten die Kavallerie-Schwadronen und hofften darauf, zum Befehlshaber der Kavallerie-Hilfseinheiten befördert zu werden.
Jedem Centurio stand ein Optio zur Seite, der die Aufgabe eines Ordonnanzoffiziers wahrnahm und geringere Kompetenzen hatte. Ein Optio wartete gewöhnlich auf einen freien Platz im Centurionat.
Unter den Optios standen die Legionäre, Männer, die sich für fünfundzwanzig Jahre verpflichtet hatten. Theoretisch durften nur römische Bürger in der Armee dienen, doch wurden zunehmend auch Männer der einheimischen Bevölkerung angeworben, denen beim Eintritt in die Legion die römische Staatsbürgerschaft verliehen wurde.
Nach den Legionären kamen die Männer der Hilfskohorten. Diese wurden in den Provinzen rekrutiert und stellten die Reiterei sowie die leichte Infanterie des Römischen Reiches und nahmen andere Spezialaufgaben wahr. Nach fünfundzwanzigjährigem Armeedienst wurde ihnen die römische Staatsbürgerschaft verliehen.
Die römische Marine
Die Römer befassten sich relativ spät mit der Seekriegsführung, und erst in der Regierungszeit von Kaiser Augustus (27 v. Chr.–14 n. Chr.) wurde eine stehende Flotte aufgestellt. Die Marine war in zwei Hauptflotten mit Stützpunkten in Misenum und Ravenna unterteilt, hinzu kamen Provinzflotten in Alexandria und anderen großen Häfen des Mittelmeers. Die Marine wahrte nicht nur den Frieden auf See, sondern überwachte auch die großen Ströme des Imperiums wie den Rhein, die Donau und natürlich den Nil.
Jede Flotte wurde von einem Präfekten befehligt. Vorherige Erfahrung in den Seestreitkräften war nicht erforderlich, denn die Tätigkeit umfasste vor allem administrative Funktionen.
Unterhalb des Rangs des Präfekten ist der große Einfluss der griechischen Marine auf die Flotte des Imperiums unübersehbar. Die Flottillenkommandanten hießen Navarchen und befehligten zehn Schiffe. Die Navarchen bekleideten zur See einen dem Centurionat entsprechenden Rang. Auf Wunsch konnten sie sich als Centurio in die Legion versetzen lassen. Der ranghöchste Navarch der Flotte trug den Namen Navarchus Princeps und entsprach dem Obercenturio einer Legion. Auf Nachfrage stand er dem Präfekten mit seinem fachmännischen Rat zur Seite.
Die Schiffe wurden von Trierarchen befehligt. Wie die Navarchen stiegen auch sie aus den Mannschaftsdienstgraden auf und hatten das Kommando über das jeweilige Schiff. Ihre Rolle entsprach jedoch nicht der eines modernen Kapitäns zur See. Der Trierarch hatte zwar im seemännischen Sinne die Befehlsgewalt über das Schiff, doch in der Schlacht lag die Entscheidungsgewalt bei dem Offizier, dem die Marineinfanteristen des Schiffs unterstanden.
Der häufigste Kampfschifftyp war eine für Erkundungsfahrten eingesetzte kleine Galeere – die Liburne. Liburnen wurden gerudert beziehungsweise gesegelt und waren zusätzlich zur seemännischen Besatzung mit einer kleinen Einheit Marineinfanteristen bemannt. Ein ähnlicher Schiffstypus war die Bireme, die aber etwas größer und schlachtentauglicher war. Die großen Kriegsschiffe, die Triremen, Quadrimen und Quinquiremen, waren zu der Zeit, in der die Handlung des vorliegenden Romans angesiedelt ist, schon eine Seltenheit und stellten nur noch Relikte eines vergangenen Zeitalters von Seekriegen dar.
Kapitel 1
Der Kommandant des kleinen Marinestützpunkts Epichos frühstückte gerade, als ihm der diensttuende Optio der Morgenwache Bericht erstattete. Seit Tagesanbruch fiel ein leichter Nieselregen – der erste Niederschlag seit Monaten –, und der Mantel des Optios war mit Tröpfchen bedeckt, die wie winzige Glasperlen aussahen.
»Was ist, Septimus?«, fragte Trierarch Philipus knapp und tunkte ein Stück Brot in eine kleine Schale mit Garum-Sauce, die vor ihm stand. Er hatte die Gewohnheit, morgens einen Kontrollgang durch das kleine, befestigte Lager zu machen und dann in sein Quartier zurückzukehren, um ungestört zu frühstücken.
»Ein Schiff ist gesichtet worden, Herr. Es fährt die Küste entlang und hat Kurs auf uns genommen.«
»Ein Schiff, so? Zufällig befährt es eine der verkehrsreichsten Schifffahrtsstraßen des Imperiums.« Philipus holte tief Luft, um seine Ungeduld zu zügeln. »Und der wachhabende Marineinfanterist hält das für ungewöhnlich?«
»Es ist ein Kriegsschiff, Herr. Und es ist auf dem Weg in die Bucht.« Der Optio überging den Sarkasmus seines Vorgesetzten und setzte seinen Bericht mit ausdrucksloser Stimme fort. So hielt er es, seit der Trierarch vor beinahe zwei Jahren das Kommando über den Vorposten übernommen hatte. Anfangs war Philipus von seiner Beförderung begeistert gewesen; zuvor hatte er ein kleines Kriegsschiff in der Provinzflotte Alexandrias befehligt, eine Liburne. Als rangniedriger Kommandant eines kleinen Schiffes, das kaum je den Hafen verließ, hatte er nie eine Gelegenheit bekommen, sich auszuzeichnen, was ihn allmählich zutiefst verdrossen hatte. Die Ernennung zum Kommandanten des kleinen Marinestützpunkts in Epichos hatte ihm Unabhängigkeit verschafft, und anfangs hatte Philipus sich größte Mühe gegeben, den kleinen Versorgungshafen vorbildlich zu führen. Doch die Monate schleppten sich dahin, ohne dass irgendetwas Aufregendes geschah, und die Männer hatten wenig zu tun. Ihnen oblag es, die Kriegsschiffe und kaiserlichen Postschiffe zu verproviantieren, die auf ihrem Weg entlang der ägyptischen Küste gelegentlich in den kleinen, flachen Hafen einfuhren. Philipus’ einzige weitere Pflicht war das Entsenden einer regelmäßigen Patrouille das Nildelta hinauf, um die Einheimischen daran zu erinnern, dass ihre römischen Herren stets ein wachsames Auge auf sie hatten.
Und so quälte Philipus sich gelangweilt durch die Tage. Er befehligte eine halbe Centurie Marineinfanteristen und ebenso viele Seeleute, dazu eine alte Bireme – die Anubis –, die einmal in der Flotte gesegelt war, mit der Kleopatra ihren Liebhaber Marcus Antonius in seinem Krieg gegen Octavian unterstützt hatte. Nach Antonius’ Niederlage bei Actium war die Bireme in die römische Marine eingegliedert worden und hatte in der Flotte von Alexandria Dienst getan. Schließlich hatte man sie am Ende ihrer Tage nach Epichos geschickt, wo sie vor dem kleinen befestigten, aus Lehmziegeln errichteten Lager, das die Bucht überwachte, auf dem Strand lag.
Was für ein trübseliges Kommando, dachte Philipus. Die Küste des Nildeltas war flach und eintönig, und ein großer Teil der Bucht bestand aus einem Mangrovensumpf, in dem Krokodile lauerten. Reglos wie umgestürzte Palmstämme lagen sie im Wasser und warteten darauf, dass ihnen ein Beutetier nah genug kam, um es zu überrumpeln. Der Trierarch hoffte immer noch auf ein Abenteuer. Doch heute würde er nur überwachen, wie Zwieback, Wasser und Ersatzteile – Tauwerk, Segel und Rundhölzer – auf das neu eintreffende Boot geladen wurden, und sonst überhaupt nichts Aufregendes erleben. Dafür hätte man ihn wirklich nicht beim Frühstück zu stören brauchen.
»Ein Kriegsschiff, so?« Philipus biss Brot ab und kaute. »Nun, es befindet sich wahrscheinlich auf einer Patrouillenfahrt.«
»Das glaube ich nicht, Herr«, erwiderte Optio Septimus. »Ich habe im Logbuch des Stützpunkts nachgeschaut, und für mindestens einen Monat wird kein Kriegsschiff in Epichos erwartet.«
»Dann ist es eben mit einem besonderen Auftrag unterwegs«, erklärte Philipus wegwerfend. »Der Kapitän macht Station, um seine Wasser- und Nahrungsmittelvorräte aufzufüllen.«
»Soll ich die Männer zu den Waffen rufen, Herr?«
Philipus warf ihm einen scharfen Blick zu. »Warum denn das? Welchen Sinn soll das haben?«
»Stehender Befehl, Herr. Bei Sichtung eines unbekannten Gefährts – ob nun zu Wasser oder zu Land – wird die Garnison alarmiert.«
»Es ist doch kein unbekanntes Gefährt, oder? Es ist ein Kriegsschiff. Wir Römer sind die Einzigen, die im östlichen Mittelmeerraum Kriegsschiffe einsetzen. Das Fahrzeug ist also nicht unbekannt. Ergo ist es nicht nötig, die Männer in Aufruhr zu versetzen, Optio.«
Septimus hielt seine Stellung. »Wenn ein Schiff nicht angemeldet ist, ist es den Regeln zufolge unbekannt, Herr.«
»Den Regeln zufolge?« Philipus blies die Wangen auf. »Hör zu, Optio, sollte es irgendein Anzeichen von Feindseligkeit geben, kannst du die Garnison alarmieren. Sag einfach dem Quartiermeister Bescheid, dass wir Besuch bekommen. Er und seine Leute sollen sich bereithalten, das Kriegsschiff zu verproviantieren. Und jetzt möchte ich zu Ende frühstücken, wenn du gestattest. Wegtreten.«
»Jawohl, Herr.« Der Optio nahm Haltung an, salutierte, machte kehrt und schritt durch den kurzen Säulengang zum Ausgang des Kommandantenquartiers. Philipus seufzte. Er hatte ein schlechtes Gewissen, weil er den Mann so abgekanzelt hatte. Septimus war ein fähiger Unteroffizier, auch wenn er nicht sonderlich viel Fantasie besaß. Er war durchaus im Recht gewesen, als er den stehenden Befehl zitierte. In den frühen Tagen seines neuen Kommandos, als er noch voller Begeisterung gewesen war, hatte Philipus diese Befehle eigenhändig sorgfältig niedergeschrieben.
Philipus aß den letzten Bissen Brot, leerte sein Glas von mit Wasser vermischtem Wein und erhob sich, um in seine Schlafkammer zu gehen. Er blieb bei den Kleiderhaken an der Wand stehen und griff nach seinem Brustpanzer und seinem Helm. Es war sicherlich geraten, den Kommandanten des Schiffs förmlich zu empfangen und für ein rasches Beladen zu sorgen, damit er der Flotte in Alexandria einen guten Eindruck vermitteln konnte. Wenn die Berichte über Philipus wohlwollend ausfielen, bestand immerhin die Möglichkeit, dass er vielleicht ein prestigeträchtigeres Kommando erhielt und Epichos hinter sich lassen konnte.
Philipus band seinen Kinnriemen fest, rückte den Helm zurecht, legte sich den Schwertgurt über die Schulter und verließ sein Quartier. Das befestigte Lager in Epichos war klein, kaum fünfzig Schritte im Quadrat. Die Mauern aus Lehmziegeln waren drei Meter hoch und würden einen Feind, der entschlossen war, den Versorgungshafen anzugreifen, kaum abhalten. Die Mauern waren jedenfalls rissig und baufällig und wären leicht einzureißen. Aber tatsächlich bestand die Gefahr eines Angriffs gar nicht, überlegte Philipus. Die römische Marine beherrschte das Meer, und die nächste Bedrohung von Landseite stellte das Königreich Nubien dar, das Hunderte von Meilen weiter südlich lag. Sonst gab es nur noch verschiedene arabische Räuberbanden, die gelegentlich isolierte Siedlungen am oberen Nil überfielen.
Das Quartier des Trierarchen lag am hinteren Ende des befestigten Lagers zwischen dem Kornspeicher und dem Lagerhaus für Schiffsbedarf. Sechs Mannschaftsbaracken säumten die Straße, die mitten durchs Lager zum Torhaus führte. Als er sich näherte, nahmen zwei Wachleute gemächlich Haltung an und präsentierten die Speere. Philipus ging zwischen ihnen hindurch und verließ das Lager. Obwohl der Himmel klar war, lag ein leichter Nebelschleier über der Bucht und wurde über dem Mangrovensumpf dichter. Das Gestrüpp aus Binsen, Palmen und Buschwerk wirkte dadurch ein wenig gespenstisch, und in seiner Anfangszeit hier hatte Philipus das sogar als leicht beunruhigend empfunden. Doch inzwischen hatte er oft an Flusspatrouillen teilgenommen und sich an den frühmorgendlichen Nebel gewöhnt, der häufig über dem Nildelta lag.
Vor dem befestigten Lager lag ein langer Strand, der um die Bucht herum bis zum Mangrovensumpf führte. Auf der anderen Seite der Bucht machte der Strand einer felsigen Landzunge Platz, die einen schönen, natürlichen Hafen bildete. Unmittelbar vor dem Lager lag die Philipus unterstellte Bireme auf dem Sand. Der oberste Zimmermann hatte dem alten Kriegsschiff viele Monate Arbeit gewidmet. Er und seine Männer hatten angefaultes Holz ersetzt, das Schiff geteert und den Mast, die Spieren und die Takelage erneuert. Nahe dem Bug waren zu beiden Seiten kunstvoll Augen aufgemalt worden. Das Schiff war seetüchtig und konnte zu Wasser gelassen werden, aber Philipus bezweifelte, dass dieser Veteran aus Actium je wieder eine Seeschlacht erleben würde. Neben der Anubis ragte ein solider Holzpier rund vierzig Schritte in die Bucht hinaus und gestattete besuchenden Schiffen das Anlegen.
Obwohl die Sonne sich noch nicht über den Nebel erhoben hatte, war die Luft warm, und Philipus hoffte, dass er auf die Förmlichkeiten, die mit der Ankunft des Schiffes verbunden waren, bald verzichten und Brustpanzer und Helm wieder ablegen könnte. Er machte kehrt und schritt über den staubigen Weg zu dem kleinen Wachturm. Dieser war auf einer Felsenerhöhung der Landzunge errichtet, die den natürlichen Wellenbrecher des Hafens bildete. An der Spitze der Landzunge bewachte ein weiterer, mächtigerer Wachturm die Zufahrt zur Bucht. Dessen Mauern waren mit vier Ballisten und einem Kohlebecken bestückt, sodass man ein feindliches Schiff, das in die schmale Hafeneinfahrt einlief, einem Hagel brennender Geschosse aussetzen konnte.
Als Philipus bei dem kleinen Wachturm eintraf, betrat er die Wachstube im Untergeschoss und sah drei seiner Marineinfanteristen auf Bänken sitzen. Sie aßen Brot mit getrocknetem Fisch und unterhielten sich dabei in leisem Tonfall. Als sie ihn erblickten, standen sie auf und salutierten.
»Rührt euch, Männer.« Philipus lächelte. »Wer hat das Kriegsschiff gemeldet?«
»Ich, Herr«, sagte einer der Marineinfanteristen.
»Gut, Horio, dann geh voran.«
Der Marinesoldat legte das Brot auf seinen Teller, durchquerte den Raum und stieg die Treppe zur Aussichtsplattform hinauf. Der Trierarch folgte ihm und trat neben dem Kohlebecken für das Signalfeuer, das in Sekundenschnelle angezündet werden konnte, auf den Turm hinaus. Über einen Teil der Plattform spannte sich ein Schutzdach aus Palmblättern. Der Wachposten, der Horio abgelöst hatte, stand an der verwitterten Holzbrüstung und spähte aufs Meer hinaus. Philipus trat zu ihm und Horio und sah zu dem Schiff hinüber, das sich der Einfahrt der Bucht näherte. Die Besatzung war damit beschäftigt, das Segel einzuholen, ein weinrotes Rechteck aus Ziegenleder, das mit Adlerflügeln bemalt war. Gleich darauf war das Segel verschnürt, und an den Seiten des Schiffs erschienen Riemen und tauchten in die leichte Dünung ein. Es folgte eine kurze Pause, dann wurden die Ruderblätter auf ein Kommando hochgerissen, schwangen nach vorn, wieder nach unten, durchschnitten das Wasser und katapultierten den Bug des Schiffs vorwärts.
Philipus wandte sich Horio zu. »Aus welcher Richtung ist es gekommen, bevor es Kurs aufs Land genommen hat?«
»Von Westen, Herr.«
Der Trierarch nickte versonnen. Somit also aus der Richtung, in der Alexandria lag. Das war eigenartig, denn das nächste Kriegsschiff war erst in über einem Monat angekündigt. Dann würde es den Vorposten besuchen, Botschaften zustellen und den vierteljährlich auszuzahlenden Sold überbringen. Unter Philipus’ Augen passierte das Schiff den Turm, der die Einfahrt zum Hafen bewachte, und fuhr durch das ruhige Wasser zum Pier. Er sah die Seeleute und Marineinfanteristen an der Reling stehen und auf die Bucht hinausblicken. Im hölzernen Gefechtsturm am Bug des Schiffes stand eine große Gestalt mit einem federgeschmückten Helm hoch aufgerichtet da. Sie hatte die Arme vor sich auf die Brüstung gelegt und spähte zur Anlegestelle und dem befestigten Lager hinüber.
Eine Bewegung vor dem Lager fiel Philipus ins Auge, und er sah, wie Septimus und der Quartiermeister sich zusammen mit einer kleinen Begleitmannschaft von Seeleuten zum Pier hinunterbegaben.
»Am besten schließe ich mich dem Empfangskomitee an«, meinte er nachdenklich. Philipus warf einen letzten Blick auf das die Bucht durchquerende Schiff, das vor dem stillen Hintergrund des fernen Mangrovensumpfs einen anmutigen Anblick bot. Dann wandte er sich um und stieg die Leiter hinunter.
Als er zum Pier zurückgekehrt war, verlangsamte das Kriegsschiff schon seine Fahrt, und der Befehl, rückwärtszurudern, hallte deutlich zu den drei Offizieren und den Seeleuten hinüber, die über den Pier liefen, um die Besucher zu begrüßen. Die Ruderer hielten die Riemen ins Wasser, und der Widerstand der Riemenblätter wirkte dem Vorwärtsschub des Schiffs rasch entgegen.
»Riemen einziehen!«
Mit einem dumpfen Poltern verschwanden die Riemen im Inneren des Schiffs, und die Männer an der Ruderpinne steuerten die langsam gleitende Liburne längsseits an den Pier heran. Philipus konnte den Offizier im Gefechtsturm jetzt deutlich erkennen: Er war hochgewachsen und breitschultrig und wirkte überraschend jung. Gleichmütig stand er da, während sein Trierarch den Matrosen den Befehl zubrüllte, die Leinen zum Anlegen bereitzumachen. Als das Schiff auf den Pier zuglitt, warfen die Männer im Bug die Leinen übers Wasser, und Philipus’ Männer fingen sie auf und zogen das Fahrzeug längsseits an den Pier heran, bis es gegen die Binsenbündel stieß, die die Pfosten des Piers schützten. Eine weitere Leine wurde den Männern zugeworfen, die in der Nähe des Hecks warteten, und gleich darauf war das Schiff sicher vertäut.
Der Offizier verließ den Gefechtsturm und schritt übers Deck. Seine Matrosen öffneten die Seitenpforte und schoben eine Laufbrücke auf den Pier hinaus. Eine Gruppe Marineinfanteristen hatte an Bord Aufstellung genommen, und der Offizier gab ihnen ein Zeichen, als er zum Pier hinüberging. Philipus schritt ihm mit ausgestreckter Hand entgegen, um ihn zu begrüßen.
»Ich bin Trierarch Philipus, Kommandant des Versorgungshafens.«
Der Offizier packte seine Hand mit einem mächtigen Griff und nickte knapp. »Centurio Macro, abkommandiert zur Flotte von Alexandria. Wir müssen uns in deinem Hauptquartier unterhalten.«
Philipus zog unwillkürlich vor Überraschung die Augenbrauen hoch. Er bemerkte, wie seine Untergebenen neben ihm einen unbehaglichen Blick wechselten.
»Weshalb? Ist etwas geschehen?«
»Mein Befehl lautet, die Angelegenheit mit dir unter vier Augen zu besprechen.« Der Offizier nickte zu den anderen Männern auf dem Pier hinüber. »Ohne Zuhörer. Bitte geh voraus.«
Philipus war von der kurz angebundenen Art des Offiziers überrascht. Der Mann war zweifellos erst vor Kurzem aus Rom hier eingetroffen und neigte daher dazu, Offiziere vor Ort mit einer Überheblichkeit zu behandeln, die typisch für seinesgleichen war. »Nun gut, Centurio, hier entlang.«
Philipus drehte sich um und schickte sich an, den Pier zu verlassen.
»Einen Moment noch.« Centurio Macro wandte sich seinen Marineinfanteristen zu, die auf Deck warteten. »Mir nach!«
Zwanzig bewaffnete Marinesoldaten, lauter stämmige Männer mit mächtigem Körperbau, überquerten die Laufbrücke und formierten sich hinter dem Centurio. Philipus runzelte die Stirn. Er hatte erwartet, ein wenig zu plaudern und Nachrichten auszutauschen, bevor er seinem Quartiermeister den Befehl geben würde, sich um das Schiff zu kümmern. Mit einem derart barschen Umgangston hatte er nicht gerechnet. Was war so wichtig, dass der Offizier es ihm nur unter vier Augen sagen konnte? Mit einem Anfall von Nervosität fragte sich Philipus, ob man ihn fälschlich eines Verbrechens oder einer Intrige bezichtigt hatte. Er machte dem Offizier ein Zeichen, ihm zu folgen, und die kleine Kolonne marschierte über den Pier zum Strand. Philipus ging langsamer, bis er an der Seite des Centurios war, und fragte ihn leise: »Kannst du mir sagen, worum es eigentlich geht?«
»Ja, gleich.« Der Offizier warf ihm einen Blick zu und lächelte ein wenig. »Nichts, worüber du dich sorgen müsstest, Trierarch. Ich muss dir einfach ein paar Fragen stellen.«
Philipus fühlte sich durch diese Antwort nicht sonderlich beruhigt und schwieg während des restlichen Weges über den Pier und zu den Toren des befestigten Lagers. Die Wachposten nahmen Haltung an, als die Offiziere und Marinesoldaten näher kamen.
»Ich könnte mir vorstellen, dass hier nicht allzu viele Schiffe vorbeikommen«, sagte Centurio Macro.
»Nein, nicht viele«, antwortete Philipus und hoffte, dass der anscheinend so kühle Mann sich nun vielleicht doch noch auf ein Gespräch einlassen würde. »Gelegentlich ein Patrouillenschiff und die kaiserlichen Botenschiffe. Außerdem noch ein paar Schiffe mit Sturmschaden während der Wintermonate, aber das ist es auch schon. In Epichos ist nicht viel los. Ich wäre nicht überrascht, wenn der Statthalter in Alexandria die Garnison hier eines Tages verkleinern würde.«
Der Centurio warf ihm einen Blick zu. »Du versuchst herauszubekommen, warum ich hier bin?«
Philipus blickte ihn an und zuckte mit den Schultern. »Natürlich.«
Sie hatten das befestigte Lager betreten, und Centurio Macro blieb stehen und blickte sich um. Alles war ruhig. Die meisten Männer hielten sich in den Baracken auf, und die Nachtwache beendete gerade ihr Frühstück, um danach schlafen zu gehen. Einige der anderen Männer saßen vor ihrer Baracke auf einem Hocker, würfelten oder unterhielten sich leise. Centurio Macro registrierte aufmerksam jede Einzelheit.
»Ein nettes, ruhiges Kommando hast du da, Philipus. Ziemlich abgelegen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ihr trotzdem gut mit Vorräten versehen seid.«
Philipus nickte. »Wir haben viel Getreide und ein großes Lager an Schiffsbedarf. Nur wird dieser Tage nicht oft danach verlangt.«
»Perfekt«, brummte Centurio Macro. Er drehte sich um und nickte dem Optio zu, der die Gruppe von Marineinfanteristen befehligte. »Zeit loszuschlagen, Karim.«
Der Optio nickte und wandte sich seinen Leuten zu. »Packt sie.«
Vier der Marinesoldaten zogen plötzlich ihre Schwerter, machten kehrt und griffen die Wachposten am Tor an. Diesen blieb gerade noch genug Zeit, sich umzudrehen, da wurden sie auch schon von einem heftigen Hagel von Schwerthieben niedergemäht; sie konnten nicht einmal mehr aufschreien, bevor sie getötet wurden. Philipus sah bestürzt, wie die Leichen zu beiden Seiten des Torwegs zu Boden stürzten. Entsetzt wandte er sich Centurio Macro zu.
Dieser lächelte ihn an. Der Trierarch hörte ein leises Klirren, sah eine rasend schnelle Bewegung und spürte einen plötzlichen Schlag in den Bauch, als hätte ihn jemand kräftig geboxt. Ein weiterer Schlag, und er rang vor Schmerz keuchend um Atem. Philipus blickte nach unten und sah, dass die Hand seines Gegenübers einen Messergriff umklammert hielt. Von der Klinge war nur ein Fingerbreit zu sehen, der Rest verschwand unmittelbar unterhalb des Brustpanzers des Trierarchen zwischen den Falten seiner Tunika. Unter Philipus’ benommenem, verständnislosem Blick breitete sich ein roter Fleck auf dem Tuch aus. Der Centurio wühlte mit der Klinge in der Wunde und verletzte lebenswichtige Organe. Philipus rang um Atem und griff mit beiden Händen nach dem Arm, der das Messer führte. »Was soll das? Was machst du da?«
Der Centurio zog das Messer zurück, und Philipus spürte, wie das Blut aus der Wunde spritzte. Er ließ den Arm los. Seine Beine knickten ein, er brach auf den Knien zusammen und starrte in stummem Entsetzen zu dem angeblichen Centurio auf. Hinter dem Tor sah er die Leichen der Wachposten liegen. Dahinter stellte einer der Marineinfanteristen sich deutlich sichtbar vor dem Lager auf und reckte dreimal sein Schwert in die Höhe. Das musste ein vorher vereinbartes Zeichen sein, denn gleich darauf ertönte von der Liburne ein Jubelgeheul, und Männer, die sich bisher unter Deck verborgen gehalten hatten, sprangen auf den Steg. Philipus sah, wie der Quartiermeister versuchte, sein Schwert zu ziehen, aber mit einer schnellen Folge von Schwerthieben überwältigt wurde. Dem überrumpelten Optio und Philipus’ Seeleuten ging es nicht anders. Sie waren tot, bevor sie auch nur ihre Waffen ziehen konnten. Die Angreifer stürmten über den Pier zum Tor des befestigten Lagers.
Philipus sackte an der Wand des Torhauses zusammen und öffnete die Schnallen seines Brustpanzers. Er warf den Harnisch zur Seite und presste stöhnend die Hände auf die Wunde. Der Offizier, der sie ihm zugefügt hatte, stand neben ihm. Er hatte seinen Dolch wieder in die Scheide gesteckt und brüllte seinen ins Lager stürmenden Männern, die jeden Gegner, den sie finden konnten, niederstreckten, Befehle zu. Philipus musste alles, von Seelenqualen gepeinigt, mitansehen. Seine Marineinfanteristen und Seeleute wurden vor seinen Augen niedergemetzelt. Die Männer, die vor den Baracken gewürfelt hatten, und andere, die bei den ersten Kampfgeräuschen herausgestürzt waren, lagen jetzt tot da. Weitere Soldaten wurden in den Baracken getötet, wie die gedämpften Schreie und Rufe, die nach draußen drangen, bewiesen. Am Ende der Straße hatte eine Handvoll Männer nach ihren Schwertern gegriffen und versucht, die Stellung zu halten, aber sie waren ihren waffengewandten Gegnern nicht gewachsen und wurden niedergestreckt.
Der Centurio blickte sich im Lager um und nickte zufrieden. Dann drehte er sich um und richtete seinen Blick auf Philipus.
Der Trierarch räusperte sich. »Wer bist du?«
»Was spielt das für eine Rolle?« Der Mann zuckte mit den Schultern. »Bald bist du tot. Denk lieber daran.«
Philipus schüttelte den Kopf. Am Rand seines Gesichtsfeldes sah er bereits spinnwebartige, dunkle Schatten. Ihm war schwindlig und seine Hände, die er auf die Wunde presste, waren blutüberströmt. Er befeuchtete die Lippen mit der Zunge. »Wer?«
Der Mann band seinen Kinnriemen auf, nahm seinen Helm ab und ging neben Philipus in die Hocke. Er hatte dunkles, lockiges Haar, und eine leichte Narbe zeichnete seine Stirn und seine Wange. Er hatte einen eindrucksvollen Körperbau und schien selbst in der Hocke vollkommen im Gleichgewicht. Er sah dem Trierarchen fest in die Augen. »Wenn es dich tröstet, dem Tod einen Namen geben zu können, so wisse, dass Ajax, Sohn des Telemachus, dich und deine Männer niedergestreckt hat.«
»Ajax«, wiederholte Philipus. Er schluckte und murmelte: »Warum?«
»Weil du mein Feind bist. Rom ist mein Feind. Ich werde so lange Römer töten, bis ich selbst getötet werde. So sieht es aus. Und jetzt mach dich bereit.«
Er stand auf und zog sein Schwert. Philipus Augen weiteten sich entsetzt. Er warf seine blutige Hand hoch. »Nein!«
Ajax runzelte die Stirn. »Du bist praktisch schon tot. Stirb mit Würde.«
Philipus verharrte einen Moment lang reglos, dann senkte er die Hand, hob den Kopf, drehte ihn zur Seite und entblößte so seine Kehle. Er kniff die Augen zusammen. Ajax holte aus, zielte mit der Schwertspitze genau auf die Halsgrube des Trierarchen und stieß mit aller Kraft zu. Dann riss er das Schwert frei, und ein scharlachroter Strahl spritzte aus der Wunde. Philipus riss die Augen auf, öffnete den Mund, und seiner Kehle entrang sich ein kurzes Gurgeln. Dann verblutete er mit zitternden Gliedern und lag schließlich still da. Ajax wischte sein Schwert mit dem Tunikaärmel des Toten ab und steckte es dann mit einem metallischen Klirren in die Scheide zurück.
»Karim!«
Einer seiner Männer, ein dunkelhäutiger Orientale, eilte zu ihm. »Herr?«
»Nimm fünf Männer und kämm die Gebäude durch. Töte die Verwundeten und jeden, den wir übersehen haben. Lass die Leichen über die Bucht rudern und in den Mangrovensumpf werfen. Die Krokodile werden sich schon um sie kümmern.«
Karim nickte, sah dann plötzlich etwas hinter seinem Anführer und streckte den Arm aus. »Schau!«
Ajax drehte sich um und erblickte eine Rauchfahne, die außerhalb der Lagermauern in den klaren Himmel aufstieg. »Das ist der Wachturm. Sie haben das Signalfeuer entzündet.« Ajax blickte sich rasch um und winkte zwei seiner Unteroffiziere herbei. Als Erstes wandte er sich an einen hochgewachsenen, muskulösen Nubier. »Hepithus, führe deine Männer im Eilschritt zum kleinen Wachturm. Töte die Wächter und lösche das Feuer, so schnell du kannst. Canthus, du übernimmst den Turm an der Einfahrt zur Bucht.«
Hepithus nickte und wandte sich um. Er befahl seinen Männern brüllend, ihm zu folgen, und rannte dann durchs Tor. Der andere Mann, Canthus, hatte einen dunklen Teint und war Schauspieler in Rom gewesen, bis er wegen der Verführung der Ehefrau eines bedeutenden und rachsüchtigen Senators zum Kampf in der Arena verurteilt worden war. Er lächelte Ajax zu und winkte der anderen Truppe, ihm zu folgen. Ajax trat zur Seite, um sie vorbeizulassen, und ging dann zur Holztreppe, die auf die Befestigungsmauer des Lagers führte. Von dort betrat er das Torhaus und bestieg gleich darauf den Turm. Er ließ den Blick über den Versorgungshafen wandern und betrachtete das Lager, die Bucht und das kleine Boot, das in der Nähe des Mangrovensumpfs, wo ein Flüsschen ins Meer mündete, auf dem Strand lag. In der entgegengesetzten Richtung sah er, wie Hepithus und seine Männer den kleinen Wachturm stürmten und das Signalfeuer löschten. Die Rauchfahne, die zum Himmel aufgestiegen war, löste sich auf.
Ajax strich sich über die Bartstoppeln und dachte über seine Lage nach. Monatelang waren er und seine Männer vor ihren römischen Verfolgern geflohen. Sie waren gezwungen gewesen, einsame Buchten an der Küste aufzusuchen und ständig den Meereshorizont nach etwaigen Hinweisen auf den Feind abzusuchen. Wenn ihnen die Vorräte ausgegangen waren, hatten sie ihr Versteck verlassen und einsame Handelsschiffe gekapert oder kleine Küstensiedlungen geplündert. Zweimal hatten sie römische Kriegsschiffe gesichtet. Das erste Mal hatten die Römer die Verfolgung aufgenommen und Ajax und seine Männer gejagt, doch nach Einbruch der Nacht hatten die Flüchtigen den Kurs geändert, waren dorthin zurückgesegelt, wo sie hergekommen waren, und hatten ihre Verfolger bis zum Morgengrauen abgeschüttelt. Das zweite Mal hatte Ajax von einer kleinen Felseninsel aus zugesehen, wie zwei Schiffe an der verborgenen Bucht vorbeigesegelt waren, in der sein Fahrzeug versteckt gelegen hatte. Der Mast war mit Palmwedeln kaschiert gewesen.
Die monatelange Flucht forderte allmählich ihren Tribut von seinen Gefolgsleuten. Sie waren ihm noch immer treu ergeben und befolgten ohne zu murren seine Befehle, aber Ajax wusste, dass einige von ihnen allmählich die Hoffnung verloren. Sie ertrugen es nicht länger, täglich in Angst vor Gefangennahme und Kreuzigung zu leben. Er musste ihnen wieder Hoffnung vermitteln, wie er es damals beim Sklavenaufstand auf Kreta getan hatte. Ajax blickte sich im Versorgungshafen um und nickte zufrieden. Er hatte ein zweites Schiff und außerdem Nahrungsmittelvorräte und Schiffsbedarf für viele Monate erobert. Der Vorposten würde eine perfekte Basis darstellen, von der aus er seinen Kampf gegen das römische Imperium fortsetzen konnte. Ajax Miene verfinsterte sich, als er an all das dachte, was Rom ihm und seinen Gefolgsleuten angetan hatte. Jahrelange harte Sklavenarbeit, dann die Gefahren eines Lebens als Gladiator. Dafür sollte Rom büßen. Solange seine Männer bereit waren, ihm zu folgen, würde Ajax ihren gemeinsamen Feind bekämpfen.
»Das genügt erst einmal«, sagte er mit Blick auf den Versorgungshafen leise zu sich selbst. »Damit sind wir vorläufig sehr gut bedient.«
Kapitel 2
Centurio Macro schwang das Bein über den Rand der schmalen Koje und reckte ächzend die Schultern, bevor er vorsichtig aufstand. Obgleich Macro eher untersetzt war, musste er doch den Kopf einziehen, um sich nicht den Schädel an der Decke zu stoßen. Die Kajüte am Heck des Kriegsschiffs war sehr beengt. Der Platz reichte gerade für die Koje, einen kleinen Tisch mit einer Truhe darunter und die Kleiderhaken, an denen Tunika, Rüstung, Helm und Schwert hingen. Er kratzte sich durch sein leinenes Lendentuch am Hinterteil und gähnte.
»Verdammte Kriegsschiffe«, knurrte er. »Wer kann nur so verrückt sein, dass er sich freiwillig zur Marine meldet?«
Er war inzwischen seit über zwei Monaten an Bord und begann allmählich zu zweifeln, ob die kleine Truppe, die mit dem Auftrag unterwegs war, den flüchtigen Gladiator und seine überlebenden Gefolgsleute zur Strecke zu bringen, die Gesuchten jemals finden würde. Über einen Monat war es jetzt her, dass sie Ajax’ Schiff vor der Küste Ägyptens zum letzten Mal gesichtet hatten. Die Römer waren dem Schiff gefolgt, sobald sie das Segel am Horizont entdeckt hatten, hatten aber in der darauffolgenden Nacht den Kontakt verloren. Seitdem hatte sich die Suche nach den Flüchtlingen als fruchtlos erwiesen. Die beiden römischen Schiffe hatten die afrikanische Küste bis Lepcis Magna abgesucht. Dort hatten sie kehrtgemacht, waren ostwärts gesegelt und hatten die Küste nach irgendeinem Hinweis auf Ajax und seine Männer durchkämmt. Sie waren erst vor zwei Tagen an Alexandria vorbeigesegelt. Ihre Vorräte gingen allmählich zur Neige, doch Cato – der Präfekt, der die Mission befehligte – war fest entschlossen gewesen, die Suche erst abzubrechen und neue Vorräte aufzunehmen, wenn seine Männer wirklich die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit erreicht hatten. Jetzt war Centurio Macro hungrig und frustriert und hatte die ganze Geschichte gründlich satt.
Er zog die Tunika über den Kopf und stieg die schmale Stiege zum Deck hinauf – barfuß, da ihm die Nachteile von Militärstiefeln auf einem Kriegsschiff rasch bewusst geworden waren. Wenn sie nass waren, boten die glattgeschmirgelten Decksplanken kaum Halt, und Macro und die anderen Soldaten hatten Mühe, sich mit ihren genagelten Sohlen auf den Beinen zu halten. Den Kriegsschiffen waren zwei Centurien von Legionären zugeteilt worden, um die Marineinfanteristen zu verstärken; diese Maßnahme war notwendig, da Ajax und seine Gefolgsleute – meist ehemalige Gladiatoren, genau wie ihr Anführer – sich selbst den besten Soldaten der römischen Armee mehr als ebenbürtig erwiesen hatten.
Als der Trierarch Macro an Deck treten sah, ging er zu ihm und nickte grüßend.
»Einen schönen Morgen, Herr.«
»Schön soll dieser Morgen sein?«, fragte Macro finster. »Ich befinde mich auf einem kleinen, engen Schiff mitten auf dem Meer und habe nicht einmal einen Krug Wein zur Gesellschaft. Schön sieht für mich anders aus.«
Polemo, der Trierarch, spitzte die Lippen und blickte sich um. Der Himmel war beinahe klar, nur ein paar weiße Wölkchen waren zu sehen. Eine leichte Brise füllte das Segel, das sich wölbte wie das Bäuchlein eines allzu genusssüchtigen Epikureers. In der leichten Dünung hob und senkte sich das Schiff in einem regelmäßigen, angenehmen Rhythmus. An Steuerbord sah man die Küste als friedlichen, schmalen Streifen. An Backbord war der Horizont klar. Eine Viertelmeile voraus segelte das zweite Schiff, eine Schaumspur im Kielwasser. Alles in allem, dachte der Trierarch, war der Tag so schön, wie ein Seemann ihn sich nur wünschen konnte.
»Gibt es Neuigkeiten?«, fragte Macro.
»Jawohl, Herr. Heute Morgen haben wir das letzte Fässchen Pökelfleisch angebrochen. Der Zwieback geht uns morgen aus, und ich habe die Wasserrationen halbiert.« Der Trierarch enthielt sich jeden Kommentars zu der angespannten Versorgungslage. Die Entscheidung, wie damit umzugehen war, oblag nicht ihm und nicht einmal Macro. Nur der Präfekt konnte den Befehl geben, den nächsten Hafen anzulaufen und Proviant aufzunehmen.
»Hmmm.« Macro runzelte die Stirn. Beide Männer blickten zu dem vorausfahrenden Kriegsschiff, als versuchten sie, Präfekt Catos Gedanken zu lesen. Der Präfekt hatte Ajax verbissen gejagt. Macro konnte das gut verstehen. Er hatte inzwischen schon einige Jahre mit Cato zusammen gedient, und bis vor Kurzem war Macro sogar sein Vorgesetzter gewesen. Cato hatte sich seine Beförderung redlich verdient, das akzeptierte Macro ohne Weiteres, aber die Umkehrung ihrer Beziehung fühlte sich doch eigenartig an. Cato war Anfang zwanzig, und seine schlanke, sehnige Gestalt ließ seinen Mut und seine Zähigkeit nicht auf den ersten Blick erkennen. Er war sehr intelligent, und seine Einfälle hatten sie immer wieder aus den Gefahren gerettet, mit denen sie in den letzten Jahren konfrontiert gewesen waren. Hätte Macro sich einen Vorgesetzten aussuchen müssen, wäre es jemand wie Cato gewesen. Vor seiner Beförderung zum Centurio hatte Macro fast fünfzehn Jahre in den römischen Legionen gedient, und er hatte genug Erfahrung, um soldatisches Talent zu erkennen. In Cato hatte er sich damals allerdings getäuscht, dachte er mit einem reumütigen Lächeln. Als der magere Jugendliche in der Festung der Zweiten Legion am Rheinufer eingetroffen war, hatte Macro geglaubt, dass er wohl kaum die vor ihm liegende harte Ausbildung überstehen würde. Doch Cato hatte ihm das Gegenteil bewiesen. Er hatte Entschlossenheit, Intelligenz und vor allem Mut gezeigt. Bei seinem ersten Scharmützel mit einem germanischen Stamm, der einen Überfall über den großen Strom – die Grenze des Imperiums – gewagt hatte, hatte er Macro das Leben gerettet. Seit damals hatte Cato sich immer wieder als erstklassiger Soldat bewährt, und er war der engste Freund geworden, den Macro jemals besessen hatte. Nun hatte Cato die Beförderung in den Rang des Präfekten errungen, und zum ersten Mal war er Macros Vorgesetzter. An diese neue Ordnung der Dinge mussten beide Männer sich erst einmal gewöhnen.
Die Entschlossenheit des Präfekten, Ajax zur Strecke zu bringen, war nicht nur der Notwendigkeit geschuldet, seine Befehle zu befolgen. Eine ebenso große Motivation war sein Wunsch nach Rache. Cato hatte zwar den Auftrag, Ajax wenn möglich lebend zu fassen und in Ketten nach Rom zu bringen, doch er verspürte wenig Neigung dazu. Während des Sklavenaufstands auf Kreta hatte Ajax Catos Verlobte entführt. Julia war in einem Käfig gefangen gehalten worden. In ihrem eigenen Schmutz und in Lumpen hatte sie dort gelitten, und Ajax hatte sie mit der Aussicht auf Folter und Tod gequält. Macro war zur gleichen Zeit gefangen genommen und in denselben Käfig gesperrt worden. Sein Rachedurst war beinahe ebenso groß wie der seines Vorgesetzten.
Der Trierarch räusperte sich. »Denkst du, er wird den Befehl geben, in einen Hafen einzulaufen, um Vorräte aufzunehmen?«
»Wer weiß?« Macro zuckte mit den Schultern. »Nach dem gestrigen kleinen Vorfall bin ich mir da nicht so sicher.«
Der Trierarch nickte. Am vergangenen Abend hatten die beiden Schiffe zum Ankern ein kleines Küstendorf angesteuert. Als sie sich der Küste näherten, waren die Bewohner der kleinen Siedlung aus Lehmziegelhäusern landeinwärts geflohen und hatten ihre Wertgegenstände und so viele Nahrungsmittel mitgenommen, wie sie tragen konnten. Ein Trupp Legionäre hatte das Dorf vorsichtig durchsucht und war mit leeren Händen zurückgekommen. Kein Bewohner war zurückgeblieben, und falls die Leute Nahrungsmittel zurückgelassen hatten, waren sie sorgfältig versteckt worden. Der einzige Hinweis auf etwas Ungewöhnliches waren eine Reihe frischer Gräber und die ausgebrannten Ruinen einiger Gebäude. Da sie niemanden hatten befragen können, waren die Legionäre an Bord zurückgekehrt. In der Nacht waren die Schiffe dann mit Steinschleudern angegriffen worden. Macro hatte nur einige dunkle Gestalten vor dem helleren Hintergrund des Strandes erkennen können. Die ganze Nacht über waren Steine auf die Schiffe niedergeprasselt oder platschend neben ihnen ins Wasser gefallen. Zwei Marineinfanteristen waren verletzt worden, bevor die Männer den Befehl erhielten, ihre Deckung nicht zu verlassen. Der überraschende Angriff hatte kurz vor Tagesanbruch geendet, und die beiden Schiffe hatten beim ersten Tageslicht die Segel gesetzt, um die Suche nach Ajax fortzusetzen.
»Achtung!«, rief der Ausguck vom Mastkorb herunter. »Die Sobek dreht bei.«
Der Trierarch und Macro sahen angestrengt voraus. Das Segel des anderen Schiffs flatterte im Wind. Catos Besatzung fierte das Schot, um die Fahrt zu verlangsamen.
»Anscheinend möchte sich der Präfekt mit uns besprechen«, meinte der Trierarch.
»Das werden wir gleich wissen. Bring uns längsseits«, befahl Macro. Dann ging er in seine Kajüte, um sein Schwert und seinen Befehlsstab zu holen und seine Stiefel anzuziehen, bevor er vor seinen Vorgesetzten trat. Als er an Deck zurückkehrte, näherte sich sein eigenes Schiff, die Ibis, dem Heck des anderen. Dort stand Cato, legte die Hände trichterförmig an den Mund und rief über die Dünung hinweg:
»Centurio Macro! Komm an Bord!«
»Jawohl, Herr«, rief Macro zurück und nickte dem Trierarchen zu. »Polemo, ich brauche das Beiboot.«
»Jawohl, Herr.« Der Offizier drehte sich um und befahl seinen Matrosen, das Boot aus seinem Gestell auf dem Hauptdeck herauszuheben. Während mehrere Männer einen Flaschenzug bedienten, schwenkten andere das kleine Boot über den Rand des Schiffes. Dann wurde es ins Wasser hinuntergelassen. Sechs Männer stiegen ein und griffen nach den Riemen. Macro kletterte die Strickleiter hinunter, ging vorsichtig zum Platz im Heck und setzte sich rasch. Gleich darauf legten die Matrosen sich in die Riemen und pullten das Boot zur Sobek hinüber. Als sie sich dem Schiff näherten, legte einer der Matrosen den Riemen beiseite, ergriff einen Bootshaken und angelte nach dem Tau, das über eine Öffnung in der Reling des Schiffs gespannt war. Macro kroch nach vorn, suchte Halt, wartete darauf, dass eine Welle das Boot nach oben trug, und sprang auf die Strickleiter, die vom Schiff herunterhing. Er kletterte rasch hoch, bevor er in ein Wellental geraten und ins Wasser eintauchen konnte. Cato erwartete ihn bereits.
»Komm mit.«
Sie gingen zum Bug und Cato schickte einige Soldaten mit einem knappen Befehl nach achtern, damit niemand ihr Gespräch belauschte. Beim Anblick des ausgemergelten Gesichts seines Freundes überkam Macro ein Moment der Sorge. Es war einige Tage her, seit sie sich von Angesicht zu Angesicht begegnet waren, und auch jetzt wieder bemerkte Macro die dunklen Ringe unter den Augen des jungen Mannes. Cato beugte sich vor, legte den Ellbogen auf die dicken Balken des Schanzkleids und wandte sich Macro zu.
»Wie ist eure Vorratssituation?«
»Wir können noch zwei Tage durchhalten, wenn ich die Wasserrationen der Männer viertele. Danach werden sie zu nichts mehr nutze sein, selbst wenn wir Ajax finden, Herr.«
Bei dieser ehrerbietigen Anrede zuckte es schmerzlich in Catos Zügen. Er hüstelte. »Pass auf, Macro, du kannst das ›Herr‹ weglassen, wenn keiner zuhört. Dafür kennen wir einander gut genug.«
Macro blickte sich nach den Männern weiter achtern um und schaute dann wieder zurück. »Du bist jetzt Präfekt, mein Junge, und die Männer erwarten, dass ich dir dementsprechend gegenübertrete.«
»Selbstverständlich. Aber wenn ich ein offenes Gespräch brauche, unter vier Augen, dann unterhalten wir uns als Freunde, einverstanden?«
»Ist das ein Befehl?«, gab Macro ernst zurück, doch dann verzogen sich seine Mundwinkel unwillkürlich nach oben und verrieten seine wahre Stimmung. Cato blickte auf. »Erspare mir die Bitterkeit eines ehemaligen Gleichgestellten.«
Macro nickte lächelnd. »Na gut. Also, wie sieht der Plan aus?«
Cato konzentrierte sich trotz seiner Müdigkeit. »Ajax’ Spur ist erkaltet. Die Männer brauchen eine Ruhepause.«
»Und du auch.«
Cato überging den Kommentar und fuhr fort: »Auf beiden Schiffen sind die Vorräte beinahe aufgebraucht. Wir kehren um und segeln nach Alexandria. Bis dorthin sind es drei Tage, wir müssen also irgendwo unterwegs Wasser und Proviant aufnehmen. Ich hoffe nur, dass wir nicht wieder genauso empfangen werden wie gestern.« Er schüttelte stirnrunzelnd den Kopf. »Das war eigenartig.«
»Vielleicht haben sie uns für Steuereintreiber gehalten.« Macro zuckte mit den Schultern. »Ich kann nicht behaupten, dass ich die Einheimischen besonders gastfreundlich finde. Hoffentlich werden wir in Alexandria besser behandelt. Wenn alle Gypos so reizend sind wie dieses Gesindel, bin ich froh, wenn die Jagd vorbei ist und wir nach Rom zurückehren können.«
»Das kann noch eine ganze Weile dauern, Macro. Unsere Befehle sind eindeutig. Wir sollen Ajax jagen und um jeden Preis zur Strecke bringen, wie lange es auch dauern mag. Und genau das werden wir tun, solange wir keinen anderen Befehl erhalten. Keine römische Provinz und nicht einmal Kaiser Claudius kann es sich leisten, sich in Sicherheit zu wiegen, solange Ajax und seine Gefolgsleute auf freiem Fuß sind. Du hast ja aus unmittelbarer Nähe beobachtet, welche Wirkung er auf seine Anhänger ausübt. Er könnte an jedem beliebigen Ort des Imperiums erneut zur Rebellion aufrufen, und die Sklaven würden sich um ihn scharen. Solange Ajax lebt, stellt er eine große Gefahr für das Imperium dar. Falls Rom fällt, entsteht Chaos, und alle, die bisher unter dem Schutz der Legionen gelebt haben, Freie wie Sklaven, fallen dann den Barbaren zum Opfer. Deshalb müssen wir Ajax finden und bezwingen. Außerdem sind wir beide ihm auch noch persönlich etwas schuldig.«
»Ganz recht. Aber was, wenn er uns entkommen ist? Ajax könnte überall sein. Er könnte auf der anderen Seite des Mittelmeers herumsegeln. Vielleicht hat er sogar sein Schiff verlassen und sich landeinwärts gewandt. In diesem Fall wäre unsere Chance, ihn zu finden, etwa so groß wie die, in der Subura Roms auf einen gesetzestreuen Anwalt zu stoßen. Apropos, du hast einen ziemlich guten Grund, so bald wie möglich nach Rom zurückzukehren.« Macro senkte die Stimme. »Nach allem, was passiert ist, braucht Julia dich an ihrer Seite.«
Cato blickte hinunter in die blauen Tiefen des Meeres. »Julia ist beinahe täglich in meinen Gedanken, Macro. Ich denke an sie, und dann stelle ich mir vor, wie sie in dem Käfig steckte, in dem Ajax euch beide eingesperrt hat. Die Vorstellung, was sie durchgemacht hat, quält mich zutiefst.«
»Sie und ich haben dasselbe durchgemacht«, erwiderte Macro freundlich. »Und ich bin immer noch da. Immer noch derselbe Macro wie früher.«
Cato sah ihn mit durchdringendem Blick prüfend an. »Wirklich? Das frage ich mich nämlich.«
»Was meinst du damit?«
»Ich kenne dich gut genug, um zu sehen, wie bitter du geworden bist, Macro.«
»Bitter? Aber sicher. Nach allem, was dieser Drecksack uns angetan hat.«
»Und was hat er euch angetan? Was genau? Du hast mir nicht viel darüber erzählt. Und Julia vor unserem Aufbruch von Kreta auch nicht.«
Macro beobachtete ihn genau. »Hast du sie danach gefragt?«
»Nein … Ich wollte sie nicht daran erinnern.«
»Oder wolltest du es einfach nicht wissen?« Macro schüttelte traurig den Kopf. »Du hast sie nicht danach gefragt, und jetzt bist du gezwungen, es dir stattdessen vorzustellen. Ist es so?«
Cato sah ihn an und nickte dann. »So ungefähr. Und hinzu kommt noch, dass ich nichts getan habe, um euch zu helfen.«
»Du konntest nichts tun. Überhaupt nichts.« Macro stützte die Ellbogen auf das Schanzkleid. »Quäl dich nicht damit herum, Cato, damit erreichst du gar nichts. Ajax fängst du dadurch jedenfalls nicht. Außerdem weißt du ja, dass Julia eine starke Frau ist, und das genügt. Was auch immer sie durchgemacht hat, gib ihr etwas Zeit, und sie wird darüber hinwegkommen.«
»Genau wie du?«
»Ich werde auf meine eigene Weise damit fertig«, erklärte Macro mit fester Stimme. »Falls die Götter beschließen, dass ich Ajax erneut begegnen werde, dann schneide ich ihm verflucht nochmal die Eier ab und stopfe sie ihm in den Hals, bevor ich ihm den Rest gebe. Das schwöre ich bei jedem Gott, zu dem ich je gebetet habe.«
Cato hob die Augenbrauen und lachte trocken auf. »So klingt einer, der mit der Vergangenheit Frieden geschlossen hat.«
Macro blickte finster. »Frieden werde ich schließen, wenn das hier alles vorbei ist.«
»Und bis dahin?«
»Wir werden nicht ruhen, bis wir unseren Auftrag ausgeführt haben.«
»Gut. Dann ist ja alles klar.« Cato richtete sich auf. »Dann gebe ich jetzt den Befehl, zu wenden und Kurs auf Alexandria zu nehmen.«
Macro nahm Haltung an und salutierte. »Jawohl, Herr.«
Der Moment der Kameradschaft war vorüber, wie Cato bedauernd akzeptieren musste. Jetzt waren sie wieder Centurio und Präfekt. Er nickte Macro zu und hob die Stimme, als wäre er ein Schauspieler, der vor Publikum deklamiert. »Sehr schön, Centurio. Kehre auf dein Schiff zurück und segle hinter der Sobek her.«
Sie begaben sich mittschiffs und hatten beinahe den Mast erreicht, als die Stimme des Ausgucks von oben herabtönte.
»Segel in Sicht!«
Cato blieb stehen und legte den Kopf in den Nacken. »In welcher Richtung?«
Der Ausguck zeigte backbord voraus aufs Meer. »Dort, Herr. Nur das Segel ist sichtbar. In acht oder vielleicht auch zehn Meilen Entfernung.«
Cato wandte sich Macro mit einem aufgeregten Leuchten in den Augen zu. »Vielleicht ist das ja unser Mann. Hoffen wir es.«
»Das bezweifle ich«, antwortete Macro. »Aber vielleicht haben sie Ajax ja gesehen oder etwas von ihm gehört.«
»Das würde mir schon reichen. Und jetzt, zurück auf dein Schiff. Setzt die Segel! Ich nähere mich ihm vom Meer und ihr von der Küste her. Er kann uns nicht entkommen, wer auch immer es ist.«
Kapitel 3
Das Schiff machte keinen Versuch, den beiden Kriegsschiffen auszuweichen, und schien ohne Kurs auf den Wellen herumzuschlingern. Als die Besatzung der Sobek näher heranruderte, sah Cato, dass das Segel des fremden Schiffes lose flatterte. Die Leinen waren entweder durchgeschnitten worden oder durchgerauscht. Die Breite des Schiffs und das hochgezogene Heck ließen auf ein Handelsschiff schließen, und Cato war einen Moment lang enttäuscht, dass er den Gesuchten hier nicht finden würde. An Deck fehlte jedes Zeichen von Leben, und während das Schiff sich in den Wellen wiegte, ruckte die Ruderpinne langsam hin und her.
Von der Küste kommend, nutzte Macros Schiff den ablandigen Wind nach Kräften aus, um rasch näher zu segeln, bevor das letzte Stück gerudert wurde. Allerdings würde Macro das Handelsschiff etwas später erreichen als die Sobek.
»Soll ich meine Männer Aufstellung nehmen lassen, Herr?«, fragte Centurio Proculus, der Kommandant der dem Schiff des Präfekten zugeteilten Legionäre.
»Nein. Ich nehme die Marineinfanteristen. Die sind zum Entern ausgebildet.«
Proculus sog scharf die Luft ein, gekränkt, dass er Männern den Vortritt lassen musste, denen er sich überlegen fühlte. Cato beachtete ihn nicht weiter. Er kannte die Spannungen zwischen Marine und Landtruppen inzwischen zur Genüge. Außerdem lag die Entscheidung bei ihm. Er wandte sich dem Decurio zu, der die dreißig Marineinfanteristen des Schiffs befehligte. »Diodorus, lass deine Männer Aufstellung zum Entern nehmen.«
»Jawohl, Herr. Soll ich den Corvus ausbringen?« Er nickte zu der Vorrichtung hinüber, die vor dem Mast auf dem Deck festgezurrt war. Der Corvus war eine Enterbrücke, die mithilfe von Seilzügen rauf- und runtergefahren wurde. Der mit einem Holzzapfen befestigte Brückenarm konnte über die Seite des Schiffs hinausgeschwenkt werden. Am anderen Ende des Arms saß ein Eisendorn, der wie ein Krähenschnabel geformt war. Wenn die Vorrichtung über das Deck des gegnerischen Fahrzeugs geschwenkt worden war, wurde sie fallen gelassen. Der Dorn bohrte sich ins Deck, und die Brücke verband beide Fahrzeuge. Darüber hinweg konnten dann die Marineinfanteristen in den Kampf stürmen. Obgleich kein Lebenszeichen zu entdecken war, beschloss Cato, sich an das übliche Vorgehen zu halten, falls man ihnen eine Falle gestellt hatte.
»Ja, das ist eine gute Idee. Falls du Verstärkung brauchst, können wir die Legionäre hinüberschicken, um die Lage zu klären.«
Proculus wölbte die Brust vor. »Wir werden die Marineinfanteristen schon raushauen, falls es Probleme gibt, Herr. Du kannst dich auf uns verlassen.«
»Das höre ich gerne«, murmelte Diodorus säuerlich und wandte sich ab, um seine Befehle zu erteilen.
Die Sobek näherte sich dem Handelsschiff, und an Deck wimmelte es von Bewaffneten, die ihre Position einnahmen. Als alles bereit war, standen sie reglos da und warteten auf den Befehl zum Losschlagen. Der Trierarch des Kriegsschiffs ließ den Takt der Ruderschläge verringern und steuerte sein Fahrzeug vorsichtig am Heck des führungslosen Schiffs vorbei. Als sie nach seiner Einschätzung gerade noch genug Fahrt machten, um längsseits des Handelsschiffs zum Liegen zu kommen, rief er den Befehl, die Ruder einzuziehen.
Cato hatte seine Rüstung angelegt und stieg in den Gefechtsturm auf dem Vordeck, um bei dem Manöver das andere Schiff in Augenschein nehmen zu können. Dunkle Streifen liefen von den Speigatten herunter und lösten sich im Wasser auf. Blut, begriff Cato. Gleich darauf erblickte er die erste Leiche, einen Mann, der über der Reling zusammengebrochen war. Auf dem Achterschiff verstreut sah er weitere Leichen liegen.
»Macht den Corvus bereit!«, brüllte Diodorus. Mit einem lauten Knarren schwenkte die Enterbrücke aufs Meer hinaus und verharrte dann über dem Deck des Handelsschiffs.
»Herunterlassen!«
Die Enterbrücke sauste nach unten, immer schneller, und der Eisendorn an ihrem Ende bohrte sich krachend in die Planken.
»Vorwärts zum Entern!«, schrie Diodorus. Das Schwert hoch erhoben, sprang er auf die Enterbrücke und stürmte zum anderen Schiff hinüber. Seine Männer rannten hinter ihm her, und die Planken der Brücke erbebten unter den Ledersohlen ihrer schweren Stiefel. Kurz darauf verteilten sich die Marineinfanteristen wachsam auf dem Deck des Handelsschiffs.
Cato stieg vom Gefechtsturm herunter und rief Proculus zu: »Warte hier mit deinen Männern. Falls ich euch rufe, kommt ihr sofort.«
»Jawohl, Herr.«
Es waren keine Kampfgeräusche zu hören. Keine Schreie oder Schreckensrufe drangen von dem Handelsschiff herüber, und Cato ließ sein Schwert in der Scheide, als er die Enterbrücke betrat. Er warf einen kurzen Blick auf die Wellen, die zwischen den beiden Schiffsrümpfen hindurchschossen. Obwohl er nun schon fast zwei Monate an Bord war, fürchtete und hasste er das Meer; ein weiterer guter Grund zu hoffen, dass er seinen derzeitigen Auftrag so bald wie möglich erfolgreich abschließen konnte. Als er die andere Seite der Enterbrücke erreichte, sprang Cato hinunter und blickte sich aufmerksam um. Leichen in getrockneten Blutlachen übersäten das Deck. Die Frachtluken waren aufgerissen worden, und im Laderaum herrschte ein einziges Chaos: zerbrochene Amphoren, liegen gelassene Stoffballen und aufgeschlitzte Reis- und Gewürzsäcke. Diodorus hockte neben einer der Leichen, und Cato trat zu ihm.
»Die Verwesung hat gerade erst eingesetzt.« Der Decurio rümpfte die Nase und führte dann die Finger zu der Blutlache, in der die Leiche lag. »Es ist noch klebrig. Der Tod dieser Männer liegt nur einen Tag, mit Sicherheit aber nicht mehr als zwei Tage zurück.«
»Wenn das Ajax’ Werk ist, sind wir ihm näher, als ich dachte«, sagte Cato und stand auf.
»Möglich, Herr. Aber es könnten auch Piraten gewesen sein.«
»Wirklich? Warum haben sie dann so wenig aus dem Frachtraum mitgenommen, falls überhaupt? Da unten liegt ein kleines Vermögen an Gewürzen. Das wäre höchst ungewöhlich, wenn das Schiff tatsächlich von Piraten gekapert wurde.«
»Herr!«, ertönte eine Stimme. »Der hier lebt noch!«
Cato und Diodorus eilten zu einem Marinesoldaten, der beim Mast stand. Der trat zur Seite und gab den Blick auf eine magere, sonnenverbrannte Gestalt frei, die bis auf ein schmutziges Lendentuch nackt war. Zuerst dachte Cato, der Mann hätte seine Arme hochgeworfen, aber dann entdeckte er den breiten schwarzen Kopf des Eisennagels, der durch seine Handflächen getrieben und ins Holz gehauen worden war. Der Nagel steckte so hoch oben im Mast, dass der Mann nicht richtig auf dem Deck stehen konnte und gezwungen war, sein Gewicht mit den Zehen und den Zehenballen zu tragen. Ein leises Stöhnen entrang sich seinem Mund, und sein Atem ging flach und gequält.
»Nehmt ihn ab!«, befahl Cato. Er drehte sich zur Sobek um und rief: »Schickt den Wundarzt herüber!«
Während zwei Marineinfanteristen den Mann anhoben, hebelte ein dritter den Nagel heraus. Der Mann keuchte und schrie auf. Die Lider über seinen blutunterlaufenen, verdrehten Augen zuckten nach oben und öffneten sich. Es schien eine Ewigkeit zu dauern, bis sich der Nagel aus dem Mast löste. Danach brach der Mann in den Armen der Marineinfanteristen zusammen.
»Legt ihn hin.« Cato winkte den Marinesoldaten, der ihm am nächsten stand, heran. »Gib mir deine Wasserflasche. Du und die anderen, sucht das Schiff nach weiteren Überlebenden ab.«
Er zog den Stöpsel aus der Feldflasche und beugte sich über den Mann. Der Anblick der aufgesprungenen, blutigen Lippen ließ ihn zusammenzucken. Cato stützte den Kopf des Mannes mit der Hand, hob ihn an und goss ihm ein wenig Wasser übers Gesicht. Die Lippen öffneten sich, als sie die Feuchtigkeit spürten, das kühle Nass rann in den ausgedörrten Mund, und der Mann stieß ein erleichtertes Stöhnen aus. Cato gab ihm noch ein paar Schlucke zu trinken, hörte aber damit auf, als der Mann sich verschluckte und Wasser spuckend das Gesicht zur Seite drehte.
»Danke«, krächzte der Mann schwach.
»Was ist hier passiert?«, fragte Cato. »Wer hat euch angegriffen?«
Der Mann leckte sich mit der geschwollenen Zunge über die aufgesprungenen Lippen und zuckte schmerzlich zusammen, bevor er antwortete. »Römer …«
Cato wechselte einen Blick mit Diodorus. »Römer? Bist du dir sicher?«
Ein Schatten streifte das Deck, und Cato erblickte den Mast der Ibis, die sich längsseits näherte. Gleich darauf war ein dumpfer Schlag zu spüren, und die Schiffe stießen zusammen. Dann hörte man, wie Männer in Stiefeln an Deck sprangen. Cato blickte auf und entdeckte seinen Freund. »Hierher, Macro!«
Macro kam herbei und sah sich dabei an Deck um. »Sieht so aus, als hätte hier ein ganz schöner Kampf getobt.«
»Mir kommt es eher wie ein Massaker vor. Aber den hier haben wir lebend gefunden.« Cato zeigte auf die Wunden in den Händen des Mannes. »Er wurde an den Mast genagelt.«
Macro stieß einen leisen Pfiff aus. »Widerlich. Warum haben sie das getan?«
»Meine Vermutung ist, dass sie einen Zeugen zurücklassen wollten. Jemanden, der lange genug am Leben bleibt, um zu berichten, was vorgefallen ist.«
Der Wundarzt von Catos Schiff eilte mit seinem Tornister voller Verbände und Salben herbei. Er kniete sich neben den Überlebenden, untersuchte ihn rasch und fühlte seinen Puls. »Er ist in einer schlimmen Verfassung, Herr. Ich bezweifle, dass ich viel für ihn tun kann.«
»Nun gut. Dann muss ich so viel wie möglich von ihm erfahren, bevor es zu spät ist.« Cato beugte sich vor und sprach dem Mann sanft ins Ohr.
»Sag mir deinen Namen, Seemann.«
»Mene … Menelaus«, kam ein heiseres Flüstern zurück.
»Hör mir zu, Menelaus. Du bist in einer sehr schlechten Verfassung. Möglicherweise wirst du sterben. In diesem Fall willst du bestimmt, dass jemand deinen Tod rächt. Berichte mir also, wer das hier gemacht hat. Römer, sagtest du. Was hast du damit gemeint? Römische Piraten?«
»Nein …«, flüsterte der Mann. Dann murmelte er noch etwas, ein Wort, das Cato nicht richtig verstand.
»Was sagst du?«
»Es klang wie Krixis«, meinte Macro.
Cato überlief es eiskalt, als er begriff, was der Seemann zu sagen versuchte. »Kriegsschiff, das meinst du, nicht wahr? Ihr wurdet von einem Kriegsschiff überfallen?«
Der Seemann nickte und befeuchtete sich die Lippen. »Befahlen uns beizudrehen … Sagten, sie müssten die Fracht überprüfen … töteten uns … ohne Gnade.« Die Stirn des Mannes furchte sich bei der Erinnerung. »Mich hat er am Leben gelassen … Sagte, ich solle mir seinen Namen merken … Dann stellten sie mich gegen den Mast und rissen meine Hände nach oben.« Eine Träne glänzte im linken Augenwinkel des Mannes auf, rollte nach unten und tropfte vom Ohr herab.
»Sein Name?«, drängte Cato ihn sanft. »Wie heißt er?«
Der Seemann schwieg einen Moment, bevor seine Lippen sich wieder bewegten. »Cent … Centurio Macro.«
Cato setzte sich auf und blickte seinen Freund an. Macro schüttelte erstaunt den Kopf. »Was redet er da, bei den Göttern?«
Cato konnte nur mit den Schultern zucken, dann wandte er seine Aufmerksamkeit wieder dem Seemann zu. »Bist du dir sicher? Bist du dir sicher, dass er gesagt hat, sein Name sei Macro?«
Der Seemann nickte. »Macro … So hieß der Drecksack … Ich musste es sicherheitshalber wiederholen … Centurio Macro«, murmelte er. Sein Gesicht verzog sich vor Qual.
»Herr«, mischte der Wundarzt sich ein. »Ich muss ihn aus der Sonne schaffen. Ins Unterdeck der Sobek. Dort kann ich seine Verletzungen versorgen.«
»Gut. Tu für ihn, was du kannst.« Cato ließ den Kopf des Mannes sinken und stand auf. Der Wundarzt rief vier der Seeleute herbei und befahl ihnen, den Seemann so sanft wie möglich hochzuheben. Cato sah ihnen auf dem Weg zur Enterbrücke nach und wandte sich dann an Macro. »Eigenartig, findest du nicht?«
»Ich habe ein Alibi«, gab Macro mit bissigem Humor zurück. »Ich war die ganze Zeit damit beschäftigt, flüchtige Sklaven zu jagen.« Er deutete auf den Seemann, der nun über die Enterbrücke getragen wurde. »Was soll dieser Unsinn mit Centurio Macro?«
»Ajax war hier. Es muss so sein.«
»Warum?«
»Wer sonst würde deinen Namen verwenden?«
»Keine Ahnung. Aber falls es Ajax ist, warum tut er das dann?«
»Vielleicht ist das seine Art von Humor. Oder er hat noch einen anderen Grund.«
»Was für einen denn?«
Cato schüttelte den Kopf. »Ich bin mir nicht sicher. Aber dahinter steckt mehr, als es den Anschein hat.«
»Nun, wenn Ajax und seine Männer hier waren, sind wir jedenfalls wieder auf ihrer Spur.«
»Ja, das stimmt.« Cato blies die Wangen auf. »Der Zeitpunkt ist allerdings nicht gerade günstig.«
»Was meinst du damit?«
»Wir haben keine Vorräte mehr. Das Wasser ist beinahe aufgebraucht. Wir können die Verfolgung erst wieder aufnehmen, wenn wir uns mit Proviant und Wasser versorgt haben. Wir nehmen, was wir an Bord dieses Schiffes finden, und segeln dann nach Alexandria.«
Macro starrte ihn an. »Das kann doch nicht dein Ernst sein … Herr.«
»Denk doch einmal nach, Macro. Er hat mindestens einen Tag Vorsprung, da kann er inzwischen über hundert Meilen entfernt sein. Was meinst du wohl, wie lange wir brauchen, bis wir ihn finden? Wie viele Tage? Versuchen wir es, laufen wir Gefahr, nicht mehr kampffähig zu sein, wenn wir ihm begegnen. Vielleicht sind wir sogar bald zu schwach für die Rückfahrt zum Hafen. Mir bleibt keine andere Wahl. Wir nehmen Kurs auf Alexandria. Dann füllen wir unsere Vorräte auf und versuchen, genug Verstärkung zu bekommen, um das Gebiet hier gründlich abzusuchen.«
Macro wollte noch einmal protestieren, doch nun kam Decurio Diodorus hinzu und erstattete Bericht. »Herr, meine Männer haben das Boot abgesucht. Es gibt keine weiteren Überlebenden.«
»Nun gut. Befiehl deinen Männern, alles, was hier an Nahrungsmitteln und Wasser zu finden ist, an Deck zu bringen und zwischen unseren beiden Schiffen aufzuteilen.«
»Jawohl, Herr.« Diodorus salutierte und wandte sich an die Marineinfanteristen, die im Frachtraum herumstanden. »Los, ihr faulen Hunde. Steckt eure Schwerter in die Scheide und legt die Schilde ab. Es gibt Arbeit.«
Macro sah Cato scharf an. Er rieb sich die Nase.
»Was ist?«, fragte Cato müde.
»Ich denke nach. Ich hoffe, du machst keinen Fehler. Wenn Ajax uns wieder entwischt, während wir nach Alexandria zurückkehren, mögen die Götter wissen, wie wir die Fährte wieder aufnehmen sollen. Es ist über einen Monat her, seit wir zum letzten Mal von ihm gehört haben.«
»Ich weiß.« Cato machte eine hilflose Geste. »Aber uns bleibt keine andere Wahl. Wir müssen umkehren.«
Macro spitzte die Lippen. »Es ist deine Entscheidung, Herr. Dein Befehl.«
»Ja. Ja, so ist es.«
Drei Tage später fuhren die Sobek und die Ibis