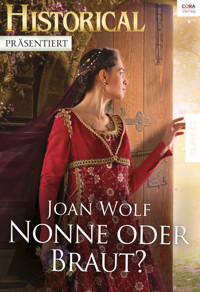Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gegen die Liebe ist sie machtlos: Der Regency-Roman »Die Leidenschaft des Lords« von Joan Wolf jetzt als eBook bei dotbooks. Annabelle ist untröstlich: Ihr geliebter Mann, der Earl of Weston, ist gestorben. Bei der Testamentseröffnung erfährt sie zu ihrem Entsetzen, dass er seinen unberechenbaren Bruder als Vormund für ihren kleinen Sohn und das herrschaftliche Gut bestimmt hat. Ausgerechnet Stephen, der ihr vor langer Zeit das Herz gebrochen hat! Als der attraktive Schurke vor ihr steht, ist Annabelle wild entschlossen, ihm die kalte Schulter zu zeigen. So beginnt ein Spiel voller Ablehnung und verborgener Leidenschaft zwischen den beiden… »Joan Wolf ist eine begnadete Erzählerin!« Publishers Weekly Jetzt als eBook kaufen und genießen: Die historische Romanze »Die Leidenschaft des Lords« von Joan Wolf lädt zu einer fesselnden Reise in die Regency-Zeit ein. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 505
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
England im 19. Jahrhundert: Annabelles Leben steht Kopf als ihr Mann, der Earl of Weston, stirbt und ausgerechnet seinen unberechenbaren Bruder Stephen als Vormund für ihren Sohn und das Anwesen bestimmt hat! Mit Stephen verbindet Annabelle eine innige und turbulente Vergangenheit: Einst ihr Liebhaber, verschwand Stephen von einem Tag auf den anderen. Er hinterließ Annabelle nicht nur mit einem gebrochenen Herzen, auch musste sie daraufhin seinen Bruder heiraten – eine lieblose Zweckehe.
Damals hatte sich Annabelle geschworen, Stephen für immer zu verabscheuen – doch jetzt, wo sie ihn wieder jeden Tag sehen muss, kann sie ihre wieder aufkeimenden Gefühle nicht mehr lange zurückhalten …
Über die Autorin:
Joan Wolf ist die amerikanische Grande Dame der Liebesromane. Sie wuchs in der New Yorker Bronx auf und studierte Englische und Vergleichende Sprachwissenschaften am renommierten Hunter College in Manhattan. Nach ihrem Abschluss arbeitete sie längere Zeit als Englischlehrerin an einer High-School, bevor sie ihre internationale Karriere als Autorin begann. Heute lebt sie mit ihrem Mann, ihrer Katze und ihrem Hund in Connecticut.
Bei dotbooks veröffentlichte Joan Wolf ihre historischen Romane »Die stolze Königin« und »Die heimliche Königin« sowie ihre Regency-Romane »Die Braut des Fürsten«, »Das Herz des Earls« und »Die Leidenschaft des Lords«.
Die Website der Autorin: joanwolf.com/
Die Autorin im Internet: facebook.com/authorjoanwolf
***
eBook-Neuausgabe April 2016, Juni 2024
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1997 unter dem Originaltitel »The Guardian« bei Grand Central Publishing New York.
Die deutsche Erstausgabe erschien 1998 unter dem Titel »Was der Sturm verspricht« im Wilhelm Goldmann Verlag, München
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1997 Joan Wolf
Published by arrangement with Natasha Kern Literary Agency.
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1998 by Wilhelm Goldmann Verlag, München
Copyright © der Neuausgabe 2016 dotbooks GmbH, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch Interpill Media GmbH, Hamburg.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: A&K Buchcover, Duisburg, unter Verwendung eines Bildmotives von Period Images, shutterstock/Mistervlad,
shutterstock/BK foto
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (vh)
ISBN 978-3-95824-635-5
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. In diesem eBook begegnen Sie daher möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Diese Fiktion spiegelt nicht automatisch die Überzeugungen des Verlags wider oder die heutige Überzeugung der Autorinnen und Autoren, da sich diese seit der Erstveröffentlichung verändert haben können. Es ist außerdem möglich, dass dieses eBook Themenschilderungen enthält, die als belastend oder triggernd empfunden werden können. Bei genaueren Fragen zum Inhalt wenden Sie sich bitte an [email protected].
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Leidenschaft des Lords« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Joan Wolf
Die Leidenschaft des Lords
Roman
Aus dem Amerikanischen von Elke Iheukumere
dotbooks.
Kapitel 1
Mein Gott, mein Gott, er liest Geralds Testament vor.
Es war, als hätte mir jemand einen plötzlichen und unerwarteten Schlag auf den Kopf versetzt.
Ich starrte den Anwalt an, der vor der eng nebeneinandergedrängten Gruppe der Familienmitglieder stand, und meine Finger verkrallten sich in meinem Schoß.
Abermals hämmerte es in mir, Geralds Testament…
Das mußte der Zeitpunkt gewesen sein, als ich endlich den Tod meines Mannes begriff.
Eine tiefe, dunkle Stimme neben mir murmelte: »Ist alles in Ordnung mit dir, meine Liebe?«
Mit fest zusammengepreßten Lippen nickte ich. Onkel Adam griff nach meinen Händen, die verkrampft in meinem Schoß lagen, dann wandte er seine Aufmerksamkeit wieder Mr. MacAllister zu. Die eintönige, leidenschaftslose Stimme des Anwaltes dröhnte in meinen Ohren:
»Für den Fall, daß irgendein Teil meiner Güter an meinen Sohn, Giles Marcus Edward Francis Grandville, vor seinem einundzwanzigsten Lebensjahr fällt, soll für ihn ein gesonderter Trust eingerichtet werden unter Verwaltung seines Vormunds, der später namentlich erwähnt wird. Im Hinblick auf die anschließend erwähnten Ziele hat dieser folgende Richtlinien und Bedingungen zu beachten.«
Da Giles erst vier Jahre alt war, mußte selbstverständlich der Besitz für ihn treuhänderisch verwaltet werden.
Giles war jetzt der Graf von Weston, Geralds Erbe. Ich holte tief Luft und starrte wie gebannt auf den kunstvoll geschnitzten Kaminsims aus Mahagoni, der hinter Mr. MacAllisters schmalem langen Kopf hervorragte.
Daß mich beim Verlesen des Testamentes so heftige Gefühle überwältigen würden, hatte ich nicht erwartet. Und nur aus diesem Grund konnten sie mich derart überrumpeln.
In den letzten Tagen war ich mir vorgekommen, als sei ich gefangen in einem unwirklichen Alptraum.
Nach Geralds Tod hatten die Dienstboten das ganze Haus in Schwarz gehüllt und seinen Körper vierundzwanzig Stunden lang in der großen Halle aufgebahrt. Unaufhörlich waren Nachbarn und Pächter an seinem Sarg vorüberdefiliert. Und gestern hatten Hunderte dunkel gekleideter Menschen einen endlosen Trauerzug gebildet, der den Sarg vom Haus bis zur Kirche begleitete. Giles war die ganze Zeit über in der Kirche neben mir gewesen; seine kleine Hand hielt die meine fest umklammert, als der Pastor über dem Sarg die Gebete sprach, ehe er in die Gruft gesenkt wurde, in der bereits sechs Grafen von Weston ruhen.
Giles hatte mir geholfen. Für ihn mußte ich die Fassung bewahren.
Doch heute war mein Sohn nicht bei mir. Es beobachteten mich keine fremden Augen mehr. Und Mr. MacAllister las Geralds Testament vor. Ich holte tief Luft, zwang mich dazu, in das Gesicht des Anwaltes zu sehen, und kämpfte mit meiner Aufmerksamkeit.
Mr. MacAllister war noch immer bei der Erklärung der Verwaltung. »Der Vormund, der später namentlich erscheint, wird die Vollmacht haben, die Güter zu führen, zu verkaufen an öffentliche und private Interessenten, zu vermieten unter von ihm aufgestellten Bedingungen oder sonst
nach seinem Ermessen zu handeln, ohne die Zustimmung eines Gerichtes; er hat die Vollmacht, die Zinsen des Vermögens zu investieren und reinvestieren …«
Es schien mir unglaublich, daß mein kleiner Sohn jetzt der Graf von Weston sein sollte.
Die Atmosphäre in dem Raum änderte sich unmerklich. Ich spürte ein leises Rascheln, als würden sich die Anwesenden aufrichten und gespannt die Hände falten. Erneut konzentrierte ich mich auf Mr. MacAllister und begriff, daß er im nächsten Augenblick den Namen von Giles’ Vormund nennen würde.
Der Anwalt fühlte selbst die Bedeutung des Augenblicks und hielt inne. Er blickte auf von dem langen juristischen Schriftstück in seiner Hand und ließ die Augen über den Halbkreis der Gesichter der Menschen wandern, die an der Testamentseröffnung in der Bibliothek von Weston Hall teilnahmen.
Wir waren nur zu sechst. Ich saß in der Mitte, zusammen mit Onkel Adam und seiner Frau Fanny auf einer Seite, und meiner Mutter auf der anderen. Neben Mama befanden sich Geralds Onkel Francis Putnam sowie dessen Sohn, Jack Grandville. Denn der Rest der Grandvilles war gleich nach der Beerdigung wieder abgereist.
Mr. MacAllister senkte den Blick abermals auf das Dokument und las deutlich weiter: »Ich ernenne hiermit meinen Bruder, Stephen Anthony Francis Grandville, und setze ihn als Vormund und Verwalter des Vermögens ein für meinen Sohn Giles Marcus Edward Francis. Er ist auch Vollstrecker dieses meines Testamentes und meines Letzten Willens …«
Die Fortsetzung hörten wir nicht.
»Stephen!« Jacks Stimme übertönte den Vortrag von Mr.
MacAllister. »Gerald kann doch nicht Stephen eingesetzt haben!«
Mr. MacAllister ließ das Dokument sinken und blickte Jack über den Rand seiner Brille hinweg an. »Ich versichere Ihnen, Mr. Grandville, der Graf hat unbezweifelbar seinen Bruder Stephen eingesetzt. Ich war derjenige, der das Testament zusammen mit ihm verfaßte, also muß ich es wissen.«
Als nächstes war Mamas klare, kühle Stimme zu vernehmen. »Stephen ist in Jamaica«, sagte sie. »Er hält sich schon seit fünf Jahren dort auf. Am anderen Ende der Welt kann er doch unmöglich als Giles’ Vormund auftreten. Sie werden einen Vertreter ernennen müssen, Mr. MacAllister. Ich kann mir nicht vorstellen, was sich Gerald bei der Wahl Stephens gedacht hat.«
Der Anwalt bewahrte absolute Ruhe, als wisse er nicht, daß er ein Faß voller Sprengstoff in unsere Mitte geworfen hatte. »Mr. Stephen Grandville wird nach Hause gerufen werden müssen, um seine Verantwortung hier zu übernehmen. In der Tat habe ich ihm den Inhalt von Graf Westons Testament bereits schriftlich mitgeteilt.«
»Also, das war verflixt hinterhältig von Ihnen, MacAllister«, erklärte Jack wütend. Sein gutaussehendes Gesicht glühte vor Wut.
»Einer der Familienangehörigen hätte Stephen vom Tode seines Bruders unterrichten müssen.« Zum ersten Mal stimmte meine Mutter mit Jack überein; sie hatte schon immer auf gesellschaftliche Formen geachtet. »Eine solche Nachricht sollte nicht von einem Anwalt kommen.«
»Auch ich habe Stephen geschrieben und ihm von Geralds Tod berichtet«, erklärte Onkel Francis ruhig. »Die beiden Briefe werden zweifellos mit dem gleichen Schiff auf Jamaica eintreffen.«
»Und wenn er sich nun weigert, zurückzukommen?« warf Jack ein. »Immerhin könnte man ihn hier nach wie vor einsperren für diese Eskapade, die er sich vor fünf Jahren geleistet hat, nicht wahr?«
»Die Frage einer Gefängnisstrafe stand nie zur Debatte«, erklärte Mr. MacAllister kühl. »Die Behörden gaben sich vollauf zufrieden mit dem Versprechen seines Vaters, ihn außer Landes zu schicken.«
»Es wurde keine Anklage erhoben«, stimmte Onkel Adam ihm zu. »Stephen kann als freier Mann nach England zurückkehren, falls er das wünscht.«
Meine Mutter wandte sich an mich und wollte wissen: »Hattest du eine Ahnung davon, daß Gerald Stephen eingesetzt hat, Annabelle?«
»Nein, das hatte ich nicht.« Ich hob meine Blicke. »Wann wurde dieses Testament aufgesetzt, Mr. MacAllister?«
»Kurz nach der Geburt von Giles, Lady Weston«, antwortete er sanft.
Ich preßte die Lippen zusammen und gab mir große Mühe, eine ausdruckslose Miene zur Schau zu stellen.
Mr. MacAllister machte einen Versuch, mich zu beruhigen. »Mr. Stephen Grandville wird der Vormund von Giles sein, Lady Weston; aber ich kann Ihnen versichern, Graf Weston wünschte stets, daß die Fürsorge für Ihren Sohn in Ihren Händen bleibt.«
Dazu nickte ich nur.
»Ich kann nicht verstehen, warum Gerald nicht Adam eingesetzt hat«, meinte Mama.
Nun ergriff ich das Wort. »Die Diskussion führt zu nichts. Gerald hat Stephen bestimmt. Ich bin allerdings ganz sicher, daß Gerald während Erstellung dieses Testaments davon überzeugt war, natürlich Giles’ Volljährigkeit zu erleben.«
Meine Stimme zitterte verräterisch. »Entschuldigt mich bitte!«
»Mr. MacAllister ist noch nicht fertig mit der Verlesung des Texts«, sagte meine Mutter.
Ohne eine Antwort ging ich einfach durch die Tür hinaus.
***
Die Hunde warteten im Flur auf mich, und wie immer, so trotteten sie auch jetzt hinter mir her, als ich die Treppe zum Kinderzimmer emporstieg, das im dritten Stock des Hauses lag. Zuerst warf ich einen Blick in den Unterrichtsraum und stellte fest, daß er leer war. Die Hunde folgten mir über den Flur, am Zimmer der Gouvernante vorbei, in die Spielkammer. Dort fand ich meinen Sohn und seine Gouvernante, Miss Eugenia Stedham. Sie saßen am Tisch und setzten das Puzzle einer Landkarte zusammen. Ich hatte Giles erlaubt, heute seinen üblichen Tagesablauf wieder aufzunehmen: Nach fünf Tagen der Trauer sollte diese Normalität ihm dabei helfen, mit seinem Schmerz besser fertigzuwerden.
Giles schob im gleichen Augenblick, als er mich sah, seinen Stuhl zurück. »Mama!« rief er und lief auf mich zu, um sich in meine Arme zu werfen. Die Hunde marschierten zu dem blauen Teppich vor dem Kamin und rollten sich darauf zusammen.
Ich streichelte den Kopf des Jungen und genoß das Gefühl, seinen kleinen, stämmigen Körper an meinen Beinen zu fühlen und sein Gesicht, das er gegen meinen Bauch gepreßt hatte. Dann wandte ich mich seiner Gouvernante zu. »Giles und ich werden nun einen Spaziergang machen, Miss Stedham!«
Der Kleine löste sich von mir und klatschte in die Hände. »Einen Spaziergang! Genau das habe ich mir gewünscht, Mama.«
»Hast du auch dein Mittagessen aufgegessen?« fragte ich ihn.
Er nickte, und seine graugrünen Augen strahlten vor Vorfreude. »Bis auf den letzten Bissen«, bestätigte er.
Miss Stedham war aufgestanden. »Es ist kein Kunststück, unsern Schlingel hier zum Essen zu überreden«, meinte sie.
Zum ersten Mal an diesem Tage lächelte ich.
»Laß dich von Miss Stedham warm anziehen, Giles«, sagte ich zu meinem Sohn. »Es ist zwar sonnig draußen, aber der Wind kommt von Osten.«
Miss Stedham fragte: »Wann soll er fertig sein, Lady Westen?«
»Sofort.« Ich zerzauste meinem Sohn das sorgfältig gebürstete Haar. »Komm in mein Ankleidezimmer, wenn du fertig bist, Giles. Auch ich möchte noch die Kleider wechseln.«
»Gern, Mama.« Er wandte sich zu Miss Stedham. »Komm schon, Genie. Wir wollen uns beeilen!«
Als ich mich zum Gehen wandte, folgten mir die Hunde auf dem Fuße.
***
Der Frühlingstag war sonnig, aber windig und kalt. Giles hüpfte neben mir her, froh, wieder draußen zu sein, nachdem er den Morgen mit dem Erlernen von Buchstaben und Zahlen verbracht hatte. Wir verließen das Haus durch den nach Süden gelegenen Ausgang, die Hunde liefen vor uns her, sprangen wild herum und kläfften freiheitsdurstig. Der Weg, den wir einschlugen, führte uns durch die gepflegten Gartenanlagen, wo blaue und rosa Hyazinthen zu blühen begannen und die Bäume einen zarten Grünschleier zeigten.
Ein schmaler Bach floß am Ende der Gartenanlagen entlang, und wir lehnten uns über das hölzerne Brückengeländer, um die Sumpfdotterblumen, die Veilchen und das Wiesenschaumkraut zu bewundern, die bunt aus dem Gras an den Ufern leuchteten. Dann folgten wir dem Pfad zwischen zwei eingezäunten Weiden entlang, wo einige meiner Vollblüter das Gras abweideten, das üppig zu sprießen begonnen hatte. Wir blieben stehen, um die Pferde zu begrüßen, ihnen den Hals zu tätscheln, ehe wir Kurs auf unser Ziel, den bewaldeten Höhenzug, nahmen.
Auch im Wald zeigten sich die Vorboten des Frühlings. Die Vögel sangen, und wir entdeckten die letzten Märzenbecher, Immergrün und den blauen Ehrenpreis, dessen Farbe ich so sehr liebte. Die Weidenkätzchen waren aufgebrochen, und Giles und ich pflückten einige davon, um sie Miss Stedham zu überreichen.
Genau wie mein Sohn, so genoß auch ich die Natur. Offenbar hatte ich endlose Wochen damit verbracht, an Geralds Krankenbett zu sitzen, seine Hand zu halten und hilflos mitanzuhören, wie sein Atem ihn quälte. Und dann war da auch noch die Beerdigung gewesen. Tief sog ich die frische kalte Luft in meine Lungen und fühlte, wie das Leben wieder Besitz von mir ergriff. Ich blickte auf in den herrlich blauen Himmel mit den weißen Wolken, die wie flinke Barken dahinsegelten und dachte: Stephen wird nach Hause kommen.
»Mama«, meldete sich Giles. »Wo ist Papa jetzt?«
Da stand er vor mir, der kleine Mann. Seine Wangen waren gerötet und die Hose an den Knien voller Erde. Auf einem umgestürzten Baumstamm nahm ich Platz und achtete nicht darauf, daß der Saum meines Rockes in den Morast hing. »Papa ist im Himmel, Liebling«, sagte ich leise.
»Aber wir haben ihn doch gestern in die Gruft gelegt«, widersprach Giles. »Wie kann er im Himmel sein, wenn wir ihn in die Kirche gebracht haben?«
»Papas Geist ist im Himmel«, sagte ich. »Im Tode verläßt der Geist unseren Körper und kehrt heim zu Gott. Papa braucht seinen Körper nicht mehr, Giles, deshalb hat er ihn in der Kirche zurückgelassen.«
Giles verzog das Gesicht. »Aber ich habe nicht gewollt, daß Papa stirbt, Mama.«
Ich streckte die Hand nach ihm aus und zog ihn an mich. Er war immer ein anschmiegsames Kind gewesen, und jetzt drückte er sein Gesicht an meine Brust. »Er soll nicht im Boden von der Kirche liegen«, beklagte er sich.
Tränen traten in meine Augen, und ich preßte sie fest zu, damit sie nicht herausliefen. »Ich mag das auch nicht, Giles«, stimmte ich ihm zu. »Aber Papa ist sehr krank geworden. Wir konnten nichts mehr tun, damit er bei uns blieb.«
»Aber du wirst nicht sterben, Mama, nicht wahr?« meinte er, und seine Stimme klang gedämpft, weil er sein Gesicht an meine Brust drückte.
»Nein, Liebling, freilich nicht«, brachte ich heraus, und es gelang mir, meiner Stimme einen festen und überzeugenden Klang zu verleihen.
Er legte seinen Kopf in den Nacken und sah mir in die Augen. »Niemals?«
Seine Wangen zeigten eine gesunde Farbe, doch seine hellen Augen waren voller Furcht. »Jeder Mensch muß irgendwann einmal sterben, Giles, aber ich werde noch lange, lange Zeit bei dir sein.« Noch immer lag die Furcht in seinen Augen, und rasch fügte ich hinzu: »So lange, bis du ein erwachsener Mann bist und selbst Kinder hast.«
Der Gedanke, daß er einmal groß sein sollte mit eigenen Kindern, schien ihm so vielversprechend, daß er zunächst einmal getröstet war und sein Blick sich wieder klärte. Er wollte sich abwenden, doch ich legte beide Hände auf seine Schultern und zwang ihn, mich anzusehen. »Papa hat ein Testament hinterlassen, Giles. Mr. MacAllister hat es uns heute morgen vorgelesen.«
Sein Interesse war geweckt. »Was ist ein Testament?«
»Es ist ein … eine Liste … von all den Dingen, die Papa erledigt haben wollte, nach seinem Tod. Eines der Dinge war, daß sein Bruder, dein Onkel Stephen, nach Hause kommen sollte, um sich für dich um Weston zu kümmern.«
»Onkel Stephen?« fragte Giles. »Wer ist das denn? Er wohnt doch gar nicht bei uns.«
»In den letzten fünf Jahren hat er in Jamaica gelebt, deshalb hast du ihn nie kennengelernt. Aber Papa hat bestimmt, daß er Weston so lange bewirtschaftet, bis du groß genug bist, es selbst zu tun. Jetzt bist du der Hausherr, mein Liebling. Ich weiß, es fällt dir schwer, das zu verstehen, aber hinfort gehört dir Papas Platz.«
Giles sah mich voller Ernst an. »Ich weiß«, erklärte er. »Genie hat gesagt, daß ich jetzt Graf Weston bin.«
»So ist es«, bestätigte ich. »Aber Onkel Stephen wird sich der Verwaltung von Weston Hall widmen, und auch all der Pächterhöfe, bis du einundzwanzig Jahre alt bist. Die Leute werden dich ›Graf‹ nennen; aber du hast noch viele Jahre Zeit, in deine Aufgaben hineinzuwachsen.«
Giles runzelte die Stirn. »Onkel Adam paßt doch auf Weston Hall und die Bauernhöfe auf!«
Ich nickte. »Sicherlich wird er das auch in Zukunft tun.«
»Warum brauchen wir dann Onkel Stephen?« insistierte mein Sohn.
»Papa hat ihn zu deinem Vormund ernannt«, erklärte ich ihm.
Das Kind, das meine Stimmung fühlte, als sei es eine Stimmgabel, warf mir einen prüfenden Blick zu. »Magst du Onkel Stephen nicht, Mama?«
Lachend stand ich auf, nahm meinen Sohn in den Arm und drückte ihn. »Natürlich mag ich Onkel Stephen. Dir gefällt er bestimmt auch. Er ist sehr lustig.«
Wir machten uns auf den Rückweg. »Kennt er prima Spiele?« fragte Giles voller Eifer.
Vorübergehend rang ich nach Luft. Ich fühlte, wie sich ein dumpfer Schmerz in meinem Kopf ausbreitete. »Ja«, antwortete ich. »Er hat gute Ideen.« Aus den Augenwinkeln erkannte ich eine Bewegung. »Oh, sieh mal, Giles«, rief ich erfreut. »Ich glaube, ich habe ein Häschen entdeckt.«
»Wo?« erkundigte er sich, und seine Aufmerksamkeit war, wie ich es gehofft hatte, abgelenkt von den Fragen nach Onkel Stephen.
***
Als ich etwas später mein Ankleidezimmer betrat, wartete meine Mutter dort auf mich. Dieses Refugium, das gleich neben dem ehelichen Schlafzimmer lag, war eigentlich mein ganz privater Bereich – aber meine Mutter schien das nicht zu akzeptieren. Natürlich hatte dieser Raum Mama gehört, in all den Jahren, in denen sie mit Geralds Vater verheiratet gewesen war, und vermutlich sah sie ihn noch immer als ihren Besitz an.
Sie saß in einem Chintzsessel vor dem Feuer und nippte an einer Tasse Tee, als ich hereinkam.
»Ich kann es nicht verstehen, warum du diese Einrichtung geändert hast«, meinte sie wie jedesmal, wenn sie hier auftauchte. »Es war unerhört elegant, als ich es noch bewohnte. Du hast dafür gesorgt, daß es nun gewöhnlich aussieht, Annabelle.« Ihre feine, gerade Nase runzelte sich, als hätte sie einen unangenehmen Geruch aufgenommen. »Geblümter Kattun«, sagte sie voller Abscheu.
Zu Mamas Zeiten war das gesamte Interieur mit strohfarbener Seide ausgeschlagen gewesen. Es hatte wirklich vornehm ausgesehen; aber mir entsprach dieses kostbare Mobiliar nicht so richtig, und die Hunde hatten auch prompt die seidenen Stoffe mit Lehm beschmutzt. Für meine Gepflogenheiten eignete sich der fröhlich bunte Kattun wesentlich besser.
Mamas grüne Augen richteten sich auf mich. »Wirklich, Annabelle«, tadelte sie und ihre Abscheu verstärkte sich noch. »Wie kannst du es nur ertragen, in solch stilloser Kleidung herumzulaufen?«
»Das ist mein Wanderkostüm«, erklärte ich. Ich setzte mich auf mein Chintzsofa, das Mamas Sessel gegenüberstand, streckte die Beine aus und betrachtete meine lehmigen Stiefel. »Wir beide mußten unbedingt einmal ins Grüne. Es war eine schwierige Zeit.«
Wegen meiner Trauer verbiß meine Mutter sich weitere Bemerkungen sowohl über den Lehm, als auch meine Aufmachung und die Hunde, die es sich in einem Streifen Sonnenlicht, der durch das Fenster fiel, bequem gemacht hatten. »Armer Gerald«, meinte sie. »Wie konnte nur ein junger und gesunder Mensch eine Lungenentzündung bekommen, die so schwer war, daß er daran sterben mußte?«
Sie machte ein Geräusch, als sei Gerald aus Leichtsinn verstorben.
»Ich weiß es nicht, Mama«, antwortete ich erschöpft. Der Schmerz in meinem Kopf hatte sich jetzt hinter meine Augen verlagert. »Der Arzt hat gesagt, daß so etwas unglückseligerweise vorkommt.«
»Nun, trotzdem ist es absurd«, widersprach sie.
Darauf konnte ich nichts antworten.
Noch einmal nippte sie an ihrem Tee. Schweigen breitete sich aus zwischen uns. Ich sah meine Mutter an, und zum ersten Mal entdeckte ich einige silberne Strähnen in ihrem blaßgoldenen, sorgfältig frisierten Haar. »Es ist mir unbegreiflich, warum Gerald Stephen zu Giles Vormund ernannte«, begann sie wieder.
Angelegentlich versenkte ich mich in meine Stiefelspitzen und versuchte, meiner Stimme einen neutralen Klang zu geben. »Stephen war sein einziger Bruder. Genau besehen war es eine ganz normale Entscheidung.«
»Unsinn. Gerald und Stephen haben einander nie nahegestanden.«
Meine Schultern verspannten sich, und ich murmelte etwas von Blutsverwandtschaft.
Schließlich kam Mama auf den Grund ihres Besuches zu sprechen. »Hattest vielleicht du etwas mit diesem Entschluß von Gerald zu tun, Annabelle?«
Ich schaute von meinen Stiefeln auf, und unsere Blicke trafen sich. »Nein, Mama, das hatte ich nicht.«
Nach einem Augenblick sah sie wieder aus dem Fenster. »Gerald muß verrückt gewesen sein«, sagte sie mißbilligend. »Was weiß Stephen denn schon von der Führung eines Gutes wie Weston?«
»Immerhin leitet er seit fünf Jahren die Zuckerrohrplantage in Jamaica«, rief ich ihr ins Gedächtnis. »Es ist nicht so, daß er keine Erfahrung mit Ländereien hat, Mama.«
Mutter warf mir einen mitleidigen Blick zu. »Sein Vater hat ihn nach Jamaica geschickt, weil die Plantage derart heruntergewirtschaftet war, daß sogar Stephen keinen Schaden mehr anrichten konnte.«
»Wie ich noch von Gerald weiß, hat Stephen dort drüben sehr gute Arbeit geleistet, Mama. Immerhin ist die Plantage nicht bankrott gegangen – wie so viele andere Besitztümer in Übersee.«
Während ich das sagte, verzog ich das Gesicht genau wie Giles. Warum verteidigte ich Stephen?
»Auf jeden Fall«, fuhr ich fort, »wird Stephen wollen, daß Onkel Adam sich weiterhin um Weston kümmert wie bisher.«
»Das hoffe ich auch«, meinte Mutter. »Stephen war leider schon immer sehr unbeständig. Er hat es nicht einmal in der Schule aushalten können. Und ständig mußte er sich prügeln. «
Ich öffnete den Mund, um ihr zu widersprechen, doch dann schloß ich ihn gerade noch rechtzeitig. Keinesfalls würde ich der Versuchung erliegen, Stephen meiner Mutter gegenüber ständig in Schutz zu nehmen.
»Wenn er nach Hause kommt, dann wird er nicht in diesem Haus leben können, zusammen mit dir«, erklärte die ehemalige Dame des Hauses.
Verwirrt starrte ich sie an.
»Tu nicht so unschuldig, Annabelle«, fuhr sie mich an. »Du kannst nicht zusammen mit Stephen in diesem Haus leben – ohne eine Anstandsdame.«
Meine Verwirrung verwandelte sich augenblicklich in Bestürzung. »Mama, Gerald ist noch nicht einmal kalt in seinem Grab.«
Mutter hob das Kinn. Sie war eine unglaublich schöne Frau, doch ihre Schönheit hatte etwas Äußerliches. Ich habe sie im Grunde nie gemocht.
»Es geht mir nur um deinen guten Ruf«, versetzte sie.
In meinem ganzen Leben war ich noch nie so wütend auf sie wie in diesem Augenblick. Ich erhob mich: »Mama, bitte geh jetzt!«
Sie sah in mein Gesicht und entschloß sich dann in der Tat zum Aufbruch. Schwebend gelangte sie zur Tür, blieb kurz
stehen und schaute zu mir zurück, in der offenkundigen Absicht, das letzte Wort zu haben. »Du solltest Schwarz tragen, Annabelle«, riet sie mir.
Dann verließ sie in aufrechter Haltung den Raum und ließ mich mit meinen Kopfschmerzen allein.
Kapitel 2
Normalerweise beendete ich im Frühling die Jagdsaison und bereitete die Übersiedelung nach London vor, um meine gesellschaftlichen Verpflichtungen zu erfüllen; doch Gerald war tot, und nichts lief mehr in den gewohnten Bahnen. Das Gefühl der Leere und der Einsamkeit in meinem Inneren war mir nur allzu bekannt, und ich verbrachte einen großen Teil meiner Zeit mit Giles. Ich redete mir ein, daß er mich brauchte; doch in Wirklichkeit war wohl ich es, die sich an ihm festhielt.
Erleichtert kehrte ich in die Normalität zurück, als Sir Matthew Stanhope mich besuchte. Der Regionalherr, der gleichzeitig der Leiter der Sussex-Jagd war, kam am 29. März zu mir, zwei Tage nach der offiziellen Beendigung der Jagdsaison. Wir saßen in dem kleinen Zimmer hinter der Treppe, das ich vor zwei Jahren als Schreibstube für mich eingerichtet hatte. Zur Erfrischung nahm er ein Glas Wein, ich trank Tee.
»Vor ein paar Tagen ist Fentons Hecke niedergetrampelt worden«, sagte er, lehnte sich in dem alten, mit Samt bezogenen Lehnsessel zurück und trank mit einem kräftigen Schluck das halbe Glas leer. »Einer dieser verdammten Cousins von Watson hat sich das geleistet.«
Die Nachbarbauern bei Laune zu halten, war normalerweise meine Aufgabe. »Oje«, sagte ich. Fenton war einer von Westons Pächtern, und ich kannte seinen Stolz auf die neue Hecke. »Hat ihm jemand gesagt, daß der Jagdherr die Sträucher ersetzen wird?« fragte ich.
»Ich war selbst bei ihm«, erklärte mir Sir Matthew. »Er ist trotzdem immer noch aufgebracht. Seine Frau sagt, was wäre wohl passiert, wenn der Kleine gerade dort draußen gespielt hätte? Er wäre totgetrampelt worden, meint sie.«
Leider hatte Mrs. Fenton recht. Verärgert stellte ich meine Tasse ab. »Wie, zum Teufel, ist dieser Kerl in Fentons Hecke geraten, Sir Matthew? Die Jagd sollte doch mindestens drei Felder weiter stattfinden.«
»Das hat sie ja auch, Annabelle, durchaus! Aber dieser verdammte Dummkopf hat ein geliehenes Pferd geritten – ein nervöses Vollblutpferd – und er konnte es nicht mehr zügeln. Das Pferd ist mit ihm durchgegangen und in die Sträucher gerast.«
Wir betrachteten einander und waren beide empört über soviel Dilettantismus. Sir Matthew besaß das asketische Gesicht eines mittelalterlichen Gelehrten; doch war er ein Mann vom Land, leidenschaftlicher Reiter und der beste Führer der Fuchsjagdhunde, den es weit und breit gab. Er kannte mich seit meinem achten Lebensjahr.
»Es wird nicht gut sein für die Jagd, wenn die Bauern ringsum sich sogar in ihren eigenen Gärten nicht mehr sicher fühlen«, bemerkte ich.
»Ich weiß, ich weiß.« Sir Matthew trank sein Glas aus, schenkte sich dann wieder nach und kam zum eigentlichen Anliegen seines Besuches. »Glauben Sie, daß es Ihnen möglich wäre, die Fentons aufzusuchen, Annabelle? Könnten Sie ihnen verständlich machen, daß es sich um einen Unfall gehandelt hat und nicht noch einmal Vorkommen wird?« Er räusperte sich. »Gerne bitte ich Sie wirklich nicht darum, ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt, meine Liebe. Ihre Trauer sollte Sie vor derlei Dingen verschonen.« Sir Matthews schmales, strenges Gesicht drückte seinen Ernst aus. »Aber die Fentons sind Pächter von Weston, und wenn Mrs. Fenton die Frauen der anderen Nachbarn aufwiegelt…«
»Dann wird die Sussex-Jagd Schwierigkeiten bekommen«, beendete ich den Satz für ihn.
Schweigend sahen wir einander an.
Die Sussex-Jagd war unsere gemeinsame Leidenschaft. Wie ich schon früher erwähnte, war Sir Matthew der Jagdmeister, und unsere Meute kostbarer Fuchsjagdhunde versorgte er auf seinem Gut Stanhope. Die Kosten für so eine Meute stellten erhebliche Summen dar, und man konnte nicht von Sir Matthew erwarten, sie allein zu tragen. Deshalb basierte unsere Jagdgemeinschaft, genau wie viele andere, auf Mitgliedsbeiträgen.
Wer zur Sussex-Jagd gehören wollte, mußte einen bestimmten Betrag in jedem Jahr entrichten. Den Mitgliedern war es erlaubt, Gäste mitzubringen, und die Gäste hatten natürlich auch zu bezahlen. Wir brauchten das Geld, um die Jagden durchführen zu können; und es versetzte uns immer wieder in Wut, wenn diese Leute Reiter einluden, die mit ihren Tieren nicht zurechtkamen. Einen ähnlichen Zwischenfall hatte es am Beginn der Jagd gegeben, im November, als das Pferd eines Gastes einen Hund getreten hatte. Damals fürchtete ich, daß Sir Matthew auf der Stelle der Schlag treffen würde.
»Natürlich werde ich mit den Fentons sprechen«, beruhigte ich ihn.
»Danke, meine Liebe. Ich versichere Ihnen, ich hatte ein strenges Gespräch mit Watson. Falls er sich noch einmal eine solche Dummheit leisten würde, könnten wir ihn leider nicht mehr mitnehmen.«
Das fand ich völlig richtig.
Schweigen senkte sich hernieder. Die Sonne hatte sich gerade diesen Augenblick ausgesucht, um hinter den Wolken hervorzukommen, und es wurde plötzlich so hell im Raum, als wären alle Lampen gleichzeitig angezündet worden. Diese Schreibstube war das einzige Zimmer im ganzen Haus, das mir allein gehörte; normalerweise verbrachte ich einen Teil jeden Tages hier an dem großen Schreibtisch, der mitten im Raum stand und das beherrschende Möbelstück darstellte. Hier führte ich die Haushaltsbücher und auch die Abrechnungen meines eigenen Tätigkeitsbereiches, der Schulung von Jagdpferden.
Meine Blicke hoben sich jetzt, wie so oft, zu dem Ölbild von George Stubbs, das an der Wand mir gegenüber hing. Darauf wurden Vollblüter in Newmarket Heath trainiert. Gerald hatte es mir zu meinem einundzwanzigsten Geburtstag geschenkt, und ich liebte diese Szene. Ganz unvermutet begannen meine Augen zu brennen.
»Wie kommen Sie zurecht, Annabelle?« fragte Sir Matthew. »Und wie geht es dem kleinen Giles?«
Mein Lächeln geriet sicher ein wenig schief. »Uns geht es so, wie es unter diesen Umständen zu erwarten ist, Sir Matthew. Es war ein solcher Schock für alle. Ich glaube, ich habe noch immer nicht so recht begriffen, daß Gerald wirklich nicht mehr da ist.«
Er schüttelte den Kopf. »Ein junger Mann wie er, so voller Leben. Wie alt war er doch gleich … neunundzwanzig?«
»Erst achtundzwanzig«, korrigierte ich.
»Wie oft war er den ganzen Tag über im Regen auf der Jagd, wie oft ist er durch und durch naß geworden, und niemals hat er auch nur einen Schnupfen davongetragen!« erinnerte Sir Matthew sich. »Warum hat er sich ausgerechnet in London eine Lungenentzündung geholt?«
Ich rieb mir meine müden Augen. »Ich weiß es nicht, Sir Matthew. Er ist einfach so gestorben.«
»Es tut mir so leid, meine Liebe«, seufzte er. »Und da belästigt Sie der aufdringliche alte Matthew auch noch mit seinen Geschichten. Aber Sie wissen, wenn Sie etwas brauchen – ganz gleich, was es auch ist – dann wenden Sie sich bitte an mich.«
Diesmal gelang es mir aufrichtig zu lächeln. »Das weiß ich, und ich bin Ihnen auch dankbar dafür. In einer Zeit wie dieser braucht man Freunde.«
Er warf mir einen durchdringenden Blick zu und fragte dann: »Ist die Herzogin immer noch hier?«
Mit der »Herzogin« meinte er die Herzogin von Saye, die zufällig auch meine Mutter war. Zwei Jahre nach dem Tod des sechsten Grafen von Weston, Geralds Vater, hatte Mama sich den Herzog von Saye geschnappt, als Ehemann Nummer drei. Sie liebte es, sich mit »Euer Gnaden« anreden zu lassen.
»Heute nachmittag wird sie abreisen«, gab ich Auskunft.
»Gut.«
Wissend lächelten wir einander zu.
»Ich habe von Adam gehört, daß in Westons Testament Stephen als Giles’ Vormund bestimmt wurde«, sprach Sir Matthew weiter.
»Jawohl.«
Der Jagdmeister nickte zustimmend. Stephen hatte früher einmal eine von Sir Matthews preisgekrönten Hündinnen vor den Hörnern eines Bullen gerettet, und deshalb war Stephen in Sir Matthews Augen auf ewig ein Held. »Gut überlegt von Weston«, meinte er jetzt. »Adam ist ein großartiger Mensch, aber zu alt, um einen Jungen wie Giles zu erziehen.« Sir Matthew fuhr sich mit der Hand durch sein kurzes, langsam grau werdendes schwarzes Haar und deutete dann vorsichtig an: »Wissen Sie, Annabelle, meiner Ansicht nach steckte noch viel mehr hinter der Geschichte mit Stephens Schmuggelaffäre damals, als wirklich aufgedeckt wurde.«
»Schon möglich«, wich ich aus. »Aber das alles ist schon fünf Jahre her, Sir Matthew, und ich glaube, jetzt hat es keine Bedeutung mehr.«
»Damit haben Sie recht.«
Ich wechselte das Thema. »Stimmt es, daß Durham seine Meute verkaufen will?« fragte ich.
Jetzt wurde er aufmerksam, setzte sich gerade. »Sie ist schon verkauft«, meinte er und zögerte einen Augenblick, ehe er weitersprach. »Für zweitausend Guineen, Annabelle.«
»Habe ich richtig gehört?«
Sir Matthew nickte ernst, goß sich noch ein Glas Wein ein und setzte sich bequem zurecht, um mir alle Einzelheiten zu berichten.
***
Am folgenden Morgen machte ich mich auf den Weg, die Fentons zu besuchen. Der Hof lag in der Nähe des Dorfes Weston, also entschied ich mich für einen ausgedehnten Ritt über einen der Graspfade, die den Weston-Park durchzogen, und erreichte nach einer Weile die Dorfstraße. In der Nacht hatte es geregnet, und die Wälder zu beiden Seiten der Allee dampften, Wasser tropfte von den Bäumen. Die Welt roch frisch und sauber, der sanft geschwungene Hals meiner Vollblutstute war so gut gestriegelt, daß er glänzte, und die Elastizität ihrer Schritte zeugte von ihrer Energie und Gesundheit. Es war einer dieser Morgen, an dem man glücklich ist, am Leben zu sein. Ich konnte es einfach nicht ertragen, an Gerald zu denken, deshalb drückte ich Elf energisch die Fersen in die Seite und bewältigte die ganze Strecke im Galopp.
Der Hof der Fentons mit seinen beiden großen Schuppen, der Remise, einem Kornspeicher und dem Schweinestall zeugte von Wohlstand. Er hätte noch besser ausgesehen, wenn nicht die Lücke in der Buchsbaumhecke an der rechten Seite des Hauses gewesen wäre, die aussah wie das Werk eines durchgedrehten Gärtners. Ich sah sie mir vom Rücken meiner Stute aus an und stellte mir in Gedanken vor, was geschehen sein mochte. Das Pferd war von der einen Seite aus in die Hecke geraten, und der Aufprall hatte es über die kleine Rasenfläche katapultiert, so daß es an der anderen Seite durch die Hecke wieder hinausschoß.
Der Gedanke, daß ein Kind auf diesem durch die Hecke eingezäunten Wiesenstück hätte spielen können, direkt in der Bahn dieser mörderischen, mit Eisen beschlagenen Hufe, ließ mir das Blut in den Adern gefrieren.
»Gnädige Frau!« Mrs. Fenton stand in der Tür des Bauernhauses und wischte sich die Hände an ihrer Schürze ab. Rasch stieg ich von meinem Pferd, band Elf am Zaun fest und folgte ihr ins Haus.
Susan Fenton zählte ein paar Jahre mehr als ich. Als Tochter und nun Ehefrau eines Pächters gehörte sie immer schon zu Weston. Sie nahm mich mit in die Küche, um Tee zu kochen, und drückte mir dann ihr Beileid über Geralds Tod aus, zweifellos meinte sie es ernst. Ich bedankte mich bei ihr, und dann wollten wir Tee in dem kleinen, unterkühlten Zimmer trinken, das nur bei »Besuch« benutzt wurde. Die junge Bäuerin stellte die Kanne ab und deutete auf einen der Stühle, dessen Sitzfläche mit einem blauweiß bestickten Kissen versehen war.
Den weiten Rock meines Reitkleides brachte ich kaum auf dem Stühlchen unter. »Ich bin gekommen, um mich wegen der Hecke zu entschuldigen«, sagte ich.
Auf ihrem hübschen Gesicht mit der frischen, apfelblütenzarten Haut zeichnete sich Sorge ab. »Natürlich werden Sie mir die Sträucher ersetzen, gnädige Frau, darum geht es mir gar nicht. Aber mein Robby spielt sehr oft dort draußen, ganz allein. Es ist eine abgeschlossene geschützte Fläche, sehen Sie.« Sie nippte an ihrem Tee. »Wenigstens habe ich das bis jetzt immer geglaubt.«
»Ich habe es mir von der Straße aus angesehen. Das Pferd ist mitten hindurchgeritten?«
»Allerdings! Es hat mir eine Todesangst eingejagt.«
Das konnte ich verstehen. »Es war keiner von unserer Jagdgemeinschaft, Susan«, versicherte ich ihr. »Irgendein Dummkopf von den Gästen saß auf einem Pferd, das er nicht beherrschte.«
»Wer es gewesen ist, ist mir ganz gleich, gnädige Frau«, begehrte Susan auf. »Ich weiß, dies hier ist Weston-Land; aber wir besitzen einen Pachtvertrag, und ich möchte nicht, daß noch einmal Jäger in die Nähe meines Hauses kommen.«
Die große Standuhr in der Ecke schlug zur vollen Stunde, und ich wartete, bis ihr Ton verhallt war, ehe ich weitersprach. »Die Jäger sollten Ihre Wohngrenze keineswegs überschreiten, Susan. Sir Matthew hat mir berichtet, daß der Rest der Gruppe eine ganze Meile von hier entfernt war.«
»Daß das Pferd hier eigentlich nichts zu suchen gehabt hätte, wäre nur ein schwacher Trost gewesen, wenn wir jetzt die trauernden Eltern von Robby wären«, gab Susan schnell zurück. »Er hielt sich innerhalb unseres Privatbereichs auf, gnädige Frau, und es wäre gut möglich gewesen, daß mein Kind dabei hätte ums Leben kommen können.«
Vielleicht sollte ich an dieser Stelle einfügen, daß Susan und mich nicht die Beziehung verband, die üblicherweise zwischen einer Gräfin und der Frau eines seiner Pächter bestand. Sie kannte mich schon als einsames und unglückliches Kind, das seinerzeit nach Weston Hall gekommen war. Zum Blaubeerensammeln hatte sie mich mitgenommen und mir beigebracht, wie man einen Gemüsegarten anlegt. Susan war es gewesen, die mir etwas erzählt hatte über die monatliche Regel der Frau.
»Natürlich hast du recht«, sagte ich resigniert. Der köstliche Duft von frisch gebackenem Brot drang aus der Küche zu uns herein, und ich schnupperte. »Könnte es sein, daß du grade am Backen bist, Susan?«
Susan wußte, wie sehr ich ihr Brot liebte. »Die Wecken sind in ein paar Minuten fertig, gnädige Frau, wenn Sie so lange warten möchten.«
»Auf dein Brot, Susan, würde ich eine Ewigkeit warten«, sagte ich.
Sie sah erfreut aus, und nur zögernd kehrte ich zu dem Thema zurück, das mich hierhergebracht hatte. »Du hast doch noch nie zuvor Probleme gehabt mit den Mitgliedern unserer Jagdgemeinschaft, nicht wahr?«
Meine ehemalige Fee runzelte nachdenklich die Stirn und blickte auf die Zinnteller, die auf dem Buffet aus Eiche aufgereiht waren. »Nein«, gab sie schließlich zu.
»Und wenn ich nun in Zukunft darauf bestehen würde, daß niemand anders mit uns jagen darf, nur noch die echten Mitglieder?«
Unsicher sah sie mich an.
»Du kennst alle, die zu uns gehören, Susan«, erklärte ich wohlüberlegt. »Es gibt niemanden darunter, dem man nicht vertrauen könne, daß er euren Wohnbereich respektiert.«
Die Sussex-Jagd war bemerkenswert demokratisch organisiert, und Susan kannte wirklich alle Mitglieder der Gemeinschaft. Einige der wohlhabenderen Pächter hatten in unseren Reihen Aufnahme gefunden, auch der Eigentümer des Dorfgasthofs gehörte dazu. Es war die Mißbilligung gerade dieses Mannes, Harry Blackstone, die Susan am meisten fürchtete. Wenn Harrys Jagen von Bob Fentons Frau eingeschränkt würde, dann wäre Bob nicht mehr im Schankraum des King’s Arms willkommen. Das wiederum würde Bob übelnehmen.
»Du schürst eine ganze Menge böses Blut gegen dich und deinen Mann, wenn du den Jägern nicht mehr erlaubst, über eure Felder zu reiten!« Selbstverständlich kannte ich ihre Achillesferse.
Susan ließ sich jedoch nicht so schnell einschüchtern. »Das ist ein Punkt für Sie«, sagten ihre Blicke. Ich lächelte sie arglos an.
»Würden die anderen Mitglieder der Jagd denn darauf verzichten, Gäste einzuladen, gnädige Frau?« fragte sie.
»Sie werden nicht gerade begeistert sein von dieser Aussicht«, gestand ich offen. »Es wird wahrscheinlich bedeuten, daß die Gebühren für die Jagd erhöht werden müssen. Aber ich halte deinen Grund zur Klage für stichhaltig. Entweder werden wir die Jagd ausschließlich auf die Downs beschränken, oder wir müssen vorsichtiger sein in der Auswahl unserer Gäste. Deinen Robby hätte es wirklich schlimm treffen können in der Einfriedung, als das Pferd hindurchraste.«
Über einer zweiten Tasse Tee und einigen Scheiben von Susans Brot versprach ich ihr, Männer aus Weston zu ihr hinüberzuschicken, mit frischen Buchsbaumpflanzen, um die Hecke zu reparieren. Der Imbiß war beendet, und ich machte mich gerade bereit, zu Elf zurückzugehen, als Susan sagte: »Wußten Sie eigentlich, daß Jem Washburn wieder zu Hause ist, gnädige Frau?«
Ich sank auf den Stuhl zurück. »Nein. Davon hatte ich keine Ahnung.« Meine Überraschung spiegelte sich in meiner Stimme wider.
Eine von Susans Katzen mußte bemerkt haben, daß Platz auf meinen Schoß war, sie sprang herauf und ringelte sich dort zusammen. Gedankenverloren streichelte ich ihr weiches graues Fell.
»Washburn liegt im Sterben, aber ich glaube kaum, daß Jem zurückgekommen ist, um sich von seinem lieben alten Pa zu verabschieden«, meinte Susan ironisch.
»Washburn ist ein Rohling«, gab ich zurück. »Alle haben schon immer gewußt, daß er Jem schlug; aber niemand hat je etwas dagegen unternommen.«
»Mr. Stephen schon – er wollte ihn oft davon abhalten«, wandte Susan ein.
Meine Hand hielt mitten in der Bewegung inne, die Katze legte den Kopf schräg und starrte mich mit großen Augen an. Sie miaute ungehalten, und ich kraulte weiter.
»Bob sagt, Jem ist nach Hause gekommen, um die Pacht seines Vaters auf dem Hof zu übernehmen«, teilte Susan mir mit. »Aber er hat Angst, daß Mr. Grandville ihm den Pachtvertrag nicht geben wird. Jem war als Junge sehr ungebärdig; aber wie ich gehört habe, ist er mit den Jahren ruhiger geworden.«
Der Katze gefiel meine Massage, und sie schnurrte laut. »Die Entscheidung, wer den Hof der Washburns bekommen wird, liegt nicht bei Mr. Grandville.«
Die hübsche Susan sah mich voller Erwartung an. »Dann ist es also wahr, gnädige Frau? Wird Mr. Stephen wirklich heimkehren?«
»Graf Weston hat ihn zu Giles’ Vormund ernannt«, sagte ich. »Unter diesen Umständen sehe ich für ihn keine Möglichkeit, in Jamaica zu bleiben.«
»Da sind wir alle von Herzen froh«, gestand Susan, »Mr. Stephen endlich wieder bei uns zu haben.«
Während meines Aufenthalts in Susans Bauernhaus hatte die Sonne all die restlichen Wolken vertrieben; nachdem ich nun Elf zu trinken gegeben und ihren Sattelgurt festgezurrt hatte, brach ich auf. Doch anstatt über die Straße von Weston nach Hause zu reiten, lenkte ich meine Stute über den ausgetretenen Pfad, der in die Downs führte. Sie spitzte die Ohren, als ihr klarwurde, wohin der Ausflug ging, und ihre Schritte wurden lebhafter.
Ich ließ Elf in einen leichten Trab fallen, als wir uns den ausgedehnten Hügeln näherten, die sich nordwärts erstreckten, und schon bald trabten wir über den herrlich festen Grasboden der Sussex-Downs. Ich fühlte den Druck von Elfs Hinterfüßen, als wir langsam bergan kletterten. Heute ritt ich im Damensattel, wie immer, wenn ich nicht gerade auf der Jagd war; ich achtete darauf, mein Gewicht nach vorne zu verlagern, um sie nicht unnötig zu belasten während des Aufstiegs.
Wir erreichten die Hochebene der Downs und wandten uns den beiden Reihen von Wacholderbüschen zu, die auf dem Höhenzug einen etliche Meter breiten natürlichen Weg bildeten.
Elfs Ohren richteten sich nach vorn, bis sie einander beinahe berührten. Sie wußte, was jetzt kam, und im gleichen Augenblick, als ich die Zügel lockerte, fiel sie in einen gestreckten Galopp. Der Wind wehte mir ins Gesicht, und ich schnalzte mit der Zunge, um Elf noch mehr anzutreiben. Sie flog dahin, ein Vollblut in vollem Lauf, eines der schnellsten Dinge der Welt, und ich beugte mich tief über ihren Hals. Kaum berührte sie mehr den Boden, und das Blut rauschte heiß durch meine Adern. Am liebsten hätte ich nie wieder angehalten.
Ungefähr eine Meile weit ritten wir in höchster Geschwindigkeit, dann verringerten wir das Tempo. Nach ungefähr anderthalb Meilen trabten wir leicht vorwärts. Und als wir dann an der Stelle waren, von der aus wir den Weg nach Westen Hall einschlagen konnten, trottete Elf gemächlich Richtung Heimat.
Der Himmel war von einem tiefen Kobaltblau, bedeckt mit einigen hohen weißen Wolken, die anmutig über das endlose Blau segelten. Ich zog die Zügel an, damit Elf stehenblieb, und beide blickten wir auf die sonnige Senke unseres Heims.
Das Gut und der Park bedeckten beinahe den gesamten östlichen Teil des Tales. Deutlich konnte ich das große, aus Naturstein erbaute Haus erkennen und auch die Ställe, die Pferdekoppeln und den See. Ich machte sogar das Fischerhäuschen am Ufer des Sees aus und den Eisschuppen.
Das Dorf Westen lag westlich des Parks. Von meinem Aussichtspunkt aus war es nicht mehr als eine Ansammlung von Bäumen und Häusern, inmitten weiter Felder. Die Kirche lag am Rand des Dorfes, und der Glockenturm ragte in rührender Wichtigkeit gen Himmel.
Im Norden des Dorfes, direkt an den Downs, befand sich das zweitwichtigste Haus der Gegend: Das Stanhope-Gut, Sir Matthews Besitz. Ein Teil des Parks lag sichtbar da, doch das Haus selbst blieb meinen Blicken verborgen.
Der Rest des Tales bestand aus fruchtbaren Äckern, die meisten davon gehörten dem Grafen von Weston und waren an die Bauern verpachtet. Über den Hügelkamm, der das Tal nach Süden hin abschloß, konnte ich nicht schauen; doch ich wußte, daß an der entfernten Seite der steilen, mit Wäldern bewachsenen Höhen das Land noch einige Meilen weit abfiel, bis hin zum Ärmelkanal und der kleinen Hafenstadt West Haven. Diese Erhebung schützte das Tal vor den Meerwinden und machte es zu einem der mildesten Orte in ganz England.
Nach ein paar Minuten trieb ich Elf wieder an, und wir suchten uns unseren Weg abwärts, über die Wiesen, bis wir schließlich den unbefestigten Wiesenpfad erreichten, der uns zurück nach Weston Park brachte.
Kapitel 3
Als ich zu Hause eintraf, begrüßte mich Hodges, unser Butler, an der Tür und unterrichtete mich davon, daß Geralds Cousin, Jack Grandville, zu Besuch gekommen war. Hodges hatte ihn in die Bibliothek geführt.
»Er ist mit seinen Koffern angereist, gnädige Frau, aber ich habe das Gepäck noch nicht nach oben bringen lassen.«
Hodges’ imposante Hakennase faszinierte mich seit meinen Kindertagen. Sie war das perfekte Barometer seiner Stimmungen, und in diesem Augenblick zitterte sie voller Entrüstung.
So lange ich denken konnte, hatte Jack in Weston Gastrecht genossen. Er war der einzige Sohn von meines Schwiegervaters jüngerem Bruder, und als solcher stand er in der Erbfolge der Grafschaft gleich hinter Giles und Stephen. Als der Sohn eines Nachgeborenen befand sich Jack ständig in Geldnöten; seit geraumer Zeit hatte er es sich demzufolge zur Gewohnheit gemacht, in Weston Quartier zu nehmen, wenn er für eine Weile billig leben mußte. Ich verstand das plötzliche Mißfallen von Hodges nicht.
»Warum kümmern Sie sich nicht um sein Gepäck, Hodges?« fragte ich ihn daher, als ich meine Handschuhe auszog.
»Er ist ein unverheirateter Mann und sollte nicht mit Ihnen unter einem Dach wohnen, solange Sie allein sind, Miss Annabelle«, erklärte mein Butler. Daß er mich mit meinem Jugendnamen ansprach, zeugte nur um so deutlicher vom Ausmaß seiner Qualen.
»Unsinn«, wehrte ich ab. »Mr. Jack gehört doch zur Familie.«
Die Hakennase blähte sich empört. »Es schickt sich nicht, Mi … gnädige Frau. Wenn er hier wohnt, dann gibt es Gerede. «
Während ich noch Hodges’ Nase studierte, wurde mir klar, daß ich eigentlich Jacks Gesellschaft von morgens bis abends gar nicht wollte. Nachdenklich klopfte ich mit meinen Handschuhen meine Rockfalten aus, dann meinte ich: »Es wäre doch möglich, daß er bei Mr. Adam unterschlüpft.«
Die Nase hörte auf zu beben. Hodges lächelte. »Ich werde Mr. Jacks Gepäck sofort zum Dower-Haus bringen lassen, gnädige Frau.«
»Es wäre besser, wenn Sie erst Mrs. Grandville fragen würden«, warnte ich ihn.
»Aber natürlich, wie Sie meinen!«
Ich warf meine Handschuhe auf das zierliche Louis-XIV-Tischchen. »Schicken Sie bitte etwas Limonade in die Bibliothek, Hodges. Reiten macht durstig.«
Jetzt, wo er seinen Willen durchgesetzt hatte, war er die Liebenswürdigkeit in Person. »Sofort, gnädige Frau.« Er bedachte mich mit einem gütigen Lächeln. »Es freut mich, daß Sie wieder etwas Farbe auf Ihren Wangen haben.«
Inzwischen blickte ich mich in der riesigen, mit Marmor verkleideten Eingangshalle um, in der wir standen; ich sah die großen, im römischen Stil errichteten Pfeiler und die klassischen Statuen in den Nischen, dann fragte ich mit unschuldiger Miene: »Aber wo ist denn Mr. Jacks Gepäck, Hodges?«
»Es steht unter der Treppe, gnädige Frau«, antwortete er beflissen.
Wir sahen einander an. Ich wußte es, und er wußte, daß ich es wußte – er hatte das Gepäck zu Onkel Adams Haus geschafft, noch ehe ich von meinem Ausritt zurückgekommen war.
»Es ist nett von Ihnen, daß Sie so tun, als besäße ich in diesem Haus eine gewisse Autorität, Hodges«, bemerkte ich honigsüß.
Er hatte wenigstens den Anstand, verlegen zu werden. Erheitert begab ich mich dann über den glänzenden, schwarzweißen Marmorfußboden, vorbei an der Treppe, in den Korridor. Statt jedoch durch den Flur weiter zum Gesellschaftszimmer zu gehen, bog ich ab und passierte den Durchgang, der zum privaten Teil des Hauses führte. Die Tür gegenüber der Treppe, über die man zu den Schlafzimmern gelangte, stand offen, und ich betrat die Bibliothek, einen prächtigen, getäfelten Raum mit Bücherregalen, die bis zu der hohen, vergoldeten Decke reichten. Über dem Kamin aus grünweißem Marmor hing ein Portrait des ersten Grafen von Weston, ein Mann, der Gerald bemerkenswert ähnlich sah und der nach der prunkvollen Mode der Wiedereinsetzung der Monarchie im Jahre 1660 gekleidet war.
An dem Fenster der Bibliothek, das nach vorne hinausging, stand ein Mann, und obwohl meine Füße auf dem dicken Orientteppich keinerlei Geräusch verursachten, wandte er sich zu mir um. Das Sonnenlicht brachte sein helles Haar zum Glänzen, und einen kurzen Augenblick lang schlug mir, obwohl ich wußte, wer er war, das Herz bis zum Hals.
»Annabelle«, sagte Jack. Stirnrunzelnd kam er auf mich zu. »Stimmt etwas nicht?«
»Es ist nur … als das Sonnenlicht auf dein Haar fiel … habe ich für einen Augenblick Gerald vor mir gesehen.«
»Oh, meine Liebe! Es tut mir leid. Setz dich, du siehst besorgniserregend blaß aus.«
Es gelang mir zu lächeln. »Ist schon gut!« Aber ich ließ mich trotzdem von ihm zu der Gruppe der Chippendale-Sessel führen, die neben dem großen Globus standen. Ich setzte mich und blickte dann in sein Gesicht, das Geralds so ähnlich war. Er besaß das gleiche blonde Haar, seine blauen Augen und sein gutes Aussehen; doch fehlte ihm Geralds heitere Unkompliziertheit. Sein Mund bildete einen harten Strich, seine Nase war habichtartig gekrümmt – Züge, die ich an meinem Mann nicht kannte.
»Ich werde dir ein Glas Madeira eingießen«, sagte er.
Meine Knie zitterten immer noch. »Einverstanden«, murmelte ich und sah ihm nach, als er zu dem Sheraton-Schrank hinüberging, in dem Getränke und Gläser aufbewahrt wurden. Er goß das Glas voll und reichte es mir schweigend. Vorsichtig nippte ich daran, dann nahm ich noch einen kleinen Schluck. Nach einem erneuten Blick in sein besorgtes Gesicht beteuerte ich abermals: »Es geht mir gut, wirklich.«
Er legte mir leicht eine Fingerspitze auf die Nase und meinte: »Du bist, wie immer, ohne Hut ausgeritten, deine
Sommersprossen sind herausgekommen.« Dann goß auch er sich ein Glas Madeira ein.
Ich stärkte mich mit einem weiteren Schluck und sah ihm zu, wie er sich in den Sessel mir gegenüber setzte. »Wahrscheinlich glaubst du, ich sei gekommen, weil ich eine Zuflucht brauche!« Auch er schlürfte genüßlich seinen Drink.
»Der Gedanke ist mir gekommen«, antwortete ich offen und ehrlich.
Er grinste. »Diesmal nicht, Annabelle. In der Tat hatte ich in der letzten Woche in Watiers Spielsalon großes Glück. Von den Gewinnen kann ich eine Zeitlang recht ordentlich leben.«
»Meinen Glückwunsch«, sagte ich.
Seine breiten Schultern nahmen sich in dem rosa Seidensessel mächtig aus. »Weißt du, ich habe mir Sorgen um dich gemacht.«
Ich drehte den Stiel des Glases zwischen meinen Fingern. »Aber das ist völlig unnötig, Jack. Mein kleiner Giles tröstet mich.«
»London ist nicht dasselbe ohne dich, Annabelle.« Über den Rand seines Weinglases sah er mich an. »Sogar dieser Schafskopf Byron hat ein Gedicht über dich geschrieben – er nannte es ›Lebewohl, Strahlende – oder etwas ähnlich Albernes.«
»Liest du etwa neuerdings Gedichte, Jack?« fragte ich voller Erstaunen.
Jetzt kam auch sein Grinsen zurück. »Nicht direkt«, wehrte er ab.
Die Tür wurde geöffnet, und ein Diener erschien im Rahmen. Er trug ein Tablett mit einem Krug Limonade und zwei Gläsern.
»Limonade?« rief Jack voller Entsetzen aus.
»Danke, William«, erklärte ich fest. »Stellen Sie es hier ab.«
William stellte das Tablett auf einen Tisch neben meinem Sessel. Er richtete sich wieder auf und sagte dann mit hölzerner Stimme: »Mr. Hodges läßt ausrichten, daß Mr. Jacks Gepäck ins Dower-Haus gebracht wurde.«
Hodges, dieser listige alte Teufel, machte Jack durchaus begreiflich, daß er nicht willkommen war. Mein sanfter Dank an William wurde übertönt von Jacks Protest: »Was, zum Teufel, soll das bedeuten, mein Gepäck einfach zu Adam hinüberzuschicken! Niemand hat, verdammt noch mal, Lust, bei Adam zu wohnen.«
Ich nickte William zu, der davoneilte. Dann wandte ich mich an Jack. »Hodges sagt, daß du nicht in diesem Haus mit mir zusammen wohnen kannst, weil ich keine Anstandsdame habe.«
Seine blauen Augen blitzten wütend. »Wie lächerlich, Annabelle, ich bin dein Cousin! Warum sollte ich nicht hier wohnen!«
»Du bist nicht mein Cousin, Jack, sondern Geralds. Und Gerald ist…«
Das Wort wollte mir nicht über die Zunge.
Sofort verschwand der Ausdruck von Wut aus seinem Gesicht, und er nahm zärtlich meine Hände in die seinen. »Annabelle, Liebling, es tut mir leid. Du weißt, ich würde nichts tun, was dir Kummer macht.«
Während ich ihm meine Hände noch für einen Augenblick überließ, ehe ich sie unmerklich zurückzog, gab ich Hodges recht: Es war besser, nicht allein zu sein mit Jack.
Er bedachte mich mit einem charmanten, ein wenig schiefen Grinsen. »Natürlich wohne ich bei Adam, wenn dich das glücklich macht.«
Ich holte tief und ein wenig zittrig Luft. »Es ist doch keine Strafe, dich bei Adam einzuquartieren, Jack!« Nach einem zweiten Atemzug klang meine Stimme wieder sicher. »Er ist sehr gut zu mir gewesen.«
Jack stand auf und ging mit großen Schritten zum Fenster. »Ich kann nicht begreifen, warum Gerald Stephen als Giles’ Vormund eingesetzt hat und nicht Adam«, meinte er dann. »Allein der Gedanke, daß Stephen einen Menschen lenken soll, jagt mir einen Schauder über den Rücken.«
»In den letzten fünf Jahren in Jamaica hat er hervorragende Arbeit geleistet.« Ich goß mir ein Glas Limonade ein. »Gerald hat gesagt, daß unsere Zuckerrohrplantage eine der wenigen war, die nicht den Bankrott erklären mußte.«
»Mein Großvater konnte mit dieser Plantage noch ein Vermögen machen, aber diese Zeit ist vorüber«, meinte Jack. »Napoleon hat dem Zuckergeschäft das Genick gebrochen, als er den europäischen Markt für britische Produkte sperrte. Es wäre vielleicht weitsichtiger, doch den Bankrott dieser Plantage zu erklären, um sie endlich loszuwerden.«
Intensiv widmete ich mich meiner Limonade und antwortete ihm nicht.
»Vermutlich werde ich Tante Fanny doch nicht länger als zwei Tage ertragen können«, meinte Jack mit düsterem Blick.
»Warum denn?« fragte ich überrascht. Adams Frau redete zwar ein wenig viel, aber sie war eine ganz besonders gutherzige Frau, die für die Kinder der Grandvilles immer ein offenes Haus gehabt hatte. Alle liebten Tante Fanny weit mehr als meine Mutter.
»Aus dem einfachen Grund«, erläuterte Jack, »weil sie mir alles – bis in jede elende Einzelheit – über Nells Einführung in die Gesellschaft erzählen wird. Den ganzen Roman kenne ich seit unseren letzten drei Begegnungen.«
»Nell hatte großen Erfolg in London, Jack. Sie bekam vier Heiratsanträge!«
»Hat sich alles herumgesprochen«, wehrte Jack ab. »Sogar die Augenfarbe ihrer Verehrer ist mir bekannt.«
Ich mußte mir auf die Lippen beißen, um nicht laut aufzulachen.
Jack ging zu dem Getränkeschrank und goß sich noch ein Glas ein. »Merkwürdigerweise hat Nell keinen Antrag dieser so wünschenswerten Freier angenommen«, meinte Jack, als er sich wieder zu mir umwandte.
Was sollte ich dazu sagen? »Vielleicht hat sie sich aus keinem von ihnen etwas gemacht.«
»Hat sie dir denn gar nichts darüber erzählt?«
Nein, keine Silbe hatte sie mir verraten.
»Na ja, sie ist sicher, daß sie noch andere Anträge bekommt«, erklärte Jack. »In der Stadt heißt es, daß Adam eine beachtliche Mitgift für sie bereithält.«
Die Hunde, die hinter der Tür zum Frühstückszimmer mitleiderregend gejault hatten, begannen jetzt lauthals zu bellen. Resigniert ließ ich sie herein.
»Die allgegenwärtigen Köter«, seufzte Jack, als sie an seinen Füßen schnüffelten und sich seinen Duft einprägten.
»Es sind Spaniels, Jack, keine Köter.«
»Also wirklich, Annabelle, müssen sie mir denn meine ganzen Stiefel versabbern?«
Ich schnalzte mit den Fingern, und die Hunde kamen zu mir.
Jack fragte: »Wer war eigentlich diese Person, die Fanny dazu überredet hat, ihr bei Nells Debüt in der Gesellschaft behilflich zu sein? War das nicht irgend so eine alte übriggebliebene Cousine?«
»Ja.« Während ich mich in meinem Sessel zurücklehnte,
legten sich die Hunde zu meinen Füßen auf den Boden. »Ihr Name ist Dorothy Grandville, und sie lebt in Bath.« Ich beugte mich zu Portia, um ihre langen, seidigen Ohren zu kraulen. »Auch ich habe Fanny angeboten, sie bei den Ereignissen zu unterstützen; aber offensichtlich wollte Fanny mich nicht dabeihaben.«
Meine Enttäuschung wollte ich mir freilich nicht anmerken lassen. Immerhin war Nell für mich beinahe wie eine kleine Schwester. Die ganze Zeit hatte ich angenommen, daß ich bei den für sie neuen Festlichkeiten an ihrer Seite sein würde.
Jack betrachtete mich mit Belustigung in seinen hellen Augen. »Annabelle, Liebling, keine Mutter mit auch nur einem Funken Verstand kann zulassen, daß ihre Tochter ihren ersten Auftritt an deiner Seite inszeniert – aus dem einfachen Grund, weil sie neben dir verblassen würde. Der Zweck der Einführung in die Gesellschaft ist der, daß man auf ein junges Mädchen aufmerksam wird – nicht auf dessen Anstandsdame.«
Merlin stieß die Schnauze gegen meine Hand, und ich ließ Portias Ohren los, um ihn zu streicheln. Eine Antwort erübrigte sich in diesem Zusammenhang.
Jack sprach weiter. »Glaubst du, du könntest Dorothy Grandville dazu überreden, sich in Weston Hall niederzulassen?«
Erstaunt blickte ich auf. »Warum sollte das nötig sein?«
»Damit du eine Anstandsdame hast, nur deswegen«, erwiderte Jack. »Du kannst nicht von mir verlangen, jedesmal bei Adam zu wohnen, Annabelle. Tante Fanny wird mich zur Verzweiflung treiben.«
»Hegst du denn die Absicht, öfter zu kommen, Jack?« fragte ich bissig. »Die Jagdsaison ist vorüber.«
»Auch Stephen wird davon ausgehen, hier wohnen zu können, wenn er nach Hause kommt«, rief mir Jack ins Gedächtnis.
Ich tätschelte Merlin noch einmal, dann faltete ich die Hände in meinem Schoß. »Es steht in den Sternen, ob Stephen überhaupt nach Hause kommt.«
»Gerald ist tot«, sagte Jack. »Natürlich wird Stephen hier erscheinen.«
Hartnäckig starrte ich auf meine Hände im Schoß. »Ja, das muß er wohl. Immerhin ist er der Vormund von Giles.«
»Er wäre sowieso zurückgekehrt, Annabelle«, hielt Jack an seiner Meinung fest. »Und das weißt du ganz genau.«
Ich fühlte, daß ich mich auf gefährlichem Gebiet bewegte, und gab mich absolut unbeteiligt. »Weston ist Stephens Zuhause. Natürlich kann er hier wohnen.«
»Deine Mutter wird sich mit Händen und Füßen dagegen wehren, daß du dich mit Stephen alleine unter einem Dach aufhältst.«
Mir fiel ein, was Mama am Tag der Testamentseröffnung gesagt hatte, und mußte zugeben, daß Jack wahrscheinlich recht hatte.
Mit bitterem Ton in der Stimme erklärte ich: »Ich bin dreiundzwanzig Jahre alt und habe ein bald fünfjähriges Kind; außerdem ist mein Mann noch nicht einmal einen Monat tot. Warum behandelt mich jeder, als wäre ich ein Mädchen, das gerade seine erste Ballsaison erlebt?«
»Du bist doch kein Dummkopf, Annabelle«, entgegnete Jack barsch. »Es kann dir nicht entgangen sein, wie viele Männer liebend gern Geralds Platz einnehmen würden.«
Hinter meinen Schläfen begann es zu pochen, und ich stand auf. »Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, Jack. Ich habe Giles versprochen, mit ihm zusammen zu Mittag zu essen.«
Jack akzeptierte seine Entlassung mit Würde. »Sehr gut, ich werde mich also pflichtschuldigst auf den Weg zum Dower-Haus machen.« Er warf mir einen gepeinigten Blick zu. »Muß ich dort auch essen?«
So hartherzig war ich nun auch wieder nicht. »Nein, komm zum Abendessen her. Und wenn du einen Augenblick wartest, dann schreibe ich schnell eine Einladung an Tante Fanny und bitte auch sie und Adam und Nell zum Dinner.«
Jack verzog das Gesicht, wartete aber, bis ich die paar Zeilen geschrieben hatte. Gemeinsam verließen wir die Bibliothek, und im Flur vor der Treppe stießen wir auf Giles und Miss Stedham.
»Wir haben vor dem Mittagessen im Garten noch etwas frische Luft geschnappt«, erklärte Miss Stedham.
»Miss Stedham, erlauben Sie mir, Ihnen meinen Cousin, Mr. Jack Grandville, vorzustellen«, sagte ich.