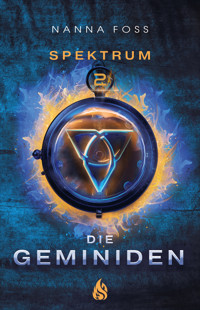17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arctis Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Spektrum
- Sprache: Deutsch
Freundschaft, Liebe, Geheimnisse und eine Zeitreise mit Folgen: »Die Leoniden« ist der fesselnde Auftakt der Fantasy-Mystery-Reihe SPEKTRUM Emilie hat eines Nachts einen seltsamen Traum von einem Jungen mit türkisfarbenen Augen und einem geheimnisvollen Prisma-Amulett. Am nächsten Tag ist sie schockiert, als dieser Junge namens Noah als reale Kopie ihres Traums in der Schule auftaucht. Als sie und fünf andere für eine Gruppenarbeit über das Universum eingeteilt werden, geschehen weitere unerklärliche Dinge, und die Grenzen zwischen Traum und Wirklichkeit verschwimmen zusehends. Die Gruppe sieht sich plötzlich mit übernatürlichen Fähigkeiten, unheilvollen Vorahnungen, einem Zeitreisekompass und dem lebensbedrohlichen Horror Vacui konfrontiert. Emilie versucht verzweifelt, dem Chaos zu entkommen, und muss herausfinden, wer auf ihrer Seite steht – und ob sie überhaupt sich selbst vertrauen kann. »Ohne Zweifel eines der besten YA-Bücher des Jahres.« WEEKENDAVISEN Bd. 2 "Die Geminiden": 12.02.2025 Bd. 3 "Die Ursiden": 10.09.2025
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 574
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Nanna Foss
Spektrum 1: Die Leoniden
Aus dem Dänischen von Alina Becker
Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel
Spektrum 1 – Leoniderne im Verlag Gyldendal, Kopenhagen.
Die Übersetzung wurde gefördert von der Danish Arts Foundation.
Deutsche Erstausgabe
© Atrium Verlag AG, Imprint Arctis, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
© Nanna Foss & Gyldendal, Copenhagen 2020.
Published by agreement with Gyldendal Group Agency
Übersetzung: Alina Becker
Covergestaltung: Franziska Stern @coverdungeonrabbit
unter Verwendung von Motiven von ©cgtrader.com und ©freepik.com
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
ISBN978-3-03880-182-5
www.arctis-verlag.com
Folgt uns auf Instagram unter www.instagram.com/arctis_verlag
EMILIE
1
»Und, Emilie? Wie sehe ich aus?« Alban zieht den Vorhang zur Seite, tritt aus der Umkleidekabine und breitet die Arme aus. Er trägt das dunkelblaue T-Shirt, das ich für ihn ausgesucht habe.
»Ich hatte recht mit der Farbe. Sie betont deine Augen«, sage ich.
»Auf eine positive Art, hoffe ich«, sagt er und lächelt kaum merklich. »Sitzt es okay?« Er dreht sich im Kreis, damit ich alles sehen kann. Der Stoff schmiegt sich an seinen trainierten Oberkörper, ohne zu eng zu sitzen und ihn wie einen Bodybuilder aussehen zu lassen, der aus dem nächstbesten Fitnesscenter entsprungen ist.
»Perfekt. Der V-Ausschnitt steht dir.« Ich werde nach und nach immer besser mit diesem ›Shopping‹, obwohl ich selbst mir das eher selten gönne. Ein paarmal im Jahr die immer selben Secondhandläden aufzusuchen, zählt nicht wirklich.
»Es fühlt sich auch wirklich gut an.« Alban schwingt mit den Armen, um die Elastizität des Stoffes auszutesten. »Ist das reine Baumwolle?«
»Ich glaube schon.«
»Du glaubst?« Er streicht mit dem Zeigefinger über die Naht des einen Ärmels. Über seiner Nasenwurzel bildet sich eine kleine Falte. »Fünfundneunzig Prozent Baumwolle, fünf Prozent Elastan, sage ich. Der Verlierer gibt ein Eis aus.«
»Eis? Im November? Bist du so scharf auf Hirnfrost?«
»Hast du Angst zu verlieren?« Alban hebt eine Augenbraue.
»Pah! Fang ruhig schon mal an, dein Kleingeld zu zählen. Und jetzt dreh dich um!«
Er gehorcht und ich fummele das Etikett aus der Innenseite. Dieses Spiel spielen wir nicht zum ersten Mal, und ich überlege kurz, ob ich inzwischen besser im Lügen geworden bin.
»Und?«, fragt Alban.
»Fünfundneunzig Prozent Baumwolle, fünf Prozent Elastan und fünfzig Prozent Kryptonit. Stoffnerd!«
»Ich glaube, der Stoffnerd hat heute Lust auf Schokoeis.« Er verschwindet wieder in der Umkleidekabine und zieht den Vorhang hinter sich zu. »Wo hast du das graue T-Shirt hingetan?«
»Hängt links am Haken. Und Schokoeis essen nur alte Leute!«
Ich höre das Geräusch eines Kleiderbügels, der gegen die Wand klappert.
»Kann da jemand nicht gut verlieren, meine minderjährige Freundin?« Alban lacht hinter dem Vorhang.
»Von wegen«, gebe ich zurück. »Und mit siebzehn bist du auch noch nicht volljährig, mein Lieber! Immer noch ein Jahr, bis du Zigaretten kaufen und Auto fahren darfst.«
»Dann wird es ja höchste Zeit, dass ich mit dem Rauchen anfange. Und meine Mutter überrede, mich den Führerschein machen zu lassen. Irgendwann muss sie doch mal nachgeben.«
Der Vorhang wird wieder zurückgezogen. Alban steht vor mir, die Arme voller Klamotten; über seinem lilafarbenen T-Shirt trägt er eine Jacke und einen Schal.
Lila passt gut zu seinem dunkelbraunen Haar und seinen stahlblauen Augen. Nicht dass ich Mode-Expertin wäre, aber ich habe einen guten Blick dafür, ob Farben miteinander harmonieren oder nicht. Das kommt ganz von allein, wenn man jeden Tag zeichnet, und genau deshalb hat mich Alban als Co-Pilotin für seine Shoppingtouren engagiert. Selbst wenn er ein Gespür für Stoffe hat, gehören Farben einfach nicht zu seinen Stärken.
Ich nehme seine ausgestreckte Hand.
»Soll ich dir nicht lieber damit helfen?«, frage ich mit einem Blick auf den großen Stoffhaufen über seinem freien Arm.
»Eure zarten Hände sollten nicht durch die unreinen Gewänder eines Plebejers besudelt werden«, erwidert er mit aufgesetzter Empörung.
»Pssst! Wenn du so redest, halten dich die Leute noch für meinen Vater!«, zische ich und ziehe ihn fort vom Umkleidebereich. »Oder für ein Relikt aus irgendeinem vergangenen Jahrhundert.«
»Das Wort Plebejer ist in unserer Sprache völlig zu Unrecht in Vergessenheit geraten«, sagt Alban.
»So wie Taugenichts und Halunke und Hitzkopf und Spitzbube«, ergänze ich. »Früher muss es viel lustiger gewesen sein, Leute zusammenzustauchen.«
»Erinnere mich daran, dass wir dir eine Zeitmaschine besorgen, damit du dich in einem passenden Zeitalter abreagieren kannst.«
»Keine Sorge, die steht schon auf meiner Wunschliste.«
Kurz darauf erreichen wir die Kasse, wo uns eine Verkäuferin mit vielsagendem Lächeln erwartet. Vermutlich liegt es an den Händen. Immer wenn wir uns an den Händen halten, denken die Leute, wir wären ein Liebespaar.
»Ich hätte gerne die hier.« Alban streckt den Arm aus und ich bugsiere den Kleiderhaufen auf den Verkaufstresen.
Die Verkäuferin versucht, Albans Blick auf sich zu ziehen, der starr auf einen Punkt links von ihr gerichtet ist. Dann schaut sie zwischen uns hin und her und ihr Lächeln verblasst.
»Ähm … ja. Klar, selbstverständlich.« Ihre Mundwinkel gleiten wieder nach oben, unsicher. Sie wendet sich an mich. »Ist das ein Geschenk?«, fragt sie.
»Keine Ahnung.« Ich zucke mit den Schultern, obwohl ich die Antwort sehr wohl kenne, und schaue Alban fragend an. »Ich will die Sachen schließlich nicht kaufen.«
Die Verkäuferin holt tief Luft und lehnt sich etwas über den Tresen, um ihre Frage zu wiederholen.
»ISTDASEINGE-SCHE-ENK?« Sie spricht so langsam, deutlich und laut, dass sich ein paar Kunden in der Nähe zu uns umdrehen.
Ich beiße mir auf die Lippe, um nichts zu sagen. Es ärgert mich jedes Mal aufs Neue, wenn wir es mit solchen Leuten zu tun haben.
»Nein. Die sind nur für mich«, antwortet Alban ruhig.
Die Verkäuferin versucht, die Diebstahlsicherungen zu entfernen, sie werden von der durchdringenden blau-weißen Ladenbeleuchtung angeschienen. Sie scannt die Preisschilder und schaut wieder zu Alban.
Er hat bereits seine Karte in das Lesegerät gesteckt und die Fingerspitzen auf die ersten Tasten für seinen PIN-Code gelegt.
»JETZTBIT-TEPINEIN-GE-BEN!« Die Verkäuferin brüllt fast.
»Gerne.« Albans Finger bewegen sich über die winzige Tastatur. »Mit meinen Ohren ist übrigens alles in Ordnung«, bemerkt er und lächelt.
Die Verkäuferin starrt ihn an und erwidert sein Lächeln zwei Sekunden zu spät.
Ich unterdrücke den Drang, ihr die Einkaufstüte aus der Hand zu reißen, lasse sie aber stattdessen einen langen Moment zappeln, bis sie ein paarmal blinzelt und die Tüte Alban entgegenstreckt.
»Vielen Dank«, sagt er. »Einen schönen Tag noch.«
»E-ebenso«, stammelt sie.
Ich schnaube und nehme wieder Albans Hand.
»Wow, was für eine Ziege«, sage ich, als wir draußen auf dem Bürgersteig stehen.
»Die war doch eigentlich ganz nett«, erwidert Alban. »Ich hatte Frostgram ja auch nicht dabei. Das warnt die Leute sonst vor.«
Frostgram, Albans neuester Begleiter, ist nach einem legendären Schwert aus dem Computerspiel World of Warcraft benannt. Das klingt ein bisschen tougher als ›Blindenstock‹. Wer hatte überhaupt die schwachsinnige Idee, dieses Ding als ›Stock‹ zu bezeichnen? Als wären Blinde automatisch lahm oder alt und bräuchten eine Gehhilfe.
»He, mal ganz ehrlich!«, sage ich. »Sobald die Leute einen Rollstuhl oder ein Hörgerät sehen, reden sie mit einem, als wäre man drei Jahre alt. Was denken die eigentlich? Dass dein Kumpel hier bedeutet ›Hallo, ich gehe in den Kindergarten‹, oder was?« Ich tippe mit dem Finger auf das viereckige Zeichen, das an der Vorderseite von Albans Jacke befestigt ist. Es ist blau und zeigt ein weißes Männchen mit einem weißen Stock. Sein Schal muss das Symbol im Laden verdeckt haben.
»Du hast heute ja einen richtig ritterlichen Tag.« Er drückt meine Hand. »Immer bereit, meine Ehre zu verteidigen.«
»Ich meine, das ist halt so typisch. Ich verstehe nicht, wieso du das einfach hinnimmst.«
»Da kann man nicht viel machen. Die Leute wissen es nicht besser. Lächle, und die Welt lächelt zurück.«
»Das sagst du so leicht. Aber es wird längst nicht so viel gelächelt, wie du vielleicht glaubst.«
»Dann ist es ja gut, dass du mit deinem ansteckenden Sinn für Humor die Wolken der Trübsal vertreiben kannst«, sagt Alban und legt die Stirn in ernste Falten.
Ich verpasse ihm einen sanften Knuff gegen die Schulter.
»Hey! Benimm dich, sonst parke ich dich am nächstbesten Laternenpfahl. Da kannst du dann warten, bis Linus zurückkommt.«
Ich schaue mich im dichten Gedränge der Fußgängerzone um. Es ist mitten am Nachmittag, aber die Dämmerung lässt die Schatten zwischen den Häusern bereits tiefer werden. Die Leute erschaudern im eisigen Novemberwind und eilen mit gesenktem Blick und roten Nasen vorbei. Ihr Atem weht wie kleine weiße Fahnen hinter ihnen her.
»Es riecht nach Schnee«, sagt Alban.
Ich schaue nach oben in den steingrauen Himmel.
»Damit könntest du recht haben. Es ist ja auch ätzend kalt.« Ich reibe meine in Fäustlingen steckenden Hände aneinander und werfe noch einen Blick ins Gewimmel. »Wo bleibt er?«
Ich erkenne die Antwort, bevor ich meinen Satz beendet habe.
Vor uns teilt sich die Menschenmenge in zwei Hälften. Durch den Wirrwarr aus Winterstiefeln schiebt sich ein weißer Stock mit einer Gummikugel an der Spitze. Der Stock schwingt rhythmisch wie ein Metronom von einer Seite zur anderen und zeichnet einen unsichtbaren Halbkreis auf die Pflastersteine.
Manche starren weiterhin demonstrativ auf ihre Füße, als würden sie die Störung nicht bemerken. Andere lassen den Blick den schmalen Stock hinaufwandern, über die roten Markierungen und das schwarze Armband, um schließlich an der Person an dessen Ende kleben zu bleiben.
Linus ist einen Kopf kleiner und zwei Jahre jünger als sein Bruder. Er ist außerdem schmächtiger und strahlt immer eine angestaute Energie aus, die ihn neben Albans ruhigen, wohldurchdachten Bewegungen rastlos wirken lässt.
Linus geht in die achte, ich in die neunte und Alban in die zehnte Klasse. Aber obwohl wir über drei Stufen verteilt sind, fühlen sich beide für mich wie Gleichaltrige an. Vielleicht liegt es daran, dass wir drei in Wahrheit alte Seelen in jungen Körpern sind. Das sind die Worte meiner Mutter, und so kann man es wohl auf die nette Art ausdrücken.
Jonathan und seine Gang nennen uns eher Nerds, Loser oder Freaks. An guten Tagen.
Walnussbraune Haarsträhnen und eine große Sonnenbrille schauen unter Linus’ Strickmütze hervor. Nur der untere Teil seines Gesichts ist zu erkennen, und der ist zu einem breiten Grinsen verzogen.
»Warum musst du immer einen auf Stevie Wonder machen, wenn du diese Nummer abziehst?«, frage ich kopfschüttelnd und greife nach seiner Sonnenbrille.
Linus blinzelt. Seine Augenfarbe ist schwer zu bestimmen, je nach Lichtverhältnissen wechselt sie zwischen Staubgrau und Hellgrün.
»Du sollst mich doch nicht verraten, Emilie! Es lief gerade so gut!« Er nimmt mir die Sonnenbrille wieder ab und setzt sie sich schnell auf die Nase. »So ist es viel einfacher und ich kann mich nicht darauf konzentrieren, immer einen leeren Blick aufzusetzen.«
»Weil ja alle Blinden aussehen wie Statisten aus ›The Walking Dead‹. So sind die Regeln.« Alban grinst. Dann reißt er Augen und Mund auf, streckt die Arme vor sich aus und lässt die Handgelenke baumeln. »Grrrraaaaaahhh!«
»Hör auf, Alban! Die Leute gucken!« Ich verkneife mir ein Kichern und greife nach seinem Arm.
»Komm runter, du Amateur-Zombie«, sagt Linus. »Du hast gerade ein paar alte Damen auf dem Bürgersteig gegenüber zu Tode erschreckt.« Er reicht den Stock an Alban weiter, der ihn prüfend vor sich über den Boden gleiten lässt.
»Frostgram ist leichter zu navigieren, findest du nicht?« Alban wiegt den weißen Stock in der Hand.
»Definitiv«, sagt Linus. »Aber Kohlefaser ist auch nicht so schwer wie Aluminium. Und bestimmt lässt sich der hier auch besser falten als der alte. Bei Excalibur haben die Gelenke immer irgendwie geklemmt.«
»Stimmt«, bestätigt Alban. »Diese Mobility-Stöcke aus Kohlefaser sind noch ganz neu.« Er klopft vorsichtig mit der Gummikugel an der Spitze auf das Pflaster. »Vielleicht war es ja Glück im Unglück, dass ich auf dem Bürgersteig ausgerutscht bin und Excalibur verbogen habe.«
»Wir halten sein Andenken in Ehren«, sagt Linus geschwollen.
Er besteht immer darauf, Albans neue Blindenstöcke einzuweihen. Und ihnen selbstverständlich Namen zu geben. Bis jetzt wurden alle nach berühmten Schwertern benannt. Linus freut sich jetzt schon auf den nächsten in der Reihe, obwohl er sich noch nicht entschieden hat, ob er ein Orcrist oder ein Gram wird. Das hängt davon ab, wer dann gerade angesagter ist: Tolkien oder die Helden der nordischen Sagen.
Linus’ Einweihungsritual hat sich nach und nach zu einer regelrechten kleinen Feldstudie entwickelt.
›Ein echter Wissenschaftler nimmt nichts in Gebrauch, ohne es vorher getestet zu haben‹, pflegt er zu sagen. Das bedeutet, dass er mit hinter einer Sonnenbrille geschlossenen Augen über die Bürgersteige flaniert, bevor Alban den neuen Stock überreicht bekommt. Das hat ihm selbst und anderen im Laufe der Zeit so einige blaue Flecke eingebracht.
Obwohl ich mein Grinsen über sein Gehabe kaum zurückhalten kann, versetzt es mir trotzdem jedes Mal einen Stich ins Herz, wenn er die Brille wieder abnimmt und seinen großen Bruder den Stock an sich nehmen lässt.
Für Linus ist es nur eine Rolle. Für Alban ist es die Realität. Jeden Tag.
Manchmal wünsche ich mir, dass Alban den verfluchten Stock nicht bräuchte. Dass er sich nicht andauernd mit dem vielsagenden Schweigen von Verkäufern oder Leuten auf der Straße auseinandersetzen müsste, die seinen rot-weißen Gehilfen sehen, bevor sie Alban sehen. Die ihm den Bedauernswert-Stempel aufdrücken, bevor sie auch nur ein Wort mit ihm gesprochen haben.
Ich habe mich noch nie dafür geschämt, mit Alban unterwegs zu sein, aber manchmal schäme ich mich für die Rücksichtslosigkeit anderer. Wenn die Leute fragen, ob Alban allein auf die Toilette gehen kann, bekomme ich Lust, die Frage an sie zurückzugeben.
Ob blind oder nicht, Alban ist der tougheste Mensch, den ich kenne. Das würde ich allen, die ihm merkwürdig hinterherstarren, gerne erzählen.
Nur den Mädchen nicht. Denn deren Blicke sind etwas anderem geschuldet. Alban ist seit der Vorschule mein bester Freund, aber auch mir ist nicht entgangen, weshalb sich die meisten Mädchen in unserem Alter nach ihm umdrehen.
Hätte er nicht vor zwölf Jahren diese Hirnhautentzündung gehabt, die seinen Sehnerv zerstörte, hätte ich ihn bestimmt nicht für mich allein. Die verstohlenen Blicke und das gedämpfte Gekicher der Grüppchen, die an uns vorbeilaufen, bestätigen das. Keines dieser Mädchen geht auf unsere Schule. Sonst würden sie kaum versuchen, Blickkontakt mit ihm aufzunehmen und verschiedene Variationen des verführerischen Schmollmundes, flirtenden Seitenblicks und sexy Langhaarwurfs anzubieten.
»Zombies stehen offenbar hoch im Kurs«, sagt Linus und schenkt dem Rudel Mädchen, die seinen großen Bruder gerade mit ihren Blicken ausgezogen haben, ein breites Lächeln. Sie schielen auf Linus’ riesige Sonnenbrille und eilen davon.
Alban lässt sich nichts anmerken, obwohl er zweifellos ihr übermütiges Flüstern gehört haben muss, als sie vorbeihuschten. Er muss einen besonderen Schutzschild haben, der ihn vor solchen Dingen abschirmt.
Mein Blick fällt auf die Tragetasche, die Linus in der Hand hält. Etwas Großes und Viereckiges steckt darin, und zwischen den Griffen lugt blaues Geschenkband hervor.
»Ist das …?«, deute ich lautlos an.
Linus nickt und legt einen Finger auf die Lippen. Es war seine Aufgabe, unser gemeinsames Geburtstagsgeschenk für Alban zu kaufen, während ich das Geburtstagskind mit Powershopping abgelenkt habe.
»He.« Ich spüre etwas Kaltes auf meiner Wange und lege den Kopf in den Nacken. Der Himmel ist dunkelgrau geworden und vereinzelte Schneeflocken rieseln herab. »Es fängt an zu schneien. Wollen wir nicht nach Hause gehen? Meine Zehen fallen bald ab!«
»Hast du nicht etwas vergessen?«, fragt Alban.
»Ach ja. Dir soll an deinem Geburtstag doch auf keinen Fall dein wohlverdienter Hirnfrost entgehen«, sage ich.
Linus hebt eine Augenbraue über das Glas der Sonnenbrille.
»Dein Bruder hat das Recht, seinen Hirnstamm zu vereisen, weil er Baumwollmischgewebe paukt, während wir Normalsterblichen schlafen«, erkläre ich.
»Fett«, sagt Linus, als würden meine Worte total Sinn ergeben.
»Wir können auf dem Weg zu euch Eis im Supermarkt kaufen. Dann schmilzt es uns nicht.« Ich biete Alban meinen Ellbogen an und wir gehen zur Bushaltestelle am Ende der Straße.
»Schmelzen? Bei zehn Grad minus?« Linus zieht den Reißverschluss seiner Jacke bis unters Kinn.
»Ja, was ist nur mit dem Wetter los?« Der kalte Wind schmerzt auf meiner Haut und bringt meine Augen zum Tränen. Ich ziehe mir meinen riesigen Schal über Mund und Wangen und die Kapuze tief über die Stirn. Bestimmt sehe ich wie eine Mumie aus, die beim Mullbinden-Ausverkauf Amok läuft, aber ich hasse die Kälte ebenso sehr wie voreingenommene Idioten.
»Puh, muss kalt sein, da zu sitzen.« Linus nickt in Richtung eines zusammengekrümmten Bündels, das sich eng an die Schaufensterfront eines Geschäfts drückt.
»Da sitzt jemand auf dem Gehweg«, erkläre ich Alban. »Bestimmt ein Obdachloser«, füge ich hinzu, als mir das braune Stück Pappe vor der Gestalt ins Auge fällt. Ich bin zu weit weg, um die Buchstaben darauf entziffern zu können.
»Warte kurz.« Alban bleibt stehen und kramt in seiner Tasche herum. Er findet einen Fünfzig-Kronen-Schein und ein paar Münzen. »Mehr habe ich leider nicht«, sagt er und reicht mir das Geld.
Wir treten näher heran.
Das Bündel entpuppt sich als eine Frau mit strähnigem grauen Haar. Ihre Strumpfhose, die mit dunklen Flecken übersät ist, war irgendwann vielleicht einmal weiß oder pastellfarben. Sie trägt ein Paar ausgetretene Herrenschuhe und einen zerschlissenen geblümten Rock. Ihre Jacke ist einige Nummern zu groß und ihre Haut sehr runzlig.
Niemand außer uns bleibt stehen oder sieht auch nur in ihre Richtung.
Die Frau scheint uns noch nicht bemerkt zu haben, obwohl wir keine zwei Meter von ihr entfernt sind. Sie sitzt dort und wippt roboterartig hin und her, völlig versunken in ihrer eigenen Welt.
Ich zögere und schaue auf das Pappschild hinunter.
DAS ENDE IST NAH! steht dort in krakeligen Buchstaben.
Ich dachte immer, solche Weltuntergangsverkünder gäbe es nur im Film. Wenn sie jetzt nur nicht anfängt, einen Vortrag zum Jüngsten Gericht zu halten.
Ich mache einen unentschlossenen Schritt auf die Frau zu. Sie reagiert noch immer nicht. Aus der Nähe kann ich hören, dass sie irgendetwas vor sich hinmurmelt. Soll ich ihr einfach das Geld hinlegen und verschwinden? Ich gehe vor dem Pappschild in die Hocke.
Auf meine Bewegung hin hebt sie den Kopf und ich blicke in ein Paar wässrige Augen mit einem weißgräulichen Schleier über den Pupillen. Es besteht kein Zweifel daran, dass sie blind ist.
Trotzdem öffnet sich ihr Mund zu einem runden, geräuschlosen Schrei, der den Blick auf faulige Zahnstümpfe freigibt. Als hätte ich sie erschreckt.
Als könnte sie mich sehen.
Sie richtet ihren milchigen Blick auf Alban und Linus hinter mir. Ihr Gesichtsausdruck wechselt von Schrecken über Ungläubigkeit bis hin zu etwas, das ich nur als blankes Entsetzen beschreiben kann.
»Ihr!«, krächzt sie.
Habe ich sie etwa schon einmal gesehen?
»Ich wollte nur …«, setze ich an.
»Ihr seid das!«, ruft sie mit brüchiger Stimme. »IHR seid das!«
Nein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich sie noch nie gesehen habe.
Ich werfe einen Blick über die Schulter. Alban und Linus stehen reglos da, wie durch ihren plötzlichen Ausbruch am Boden festgenagelt.
»Es ist so weit!« Das Geschrei der Frau zieht neugierige Blicke an. »Er kommt!Jetzt ist es so weit!« Sie streckt mir einen knorrigen Zeigefinger entgegen und senkt die Stimme zu einem theatralischen Flüstern. »Und das ist eure Schuld!«
»Was kommt?«, frage ich, ganz irritiert darüber, plötzlich zu einer unfreiwilligen Statistin in ihrer Weltuntergangspredigt geworden zu sein. Ich mache Anstalten, wieder aufzustehen, aber sie erwischt mich am Arm und greift zu. Fest. Ich lasse das Geld fallen und verliere beinahe das Gleichgewicht.
Sie klammert sich an mir fest und zieht sich so nah an mich heran, dass ich alten Schweiß riechen kann.
»Horror Vacui. Es ist so weit.Und er findet euch. Ihr könnt nichts machen! ER FINDET EUCH!« Ihre knöchrigen Finger bohren sich mit erstaunlicher Kraft in meinen Oberarm.
»Aua, nicht!«
»Hey, lassen Sie sie los!«, höre ich Linus’ Stimme an meiner Seite. Er greift nach der Schulter der Frau und drückt uns auseinander. Er schiebt noch nicht einmal sonderlich fest, aber die Frau taumelt rücklings gegen die Wand und ich lande hart auf meinem Hintern.
Mit Mühe rappele ich mich auf, mein Steißbein schmerzt nach der plötzlichen Begegnung mit den Pflastersteinen.
Linus legt das Geld auf das umgekippte Pappschild. Er behält die Frau dabei aufmerksam im Auge.
Sie ist wieder in sich zusammengesunken und murmelt vor sich hin. Der knochige Körper schwankt von einer Seite zur anderen, stärker als zuvor.
»Wir haben Ihnen etwas Geld auf Ihr Schild gelegt«, sagt Linus, aber die Frau antwortet nicht. Er wirft mir einen Blick zu und zuckt mit den Schultern.
Hinter ihm nehme ich eine wohlbekannte gelbe Silhouette in der Dämmerung wahr.
»Der Bus!«, platze ich heraus.
Linus wirbelt herum und läuft mit wild fuchtelnden Armen zur Haltestelle, um die Aufmerksamkeit des Fahrers auf sich zu lenken.
Der Bus kommt mit kreischenden Bremsen zum Stehen und ich drehe der merkwürdigen alten Frau den Rücken zu und greife nach Albans Hand, dann machen wir uns auf den Weg zur Straße.
2
»Der Obdachlosen da ging es bestimmt nicht so gut, was?«, sagt Linus, als wir uns im schmalen Flur seines Zuhauses den Schnee von den Stiefeln klopfen. Die Fahrt im vollen Bus zum Wohnblock, in dem Alban und Linus leben, haben wir schweigend verbracht, aber ich bin offensichtlich nicht die Einzige, der die Szene aus der Fußgängerzone nachhängt.
»Ach, findest du?«, frage ich. »Ist doch ganz normal, irgendwelche Leute auf der Straße mit Weltuntergangsgeschwafel zu überfallen.«
»Was hat sie noch gesagt?« Alban hängt seine Fäustlinge zum Trocknen auf die Heizung und beugt sich vor, um seine Stiefel aufzuschnüren.
»Er kommt!Jetztist es so weit!«, sage ich mit Gruselfilmstimme.
»Und offenbar ist das unsere Schuld«, ergänzt Linus.
»Was ist unsere Schuld? Das Jüngste Gericht, oder wie?« Alban zieht sich die Stiefel aus.
»Ne, ne. Horror Vacui«, sage ich. »Aber das muss wohl ebenso brutal sein.«
»So brutal wie der Weltuntergang? Dann sollte ich wohl möglichst bald auf meinem Schokoeis bestehen«, sagt Alban.
»Oh nein, wir haben das Eis vergessen!«, stöhne ich.
»Macht nichts.« Er richtet sich auf und wedelt abwehrend mit der Hand. »Mama hat Torte gebacken. Wir brauchen fürs Erste also keinen Zuckerentzug zu befürchten.«
»Das glaube ich auch nicht.« Sandra, Linus’ und Albans Mutter, steckt den Kopf in den Flur. Sie ist eine schmächtige Frau mit silbernen Strähnen in ihrem dunkelbraunen Haar und zu vielen Sorgenfalten für ihr Alter. Die Farbe ihrer sanft dreinblickenden Augen ist eine Mischung aus Linus’ Graugrün und Albans kühlem Blau. »Hallo, Jungs. Hallo, Emilie.« Sie schenkt mir ein herzliches Lächeln. Ich verbringe so viel Zeit in ihrer kleinen Wohnung, dass sie mich quasi als ihr drittes Kind ansieht.
Wäre ihr Mann nicht kurz nach Linus’ Geburt an Krebs gestorben, hätte sie vielleicht noch eine eigene Tochter bekommen. So abgöttisch, wie sie ihre beiden Söhne liebt, hätte sie sicher genug Liebe für eine große Kinderschar übriggehabt.
»Hallo, Sandra.« Ich erwidere ihr Lächeln und greife nach dem Putzlappen, der über der Heizung hängt, um die Schneepfützen aufzuwischen.
»Ich hole gleich Albans Geschenk. Das Essen ist jeden Augenblick fertig, ihr könnt also schon mal den Tisch decken.« Sandra verschwindet durch die Tür zu ihrem kleinen Schlafzimmer.
Wir anderen gehen in die Küche, wo das Geburtstagsessen gerade Gestalt annimmt. Neben dem Spülbecken liegt eine mit Reis verklebte Sushimatte und eine offene Packung Noriblätter. Auf der Kaffeemaschine balanciert ein großer Teller mit bereits zubereiteten Sushistücken. Überall liegen gebrauchte Messer, Schneidebretter und Schüsseln zwischen leeren Plastiktüten und Avocadoschalen, sodass man die Arbeitsfläche darunter nicht mehr sehen kann.
»Hier zu Hause ist offenbar auch Horror Vacui angesagt«, sage ich.
»Das gibt es also wirklich?«, fragt Linus. »Ich dachte, das wäre nur Blödsinn gewesen.«
»Horror Vacui ist ein Begriff aus der bildenden Kunst«, erkläre ich. »Wenn man versucht, ein Papier oder eine andere Oberfläche komplett auszufüllen. Es bedeutet ›Angst vor dem leeren Raum‹.«
»Drohen diese Weltuntergangspropheten nicht eigentlich mit Sintfluten, Seuchen und dem ewigen Fegefeuer?«, fragt Linus. »Die Angst vor dem Nichts wirkt dagegen irgendwie ziemlich zahm, oder?«
»Bei ihr klang es wirklich übel.« Ich schüttele verwirrt den Kopf, um die angsterfüllten Augen der Frau von meiner Netzhaut zu verbannen.
Ihre merkwürdigen weißen Augen.
»Glaubst du eigentlich, dass sie blind war, Linus?«, frage ich.
»Ähm … du nicht?« Er holt ein paar saubere Teller aus der Spülmaschine.
»Ihre Iris und Pupillen waren ganz verschwommen.« Ich ziehe die Besteckschublade auf und nehme das Bündel Essstäbchen heraus. »Aber es schien, als könnte sie mich trotzdem sehen. Sie wirkte völlig erschrocken, obwohl ich kein Wort gesagt habe.«
»Vielleicht hat sie deinen Atem gehört und den Kopf zum Geräusch hingedreht«, sagt Alban. »Man muss die Leute nicht immer sehen können, um zu wissen, wo sie sind.« Er zwinkert in meine Richtung und öffnet den Kühlschrank, um die Flasche mit kaltem Wasser herauszuholen.
Ich fingere Essstäbchen für vier heraus und lege den Rest zurück in die Schublade.
»Aber … sie hat immer wieder ›ihr‹ gesagt, so als hätte sie nicht nur mich angesprochen. Und sie hat auch auf dich und Linus gezeigt.«
»Sie hat bestimmt unsere Schritte gehört, als wir uns ihr genähert haben«, sagt Alban. »Oder vielleicht hatte sie auch nur irgendeine Erscheinung. Es klang ja nicht wirklich so, als hätten wir uns in derselben Realität befunden.«
Alban hat sicherlich recht. Aber warum bereitet mir jeder Gedanke an sie immer noch Gänsehaut?
Sandra kommt mit einem großen Geschenk in den Armen zurück in die Küche.
Ich knalle die Schublade zu und schüttele das Unbehagen ab.
»Also, Alban, du alter Knacker«, sage ich laut. »Willst du die Geschenke vor oder nach dem Essen haben?«
Als ich kurz nach Mitternacht in Albans und Linus’ mikroskopisch kleinem Badezimmer stehe und mir die Zähne putze, fühle ich mich ganz benommen. So ist das eben nach drei Stunden ›Bezzerwizzer‹ mit einer Gruppe Hardcore-Nerds.
Linus und ich haben die De-luxe-Version mit dem Xylofon gekauft, und Alban hat einen tapferen, aber vergeblichen Kampf gegen unser nicht vorhandenes musikalisches Gehör ausgefochten. Glücklicherweise musste Sandra los zur Nachtschicht im Pflegeheim, bevor wir richtig mit dem Spielen loslegten.
Obwohl Linus uns bei allen Fragen zu Logik und Zahlen abzog und ich in der Kategorie ›Literatur und Sprache‹ punkten konnte, war es dennoch Alban, der aus einem nervenaufreibenden Finale als Sieger herausging. Linus und ich setzten alles darauf, dass er nicht wusste, wer die Fußball-WM1994 gewonnen hatte. Brasilien war definitiv ein reiner Glückstreffer. Hätte ich gewusst, dass Christiania im Jahr 1971 gegründet worden war, hätte ich die entscheidende Runde gewonnen, aber ›Geschichte‹ ist nicht gerade meine Stärke.
Ich spüle mir den Mund aus und stelle meine Zahnbürste zurück an ihren festen Platz im Becher. Ich übernachte oft bei Alban und Linus. Offiziell, weil es so praktisch ist, dass sie direkt gegenüber der Schule wohnen. Aber inoffiziell, weil es hier so wunderbar friedlich ist, im Gegensatz zu meinem Zuhause. Ich liebe meine Familie, aber die Ruhe, die ich hier finde, gibt es mit fünf Kindern unter einem Dach und einem laufend wechselnden Bestand an Tieren einfach nicht.
Meine braunen Augen sehen in dem schwachen Licht fast grau aus. Ich löse meinen geflochtenen Zopf, entwirre die schlimmsten Knoten mit den Fingern und flechte meine Haare erneut. Sie sind schlammfarben und reichen mir bis knapp unter die Schulterblätter. Ich trage sie immer geflochten, weil ich keine Ahnung habe, was ich sonst damit anfangen soll, so glatt, wie sie sind.
Der Pullover wird durch ein unförmiges T-Shirt-Nachthemd ersetzt, aber ich behalte meinen BH darunter an. Mit BH zu schlafen, kann die Durchblutung stören und die Brüste stark verformen, aber ich verstecke meine winzigen, spitzen Mückenstiche am liebsten, so gut es eben geht. Die Spätpubertät ist ätzend, wenn alle anderen Mädchen in der Klasse schon ordentlich Holz vor der Hütte haben.
Meistens versuche ich zu vergessen, dass ich einen Körper habe. Hülle mich in möglichst viele Schichten Stoff, wie eine verpuppte Larve, und hoffe, eines Tages wie ein anmutiger Schmetterling ins Licht herauszubrechen. Aber die Enttäuschung ist jeden Abend immer wieder groß, wenn die Stoffhülle fällt und zeigt, dass ich immer noch knochige Knie und schlaffe Haut am Bauch habe.
Ich strecke der Larvenvisage im Spiegel die Zunge heraus und sammle meine Jeans und meinen Pullover vom Fliesenboden auf.
Alban sitzt auf dem Bett und stimmt seine Gitarre, als ich das Zimmer betrete. Er trägt ein T-Shirt und eine Schlafanzughose und runzelt die Stirn unter den halblangen Haaren. Er muss die Nacht nicht in einem Kokon verbringen, um perfekt zu sein.
Sein Anblick mit der abgegriffenen ockerfarbenen Gitarre ist zu einem festen Teil meines Lebens geworden, seit wir uns vor etwa einem Jahrzehnt kennengelernt haben. Die Bettdecke unter ihm ist verblichener, seine Finger länger und geschickter bei den komplizierten Griffen, aber seine Körperhaltung ist dieselbe geblieben. An die Wand am Kopfende des Bettes gelehnt, ein Bein ausgestreckt, das andere angewinkelt in einem halben Schneidersitz.
Ich schalte das Licht aus und schlüpfe unter die Bettdecke. Alban rutscht ein Stück in Richtung Wand, um auf dem schmalen französischen Bett Platz zu machen.
»Wenn ich ganz nett frage, singst du mir dann ein Gute-Nacht-Lied?« Ich unterdrücke ein Gähnen.
»Da musst du aber wirklich, wirklich nett fragen«, sagt Alban. Im Schein der Straßenlampe vor dem Fenster sehe ich, wie er eine Saite spannt, bevor er sie erneut anschlägt.
»Lieber, kluger, fantastischer Alban … bitte sing doch ein klitzekleines Gute-Nacht-Lied für deine arme minderjährige Freundin.« Ich versuche, meinen Hundeblick in Schallwellen umzuwandeln, und sehe, wie einer von Albans Mundwinkeln zuckt.
»Wenn die minderjährige Freundin im Gegenzug verspricht, sich anschließend schlafen zu legen.«
»Ich glaube, sie hat leider keine Wahl.« Diesmal übernimmt das Gähnen auf der Hälfte des Satzes und dehnt die Wörter zu wenig charmanten Kehlkopflauten.
»Was willst du hören?«
»Such du aus«, sage ich, kuschle mich an ihn und schließe die Augen.
Alban sitzt einen Augenblick schweigend da. Dann schweben die sechs charakteristischen Töne des Intros von ›Nothing Else Matters‹ in die Schatten um uns herum.
Ich lächle, als Alban anfängt zu singen und sich seine Stimme um die langsame Melodie der Gitarre legt und den Rest der Welt ausblendet.
Ich muss nicht hinsehen, um zu wissen, dass er die Augen beim Singen geschlossen hat. Das hat er auch als Kind schon so gemacht, hat Sandra mir erzählt. Damals, als es noch einen Unterschied gemacht hat, ob seine Augen offen oder geschlossen waren. Aber es hilft ihm trotzdem, die Musik intensiver zu spüren, sagt er.
Er singt den Song so leise und sanft wie ein Wiegenlied, ganz ohne die raue, verhaltene Heavy-Metal-Energie von Metallica. Ein kalter Schauer des Wohlbefindens kitzelt mich im Nacken und an den Armen, bevor ich mich vom Schlaf einhüllen lasse.
3
Das Gefühl der Angst ist überwältigend, schon bevor ich die Augen öffne.
Die Leuchtstoffröhre über mir taucht alles in neonweißes Licht und bereitet mir Kopfschmerzen.
Ich liege auf dem Boden. Er ist kalt und feucht. Mein Herz klopft heftig hinter meinen Rippen, wie ein Alien, der versucht, sich zu befreien.
Über meinem Gesicht schwebt ein gebogenes Metallrohr vor einer glänzenden weißen Oberfläche.
Ich müsste wissen, was das ist. Ich habe so etwas schon einmal gesehen. Aber die anschwellende Panik lässt keinen klaren Gedanken zu.
Die Wände reflektieren das Neonlicht. Weiße, mit Buchstaben beschriebene Kacheln. Eine Art Behälter steht auf dem Boden neben mir, gefüllt mit zerknülltem Papier.
Ein Siphon. So heißt dieses Metallrohr. Ich liege unter einem Waschbecken.
Wie bin ich hier gelandet?
Ich versuche, mich zu bewegen, versuche, mich an etwas zu erinnern, aber es gelingt mir nicht. Sowohl Körper als auch Gehirn sind außer Reichweite, eingehüllt im Grauen.
Ich weiß, dass etwas Schreckliches passiert ist. Und dass etwas noch Gefährlicheres im Anmarsch ist. Aber ich habe keine Ahnung, was es ist.
Mein willenloser Körper starrt zum Waschbecken hinauf, während das außerirdische Wesen in meinem Brustkorb um sein Leben kämpft.
Unter dem Waschbecken hängt ein Tropfen. Er löst sich und fällt in Zeitlupe herunter auf mein Gesicht. Ich warte auf das leise Geräusch, das er von sich geben wird, wenn er mich zwischen den Augen trifft, aber es kommt nichts. Der Tropfen ändert seine Richtung und schwebt an meinem Körper vorbei.
Etwas bewegt sich am Rand meines Sichtfeldes. Mein Blick flackert in dem schmerzenden Licht umher, aber da ist nichts zu sehen. Ich bin vollkommen allein.
Ich erkenne, dass das Licht sich bewegt. Es wird langsam aus dem Raum gesogen. Oder vielleicht liegt es auch an den Schatten, die über die Wände kriechen und auf ihrem Weg den Boden, die Decke und das Waschbecken fressen.
Die Fugen zwischen den weißen Fliesen erwachen zum Leben. Sie wellen sich im schwindenden Licht, als wäre ich betrunken, und sie werden in dieselbe Richtung gezogen wie der Tropfen.
Die Dunkelheit überflutet mich.
Die Angst ist nun so stark, dass sie physisch schmerzt. Oder vielleicht war der Schmerz auch die ganze Zeit da.
Vielleicht sterbe ich gerade.
Ich kann nicht mehr denken.
Meine Augen sind weit aufgerissen, aber ich kann nichts sehen. Mein Mund öffnet sich zur Gegenwehr. Der Schrei zerrt an den Stimmbändern, Hals und Kopf tun weh, aber ich kann mich selbst nicht hören, und ich kann die Dunkelheit nicht übertönen.
Als die Schatten über mir zusammenfließen und die letzten krummen Linien verwischen, spüre ich nichts mehr. Selbst der Schmerz ist verschwunden.
Das Nichts ist ein Vakuum, das die Erinnerungen und die Gefühle und das Leben aus mir heraussaugt.
Vielleicht bin ich bereits tot.
Der Schrei bricht aus mir heraus und ich schrecke aus dem Schlaf. Die namenlose Angst überdauert wie ein klebriger Abdruck im Hirn.
Ich sehe mich verstört um. Die blassgelben Lichtfinger der Straßenlaterne umschmeicheln die Umrisse der Möbel in Albans Zimmer. Mein Herz pocht wie wild unter meinem T-Shirt, das feucht ist von Schweiß.
Ich ziehe die Knie bis unters Kinn und schlinge die Arme fest darum. Die Unruhe in meinem Körper zeigt sich in einer sanften Schaukelbewegung. Ich lege die Stirn an die Knie, schließe die Augen und versuche, ruhig Luft zu holen.
Erst als ich mich auf meine eigene Atmung konzentriere, bemerke ich Albans. Das Ein- und Ausatmen folgt zu schnell aufeinander, als würde er hyperventilieren.
Ich drehe mich zu ihm um.
Er liegt auf dem Rücken. Ein Lichtstreifen auf seinem Gesicht zeigt, dass seine Augäpfel sich hektisch hinter den geschlossenen Lidern bewegen, und sein Atem geht geräuschvoll und schwerfällig. Er stößt einen gequälten Laut aus und krallt sich mit einer Hand im Kissen fest. Die andere schlägt um sich und schlägt mit einem dumpfen Knall gegen die Wand.
Hat er so etwas wie einen Anfall? Der Gedanke lässt die Angst aus dem Traum wieder in mir aufsteigen, ein eisiger Hauch im Herzen.
»Alban!« Ich schüttele ihn, und er schlägt die Augen auf und schnappt nach Luft.
Einen Moment lang wirkt es, als starrte er mich an, aber dann legt er einen Unterarm über sein Gesicht und stößt ein tiefes, zittriges Seufzen aus. Die Vertiefung zwischen seinen beiden Schlüsselbeinen glänzt vor Schweiß.
»Hattest du einen Albtraum?«, frage ich und lege eine Hand auf seine Schulter.
Er nickt unter seinem Arm, atemlos.
»Ja.«
»Ich auch. Wir hatten bestimmt zu viel Torte.« Ich versuche, ein Lachen zustande zu bringen.
»Boah«, sagt er und wischt sich mit einem Ende der Bettdecke über die Stirn. »Ich weiß gar nicht mehr, wann ich zuletzt so schlecht geträumt habe.«
Ich wünschte, ich könnte dasselbe sagen. Aber es wäre wohl zu viel verlangt, von seinen Quälgeistern verschont zu bleiben, wenn man schläft.
Ich schmiege mich wieder an Alban und er breitet einladend die Arme aus. Unter dem vertrauten Duft von frischem Schweiß und seinem Deo weicht das klaustrophobische Gefühl allmählich aus meinem Körper.
Ich lege einen Arm über seine Brust und den Kopf auf die weiche Stelle unter seinem linken Schlüsselbein. Ich spüre seinen dumpfen, beständigen Herzschlag an meinem Ohr und an den Fingerspitzen, als ich wieder einschlafe.
Wieder Dunkelheit. Mein Herz beginnt zu rasen und ein Schrei formt sich tief in meiner Kehle.
Aber die Dunkelheit ist diesmal eine andere. Sie ist weniger dicht. Dreidimensionale Gebilde tauchen auf und verjagen die Panik, bevor sie Wurzeln schlagen kann.
Ein Bürostuhl mit einem Loch in der Rückenlehne. Ein wackeliger Bücherstapel. Ein Stativ mit einem riesigen weißen Zylinder.
Anders als im letzten Traum stehe ich jetzt aufrecht und kann mich bewegen. Meine Schritte hallen in dem finsteren Raum wider, als wäre die Decke sehr hoch und die Wände weit entfernt.
Ein Kälteschauer fährt mir über den Rücken. Die Angst, dass das Nichts zurückkehren könnte, sitzt mir im Nacken, aber das ist nicht der einzige Grund für mein Zittern. Beim Ausatmen bilden sich weiße Wolken vor mir.
Ein schwacher Lichtschein nahe am Boden weckt meine Aufmerksamkeit. Ich schaue nach unten und stelle fest, dass das Licht nicht von dort kommt, sondern von mir selbst.
Meine Handflächen leuchten violett. Ich halte sie mir vor das Gesicht. Meine Hände kribbeln, als wären sie eingeschlafen, und sie fühlen sich brennend heiß an.
Ein niederfrequentes Brummen setzt gleichzeitig mit dem violetten Leuchten ein. Es summt in meinen Zahnwurzeln.
Ich drehe die leuchtenden Handflächen nach außen, um die Lichtquelle zu suchen.
Der Boden besteht aus breiten Dielen und verschwindet fast vollständig unter einer sonderbaren Landschaft aus Kisten, Büchern, losen Papierbögen und etwas, das nach großen Landkarten aussieht.
Ich lege den Kopf in den Nacken, aber anstatt zu einem dunklen Deckengewölbe, starre ich zu einem funkelnden Sternenhimmel hinauf. Die Decke besteht aus viereckigen Glasscheiben, wie die Wände eines Gewächshauses.
Eine Sternschnuppe saust über den Himmel, dicht gefolgt von einer weiteren. Und plötzlich wird die sternenbestickte Decke über mir von Myriaden von Lichtblitzen übersät, die die Dunkelheit aufreißen.
Meine Hände brummen noch stärker und das Violett lodert auf, als hätte ich die Finger in Anzünder getaucht. Meine pulsierenden Handflächen und die herabstürzenden Sterne sind die einzigen Lichtquellen im Raum. Als ich die Augen schließe, zeichnen die Sternschnuppen glühende Spuren auf die Innenseiten meiner Lider.
Ich öffne die Augen erneut.
Und schreie.
Mehr vor Schrecken als aus Furcht.
Eine schlaksige Gestalt hat sich aus dem Schatten gelöst und steht jetzt direkt vor mir.
Es ist ein Junge in meinem Alter, etwas größer als ich. Er hat zwei Silberringe in der Unterlippe, Piercings in den Ohren und schwarzes, zerzaustes Haar, das ihm in die Augen fällt.
Die Augen des Jungen haben dieselbe Farbe wie das Wasser über den Korallenriffen, die man von Postkarten kennt. Ein Zwischending aus Türkis und klarem Hellgrün. Sein Blick ist so intensiv, dass die Hitze unter meiner Gänsehaut hochkocht.
Um den Hals trägt er eine Schnur mit einem dreieckigen Anhänger. Er ähnelt einem Kristall oder klarem Glas, eingefasst in einen verschnörkelten Metallrahmen.
Der Junge hebt eine Hand und zeigt auf etwas in ein paar Metern Entfernung. Seine Handfläche leuchtet in kräftigem Türkis. Fast in derselben Farbe wie seine Augen.
Ich folge der Richtung seines türkisfarbenen Zeigefingers und sehe einen großen Umzugskarton mit Symbolen an der Seite. Einen Stern und die Buchstaben MV.
Mir wird klar, dass das Brummen aus diesem Karton kommt.
Ich schaue den Jungen wieder an. Er hat seine Halskette abgenommen. Der Glasanhänger baumelt zwischen uns an der Schnur. Er pulsiert mit einem klaren weißen Licht.
Ohne Vorwarnung schießt ein Lichtstrahl aus dem Glas und trifft den Karton. Das Licht ist nicht mehr weiß, sondern bunt wie ein Regenbogen.
Der Brummlaut schwillt an. Die Wärme in meinen Händen nimmt zu, genau wie die violette Farbe.
Der Junge schaut mich an, den Kopf leicht zur Seite geneigt. Dann lächelt er. Ein schiefes, spöttisches Lächeln, das mich wie ein elektrischer Schlag unterm Solarplexus trifft.
Der unerwartete Haken in die Magengrube kitzelt, als ich die Augen aufschlage.
Alban schläft noch. Sein Puls unter mir ist langsam und ruhig, seine Atmung regelmäßig.
Ich hebe den Kopf von seiner Schulter, ganz steif im Nacken vom schiefen Liegen, und drehe mich auf den Rücken.
Das Gesicht aus dem Traum steht mir noch klar vor Augen, und es juckt mich in den Fingern, es festzuhalten, bevor die Erinnerung verschwimmt.
Ich schiebe mich vorsichtig von Alban weg und schwinge die Beine über die Bettkante. Barfuß schleiche ich zu meiner Schultasche, die an ihrem üblichen Platz neben Albans Kurzhanteln steht. Ich hole Federmappe und Skizzenblock heraus, unendlich langsam, um keinen Krach zu machen, und mache das Licht an.
Der leise Knall des Schalters klingt wie ein Pistolenschuss in der stillen Nacht.
Ich halte den Atem an und schaue zu Alban. Das Licht hat keine Auswirkung, aber mit Geräuschen ist es etwas anderes.
Der Rhythmus, in dem sich seine Brust hebt und senkt, verändert sich nicht.
Ich setze mich aufrecht an die Wand und schlage die letzte Seite meines Skizzenblocks auf. Meine Hand sucht in dem verschmierten Federmäppchen herum und findet einen Kohlestift.
Damit mir das brüchige Bild nicht entgleitet, lasse ich den Stift nur ganz langsam über die leere Seite kreisen. Ich konzentriere mich auf die Erinnerung an das Gesicht, während meine Hand die Konturen nachmalt. Es passiert immer mal wieder, dass ich von etwas träume, das ich dann einfach aufzeichnen muss, aber oft verschwimmen die klaren, funkelnden Bilder, bevor ich es überhaupt aus dem Bett schaffe.
Diesmal ist es anders. Es ist, als würden die Linien über das Papier fließen und die schwarze Spitze in einem streng choreografierten Tanz mit sich ziehen, dessen Schritte ich zu meinem Erstaunen beherrsche. Ich kaue auf meiner Oberlippe herum, versunken in das Eigenleben der Zeichnung.
»Was malst du da?«
Ich zucke zusammen und der Kohlestift fällt mit einem sanften, dumpfen Geräusch zu Boden.
»Verdammt, Alban!«, ächze ich. »Du hast mich beinahe zu Tode erschreckt!«
»Entschuldige«, sagt er mit tiefer Stimme. Ich spüre, dass er lächelt.
Ich hebe den Stift auf und atme schwer aus. Mein Körper kann mit so viel Adrenalin in einer einzigen Nacht nicht umgehen.
»Ich zeichne nichts Bestimmtes«, sage ich. »Nur … grobe Skizzen, weißt du.«
Das ist eine kleine Lüge, so klein, dass sie in der Leichtigkeit des Satzes verschwinden kann, aber sie löst einen Anflug des schlechten Gewissens in mir aus. Vor allem, da ich nicht weiß, warum ich überhaupt lüge. Es ist schließlich nur ein Traum. Nur eine Zeichnung.
Vielleicht, weil Alban es nicht verstehen würde. Er zeichnet schließlich nie, um sich an Dinge zu erinnern.
Oder vielleicht, weil ich diesen besonderen Traum lieber für mich behalten möchte.
»Ich konnte nicht mehr schlafen«, sage ich.
»Ruhelose Künstlerin, wie üblich?«
»Genies schlafen nie.«
»Gut gesagt, Picasso«, sagt Alban und grinst.
»Warum ausgerechnet Picasso?« Ich rümpfe die Nase. »Kubismus ist so überhaupt nicht mein Stil. Fluchtpunkte und Säure sind nichts für mich.«
»Picasso war nicht nur im Kubismus unterwegs. Wenn mich meine Erinnerungen nicht ganz im Stich lassen, hat er bereits Anfang des 20. Jahrhunderts …«
»Okay, Kunstnerd, wir spielen nicht mehr ›Bezzerwizzer‹!« Ich beuge mich wieder über meinen Entwurf. Die schwarze Spitze des Stifts lockt das Gesicht aus dem Traum tiefer in mein Bewusstsein.
»Kohlestift?«, rät Alban.
»Vor dir kann man aber auch gar nichts geheim halten.« Ich fasse es nicht, dass er jedes Mal wieder richtigliegt.
»Kohle macht ein ganz eigenes Geräusch. Trockener als Grafit, aber nicht so weich wie Buntstifte.«
»Wenn du das so sagst, klingt es wahnsinnig kompliziert.«
»Zeichenwerkzeuge sind eine Wissenschaft für sich«, sagt er mit gekünstelter Schnöselstimme.
Ich lasse den Kohlestift intuitiv weiterwandern und achte jetzt aufmerksamer auf das kratzende Geräusch, das sein Kontakt mit dem Papier erzeugt.
Alban macht mich immer wieder auf Dinge aufmerksam, die ich sonst nicht bemerkt hätte. Er achtet so genau auf seine Umgebung, dass es zwangsläufig auf mich abfärbt.
Normalerweise mag ich unsere kleinen Zeichenratespiele, aber zum ersten Mal spüre ich einen mikroskopisch kleinen Keim der Verärgerung darüber, dass ich meinem Hobby nicht in Ruhe nachgehen kann.
Es muss der idiotische Traum sein, der mich so reizbar gemacht hat.
Ich zeichne schweigend weiter.
Es fühlt sich an wie eine Ewigkeit, bis Alban wieder gleichmäßig atmet und mich mit dem geheimnisvollen Jungen allein lässt.
4
Ich spüre den Novembermorgen durch meine dicke Winterjacke, er überzieht mein Gesicht mit Taubheit. Der Bürgersteig ist mit salzigem Schneematsch bedeckt und die Autos schleichen im Schneckentempo über die Straße, die Albans und Linus’ Zuhause von der Schule trennt.
Meine Zähne klappern, noch bevor Linus die Tür hinter uns abgeschlossen hat. Der Weg zum Schuleingang dauert keine zwei Minuten, weshalb ich davon ausgegangen bin, die Fäustlinge in der Tasche lassen zu können. Aber der beißende Wind lässt mich meine Meinung ändern, und ich suche mit steifen, roten Fingern nach dem Reißverschluss meiner Tasche, während wir die Straße überqueren.
Wir sind schon fast auf der gegenüberliegenden Seite angekommen, als mein Kopf in weiß glühendem Schmerz explodiert. Ich lasse die Schultasche fallen und schlage mir die Hände vors Gesicht, das voller Schnee und Steinchen ist.
Lautes Gelächter umgibt uns, als ich auf die Knie sinke und nach meinen Sachen taste, eine Hand immer noch auf die Augen gepresst.
Die andere Hand findet meine Schultasche, und zu meinem Entsetzen merke ich, dass Bücher und Zettel im Schnee verteilt liegen.
Ich kann hören, wie Linus neben mir von einem Schneeball getroffen wird.
»Jonathan, du Mistkerl!«, murmelt er wütend.
Alban steht auf der anderen Seite und hebt einen Arm, um sein Gesicht hinter dem Ellbogen zu schützen, obwohl er normalerweise nicht zur Zielscheibe wird. Ich wüsste nicht, dass er schon einmal offenkundig gemobbt wurde. Nicht einmal von Jonathan. Vielleicht liegt es daran, dass er blind ist, oder auch nur daran, dass er eben Alban ist.
Sein Mund ist nicht mehr als eine harte weiße Linie, aber er sagt nichts. Glücklicherweise. Er hat mittlerweile verstanden, dass es alles nur noch schlimmer machen kann.
Linus bückt sich und greift nach meiner Schultasche, um mir zu helfen.
Ich blinzele den Schnee aus meinen Augen; sie tränen, während ich meine durchnässten Schulbücher an mich nehme und sie in die Tasche stecke.
Ich spüre einen Stich im Magen, als ich meinen Skizzenblock in einer schmutzigen Pfütze aus Wasser und Schneematsch schwimmen sehe.
Linus hebt ihn auf und reicht ihn mir mit rotem Gesicht. Ich trockne ihn schnell mit dem Ärmel ab, um zu verhindern, dass das Wasser vom Papier aufgesaugt wird, und stopfe ihn tief in die Tasche.
Das Gelächter schwillt an, aber vor allem eine Stimme sticht heraus. Der Rest ist lediglich ein nervöses Echo.
Ich schaue auf und blicke in das Gesicht, das mich in den meisten meiner Albträume verfolgt.
Jonathan lässt nie eine Gelegenheit verstreichen, mich in Grund und Boden zu stampfen, und ich war zu sehr mit den Träumen und der Zeichnung beschäftigt, um mich um den Schnee zu kümmern, der im Laufe des Abends und der Nacht gefallen ist. Jonathans Fäustlinge sind nass von halb geschmolzenen Eiskristallen. Seine grauen Augen unter dem Bürstenschnitt sind zusammengekniffen.
»Kannst du das Gleichgewicht nicht halten, Debilie?«, fragt er unschuldig. Vereinzeltes Kichern entfährt der Menge, die sich im Halbkreis um uns schart.
Ich beiße die Zähne vor Wut so fest zusammen, dass die hellen Flecken vor meinen Augen mit neuer Kraft zurückkehren. Ich kratze den letzten Papierbogen vom Boden, stehe auf und dränge mich durch das Gelächter, während ich zu Boden schaue.
Außer Atem und mit glühenden Wangen betrete ich das leere Klassenzimmer und gehe schnurstracks zu meinem Platz. Hinterster Tisch, direkt neben dem Fenster.
Ich hänge meine Jacke über die Stuhllehne und setze meine Strickmütze ab. Mein Nasenrücken und eine Wange brennen, als ich mir mit der Mütze vorsichtig das Gesicht abtupfe, und die Wolle wird mit Schmutz und kleinen Blutstropfen befleckt. Ich werfe sie auf die Jacke und lasse mich auf den Stuhl fallen. Innerlich koche ich.
Der Zeichenblock liegt auf dem Tisch, aufgequollen und dreckig. Ich hebe ihn hoch und trockne Vorder- und Rückseite gründlich mit meinem Ärmel ab, bevor ich ihn aufschlage. Viele der Zeichnungen sind ruiniert. Die ersten Seiten bestehen nur noch aus verschmierten Farbflecken oder schwarzgrauen Schattierungen, und ich kann die einzelnen Zettel nicht voneinander trennen, ohne das Papier zu zerstören.
Zornestränen brennen hinter meinen schmerzenden Augenlidern, aber ich beiße mir in die Wangen, um zu verhindern, dass meine Schwäche überhandnimmt.
So geht das schon seit dem ersten Schultag, als Jonathan meine Brotdose klaute und die Kordel aus der Kapuze meiner Sommerjacke riss. Über die Jahre hinweg hat sich das zu täglichen Schikanen entwickelt; verdorbene Milch in der Schultasche, zerbrochene Aquarellstifte und ein nicht enden wollender Soundtrack aus höhnischem Gelächter, der jeden meiner Schritte begleitet. Ich habe schon vor einigen Jahren aufgehört, mit dem Fahrrad zur Schule zu fahren, weil es mir zu lästig wurde, ständig alle platten Reifen zu reparieren, und ich habe schon fast so lange eine Geheimnummer, wie ich ein Handy besitze. Ich habe es auch aufgegeben, meine Nachrichten in den sozialen Medien zu checken. Viel zu oft zeigt mir die kleine Zahl über dem Nachrichten-Icon eine neue Boshaftigkeit von Jonathan an. Ihn zu blockieren reicht nicht, solange man sich so einfach Fake-Profile zulegen kann.
Ich habe nie verstanden, was zum Teufel ich ihm eigentlich getan habe.
Es ist nur noch schlimmer geworden, seit seine drei älteren Brüder von der Schule abgegangen sind. Bislang hat er sein Bestes gegeben, genau wie sie Ruhm als abgestumpfter Idiot zu erlangen. Vielleicht gibt es Extrapunkte auf das Arschlochkonto, wenn man sich eine Haftstrafe einhandelt oder noch vor der Volljährigkeit Erfahrungen mit harten Drogen vorweisen kann. In dem Fall sind ihm seine Brüder um einige Punkte voraus. Aber kein Wunder, dass das jüngste Arschloch der Familie vollauf damit beschäftigt ist, sie einzuholen.
Linus sagt, Jonathan sei einfach nur neidisch, weil ich klüger bin als er.
›Primaten zeigen die Zähne oder gehen zum Angriff über, wenn sie sich bedroht fühlen. Du lässt ihn vor dem Rest der Gruppe schwach aussehen. Ergo musst du ausgerottet werden. Das ist simple Verhaltenspsychologie.‹
Es ist nur ein schwacher Trost, dass er ein klassisches Beispiel für einen Affen mit mangelndem Selbstwertgefühl ist.
Ich verbanne Jonathan aus meinen Gedanken und konzentriere mich wieder auf meinen Skizzenblock. Auf einer der Seiten, inmitten der farbigen Grütze, kann man mit ein bisschen gutem Willen noch die Worte Carpe diem erkennen. Das bedeutet ›Nutze den Tag‹ auf Latein. Es geht darum, im Hier und Jetzt zu leben. Quasi das YOLO der alten Römer.
Das lateinische Sprichwort kämpft um seinen Platz auf dem nassen Zeichenblock, umgeben von Farben und Formen. Grüne und blaue Streifen laufen wie Blut von den feuchten Carpe diem-Buchstaben weg und vermischen sich mit dem Rot und Gelb der Schmetterlinge, die zerflossen um die beiden Wörter herumflattern.
Auf die gegenüberliegende Seite habe ich in verschnörkelten Buchstaben Gutta cavat lapidem geschrieben. Das bedeutet ›Steter Tropfen höhlt den Stein‹. Es erinnert mich daran, dass etwas, das auf den ersten Blick machtlos und fügsam wirkt, genug Stärke aufweisen kann, um gegen den härtesten Widerstand anzukämpfen.
Viele Sprichworte aus dem letzten Monat sind von dem schmelzenden Schnee verschlungen worden, stelle ich verbittert fest. Ich bin gezwungen, die nassen Zeichnungen herauszureißen, wenn sie nicht auch die übrigen zerstören sollen. Ich entferne einen nach dem anderen die klebenden Papierbögen, bis ich einen kleinen Haufen bunten Matsch neben dem Block zusammengetragen habe.
Der geheimnisvolle Junge ist glücklicherweise unbeschädigt. Weiter als bis zum Kohlestift bin ich nicht gekommen, und er sieht mich mit einem schiefen Lächeln auf den farblosen Lippen an. Sein Haar ist so lang, dass es fast die Augenbrauen und eines seiner Augen verdeckt, und es ist auf diese absichtlich-unabsichtliche Emo-Punker-Art zerzaust, wie man sie oft in Mangas sieht.
Aber abgesehen von der wilden Frisur hat er nichts von einer niedlichen japanischen Zeichentrickfigur. Er trägt zwei Piercings in der Unterlippe auf Höhe seiner Eckzähne und je ein krummes schwarzes Piercing in seinen Ohrläppchen. Eines davon hat einen Durchmesser von mindestens einem Zentimeter.
Er ist beunruhigend anders als die putzigen Tiere und anmutigen Elfenprinzessinnen, die ich normalerweise zeichne. Meine Kunstlehrerin schüttelt immer den Kopf, wenn sie meine üblichen Motive sieht.
›Zu viele Schmetterlinge, Emilie … das Leben bietet noch mehr als Schmetterlinge.‹ Sie will gerne mehr ›Kanten‹ sehen, wie sie es ausdrückt. Aber wenn die eigene Realität schon voller Kanten ist, braucht man nicht noch mehr davon auf dem Papier.
Jedenfalls nicht mit Absicht. Wer weiß, welcher Teil meines Unterbewusstseins den gepiercten Jungen aus seinem Versteck gelockt hat.
Das Wiedersehen mit dem Lächeln aus dem Traum lässt langsam meine eigenen Mundwinkel nach oben gleiten. Ich taste in der Schultasche nach dem feuchten Federmäppchen, suche einen türkisfarbenen Buntstift mit dem richtigen Verhältnis von Grün und Blau aus und mache mich daran, eine Iris des Jungen zu schraffieren.
Die Augen sind immer das Erste, was ich zeichne, und das Erste, was ich koloriere. Die Seele einer Zeichnung hängt ganz von den Augen ab. Wenn die nicht richtig lebensecht strahlen, wird die ganze Zeichnung nicht gut. Man muss Highlights setzen, Schatten und Farbnuancen abstimmen, bis sich alles zu einer perfekten Kombination zusammenfügt. Die Wimpern sollten in einer bestimmten Art und Weise geschwungen sein, damit sie nicht wie steife Borsten aussehen, und der Bereich direkt unter der Augenbraue sollte immer heller sein, als man denkt.
Der Rest der Klasse tröpfelt in den Raum. Ihre Schritte und ihr Geplapper dringen nur als ein schwaches Summen zu mir.
Jonathans lautes Gelächter lässt mich aber zusammenschrecken. Automatisch beuge ich mich tiefer über die Zeichnung und verstärke meinen Griff um den Buntstift. Ich halte den Atem an und warte, ob Jonathan zu meinem Tisch kommt, aber er ist zu beschäftigt damit, über seinen eigenen Witz zu lachen, um weiter auf mir herumzuhacken.
Casper und Mathias lachen mit. Wie immer. Ritter Arschlochs stupide Schildknappen. Obwohl ich längst nicht Jonathans einziges Opfer bin, gehöre ich eindeutig zu seinen Favoriten. Vielleicht gibt er ja auf, wenn er es schafft, mich in der Öffentlichkeit zum Weinen zu bringen. Vielleicht provoziert es ihn, dass ich nicht so bin wie viele andere, die er mobbt. Dass ich nicht heule oder ausraste oder bei den Erwachsenen petze.
Das Sprichwort Eloquium est argentum, silentium est aurum liegt leider in dem Haufen toter, zerflossener Zeichnungen, aber das macht es nicht weniger wahr. ›Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.‹ Einer der wenigen Sprüche, die immer wieder in meinen Skizzenblöcken auftauchen. Es geht darum, sich nicht brechen zu lassen. Zu schweigen, bis die Worte ihre Macht verlieren. Beharrlichkeit ist die einzige Waffe, die der Tropfen gegen den Stein besitzt.
Unsere Dänischlehrerin Mette betritt den Klassenraum. Sie fängt an, etwas auf die Tafel zu schreiben, und erzählt von den Anfängen der Science-Fiction.
Ich fische meinen Notizblock aus der Schultasche, um es so aussehen zu lassen, als würde ich mich an der Stunde beteiligen. Ich schreibe immer noch von Hand mit, weil ich dabei zeichnen kann. Außerdem erinnere ich mich besser an Worte, wenn ich sie mit einem Stift geformt habe, als wenn ich sie einfach nur in eine Tastatur hacke.
Die Buchstaben auf dem Smartboard sehen von meinem Platz in der hintersten Reihe aus verschwommen aus. Ich bin gezwungen, die Augen zusammenzukneifen, damit Wörter aus ihnen werden. Ich sollte wirklich diese Brille tragen, die mir meine Mutter gekauft hat, aber das würde Jonathan nur noch einen weiteren Grund für Gemeinheiten geben. Die paar Jahre mit Zahnspange waren schrecklich genug.
Mette redet weiter, aber ich höre nicht zu. Zeit und Raum lösen sich auf, während die Farben auf dem Gesicht des Jungen langsam Gestalt annehmen.
5
Als die Dänischstunde vorbei ist, hat das Gesicht auf dem Block einen ganz anderen Ausdruck bekommen. Von einem flachen und farblosen Entwurf hat es sich in ein lebensechtes und fast dreidimensionales Porträt verwandelt.
Die zerzauste Frisur ist schwärzer geworden und die Augen leuchten blaugrün hinter dem Pony. Ein Mundwinkel des Jungen zeigt nach unten, obwohl er lächelt, aber der andere verläuft in einer scharfen Kurve nach oben und zaubert ein Grübchen in seine Wange.
Der dreieckige Glasanhänger auf seiner Brust ist in einen dünnen, verschnörkelten Rahmen eingefasst. Es waren viele Grautöne und Highlights nötig, damit es wie Metall aussieht. Der Anhänger strahlt ein Spektrum regenbogenfarbenen Lichts bis zum Rand des Papiers. Im Traum hat es so ausgesehen, als ob das Glas das weiße Licht im Kern des Anhängers in eine Vielzahl von Farben aufspalten würde.
Spalten … das sagt mir etwas.
Ich sehe das Cover unseres Physik- und Chemiebuchs vor mir. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man so ein Stück Glas Prisma nennt.
Auf einer Skala von eins bis zehn, wie nerdig ist man, wenn einen die Physikhausaufgaben im Traum heimsuchen?
Durch das Fenster sehe ich die wintergraue Landschaft, die in starkem Kontrast zu dem Farbspektakel in meiner Zeichnung steht. Eine frische Schneeschicht hat sich in der Zwischenzeit vom Himmel geschlichen. Das wäre ein hübscher Anblick, würde er mich nicht an das erinnern, was mich erwartet, sobald ich den Fuß wieder vor die Tür setze.
Die Pause endet, ohne dass ich mich von meinem Platz wegbewegt habe. Allmählich füllt sich der Raum mit Neuntklässlern und die Intensität des Lärms um mich herum nimmt zu. Ich hole mein Mathematikbuch heraus und zeichne weiter. Ich bin in die Schattierung der Wangenknochen des Traumjungen vertieft, als sich die Tür öffnet, und von Leder knirschende Schritte ziehen eine Spur gedämpfter Stimmen hin zur Tafel hinter sich her.
Ich schaue auf und sehe einen großen, drahtigen Mann vor dem Lehrerpult stehen.
Mein Blick gleitet über braune Lederstiefel mit Fransen und eine Cordhose mit ausgeblichenen Knien und weiter hinauf über einen bunten Sweater, einen silbergrauen Bart und langes, im Nacken zusammengebundenes Haar.
Aber es ist nicht der merkwürdige Hippie-Gandalf-Stil, der mich dazu bringt, ihn anzustarren.
Es ist das Gesicht des Mannes.
Weiße und wulstige Narben bedecken seine linke Wange, den Nasenrücken und einen Teil der Stirn, und über seinem linken Auge trägt er eine lederne Augenklappe.
Wir hatten ganz unterschiedliche Vertretungslehrer in Mathematik, seit Svenning sich vor einem Monat krankgemeldet hat, aber keiner von ihnen war … wie der hier.
»Hallo, Kids.« Die Stimme des Fremden klingt melodisch und viel tiefer, als es seine lange, dünne Gestalt vermuten lässt. Die Narben und der dichte Bart machen es schwierig, sein Alter zu schätzen. Er könnte alles zwischen Mitte vierzig und siebzig sein.
Niemand antwortet. Jonathan ist der Einzige, der es wagt, einen etwas gequälten Laut von sich zu geben, eine Art Lachen, das im Keim erstickt wird.
»Ich heiße Janus«, fährt der Mann fort. »Es tut mir leid, dass Svenning erkrankt ist. Soviel ich weiß, wird er leider nicht wieder unterrichten können. Das heißt also, dass ich seine Stelle übernommen habe. Mit anderen Worten: Wir haben für den Rest des Schuljahrs das Vergnügen miteinander, sowohl in Englisch als auch in Mathematik und Naturwissenschaften.« Der graue Bart macht Platz für ein ernstes Lächeln, und als sich das rosafarbene Narbengewebe unter der Augenklappe runzelt, wird mir leicht übel.
Trotzdem kann ich nicht wegsehen.
Ich frage mich, ob er wie Svenning auch die Begleitung im Unterricht für Alban übernimmt.
Obwohl Alban ein Superhirn ist, braucht er für einige Unterrichtsstunden Hilfe von einem Betreuer. Svenning hatte ihn in den praktischen Stunden, wie Kunst und Sport, und in den eher visuellen Fächern wie Mathematik unterstützt, wo viel an der Tafel unterrichtet wird.
Aufgrund von Svennings Krankmeldung hatten in den vergangenen Wochen einige andere Lehrer die Begleitung im Unterricht übernommen. Und obwohl Alban sich nicht beschwert, weiß ich, wie anstrengend es für ihn ist, sich mitten im Schuljahr wieder auf neue Routinen einstellen zu müssen.
Es wirkt auf mich unfreiwillig komisch, dass ausgerechnet ein Einäugiger einem Blinden helfen soll.
Mit seinem gesunden Auge scannt Janus die sprachlose Menge ab, bis er bei mir hängen bleibt, als hätte ich laut gedacht.
»Da will wohl jemand unbedingt loslegen.« Janus nickt in Richtung meines Blocks, immer noch lächelnd, sodass sich die Narben rund um die Augenklappe runzeln.
Ich laufe feuerrot an und der plötzliche Blutzufluss bringt den Kratzer auf meinem Nasenrücken zum Pochen.
Unsere Lehrer sprechen mich im Unterricht so gut wie nie an. Das ist eine Art stillschweigende Übereinkunft. Solange ich in den schriftlichen Prüfungen gute Zensuren bekomme, lässt man mich den Rest der Zeit weitestgehend in Ruhe.
»Ähm … ja«, murmele ich und schiebe meinen weißen Zeichenblock unter den Notizblock, der nach der Dänischstunde noch peinlich leer ist. Jonathan stößt erneut dieses erstickte Geräusch aus und bringt meine errötete Haut zum Brodeln.
Glücklicherweise richtet Janus seine Aufmerksamkeit wieder auf die ganze Klasse.
»Da ich euch kurzfristig in mehreren Fächern unterrichten werde, dachte ich mir, dass ich euch bis Weihnachten eine fächerübergreifende Aufgabe gebe. Ihr tut euch paarweise zusammen und schreibt einen Aufsatz, in dem ihr zu einem bestimmten Thema Mathematik, Naturwissenschaften und Englisch verbindet. Die Aufsätze gebt ihr kurz vor den Weihnachtsferien ab.«
Einige meiner Mitschüler stöhnen leise und demonstrativ auf und ich rutsche unwillkürlich etwas tiefer auf meinem Stuhl nach unten.
Och nö. Bloß keine Gruppenarbeit.
Janus fährt fort, als hätte er das missbilligende Raunen nicht gehört.