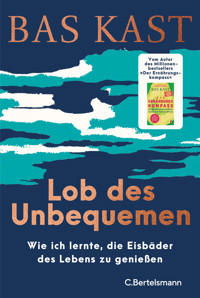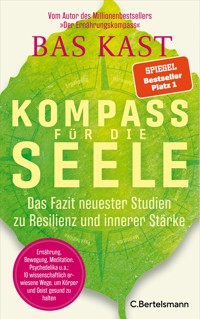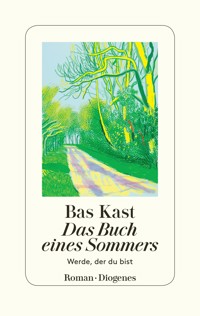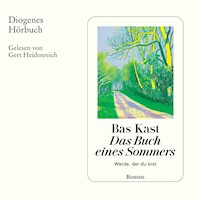9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Warum verlieben wir uns? Was macht uns attraktiv? Macht Liebe blind? Ziehen sich Gegensätze sich an? Schadet Eifersucht? Warum scheitern manche Beziehungen? Was ist das Geheimnis glücklicher Paare? Die moderne Wissenschaft findet immer mehr Antworten auf diese Fragen. Auch wenn sich das Mysterium der Liebe nie ganz entschlüsseln lässt, kann man doch Muster erkennen, warum Beziehungen glücken oder scheitern. Bas Kast vereint all diese faszinierenden Erkenntnisse zu einer Logik der Liebe, die wir uns für unser Leben zu Eigen machen können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 319
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Bas Kast
Die Liebe
und wie sich Leidenschaft erklärt
Studien
Über dieses Buch
Warum verlieben wir uns? Was macht uns attraktiv? Macht Liebe blind? Ziehen Gegensätze sich an? Schadet Eifersucht? Warum scheitern manche Beziehungen? Was ist das Geheimnis glücklicher Paare?
Die moderne Wissenschaft findet immer mehr Antworten auf diese Fragen. Auch wenn sich das Mysterium der Liebe nie ganz entschlüsseln lässt, kann man doch Muster erkennen, warum Beziehungen glücken oder scheitern. Bas Kast vereint all diese faszinierenden Erkenntnisse zu einer Logik der Liebe, die wir uns für unser Leben zu Eigen machen können.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Covergestaltung: Hißmann & Heilmann, Hamburg
Coverabbildung: © Magneto, Seesen
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2004
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-400823-3
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
für Sina
Einführung Intensivkurs Liebe
Das Vergrößerungsglas für Gefühle
Die Liebe als Antidepressivum
In den Labors der Leidenschaft
Verrückt vor Verliebtheit
Ein Werkzeugkasten für die Beziehung
Millionen Singles, die nicht zueinander finden
Sex: Note 4+
Die Logik der Liebe
Kapitel 1 Die Kunst der Verführung
Wo die Leidenschaft erwacht
Die Brücke zur Liebe
Wir verlieben uns, weil wir Herzklopfen haben
Balzbeobachtungen in der Bar
Stufe 1: Beim Flirten führt die Frau
Was Blicke bewirken
Eine Marionette namens Mann
Stufe 2: Verführersprüche im Test
Stufe 3: Zügeln Sie Ihre Zunge!
Stufe 4: Die Choreographie der Liebe
Er wirbt, sie wählt
Der Geist entstand bei Mondschein
Kapitel 2 Die Chemie der Schönheit
Welche Rolle spielt das Aussehen?
Schönheit als Empfehlungsbrief
Wie wir ein Gesicht lesen
Der Glaube wird Wirklichkeit
Was Männer wollen
Die hin- und hergerissene Frau
Der Eisprung ändert die Wahrnehmung
Testosteron stinkt
Ein Riecher für den Richtigen
Kapitel 3 Von der Leidenschaft zur Liebe
Der Moment, in dem es funkt
Die fünf Traumeigenschaften
Wie eine verhängnisvolle Affäre entsteht
Die Liebe als Selbsterweiterung
Gleich und Gleich gesellt sich gern
Je gleicher, desto glücklicher
Die Beziehung als Therapie
Moleküle der Monogamie
Das Bindungshormon Oxytocin
Kapitel 4 Eifersucht
Keine Macht mehr über die Gefühle
Ist Eifersucht eine Zwangsneurose?
Frauen empfinden anders, Männer auch
Die Alarmanlage im Kopf
»Mama’s baby, papa’s maybe«
Das Geflüster der Gene
Ewig lockt das Weib
Warum Frauen fremdgehen
Der Krieg der Spermien
Kuckuckseier
Kapitel 5 Was uns auseinander treibt
Die Anatomie der Ehe
Gutes Streiten, schlechtes Streiten
Was kommt nach dem Hochzeitshoch?
Vernachlässigte Zärtlichkeit
Das Einfühlungsvermögen schwindet
Der erste apokalyptische Reiter: Kritik
Der zweite Reiter: Verteidigung
Der dritte Reiter: Verachtung
Der vierte Reiter: Rückzug
Der fünfte Reiter: Machtdemonstration
Das Endstadium: Gemeinsam einsam
Das verflixte vierte Jahr
Kapitel 6 Stimmen der Vergangenheit
Glückliche Paare denken anders
Der Negativdetektor im Kopf
Die drei Liebesstile
Beobachtungen an Babys
Mutti ist nicht schuld
Sie können Ihren Liebesstil ändern
Sicherer lieben
Kapitel 7 Was uns zusammenhält
Wie entsteht Intimität?
Liebesformel Nummer 1: Zuwendung
Unterstützen Sie Ihren Partner
Romantik im Supermarkt
Liebesformel Nummer 2: Wir-Gefühl
Liebesformel Nummer 3: Akzeptanz
Liebesformel Nummer 4: Positive Illusionen
Liebesformel Nummer 5: Aufregung im Alltag
Epilog Liebe kann man lernen
Danksagung
Literatur
Bildnachweis
für Sina
EinführungIntensivkurs Liebe
Das Vergrößerungsglas für Gefühle
Ein kurzer Anruf genügt, eine kleine E-Mail, oder eine Frau geht vorbei, die ihr ähnlich sieht, und ich höre auf zu schreiben. Eine Zigarette, denke ich, denkt irgendetwas in mir, und ich merke, wie ich feuchte Hände bekomme, obwohl sie bewegungslos auf der Tastatur liegen. Ich tue nichts mehr, und eigentlich denke ich auch nicht mehr, das heißt, ich denke schon, ich denke nur. An sie.
So steht es in meinem Tagebuch, auf den ersten Seiten, so habe ich mich gefühlt damals. Komisch, diese Zeilen heute wieder zu lesen. Damals dachte ich: Es kann unmöglich jemand geben, noch jemand auf dieser Welt, der so verliebt ist wie ich.
Ich war Student, 21, sie hieß Evelyn, und ich weiß noch, was ich in meiner Verzweiflung zu lesen begann: Goethes Werther, Stendhal, Tolstoj.
Eigentlich passiert das ja fast nie: dass ich eine Mail bekomme oder dass sie anruft oder dass sie mich ansieht und lächelt. Auf fünfmal Wegschauen ein Lächeln, auf zwei meiner Anrufe einer von ihr, auf drei Mails, die ich ihr schicke, kommt eine zurück. Ob sie strategisch vorgeht?[1]
Es war eine Qual, sie war eine Qual, aber eine Qual, die mich glücklich machte. Sie konnte mich in einen Rausch versetzen, sobald ich ihr Gesicht sah, ihr Lächeln ...
Und wenn sie dann wieder weg war, verschwand auch die Euphorie. Mein Glücksgefühl löste sich in nichts auf. Je mehr Zeit verging, ohne sie, desto stärker wuchs die Unruhe in mir, bis ich mich irgendwann bloß noch deprimiert fühlte.
Damals fing es an, ja, damals muss es begonnen haben. Ich wollte dahinterkommen. Ich wollte wissen, was es ist: das Geheimnis der Liebe. Ob das überhaupt möglich ist? Das Rätsel der Liebe, ob es sich lösen lässt? Und wenn ja, wie?
Ich las. Liebesromane, Gedichtbände, Briefwechsel, ich verschlang die Bücher wie ein Besessener, um nicht allein zu sein mit meinen Gefühlen. Und die Ausführungen der Dichter wirkten auf mich wie eine Art Vergrößerungsglas. Es war, als könnte ich damit meine Gefühle klarer sehen, meine Gefühle für Evelyn.
Und doch, die Liebe schien mir nach wie vor ein Mysterium. Die Beschreibungen der Schriftsteller trafen nicht selten meine Empfindungen, manchmal haargenau. Aber es blieben Beschreibungen.
Was mir fehlte, waren Hintergründe, Erklärungen. Was war es denn nun, das mir den Kopf verdrehte? Warum reichte Evelyns Anblick, um mich glücklich zu stimmen? Warum konnte ich nur noch an sie denken? Und vor allem: Wie würde ich ihr Herz erobern können? »Magnetes Geheimnis, erkläre mir das!«, hatte Goethe (1749–1832) geklagt, »kein größer Geheimnis als Lieb und Hass.« [2]
Was mir fehlte, war: eine Gebrauchsanleitung für die Liebe.
Die Liebe als Antidepressivum
London, Ende der 90er Jahre. Per E-Mail fordern die Hirnforscher Andreas Bartels und Semir Zeki mehrere tausend Studenten aus der britischen Hauptstadt und Umgebung auf, sich zu melden, falls sie sich »truly, madly and deeply« (wahrhaft, wahnsinnig und tief) verliebt fühlen. 70 Personen reagieren, drei Viertel davon Frauen.
Die beiden Wissenschaftler bitten die Studentinnen und Studenten in die Abteilung für Kognitive Neurologie am Londoner University College. Um ihren leidenschaftlichen Gefühlen auf den Grund zu gehen, lassen sie die Kandidaten ihre Beziehung kurz beschreiben, führen mit jedem ein Interview und wählen schließlich elf Frauen und sechs Männer aus, die sich alle durch eins auszeichnen: eine hochgradige Verliebtheit.
Die Liebe schaltet Hirnregionen ab, die mit negativen Gefühlen einhergehen, etwa Trauer, Angst und Aggressionen – zu den deaktivierten Bereichen gehören das rechte Stirnhirn (Kreisbereich im linken Bild) und Teile des Mandelkerns (Kreis im rechten Bild).
Die Auswahl ist offenbar geglückt. Bei einem psychologischen Liebesfragebogen, der in Untersuchungen zuvor bereits an Dutzenden von Verliebten getestet worden war, erreichten die Versuchspersonen Höchstwerte.
Das bestätigt auch ein anschließender »Lügendetektortest«, bei dem die Wissenschaftler den elektrischen Hautwiderstand ihrer Probanden prüfen. Wenn wir nervös werden, kommen wir ins Schwitzen, die Folge ist: Unsere Haut leitet elektrischen Strom besser. Die Reaktion ist unbewusst, wir können sie mit unserem Willen nicht beeinflussen. Deshalb erfasst ein Lügendetektor nicht nur den Puls und die Atemfrequenz, sondern auch die Veränderung der Hautleitfähigkeit. Und tatsächlich, wie die Messung ergibt: Es genügt, den Studenten ein Foto ihres geliebten Partners zu zeigen, schon bekommen sie einen kleinen Schweißausbruch.
Das Experiment kann beginnen. Die Forscher legen ihre Probanden in einen Kernspintomographen und registrieren die Hirnaktivität, während die Versuchspersonen in dem Gerät auf das Bild ihres oder ihrer Liebsten blicken.
Das Ergebnis: Die verliebten Studenten befinden sich in einem Zustand, als hätten sie gerade ein Tütchen Kokain geschnupft. Hirnregionen, die mit Glücksgefühlen einhergehen, leuchten auf. Andere Areale, die mit schlechter Stimmung zusammenhängen, sind schlicht abgeschaltet, beispielsweise das rechte Stirnhirn.
In der Fachsprache wird das Stirnhirn auch als »Präfrontalcortex« bezeichnet. Das Areal liegt direkt hinter der Stirn und hat die Größe einer Billardkugel. Bei depressiven Patienten ist der rechte Präfrontalcortex oft besonders aktiv. Eine neuartige Therapie gegen Depressionen besteht darin, mit starker Magnetstimulation am Schädel die außer Kontrolle geratene Erregung dieses Hirnbereichs zu bremsen. Die Übererregung geht zurück, die Stimmung steigt. [3]Das heißt: Das Gesicht des geliebten Menschen zu sehen wirkt wie ein regelrechtes Antidepressivum!
Doch nicht nur das rechte Stirnhirn, auch ein Teil des Mandelkerns knipst beim Anblick des Geliebten sein neuronales Licht aus. Der Mandelkern (Fachjargon: »Amygdala«) ist eine mandelförmige und -große Struktur tief im Innern des Hirns. Er liegt in zweifacher Ausgabe vor, einmal in der linken und einmal in der rechten Hirnhälfte. Man könnte die Struktur auch als Angst- und Aggressionszentrum im Kopf bezeichnen – das Feld springt immer dann an, wenn wir uns fürchten oder wütend sind. [4]Erlischt die Aktivität der Amygdala, wie bei den Studenten, sobald sie ihren Partner vor Augen haben, verschwinden Furcht und Wut.
Die Liebe, schlussfolgern die Forscher, macht nicht nur glücklich, sondern auch mutig und sanft. [5]
In den Labors der Leidenschaft
»Was Prügel sind, das weiß man schon; was aber die Liebe ist, das hat noch keiner herausgebracht«, schrieb Heinrich Heine (1797–1856). [6]Vor zehn Jahren, als es die Londoner Studie noch nicht gab und ich nach langer Lektüre immer noch nicht klüger war, schoss es mir plötzlich durch den Kopf. Im Nachhinein wundere ich mich darüber, dass es mir nicht eher eingefallen ist. Dass ich nicht gleich darauf gekommen bin: Bei meiner Suche nach den Geheimnissen der Liebe nicht nur die Dichter, sondern auch die Wissenschaft zu fragen. Ich studierte damals Hirnforschung, zusammen mit Evelyn – konnte sie mir das Rätsel nicht erklären?
Im ersten Moment hört es sich vielleicht merkwürdig an, womöglich sogar abwegig, scheint es doch kaum zwei Welten zu geben, die unterschiedlicher sein könnten, die Welt der Liebe, der Leidenschaft, und die Welt der Wissenschaft, der Vernunft. Das A und O der Wissenschaft ist das Experiment, das Messen. Und ist die Liebe nicht unmessbar, gar unermesslich?
Das ist sie, einerseits. Und sie ist es nicht: Die Untersuchung aus London zeigt, dass es möglich ist, die Liebe zu erforschen. Es ist nur dann unmöglich, wenn man Unmögliches von der Forschung verlangt, etwa: dass eine Studie alles erklärt.
Die Londoner Analyse ist also nicht mehr als ein erster Ansatz, aber auch nicht weniger. Wie machte Evelyns Lächeln mich glücklich? Ein Teil der Antwort liegt darin, dass ihr Gesicht in der Lage war, Glücksareale in meinem Kopf zu aktivieren und zugleich die Erregung in meinem rechten Stirnhirn, die mit negativen Gefühlen einhergeht, zu drosseln. Was passiert in unserem Kopf, dass wir uns so sicher und geborgen fühlen, wenn der oder die Geliebte in unserer Nähe ist? Die Antwort lautet: Unser Angstzentrum namens Amygdala kommt dann zur Ruhe. Das ist noch keine Antwort auf die Frage, warum unsere Gefühle Achterbahn spielen, wenn wir verliebt sind. Doch die Studie demonstriert, dass die unfassbare Liebe für die Forschung fassbar ist.
Zugleich markiert die Untersuchung einen endgültigen Tabu-Bruch. Denn das Vorurteil, der Liebe ließe sich mit wissenschaftlichen Mitteln nicht beikommen, herrschte nicht zuletzt in den Köpfen der Forscher selbst. »In den 70er Jahre wurde ich, als ich mich damit beschäftigen wollte, noch ausgelacht«, hat mir die Anthropologin Helen Fisher erzählt. Auch sie blickt heute mit dem Kernspintomographen in den Kopf verknallter Versuchspersonen. [7]Fisher: »Die Liebe zu erforschen, sagten mir meine Kollegen damals, sei schier unmöglich, reine Geldverschwendung und ein guter Weg, mir rasch die Karriere zu ruinieren.«
Diese Situation hat sich geändert, und zwar gründlich. Die Wissenschaft hat die Liebe als Thema entdeckt. In den letzten Jahren sind genau solche Orte entstanden, wo das scheinbar Unvereinbare aufeinander trifft: Labors der Leidenschaft, in denen die Naturgesetze unserer Gefühle ergründet werden. Ich hatte die Chance, einige dieser Labors besuchen zu können, den Liebesdoktoren bei ihren Untersuchungen über die Schulter zu sehen, mit ihnen zu reden.
Mittlerweile nehmen Forscher rund um den Globus jede Phase der Liebe unter die Lupe, vom Flirten bis zur Eifersucht, von den ersten Schmetterlingen im Bauch bis hin zu Streitmustern, die eine Beziehung in den Bankrott treiben. Wahrnehmungsspezialisten sind dem Mysterium der Schönheit auf der Spur, Psychologen ermitteln Muster der Partnerwahl, Biologen entschlüsseln Moleküle der Monogamie.
Damit lassen sich die Fragen, die ich mir damals in meiner Verzweiflung stellte, neu beantworten: Warum verlieben wir uns? Wie verführt man einen Menschen? Was macht uns attraktiv? Macht Liebe blind? Ziehen Gegensätze sich an? Was passiert eigentlich mit uns, wenn wir verrückt nach jemandem sind?
Verrückt vor Verliebtheit
Verrückt – für die Psychiaterin Donatella Marazziti von der Universität Pisa ist das keine bloße Metapher. [8]Ein verliebter Mensch, sagt die italienische Forscherin, befindet sich in einem Zustand, der sich am besten mit dem eines Zwangspatienten vergleichen lässt, einem Menschen also, der beispielsweise den unwiderstehlichen Drang verspürt, sich 43-mal am Tag die Hände zu waschen. Die Zwangshandlungen stellen für die Patienten einen Versuch dar, sich selbst zu beruhigen, den Versuch, eine dunkle Angst, die sonst um sich greifen würde, in Schach zu halten.
Wenn wir uns verlieben, meint die Psychiaterin aus Pisa, sind es zwar nicht unbedingt bestimmte Verhaltensweisen, die einen zwanghaften Charakter annehmen, dafür umso mehr unsere Gedanken. Die Fantasien kreisen nur noch um eins: die angehimmelte Person.
Um ihren Verdacht zu überprüfen, untersuchte Marazziti 20 Studentinnen und Studenten, die sich in den letzten sechs Monaten über beide Ohren verknallt hatten. Mindestens vier Stunden täglich, gaben die Liebestollen an, konzentrierten sie sich einzig und allein auf das Objekt ihrer Begierde.
Doch nicht nur ihr Geisteszustand hatte zwangsneurotische Züge angenommen. Ein Bluttest offenbarte: Auch ein bestimmter Botenstoff in ihrem Körper, das Serotonin, war auf ein krankhaft niedriges Niveau gesunken. [9]Der gleiche Befund zeigt sich bei Zwangspatienten. [10]Somit lässt sich auch biochemisch ein gemeinsamer Nenner zwischen einer Neurose und der Verliebtheit feststellen.
Serotonin spielt in unserem Gehirn eine zentrale Rolle, und zwar als ein Glücksbote. [11]Die Nervenzellen, die Neuronen, kommunizieren untereinander mit Hilfe von chemischen Botenstoffen, den so genannten Neurotransmittern. Serotonin ist ein solcher Botenstoff. Fehlt er, kommt es zu Störungen in der Kommunikation zwischen den Neuronen. Das Gehirn gerät aus dem Gleichgewicht. Je nach Transmitter hat das unterschiedliche Auswirkungen auf unsere Psyche.
Niedrige Serotoninspiegel gehen mit Nervosität und Traurigkeit einher. Serotonin ist ein Stoff, der beruhigt und die Stimmung hebt. Viele Arzneien gegen Depressionen, zum Beispiel auch das US-Modemedikament »Prozac« [12], wirken erhellend aufs Gemüt, indem sie das zu knappe Serotonin im Kopf wieder auf Trab bringen. [13]
Es wäre allerdings naiv, Verliebtheit einfach mit Serotoninmangel gleichzusetzen. Zahlreiche Hormone und Hirnregionen sind im Spiel. Den genauen Liebescocktail kennt keiner. Vielleicht aber ist das mangelnde Serotonin im Gehirn einer der Gründe dafür, dass wir, wenn wir uns verliebt haben, oft so ruhelos und manchmal richtig deprimiert sind.
Der Befund der italienischen Psychiaterin lenkt den Blick auf die schmerzhafte Seite der Leidenschaft. Die Analyse der Londoner Forscher dagegen durchleuchtet das Glück der Liebe. Beide Ergebnisse scheinen sich diametral zu widersprechen – auf der einen Seite himmelhoch jauchzend, auf der anderen zu Tode betrübt!
Aber vielleicht spiegelt dieser Widerspruch nur die Widersprüche der Liebe selbst? Ich weiß noch, damals mit Evelyn: Ich litt, aber irgendwie litt ich gern. Ich fühlte mich gereizt, niedergeschlagen, wenn sie nicht da war. Doch statt mich abzulenken, statt die Zeit sinnvoll zu nutzen, wanderten meine Gedanken immer wieder zu ihr zurück, was mich beruhigte und was zugleich alles nur noch schlimmer machte.
Und dann, wenn ich sie wieder sah, war das schlechte Gefühl plötzlich wie weggewischt. Als hätte sich in meinem Kopf ein Schalter umgelegt. Das Stimmungstief verflog. Die Ekstase kehrte zurück.
Insofern kommen mir die Untersuchungen aus London und Pisa wie zwei Puzzlestücke vor, die zwar noch kein Bild der Liebe ergeben, aber sie passen. Denn rein biologisch gesehen besteht die Funktion der Liebe darin, zwei Menschen für den Nachwuchs zusammenzubringen. Sie dient als Beziehungskitt. Nur wie kann die Natur das bewerkstelligen? Eine mögliche Lösung wäre, uns fürs Beisammensein mit guten Gefühlen zu belohnen, Trennungen dagegen mit einer kleinen Depression zu bestrafen.
Ein Werkzeugkasten für die Beziehung
Als wir das Studium beendeten, haben wir den Kontakt verloren. Ich habe Evelyn nie wieder gesehen. Manchmal noch ertappte ich mich dabei, wie ich plötzlich an sie dachte. Allmählich jedoch verblasste ihr Bild in meinem Kopf, es verschwand.
Was blieb, war meine Faszination für die Liebe. Sie löste sich von Evelyn, verselbstständigte sich. Immer wieder machte ich mich auf die Suche nach neuen Ergebnissen aus den Labors der Leidenschaft. Und ich merkte, dass auch die Erkenntnisse der Forschung, wie die Herzensergüsse der Dichter, den Blick für die Liebe schärfen können. Mehr noch, oft liefern sie die Hintergründe, die Erklärungen, nach denen ich damals gesucht hatte.
Mit der Zeit verlagerte sich mein Interessensschwerpunkt. So spannend ich den ersten Rausch der Leidenschaft fand und finde, was, fragte ich mich, weiß die Wissenschaft über das, was danach kommt? Wie wird aus Verliebtheit Liebe? Kann eine Liebe für immer dauern? Warum scheitern so viele Beziehungen, woran scheitern sie? Was ist das Geheimnis dauerhaft glücklicher Paare?
Überrascht stellte ich fest, dass die Paarforschung längst zu einem der größten Felder der Psychologie angewachsen ist. Ihre Erkenntnisse halte ich für besonders wertvoll. Sie helfen uns nicht nur, das eigene Verhalten besser zu verstehen, sondern lassen sich häufig auch in die Praxis umsetzen. Anders ausgedrückt: Verliebtheit lässt sich nicht lernen, Liebe – bis zu einem gewissen Grad – schon.
Dazu ein Beispiel. In Seattle, Washington, hat der Psychologe und Mathematiker John Gottman ein Liebeslabor gegründet, in dem er seit Jahren Ehepaare systematisch beobachtet. Nach Hunderten von Observationsstunden an erfolgreichen Partnern und solchen, die sich später scheiden ließen, hat der Gefühlsgeometriker fünf Verhaltensweisen identifiziert, die das Ende einer Ehe verkünden. Es sind die »apokalyptischen Reiter«. Sie lauten: Kritik, Verteidigung, Verachtung, Rückzug und Machtdemonstration. In Kapitel 5 werden wir uns diese Untergangsboten genauer ansehen. [14]
Dabei wird Ihnen der ein oder andere apokalyptische Reiter sicherlich nicht fremd vorkommen. Jedenfalls ging es mir so. Es ist fast unmöglich, glaube ich, die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu studieren, ohne sie mit den eigenen Erfahrungen zu vergleichen.
Das ist nicht immer angenehm. Auf seine Schwächen hingewiesen zu werden, sie klarer zu sehen als je zuvor – im ersten Moment hat mir das nicht nur Spaß gemacht. Aber einen unsichtbaren Feind kann man nicht bekämpfen. Besser, man sieht ihn. Erst dann kann man sich gegen ihn wehren.
Damit eröffnen die Einsichten der Eheforschung einen Weg, die eigene Partnerschaft erfolgreicher zu gestalten. Bei ihren Untersuchungen trafen die Zweisamkeitsforscher auch auf wahre »Meister der Ehe«, wie Gottman die dauerhaft glücklichen Paare nennt, die einen Streit »wie einen Scherz aussehen« lassen. [15]Wie gelingt ihnen das? Wie lautet die Formel ihres gemeinsamen Glücks?
Glückliche Paare sind keine Heiligen. Sie sind nicht intelligenter als Sie oder ich. Sie haben nur einige wenige Spielregeln der Liebe verinnerlicht – in Kapitel 7 habe ich sie zusammengefasst.
Diese Spielregeln sind, nach allem, was wir heute wissen, so universell wie die Liebe selbst. Jeder Mensch liebt auf seine Weise, und doch gibt es Konstanten, die für uns alle gelten, Kräfte, die uns allen eher schaden oder nutzen. Natürlich fühlt und denkt eine 16-jährige Schülerin, die sich zum ersten Mal verknallt hat, anders als ein 74-jähriger Rentner. Und doch, ganz gleich, ob Sie frisch verliebt, verlobt, seit Jahren verheiratet oder geschieden und wieder auf der Suche sind, sogar in der Liebe und der Leidenschaft lassen sich Gesetze ausmachen, die allgemeine Gültigkeit haben. In dieser Hinsicht verhält sich unsere Psyche nicht anders als unser Körper. Um nur ein Beispiel zu nennen: Rauchen schadet. Jedem. Bewegung und ausgewogene Ernährung dagegen tun uns gut, egal, in welchem Alter wir sind und unabhängig vom Geschlecht.
Manch eine Spielregel der Liebe mag Sie vielleicht überraschen. Die eine oder andere erfordert etwas Disziplin. Keine von ihnen aber ist unerreichbar. Im Gegenteil, wenn die Gesetze der Leidenschaft sich durch ein gemeinsames Kriterium auszeichnen, dann ist es dieses: Jeder von uns kann sie sich zu Eigen machen.
Natürlich geht das nicht von allein. Ich empfinde es eher so: Man bekommt einen kleinen Werkzeugkasten in die Hand gedrückt. Die Arbeit muss man immer noch selbst machen, es gibt keinen, der sie einem abnimmt. Aber in dem Werkzeugkasten befinden sich wenigstens einige Schlüssel zum Erfolg.
Millionen Singles, die nicht zueinander finden
Die Erkenntnisse der Wissenschaft, könnte man meinen, sind so wichtig für uns, für unsere Liebe – bestimmt sind sie uns allen längst bekannt!
Erstaunlicherweise ist das nicht der Fall. Viele der Entdeckungen formen sich erst in den Köpfen der Forscher zu Theorien, verstecken sich in schwer verständlichen Fachartikeln oder entlegenen Bibliotheken. Wir haben sie bislang kaum zur Kenntnis genommen.
So lässt sich eine bittere Ironie beobachten. Während in den Labors die Mechanismen der Leidenschaft Stück für Stück entziffert werden, während Wissenschaftler auf der ganzen Welt die Faktoren erfolgreicher Paare ermitteln und ihre Liebesformeln unsere Beziehungen bereichern könnten, entwickeln wir uns, scheint es, eher umgekehrt zu Dilettanten der Liebe.
Immer mehr Menschen leben allein. Die Zahl der Singles ist in den letzen Jahrzehnten explodiert, Schätzungen sprechen von mindestens vier Millionen allein in Deutschland. [16]Einsame Spitze: die Großstädte. In München, Frankfurt, in Hamburg oder Berlin beträgt die Zahl der Einpersonenhaushalte mittlerweile rund 50 Prozent. [17]Millionen von Solisten konzentrieren sich in den Metropolen und finden nicht zueinander, oder sie halten es nicht lange miteinander aus.
Gleichzeitig entschließen sich immer weniger Menschen zur Heirat. 1950 gaben sich in Deutschland noch über 750 000 Paare das Ja-Wort. 1980 waren es knapp 500 000. Mittlerweile liegt die Zahl unter 400 000. [18]
Umgekehrt sind die Scheidungsraten in die Höhe geschnellt. Inzwischen geht bei uns jede dritte Ehe in die Brüche, in den Ballungszentren ist es jede zweite. [19]Anfang der 60er Jahre standen in Deutschland rund 70000 Paare vor dem Scheidungsrichter. Heute sind es gut 200 000 jährlich, Tendenz steigend. [20]
Dieser Trend zur Trennung verstärkt sich auch noch selbst. Die Hälfte der geschiedenen Ehepaare hat Kinder unter 18 Jahren. [21]Und Scheidungskinder, das ist belegt, neigen auch selbst eher zur Scheidung. Ihr Risiko, mit der eigenen Ehe ebenfalls Schiffbruch zu erleiden, ist um 50 Prozent erhöht, ein Phänomen, das Forscher als »soziale Vererbung« bezeichnen. [22]
Das heißt nicht, dass die Ehen früher per se glücklicher verliefen. Frauen sind unabhängiger, Trennungen leichter geworden. Es ist heute gesellschaftlich gestattet, sich scheiden zu lassen. Kaum jemand wird dafür noch schief angesehen. Diese mühsam erkämpfte Freiheit will und soll niemand aufgeben. Aber es wäre doch schön, wenn wir unsere Freiheit nicht mit Alleinsein bezahlen müssten.
Sex: Note 4+
Nur, warum eigentlich nicht? Können wir etwa nicht alleine glücklich werden? Vielleicht sind die Zeiten dauerhafter Beziehungen vorbei? Wie oft lässt sich lesen, dass die Ehe ein »Auslaufmodell« ist! Dass dem Single die Zukunft gehört...
Das aber glaube ich nicht. Ein Blick auf die Realität legt vielmehr nahe, dass es sich bei dem schillernden Bild vom »Swinging Single«, der sich Nacht für Nacht in die Abenteuer des Großstadtdschungels stürzt, um einen Medienmythos handelt. Singles sind im Großen und Ganzen nicht nur unglücklicher, sie fühlen sich auch häufiger einsam, sind egozentrischer, eigenwilliger und weniger optimistisch als Paare. [23]»Der junge Single bis etwa 30 wirkt emotional eher labil, sozial gehemmt und zurückhaltend, und sein Selbstwertgefühl ist nicht besonders hoch«, fasst der Beziehungsforscher Franz Neyer von der Berliner Humboldt-Universität die Befunde zusammen. [24]
Sogar um das Sexleben der Singles ist es, allen Legenden und Fantasien Verheirateter zum Trotz, schlecht bestellt. Eine repräsentative Umfrage ergab, dass Ehemänner ihrem Sex die besten Noten geben: Eine glatte 2. Die freiwilligen Single-Männer bringen es nur auf eine 4+. Dieses Tief wird noch von den unfreiwilligen Singles unterboten – gleich, ob Mann oder Frau, Solisten wider Willen stufen ihr Sexleben noch nicht einmal als ausreichend ein. [25]
Verheirateten geht es nicht nur besser im Bett, sie sind auch generell glücklicher, wie sich quer durch 16 Länder [26]und bei zahlreichen verschiedenen ethnischen Gruppen [27], die Psychologen dazu untersucht haben, gezeigt hat.
»Das eine und in sehr vielen Studien wohl am besten gesicherte Faktum über die Ehe ist, dass verheiratete Menschen glücklicher sind als alle anderen«, resümiert der renommierte US-Psychologe Martin Seligman in seinem Buch Der Glücksfaktor. »Ehe ist ein wichtigerer Glücksfaktor als Arbeitszufriedenheit oder Finanzen oder Gemeinschaft mit anderen Menschen.« [28](Unter dem Begriff Ehe versteht der Forscher in diesem Zusammenhang jede feste Liebespartnerschaft, der Trauschein ist nicht unbedingt das Entscheidende. [29]
Die Logik der Liebe
Am Anfang war der Kugelmensch, vierbeinig, doppelgesichtig. Er war vollständig, nichts fehlte ihm, erzählt der griechische Philosoph Platon (427–347 v. Chr.) in seinem Symposium. Aber die Kugelmenschen wurden übermütig, drohten die Götter anzugreifen. Diese beratschlagten, was zu tun sei, und schließlich griff Zeus ein, schnitt die Kugelmenschen kurzerhand in zwei Teile, wie man eine Frucht halbiert. Die Überheblichkeit erfuhr einen gründlichen Dämpfer. Doch nun ergriff die halbierten Wesen ein neues Gefühl: die Sehnsucht nach ihrer anderen Hälfte. Eros erwachte in der Welt.
Seitdem sind wir auf der Suche. Wenn zwei Hälften sich schließlich finden, fallen sie sich in die Arme, die Sehnsucht stillt sich, weil sie nun wieder ganz sind. »Von so langem her also«, schreibt Platon, »ist die Liebe zu einander den Menschen angeboren, um die ursprüngliche Natur wiederherzustellen, und versucht aus zweien eins zu machen und die menschliche Natur zu heilen.« [30]
Der Philosoph hat Recht. Die Sehnsucht nach Zweisamkeit ist uns angeboren, sie ist Teil unserer Natur. Jeder von uns ist auf der Suche. Und wenn wir die richtige Hälfte gefunden haben, wollen wir sie behalten, wir wollen »ganz« bleiben.
Ich werde diese doppelte Herausforderung – das Finden und das Festhalten eines passenden Partners – von nun an als »Platons Problem« bezeichnen, obwohl es natürlich unser aller Problem ist.
Ich denke, dass die Wissenschaft uns helfen kann, Platons Problem zu lösen. Das ist das Thema dieses Buchs. Ich habe versucht, die Ergebnisse aus den Labors der Leidenschaft so zusammenzufügen, dass sie sich möglichst auch für unser eigenes Liebesleben nutzen lassen.
Um es gleich vorwegzunehmen: In den Hunderten von Studien, die ich mir angesehen habe, ließ sich kein Patentrezept finden. Aber die neuen Erkenntnisse führen zu einem tieferen Verständnis unserer leidenschaftlichen Gefühle sowie der Mechanismen einer Partnerschaft – und stellen so jedem den Werkzeugkasten im Kopf zur Verfügung.
Die Entdeckungen aus den Liebeslabors, ich habe es selbst erfahren, können Ihr Beziehungsleben verändern. Die Lehren, die sich aus ihnen ziehen lassen, beruhen nicht einfach auf der Meinung irgendeines Therapeuten. Man hat sie anhand von zahlreichen Versuchen oder mit Hilfe von systematischen Beobachtungen aufgespürt.
In der Schule lernen wir Mathematik und Geographie, wir büffeln Vokabeln, studieren chemische Formeln und werden täglich darin trainiert, unsere Meinung mit Argumenten zu begründen. [31]Es existiert kaum noch ein Beruf, den man ohne Ausbildung ergreifen könnte, einfach so. Für so gut wie alles gibt es eine Lehre, ein Studium, einen Intensiv- oder Crashkurs, und noch beim neuen DVD-Player werden wir, bevor wir es wagen, das hochsensible Gerät an die Steckdose zu schließen, angehalten, die 87-seitige Gebrauchsanweisung in fünf Sprachen durchzunehmen.
Sobald es jedoch zum Thema Beziehungen kommt, gehen wir stillschweigend davon aus, auch ohne Vorbereitung ganz gut gerüstet zu sein. Ist das nicht seltsam? Die Vorstellung etwa, Verlobten einen Eheführerschein abzuverlangen, klingt geradezu absurd. [32]
Zugegeben, der Vergleich ist nicht ganz fair. Mit jeder Freundund Partnerschaft, mit jeder Affäre, jedem Streit, jeder Versöhnung, lernen wir etwas über die komplizierte Logik der Liebe.
Andererseits legt schon eine simple Beobachtung nahe, dass »einfach nur machen« nicht ausreicht. So heiraten drei Viertel der Geschiedenen wieder, die meisten bereits binnen drei Jahren. [33]Und man könnte meinen: Diese Gruppe hat gelernt, mit Krisen umzugehen, mit Unterschieden im Charakter, mit Konflikten, und geht nun reifer, klüger, erfolgreicher in die nächste Beziehung. Aber diese Vorstellung ist falsch: Paare in ihrer zweiten Ehe lassen sich noch öfter scheiden als in ihrer ersten, ganz so, als hätten sie nichts dazugelernt. [34]
Woran könnte das liegen? Vielleicht ist unsere Grundannahme – dass man für die Liebe keine Bildung braucht – falsch. Vielleicht kommt es auch in der Liebe auf beides an, Erfahrung und Hintergrundwissen, Praxis und Theorie. Deshalb habe ich dieses Buch geschrieben. Es soll das Hintergrundwissen unseres Liebeslebens zur Verfügung stellen, vom ersten Flirt bis hin zu den Erfolgsgeheimnissen von Dauerpaaren.
Sie ist weit gekommen, die Wissenschaft. So manches Geheimnis unserer leidenschaftlichen Gefühle hat sie gelöst. Dennoch: Die Erkenntnisse nehmen nichts von dem Zauber der Liebe, im Gegenteil. Sie werden dazu beitragen, dass Sie diesen Zauber länger genießen können.
Kapitel 1Die Kunst der Verführung
Wo die Leidenschaft erwacht
Die Wurzeln der Flirtforschung lassen sich ziemlich genau datieren. Sie liegen um die Jahre 2 bis 1 vor Christi Geburt. In dieser Zeit verfasste der römische Dichter Ovid (43 v. Chr. – 18 n. Chr.) das erste Benutzerhandbuch für Verführer: Ars amatoria oder Liebeskunst.
Der Ratgeber, der sich an die Jugend Roms wendet, lässt nur wenig zu wünschen übrig. Zuerst stärkt der Autor das Selbstbewusstsein seiner Leser: »Ernstlich durchdringe dein Herz die Zuversicht, du könntest alle fangen; dann fängst du sie auch.« Es folgen hochdetaillierte Anweisungen fürs Äußere: »Nicht sei zu Stacheln dein Haar in entstellender Weise geschoren; [...] Und aus dem Nasenloch steh’ niemals ein Haar hervor. Nicht komme widriger Atem aus übel riechendem Munde.« Praxisbewährte Tipps sollen dabei helfen, die Vertreter des anderen Geschlechts rumzukriegen, und sowohl Männer als auch Frauen, für die es eigens getrennte Kapitel gibt, kommen auf ihre Kosten.
Besonders beachtenswert ist dabei eine Erkenntnis, die sich an verschiedenen Stellen im römischen Ratgeber finden lässt und die man als »Ovids Verführungsformel« bezeichnen könnte. Damit der Funke überspringt, komme es nicht nur aufs Selbstbewusstsein und aufs Äußere an, sondern auch auf die Umstände. Auf die Situation. Die Leidenschaft erwache vor allem an Orten der Aufregung, im Theater, bei »Wettrennen rassiger Pferde«, simulierten Seeschlachten oder Gladiatorenspielen: »Schaut die Arena euch an, die vom warmen Blute befleckt ist, und den Wendepunkt, den glühende Räder umfahrn.« [35]
Mit dieser Einsicht hat Ovid die moderne Forschung um fast 2000 Jahre vorweggenommen.
Die Brücke zur Liebe
Anfang der 70er Jahre machen sich zwei Psychologen in Kanada auf, Ovids Hypothese zu testen. Schauplatz ist der Capilano-Canyon, ein großer, grüner Naturpark, nicht mehr als zehn Minuten von der Metropole Vancouver, Kanadas drittgrößter Stadt, entfernt.
Eine beliebte Touristenattraktion dort ist die Capilano Canyon Suspension Bridge, die größte Fußgängerhängebrücke der Welt. [36]Sie ist zwar nur gut einen Meter breit, dafür aber 140 Meter lang. Umringt von riesigen Zedernbäumen, ragt die Brücke in einer Höhe von 70 Metern über den rauschenden Capilano River. Das Geländer ist niedrig, und es kippt und schaukelt ununterbrochen. Eine wacklige Angelegenheit. Ein aufregender Ort.
Ein kleines Stück flussaufwärts gibt es eine weitere Brücke. Sie besteht aus festem Zedernholz, ist drei Meter hoch und führt über einen schmalen Nebenarm des Flusses. Hier ist nichts wacklig und aufregend, sondern alles solide und langweilig.
Damit ist der Capilano-Canyon der ideale Ort für das »Brücken-Experiment«, das unter den Liebesforschern der Welt inzwischen legendär ist.
Der Versuch sieht folgendermaßen aus: Eine hübsche Mitarbeiterin der Forscher begibt sich in den Park, ausgerüstet mit einem belanglosen Fragebogen. Einmal stellt sich die Frau auf die wacklige Hängebrücke, ein anderes Mal auf die harmlose Holzbrücke. Dort bittet sie die männlichen Passanten, den Fragebogen auszufüllen, was die meisten Männer auch bereitwillig tun. Es handele sich um ein Projekt, sagt die Frau, mit dem sie versuche herauszufinden, wie sich Naturszenarien auf die kreative Ausdruckskraft auswirken. Dann, sobald der Bogen bearbeitet ist, reißt sie die Ecke eines Stück Papiers ab, notiert ihre Telefonnummer und bietet dem Mann an, ihre Arbeit näher zu erläutern, »wenn mal mehr Zeit dazu ist«.
Das Resultat ist verblüffend: Neun von 18 Männern, die den Fragebogen auf der Hängebrücke ausgefüllt haben, rufen an. Dagegen greifen nur zwei der 16 Passanten von der Holzbrücke zum Hörer, um sich angeblich nach dem Projekt zu erkundigen.
Wie es scheint, hatte Ovid Recht. Unsere Anziehungskraft hängt nicht nur von uns ab, sondern auch von den Umständen. Von dem Ort, an dem wir uns befinden. Von der Aufregung oder der Langeweile, die diesen Ort charakterisieren. Die Männer der Hängebrücke meldeten sich immerhin viermal häufiger bei der Frau als jene der Holzbrücke.
Aber vielleicht hatte die Aufregung nur ihr Interesse an dem Arbeitsprojekt der Frau geweckt? Oder an der Wackelbrücke waren neugierigere Leute als an der stabilen? Nicht ganz, wie ein Kontrollversuch der Psychologen nahe legt: Als sie einen Mann mit einem Stapel Fragebögen in den Capilano-Park schicken, der auf den beiden Brücken die männlichen Passanten anspricht, klingelt das Telefon so gut wie gar nicht. [37]
Fazit: Die Männer der Hängebrücke hatten nicht etwa eine plötzliche Faszination für das Thema Kreativität entwickelt, sondern für die Frau. Aus ihrer Aufregung war Erregung geworden.
Balzbeobachtungen in der Bar
Nicht überall gibt es Brücken, die uns beim Verführen behilflich sind, aber es gibt überall Bars. Die vielen unbekannten Gesichter, die Musik, das schummrige Licht – auch das Drumherum einer Kneipe kann uns leicht in körperliche Erregung versetzen. Man könnte sagen: Was die Hängebrücke für den Canyon ist, das ist die Bar für die Stadt. Nicht umsonst wird an diesem Ort besonders gern geflirtet.
Und so begaben sich David Givens [42]und, wenige Jahre nach ihm, Timothy Perper [43]in das natürliche Habitat des Verführers: in Bars und Discos, in Cafés und auf Cocktailpartys. Jahrelang beobachteten die Anthropologen das Balzverhalten des Homo sapiens – heimlich, versteht sich.
Was gar nicht so leicht ist. Um bei ihren Feldobservationen nicht aufzufallen, mussten sich die Forscher so manchen Trick einfallen lassen. Givens beispielsweise berichtet, wie er möglichst dezent vorging. »Wenn ein Mann oder eine Frau mich beim Gucken erwischte, sah ich nicht sofort weg«, so der Flirtforscher. »Ich hielt meine Augen in Position, und dann bewegte ich sie langsam nach oben, als sei ich tief in Gedanken versunken.« [44]