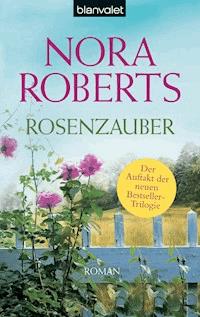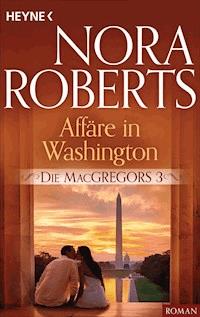
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die MacGregor-Serie
- Sprache: Deutsch
Familie, Liebe, Leidenschaft: Der faszinierende MacGregor-Clan.
Shelby Campbell weiß aus schmerzlicher Erfahrung, was es heißt, eine öffentliche Person zu sein und das Leben in der Politik zu führen. Die sympathische Betreiberin eines Töpferladens ist deshalb nicht begeistert, als Senator Alan MacGregor sie mit Aufmerksamkeiten überschüttet. Sie hat sich geschworen, nie einen Politiker zu heiraten, mag er eine noch so viel versprechende Karriere vor sich haben, mag er noch so sexy sein, mögen die Herzen noch so im Takt schlagen. Kann sie diesen Mann ablehnen, der Himmel und Erde in Bewegung setzt, um sie zu gewinnen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Nora Roberts
Die MacGregors 3
Affäre in Washington
Roman
Aus dem Amerikanischenvon Christiane Schmidt
Wilhelm Heyne Verlag München
1. KAPITEL
Shelby wusste, dass Washington eine verrückte Stadt war. Doch gerade deshalb lebte sie dort so gern. Man konnte hier Eleganz finden und Tradition, aber auch einen exzentrischen Club aufsuchen oder ein Kabarett mit witzig-frechen Darbietungen.
Durchstreifte man die Stadt von einer Seite zur anderen, stieß man auf viel Gegensätzliches. Schimmernd weiße Monumente und imponierende Regierungsgebäude standen neben modernsten Stahl- und Glaskästen, dazwischen versteckten sich alte Backsteinhäuser. Würdige Statuen, schon vor so vielen Jahren oxidiert, dass sie sich selbst nicht mehr daran erinnern konnten, wann sie grün geworden waren. Straßen mit holprigem Kopfsteinpflaster führten zum Watergate.
Aber die City hatte sich nicht planlos zu diesem Durcheinander entwickelt, das Herz von allem war das Capitol. Und um Politik drehte sich der Reigen.
Washington brodelte wie kochendes Wasser, aber es war ganz anders als das unpersönliche New York. Hier ging man freundlicher miteinander um. Man war in der Regel höflich, rücksichtsvoll und oft sogar liebenswürdig.
Für die meisten Männer und Frauen, die in Washington ihrer Arbeit nachgingen, hatten die Jobs nur von einer Präsidentschaftswahl bis zur nächsten Gültigkeit. Man war hier also nicht gerade von Sicherheit umhüllt.
Aber genau diese Art Leben entsprach Shelbys Geschmack. Für sie war jede Garantie gleichbedeutend mit monotoner Selbstzufriedenheit, und sie hatte es zu ihrem obersten Grundsatz gemacht, dass Langeweile in ihrem Leben keinen Platz haben sollte.
Im Stadtteil Georgetown fühlte sie sich rundum wohl. Georgetown war nicht das Zentrum von Washington, aber hier dominierte die Universität. Jugendliche Unbekümmertheit drückte sich in den Schaufenstern der Boutiquen aus, zeigte sich an Sonnentagen auf den Gehsteigen vor den Cafeterias. Das Bier kostete mittwochabends nur den halben Preis. Hübsche kleine Häuser schmückten sich mit bunten Fensterläden, und ehrbare Damen führten wohlerzogene Hunde an der Leine spazieren.
Man tolerierte einander, das gefiel Shelby.
Ihr Laden lag in einer der engen älteren Gassen, im zweiten Stockwerk befand sich ihre kleine Wohnung. Dort war sogar ein Balkon, von dem aus sie in warmen Sommernächten das Leben und Treiben in der Stadt beobachten konnte. Alle Fenster ließen sich vor neugierigen Blicken mit Bambusrollos abschirmen, doch davon machte sie höchst selten Gebrauch.
Shelby Campbell war kein Eigenbrötler. Sie liebte Unterhaltung, Publikum und Bewegung. Lärm sagte ihr mehr zu als Stille, und mit Fremden redete sie genauso gern wie mit alten Freunden. Da sie jedoch selbst über sich bestimmen und ihrem eigenen Geschmack und Rhythmus gemäß leben wollte, hatte sie als Hausgenossen nicht Menschen, sondern Tiere gewählt.
Der einäugige Kater hieß Moische und der Papagei Tante Emma, der sich standhaft weigerte, mit irgendjemandem ein Wörtchen zu sprechen. Friedlich lebten die drei in dem genialen Durcheinander zusammen, das Shelby als ihr Heim bezeichnete.
Von Beruf Töpferin, war Shelby gleichzeitig eine gute Geschäftsfrau. Der kleine Laden, den sie vor drei Jahren unter dem Namen »Calliope« eröffnet hatte und wo sie ihre Erzeugnisse verkaufte, lief ausgezeichnet. Der Umgang mit den Kunden machte ihr genauso viel Freude wie die Arbeit an ihrem Töpferrad, wo sie aus einem Klumpen Ton mit viel Fantasie die hübschesten Dinge zu zaubern verstand. Der Papierkram, den sie als Inhaberin des Geschäfts erledigen musste, war ihr zwar ein ständiger Dorn im Auge, aber solche kleinen Unannehmlichkeiten machten für Shelby eigentlich erst den wahren Reiz des Lebens aus. So war »Calliope« zum Vergnügen ihrer Familie und dem Erstaunen vieler Bekannten unbestreitbar ein Erfolg geworden.
Um sechs Uhr pünktlich begann der Feierabend. Von Anfang hatte es sich Shelby zur Regel gemacht, ihre Freizeit nicht zu opfern. Natürlich kam es vor, dass sie bis in die frühen Morgenstunden an einem besonderen Stück arbeitete, Glasuren mischte und den Brennofen in Gang hielt. Aber in solchem Falle war die Künstlerin am Werk, die clevere Geschäftsfrau hielt überhaupt nichts von Überstunden.
Am heutigen Abend jedoch musste sie wohl oder übel etwas tun, das sie gern vermieden hätte: einer Verpflichtung nachkommen. Sie löschte das Licht und kletterte die Treppe hinauf zur zweiten Etage. Der Kater erwachte, als seine Herrin erschien. Er streckte sich und sprang vom Fensterbrett herunter. Wenn Shelby kam, konnte das Abendessen nicht weit sein. Auch der Vogel schüttelte seine bunten Flügel und knackte mit dem krummen Schnabel.
»Wie geht es dir?«, erkundigte sich Shelby bei Moische und kraulte ihn hinter den Ohren, was er immer besonders genoss. Mit freundlichem Schnurren schaute der Kater zu ihr auf und drückte seinen Kopf gegen die Hand seiner Herrin. »Die schwarze Augenklappe steht dir ausgezeichnet«, lobte Shelby und holte das Futter für Moische.
Dabei wurde ihr deutlich, wie hungrig sie selbst war. Zum Essen hatte sich einfach keine Zeit gefunden, und jetzt musste sie sich beeilen, um nicht zu spät auf der Party zu erscheinen. Hoffentlich gibt es ausnahmsweise etwas mehr als Snacks und Salzgebäck, dachte sie. Sie hatte es ihrer Mutter fest versprochen, dass sie zu dem Empfang des Abgeordneten Write kommen würde, da half alles nichts. Deborah Campbell, ihre Mutter, verstand keinen Spaß, wenn man sein Wort nicht hielt.
Shelby liebte ihre Mutter sehr, mehr und auf eine andere Art, als es bei Kindern im Allgemeinen üblich war. Trotz der fünfundzwanzig Jahre Altersunterschied wurden Deborah und Shelby Campbell manchmal für Schwestern gehalten. Beide hatten leuchtendes kastanienrotes Haar. Deborah trug es kurz geschnitten, eng am Kopf anliegend. Um Shelbys Gesicht wogte eine lange, lockige Mähne, und Ponyfransen, die meist dringend einer Kürzung bedurften, fielen ihr in die Stirn. Bei Deborah Campbell wirkte diese Kombination zart und vornehm. Shelby erinnerte mit ihrem schmalen Gesicht und den betonten Wangenknochen, die sie etwas hohlwangig erscheinen ließen, ein wenig an ein verlassenes Waisenkind, das an der Straßenecke kauerte und Blumen zum Verkauf anbot. Gelegentlich unterstrich sie diesen Eindruck noch durch geschicktes Make-up und leicht antik wirkende Kleidung, für die sie eine besondere Vorliebe hatte.
Shelby mochte äußerlich viel von ihrer Mutter haben, sonst aber glich sie ihr nicht. Es war ihr nicht bewusst, dass sie besonders eigenständig oder exzentrisch war. Diese Züge gehörten einfach zu ihrem Wesen.
In Washington aufgewachsen, vor dem Hintergrund hoher Politik, lebte sie mit größter Selbstverständlichkeit in dieser Umgebung. Wochenlang hatte die Familie den Vater nicht zu Gesicht bekommen, wenn Wahlfeldzüge ihn in Atem hielten, finanzielle Transaktionen organisiert und durchgeführt wurden und Parteiinteressen oberstes Gebot waren. All das bildete einen nicht wegzudenkenden Teil ihrer Vergangenheit.
Sie erinnerte sich gut an sorgsam geplante Kindergesellschaften, die wie Pressekonferenzen vorbereitet werden mussten. Die Kinder von Senator Campbell gehörten zu seinem Image, und alle Bemühungen in dieser Richtung hatten ein gemeinsames Ziel: den Sessel hinter dem großen Schreibtisch im Weißen Haus.
Dabei war sich Shelby absolut im Klaren, dass ihr Vater es nicht nötig hatte, sich und anderen etwas vorzumachen. Er war ein ausgezeichneter, fähiger Mann, fair, großzügig und vortrefflich geeignet für dieses hohe Amt.
Aber sein Sinn für Humor und sein politischer Weitblick hatten ihn nicht vor der Revolverkugel eines Wahnsinnigen schützen können.
Seitdem waren fünfzehn Jahre vergangen. Shelby war damals zu der Erkenntnis gelangt, dass die Politik ihren Vater getötet hatte. Jeder Mensch musste sterben – so viel hatte sie schon als elfjähriges Kind verstanden. Aber der Zeitpunkt kam zu früh für Robert Campbell. Wenn der Tod sogar einen Mann wie ihn, den sie für unverwundbar gehalten hatte, vorzeitig treffen konnte, dann war niemand in diesem Geschäft davor sicher. Jeder befand sich täglich in Lebensgefahr.
Seinerzeit, als verzweifeltes, unglückliches kleines Mädchen, hatte Shelby sich fest vorgenommen, jeden Moment ihres Lebens zu genießen und so viel wie möglich aus diesem Erdendasein herauszuquetschen. Und an diesem Entschluss hatte sich bis heute nichts geändert.
Auch bei der Write’schen Cocktailparty in der geräumigen Villa auf der anderen Flussseite würde irgendetwas amüsant und unterhaltsam sein. Einen verlorenen Abend akzeptierte Shelby nicht.
Shelby hatte sich verspätet, aber das war bei ihr nichts Außergewöhnliches und hätte deshalb niemanden verwundert. Nicht aus Nachlässigkeit war sie so oft unpünktlich oder etwa deshalb, weil sie Aufmerksamkeit erregen wollte, keineswegs. Die Dinge, die sie sich vorgenommen hatte, dauerten einfach immer ein bisschen länger als vorausgesehen. An diesem Abend jedoch waren so viele Menschen in dem großen weißen Landhaus versammelt, dass Shelbys Eintreffen nicht einmal bemerkt wurde.
Der Empfangssaal war riesig, ihre Wohnung hätte leicht darin Platz gehabt. Helle Farbtöne dominierten und ließen alles noch weiträumiger erscheinen. Einige wertvolle französische Ölbilder in Goldrahmen hingen an den Wänden. Diese Umgebung gefiel Shelby, obwohl sie darin nicht hätte leben mögen. Auch den Geruch von Tabak, Parfums und Eau de Cologne mochte sie. Es war der Duft gepflegter Partys mit elegantem Publikum.
Die Konversation drehte sich um typische Themen: Kleider, andere Leute, Golfturniere. Interessanter aber waren die leisen Töne, das Gemurmel über Preisindex, neueste Nachrichten von der NATO und das aufsehenerregende Fernsehinterview mit dem Staatssekretär.
Shelby kannte die meisten der elegant gekleideten Gäste. Sie nickte grüßend nach allen Seiten und fand mit sicherem Instinkt den Weg zum kalten Büfett. Essen war für Shelby eine ernst zu nehmende Angelegenheit.
Als sie die leckeren, fingerdicken Kanapees erspähte, erkannte sie mit Genugtuung, dass es sich tatsächlich für sie gelohnt hatte, zu dieser Party zu kommen.
»Grüß dich, Shelby! Es ist mir überhaupt nicht aufgefallen, dass du gekommen bist. Aber ich freue mich sehr, dass du es einrichten konntest.« Carol Write, in pastellfarbenem Chanelkostüm elegant wie immer, war durch die Reihen der Gäste zu Shelby geschlüpft, ohne auch nur einen Tropfen ihres Sherrys zu verschütten.
»Ich habe es leider nicht eher geschafft.« Shelby küsste die Freundin ihrer Mutter auf die Wange, was mit dem vollen Teller in der Hand gar nicht so einfach war. »Ihr Haus ist wunderschön, Mrs. Write.«
»Danke, Shelby. Ich zeige dir gern später die anderen Räume, wenn ich etwas mehr Zeit habe.« Mit dem prüfenden Blick einer vollendeten Gastgeberin, der das Wohl ihrer Gäste am Herzen lag, sah sich Carol Write um. Erst nachdem sie befriedigt festgestellt hatte, dass alles klappte, sprach sie weiter. »Wie läuft’s in deinem Shop?«
»Danke, vorzüglich! Ich hoffe, der Herr Abgeordnete ist wohlauf?«
»Oh ja. Er wird dich begrüßen wollen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr er sich über den großen Aschenbecher gefreut hat, den du ihm für sein Büro angefertigt hast.« Obwohl Carol Write ihre texanische Herkunft in der Sprache nicht verleugnen konnte, redete sie mit der Schnelligkeit eines New Yorker Straßenhändlers. »Er sagte, das sei bei Weitem sein hübschestes und praktischstes Geburtstagsgeschenk gewesen. Aber du solltest dich unter die Gäste mischen und nicht allein hier stehen.«
Carol hatte Shelbys Arm ergriffen und führte sie vom Büfett weg. Shelby bedauerte das, sie hätte gern ihren Teller noch einmal aufgefüllt.
»Wirklich, niemand kann besser Konversation machen als du. Zu viel einseitige Unterhaltung ist für eine Party tödlich. Die meisten Leute kennst du, aber … Oh, da ist ja Deborah! Ich lasse euch einen Augenblick allein. In ein paar Minuten komme ich zurück und entführe dich wieder.«
Erleichtert drehte sich Shelby um und ging erneut zum Büfett. »Hallo, Mom.«
»Ich fürchtete schon, du hättest gekniffen.« Deborah Campbell musterte die Tochter kritisch. Der bunte Rock, die weiße Trachtenbluse und das Bolerojäckchen standen ihr vorzüglich. Wie war es möglich, dass Shelby Dinge tragen konnte, die bei anderen jungen Frauen wie ein Faschingskostüm gewirkt hätten?
»Wie könnte ich? Hab’s doch versprochen.« Mit Kennerblick prüfte Shelby die Speisen auf der reich gedeckten Tafel, bevor sie ihre Wahl traf. »Das Essen ist besser, als ich annahm.«
»Shelby! Du darfst nicht immerzu an deinen Magen denken.« Mit einem halben Seufzer hakte Deborah ihre Tochter unter. »Falls du es noch nicht bemerkt haben solltest … hier sind einige recht nette, gut aussehende Männer.«
»Versuchst du schon wieder, mich unter die Haube zu bringen?« Shelby küsste die Mutter liebevoll auf die Wange. »Dabei habe ich dir den Kinderarzt noch nicht verziehen, den du mir vor ein paar Wochen aufschwatzen wolltest.«
»Das ist ein sehr charakterstarker, tüchtiger junger Mann.«
»Hm.« Taktvoll verschwieg Shelby ihrer Mutter, dass sie den »charakterstarken« Mediziner als einen Zudringling kennengelernt hatte, der seine Hände nicht unter Kontrolle halten konnte, und dass sie sich deshalb seine Gesellschaft hatte verbitten müssen.
»Im Übrigen will ich dich beileibe nicht unter die Haube bringen«, fuhr ihre Mutter fort. »Ich möchte nur, dass du glücklich bist.«
»Bist du denn selbst glücklich?«, konterte Shelby lächelnd.
»Natürlich, warum nicht?« Gedankenverloren drehte Mrs. Campbell an dem Brillantclip in ihrem linken Ohr. »Weshalb fragst du?«
»Weil es mich wundert, dass du noch nicht wieder vor dem Traualtar warst.«
»Aber Shelby! Schließlich bin ich lange Jahre verheiratet gewesen, habe einen Sohn und eine Tochter …«
»… die dich anbeten«, unterbrach Shelby die Mutter. Dann wechselte sie das Thema. »Für den Ballettabend im Kennedy Center habe ich zwei Karten. Hast du Lust, mitzukommen?«
Die Wolke des Unmuts verflog aus Deborah Campbells Gesicht. Sie konnte Shelby einfach nicht böse sein. »Gut, dass du ablenkst. Selbstverständlich, mit dem größten Vergnügen komme ich mit.«
»Gibt’s vorher bei dir was zu essen?«, erkundigte sich Shelby und nickte im nächsten Moment einem jungen Mann zu. »Hi, Steve! Du schaust gut aus. Wo hast du gesteckt?«
Amüsiert beobachtete Deborah Campbell, wie ihre Tochter sich gleichzeitig unterhielt und den Obstsalat entdeckte. Der sportliche Pressesekretär und ein neuer Direktor von EPA traten hinzu. Freigiebig versprühte Shelby ihren Charme, die jungen Männer fühlten sich in ihrer Gesellschaft sichtbar wohl.
Warum wehrt sich meine hübsche Tochter so gegen jede festere Bindung? überlegte Deborah. Dabei hat sie offensichtlich im Prinzip nichts gegen eine Eheschließung einzuwenden. Aber sie zieht eine hohe Mauer um ihre Privatsphäre.
Mit Freuden hätte sie Shelby tröstend oder beratend zur Seite gestanden, doch dafür ergab sich keine Gelegenheit. Es war Mrs. Campbell nicht entgangen, dass ihre Tochter seit fünfzehn Jahren um tiefe Gemütsbewegung und jedweden Seelenschmerz bewusst und mit großem Erfolg einen Bogen machte. Aber ohne Schmerz gab es kein Glücklichsein, keine Erfüllung. Ohne Schatten kein Licht …
Deborah Campbell seufzte. Wie oft hatte sie versucht, mit der Tochter darüber zu sprechen. Es war zwecklos. Und wenn sie Shelby betrachtete, wie sie sorglos lachte und mühelos plauderte, strahlend, jung und hübsch – dann erschienen ihr alle Befürchtungen unsinnig. Vielleicht sehe ich Gespenster, tröstete sie sich. Glück ist eine sehr persönliche Sache. Wer kann in einen anderen Menschen hineinsehen?
Alan MacGregor beobachtete die junge Frau mit dem Flammenhaar, die wie eine wohlhabende Zigeunerin gekleidet war. Er hörte, wie ihr Lachen klang – sinnlich und unschuldig zugleich. Ein interessantes Gesicht, stellte er fest. Es ist außergewöhnlich, nicht unbedingt schön. Wie alt mag sie sein? Achtzehn oder dreißig? Sie war kein Partytyp. Alan hatte, seit er in Washington war, schon genug solcher Gesellschaften besucht, um das beurteilen zu können. Sie gab sich weder geziert noch scheu, sie war einfach natürlich. Diesen bunten Rock hatte sie bestimmt nicht in einem der üblichen Modegeschäfte gekauft, wohin alle Politikerfrauen liefen. Und ihre Frisur entsprach weder der augenblicklichen Geschmacksrichtung, noch schien sie einen teuren Salon dafür bemüht zu haben. Aber es stimmt alles, dachte Alan. Das Flair von Los Angeles und etwas New Yorker Paprika, und trotzdem passte eins zum anderen. Wer, zum Teufel, ist …
»Wie geht’s, Senator?« Der Hausherr legte Alan freundschaftlich seine Hand auf die Schulter. »Freut mich, Sie auch außerhalb der Arena zu treffen. Wir sollten öfter mal ausbrechen.«
»Der Scotch ist hervorragend, Charlie.« Alan hob sein Glas zum Nachschenken. »Er bringt einen immer in Stimmung.«
»Nach allem, was man hört, werden Sie ja langsam Experte auf diesem Gebiet.« Der Ältere winkte gut gelaunt einen Kellner herbei und wies auf Alan.
Der lächelte. »In Washington bleibt nichts verborgen. Ja, augenblicklich tut sich so allerhand.«
Charlie Write nickte zustimmend. »Mich würde Ihre Meinung über das Breiderman’sche Papier interessieren, das nächste Woche besprochen werden soll.«
Alan blickte den Abgeordneten ruhig an. Write unterstützte diese Sache, das wusste er. »Ich bin dagegen«, sagte er einfach. »Wir können auf dem Bildungssektor keine Abstriche mehr verkraften.«
»Na, na, Alan! Wir beide wissen doch, dass man solche Dinge nicht schwarz und weiß sehen kann.«
»Manchmal wird die Grauzone zu groß, dann sollte man besser zum Grundsätzlichen zurückkehren.« Alan merkte erstaunt, dass ihm an einer politischen Unterhaltung augenblicklich gar nichts lag. Durfte ein Senator überhaupt kein Privatleben haben? Aber Alan MacGregor war immerhin Diplomat genug, sich seine Gedanken nicht anmerken zu lassen. Er schaute wie unabsichtlich in Shelbys Richtung. »Ich glaubte, hier langsam jeden zu kennen. Aber Sie müssen mir helfen – wer ist die junge Frau dort drüben, die ein Mittelding zu sein scheint zwischen Prinzessin und Landfräulein?«
»Wen meinen Sie?« Writes Neugier war erwacht, und er folgte Alans Blick mit den Augen. »Oh, nun sagen Sie nur nicht, dass Sie Shelby noch nicht kennen!« Er lachte, die Beschreibung gefiel ihm. »Soll ich Sie vorstellen?«
»Danke, nicht nötig. Ich werde mich mal heranpirschen.« Alan schlenderte durch die Reihen der Gäste. Er plauderte hier und lachte dort, hielt sich aber nirgendwo länger auf. In dieser Beziehung hatte er viel Ähnlichkeit mit Shelby, denn es gelang ihm mühelos, das rechte Wort zum richtigen Zeitpunkt zu finden. Seine Freundlichkeit war ungekünstelt, und für Gesichter besaß er ein ausgezeichnetes Gedächtnis. Bei einem Mann, dessen Karriere ebenso sehr von der Gunst des Publikums abhängig war wie vom eigenen Können, waren diese Fähigkeiten eine grundlegende Voraussetzung. Alan verstand sein Handwerk.
Nach gründlichem Studium der Rechtswissenschaften war er auf allen juristischen Gebieten bewandert. Sein Bruder Caine hatte sich mit der gleichen Ausbildung für den Anwaltsberuf entschieden. Aber Alan war damit nicht zufrieden, er wollte mehr erreichen. Ihn faszinierte die Gesetzgebung in Theorie und Anwendung und die entsprechende verfassungsmäßige Nutzung für das Wohl des Volkes. Deshalb hatte er die politische Laufbahn eingeschlagen, und sein bisheriger Weg führte steil bergauf. Mit fünfunddreißig Jahren bereits Senator zu sein war sehr zufriedenstellend. Und eine viel versprechende Zukunft mit fast unbegrenzten Möglichkeiten lag in Griffnähe vor ihm.
»Sind Sie allein, Alan?« Myra Ditmeyer, die Frau eines der obersten Richter, legte ihre Hand auf seinen Arm, als er vorüberging.
Alan blieb stehen und küsste mit dem Vorrecht eines alten Freundes ihre Wange. »Soll das ein Angebot sein?«
Myra lachte schallend. »Wenn ich zwanzig Jahre jünger wäre, würde ich Sie beim Wort nehmen, Sie schottischer Herzensbrecher.« Mit klugen, freundlichen Augen strahlte sie den jüngeren Mann an. »Warum hängt heute Abend keines dieser bemalten, nichtssagenden Mädchen an Ihrem Arm?«
»Weil ich hoffte, Sie zu einem Wochenendausflug nach Puerto Vallerta überreden zu können.«
Myra tippte mit ihrem langen, rot gelackten Fingernagel nachdrücklich auf Alans weiße Hemdbrust. »Sie meinen wohl, es sei kein Risiko, mit einer alten Frau derartige Scherze zu treiben, was? Aber leider haben Sie damit recht.« Gut gelaunt seufzte sie und fuhr fort: »Warten Sie nur ab. Man müsste eine ganz gefährliche Person auf Sie ansetzen. Ein Mann in Ihren Jahren und noch allein – ich werde mir darüber Gedanken machen.« Sie zog die Augenbrauen hoch und meinte neckend: »Die Amerikaner mögen es lieber, wenn ihre Präsidenten ordentlich verheiratet sind, mein lieber Alan.«
»Das sagt mein Vater auch immer.« Mit gespieltem Ernst ging er auf ihren Ton ein.
»Dieser alte Pirat!« Die Unterhaltung amüsierte sie aufs Äußerste. »Manchmal hat er nicht unrecht, Sie täten gut daran, hin und wieder auf ihn zu hören. Zu einem erfolgreichen Politiker gehört die richtige Partnerin.«
»Sie raten mir demnach, nur meiner Karriere zuliebe vor den Traualtar zu treten?«
»Versuchen Sie nicht, mich auf den Arm zu nehmen, mein Junge.« Myra bemerkte, dass Alans Blick in eine bestimmte Richtung gelenkt wurde, aus der ein dunkles, wohlbekanntes Lachen ertönte.
Hoppla! dachte sie und wurde sofort aufmerksam. Wäre das wohl eine interessante Zusammenstellung? Der Fuchs und der Schmetterling!
»Ich gebe nächste Woche ein Abendessen«, sagte sie und erwähnte natürlich nicht, dass diese Idee ihr soeben erst gekommen war. »Nur ein paar Freunde kommen. Meine Sekretärin ruft Ihr Büro an und gibt alles Nähere durch.« Sie tätschelte Alan mit ihrer reich beringten Hand die Wange und entfernte sich, um einen günstigen Platz zu suchen, von dem aus sich die weitere Entwicklung des Abends gut beobachten ließ.
Alan sah, dass Shelby sich von den Gästen abwandte, mit denen sie eben noch gesprochen hatte. Sofort bewegte er sich in ihre Richtung. Das Erste, was er bemerkte, als er in ihre Nähe kam, war der Duft, der von ihr ausströmte. Nicht Blüten, Kräuter oder Moschus, sondern eine aufreizende, völlig unbekannte Mischung aus allen drei Substanzen. Seine Nase nahm diesen Geruch nicht als Parfum wahr, sondern als unvergessliches Signal.
Shelby hatte sich vor eine Glasvitrine gekauert und presste beinahe ihre Nase an die Scheibe. »Porzellan aus dem achtzehnten Jahrhundert«, wisperte sie, als er hinter ihr stand. »Ist es nicht wunderschön?«
Alan betrachtete die hauchdünne Schale und ließ dann seinen Blick zu Shelbys schimmernd rotem Haar wandern, das ihm bei Weitem besser gefiel. »Wirklich aufsehenerregend«, sagte er anerkennend.
Shelby schaute über ihre Schulter zu ihm auf und lächelte. Das war so überraschend und bezaubernd wie ihr Duft. »Hallo!«
»Guten Abend.« Alan ergriff die ausgestreckte Hand, die hart und kräftig war und absolut nicht zu ihrer Erscheinung passte, und half Shelby aufzustehen. Gegen seine sonstige Gewohnheit hielt er ihre Finger fest.
»Ich wurde von meinem Ziel abgelenkt«, erklärte sie freundlich. »Würden Sie mir einen Gefallen tun?«
Alan blickte sie erstaunt an. »Und was?«
»Nur stehen bleiben und mir Rückendeckung geben.« Blitzschnell nahm sie einen Teller vom Büfett und belud ihn. »Immer ist mir jemand dazwischengekommen«, erklärte sie. »Ich hatte nämlich keine Zeit zum Abendessen und bin schrecklich hungrig. So, das genügt.« Zufrieden drehte sie sich zu Alan um. »Wir könnten auf die Terrasse gehen.« Schon war sie auf dem Weg. Alan folgte ihr verblüfft.
Die Luft war lau und voller Fliederduft. Das Mondlicht fiel silbern auf frisch gemähten Rasen und verzauberte die herabhängenden Zweige einer knorrigen alten Weide.
Mit einem tiefen zufriedenen Seufzer angelte sich Shelby eine frittierte Krabbe und steckte sie in den Mund. »Was das hier ist, weiß ich wirklich nicht«, meinte sie und betrachtete eine Pastete von allen Seiten. »Probieren Sie mal und sagen Sie’s mir.«
Als handle es sich um die wichtigste Sache der Welt, nahm Alan ein Stückchen von Shelbys Teller, kostete mit prüfender Miene und erklärte dann: »Gänseleber in Blätterteig mit einem Hauch von Maronen.«
»Hmm, könnte stimmen.« Shelby vertilgte den Rest der Speise. »Ich bin Shelby«, bemerkte sie kauend und stellte den halb leeren Teller auf einen Beistelltisch.
»Und ich Alan.« Ein belustigtes Lächeln huschte über sein Gesicht, während sie sich beide auf eine Gartenbank setzten. Wie in aller Welt war dieses bemerkenswerte Geschöpf einzuordnen? Das musste er unbedingt herausfinden. Außerdem war die frische Frühlingsluft eine willkommene Abwechslung nach dem Tabakrauch und der Wärme im Haus. Einladend deutete er auf sein Glas. »Wie wäre es mit einem Schluck?«
Shelby betrachtete ihren Begleiter aufmerksam. Er war ihr schon vorher aufgefallen, wahrscheinlich wegen seiner Größe und athletischen Figur. Sportler traf man nicht sehr oft auf diesen Washingtoner Partys. Die meisten Herren achteten auf ihre Figur, sie joggten und spielten Squash, aber dieser erinnerte mehr an einen Schwimmer. Ein Langstreckenschwimmer vielleicht? Sie konnte sich gut vorstellen, wie er mühelos durch die Wellen glitt.
Sein Gesicht war hager und rassig, der Mund schmal unter einer Nase, die ein wenig schief stand. Das gefiel Shelby. Auch das Zwinkern in seinen Augen mochte sie leiden. Das dunkle Haar und die dunklen Augen erinnerten sie an einen Ritter in ihrem Kindermärchenbuch. Er wirkte verlässlich und beruhigend, andererseits auch wieder ein wenig aufregend. Ihre Lippen verzogen sich zu einem Lächeln.
»Was trinken Sie denn?«
»Scotch – Whisky on the rocks.«
»Ich freue mich, dass man Ihnen trauen kann.« Sie nahm ihm das Glas ab und nippte an dem Whisky. Ihre Augen blitzten Alan über den schimmernden Rand fröhlich an, das Mond- und Sternenlicht stand ihr vorzüglich. Sie sah aus wie eine kleine Waldelfe, die jeden Augenblick von einem Windhauch durch die Lüfte davongetragen werden konnte.
»Weshalb sind Sie hier?«, fragte er neugierig.
»Mütterlicher Druck. Kennen Sie das auch?«
Er verstand sie sofort. »Väterlicher Druck trifft bei mir eher zu.«
»Das dürfte kein großer Unterschied sein.« Shelby nahm noch einen Schluck Whisky. »Wohnen Sie auf dieser Flussseite?«
»Nein, in Georgetown.«
»Was Sie nicht sagen! Wo denn?«
Das Mondlicht glitzerte jetzt in ihren Augen, die so leuchtend silbergrau waren, wie Alan noch nie welche gesehen hatte. »In der P-Street.«
»Seltsam, dass wir uns noch nie begegnet sind. Mein Laden liegt dort ganz in der Nähe.«
»Sie führen ein Geschäft?« Wahrscheinlich ausgefallene Kleider, Samtjäckchen und Modeschmuck, mutmaßte er.
»Ich bin Töpferin.«
Impulsiv nahm Alan Shelbys Hände, drehte die Innenflächen nach oben und betrachtete sie prüfend. Es waren schmale Hände mit langen Fingern und kurz geschnittenen, unlackierten Nägeln. Sie waren angenehm zu halten, das galt auch für das schlanke Handgelenk unter einem schweren goldenen Armband. »Sind Sie gut?«, fragte er.
»Ich bin fantastisch!« Shelby spürte erstaunt, dass es ihr heute schwerfallen würde, nach ihrer selbst erdachten Vorsichtsmaßnahme zu verfahren. Normalerweise hätte sie schon längst aufstehen und den Kontakt zu diesem Mann abbrechen müssen. Wenn ich es jetzt nicht tue, ist es vielleicht zu spät, und er hält meine Hände morgen auch noch, dachte sie. Doch sie forschte weiter. »Sie stammen nicht aus Washington, woher kommen Sie?«
»Aus Massachusetts.«
»Ah ja! Eine Spur von Harvard ist geblieben. Aber Mediziner sind Sie gewiss nicht«, überlegte sie laut und bewegte ihre Finger in Alans Hand, ohne sich seinem Griff zu entziehen. »Für einen Arzt sind Ihre Ballen nicht weich genug.«
Welchen Beruf mochte er haben? War er Künstler? Der leicht träumerische, grüblerische Ausdruck in seinen Augen ließ auf einen Menschen schließen, der dazu neigte, die Dinge erst gründlich zu durchdenken, ehe er handelte.
Alan hatte sich die ernsthafte Inspektion geduldig gefallen lassen, doch nun schien es ihm an der Zeit, seine Gesprächspartnerin aufzuklären. »Jurist«, sagte er und fügte, als er Shelbys verwirrte Miene sah, hinzu: »Enttäuscht?«
»Nur überrascht«, erwiderte sie. »Das liegt wohl daran, dass ich mir alle Anwälte mit weißer Perücke und dicken Augengläsern vorstelle. Bei einer Menge alltäglicher Dinge können einen Gesetze ganz schön nerven, finden Sie nicht auch?«
Alan hob verwundert die Brauen. »Bei Mord und Totschlag etwa?«
»Nein, das meine ich natürlich nicht, das ist doch nichts Alltägliches, oder? Ich dachte an die endlosen bürokratischen Vorschriften. Sie können sich kein Bild machen, wie viele Formulare ich ausfüllen muss, nur um meine Töpferwaren zu verkaufen. Das muss doch gelesen und bearbeitet, von Neuem verschickt und sortiert werden und so weiter. Wäre es nicht praktischer, man ließe mich die paar Vasen einfach so gegen Entgelt unter die Leute bringen und meinen Lebensunterhalt damit verdienen?«
»Das würde problematisch, wenn’s in die Millionen ginge.« Alan hatte vollkommen vergessen, dass er nicht diskutieren wollte. Unbewusst spielte er mit dem Ring, der an Shelbys kleinem Finger steckte. »Nicht jeder Einzelhändler würde sich an faire Geschäftsgrundlagen halten, niemand wäre bereit, Steuern zu zahlen. Und schließlich hätte der ehrliche Kaufmann dabei das Nachsehen, denn er wäre genauso ungeschützt wie jeder Verbraucher.«
»Es ist schwer verständlich, dass die Basis für all diese Dinge meine dreifach einzureichenden Steuererklärungen sind.«
Die Berührung seiner Hände war keineswegs unangenehm, lenkte jedoch kolossal ab, und sein Lächeln noch mehr. Nie in ihrem Leben hatte Shelby bei einem Mann ein so unwiderstehliches Lächeln gesehen.
»Es wird immer eine Überschneidung zwischen Bürokratie und Notwendigkeit bestehen.« Alan hörte erstaunt seiner eigenen Stimme zu. Was, zum Teufel, sollte das? Warum unterhielt er sich in dieser schönen Frühlingsnacht über so trockene Themen mit einem Mädchen, das einem Märchenwesen glich und einen aufreizenden Duft verbreitete?
»Das Beste an den Gesetzen ist, dass man unzählige Möglichkeiten hat, sich drum herumzuschlängeln«, erklärte Shelby und lachte verhalten. »Wahrscheinlich ist das nun wieder Ihre Existenzgrundlage.«
Durch das geöffnete Fenster drang die kühle, autoritäre Stimme eines Mannes: »Mag sein, dass Nadonley seinen Finger genau am Puls der amerikanisch-israelischen Beziehungen hat, aber mit dieser Politik macht er sich keine Freunde.«
»Seine mittelmäßige, nachlässige Kleidung wirkt auch etwas merkwürdig«, entgegnete ein anderer.
»Typisch«, sagte Shelby leise und verzog ihren Mund. »Wie doch auf Äußerlichkeiten geachtet wird, vielleicht mehr als auf die erbrachte Leistung. Dunkler Anzug und weißes Hemd – man ist ein Konservativer. Legerer Look und Kaschmirpullover steht für liberale Gesinnung.«
Alan bemerkte erstaunt den kritischen Unterton in Shelbys Stimme. An mehr oder weniger unsachliche Urteile über seinen Beruf war er gewöhnt. Meistens überhörte er solche Bemerkungen. Von ihr mochte er dergleichen nicht hören, ihre Worte ärgerten ihn. »Sie vereinfachen gern, nicht wahr?«
»Nur dann, wenn mir etwas nicht wichtig genug ist, Geduld dafür aufzubringen.« Sie zuckte mit den Schultern. »Die Politik ist ein ärgerliches Nebenprodukt der gesellschaftlichen Ordnung, seitdem Moses sich auf Debatten mit Ramses eingelassen hat.«
Um Alans Mund spielte wieder das besondere Lächeln. Shelby kannte ihn nicht, sonst hätte sie es deuten können. Diese Unterhaltung amüsierte ihn nun doch, und er wollte sie herausfordern. »Sie scheinen Politiker nicht besonders zu mögen«, stellte er fest.
»Was diese Leute betrifft, so kann ich nur verallgemeinern, was ich sonst nicht so leicht tue«, erwiderte Shelby. »Es gibt sie in verschiedenen Spielarten. Sie sind entweder Pedanten oder Fanatiker, manche sind machthungrig, andere schwach. Es hat mich immer bedrückt, dass unsere komische Welt von einer Hand voll Männer allein regiert wird. Deshalb«, sie schob den Teller energisch zurück, »versuche ich mir vorzumachen, ich hätte absolute Kontrolle über mein eigenes Schicksal.« Die Schatten der Bäume malten eigenartige Linien auf Alans Gesicht, und Shelby hätte sie gern mit ihren Fingerspitzen nachgezogen. »Möchten Sie wieder hineingehen?«
»Nein.« Alan strich mit dem Daumen über die Innenhaut ihres Handgelenks. Erstaunt fühlte er, wie ihr Puls sich beschleunigte. »Wie sehr ich mich dort drinnen gelangweilt hatte, merkte ich erst, als wir beide uns hier niedergelassen haben.«
Spontan leuchtete Shelbys Lächeln auf. »Das ist ein sehr nettes Kompliment, und so unterkühlt gebracht. Sind Sie etwa irischer Abstammung?«
Er schüttelte den Kopf, weil er sich gerade vorstellte, wie diese frischen, mädchenhaften Lippen schmecken würden. »Ich bin Schotte«, sagte er dann.
»Gütiger Himmel, ich auch!« Shelby runzelte die Stirn, als gefiele ihr diese Tatsache gar nicht. »Allmählich glaube ich, hier ist die Vorsehung am Werk. Aber die war mir immer schon unheimlich.«
»Warum eigentlich? Da Sie doch Ihr Schicksal so souverän lenken.« Alan führte ihre Hand zum Mund und küsste die schlanken Finger.
»Allerdings«, gab sie zu. »Ich nehme das Steuer lieber selbst in die Hand, das gehört zur Campbell’schen Lebensweisheit.«
Erstaunt sah sie auf, denn Alan brach jäh seine höchst angenehmen Zärtlichkeiten ab und lachte laut und herzlich. »Auf die alte Familienfehde!«, rief er und hob sein Glas. »Ich gehöre nämlich zum Clan der MacGregors. Ihre und meine Vorfahren haben sich unter den Klängen von Dudelsackmusik gegenseitig umgebracht.«
Shelby stimmte in sein Gelächter ein. »Mein Großvater würde mich bei Wasser und Brot einsperren, wenn ich Ihnen auch nur Auskunft darüber gäbe, wie spät es ist. Ein verrückter, verflixter MacGregor also!« Alan freute sich, aber Shelbys Gesicht wurde ernst. »Sie sind demnach Alan MacGregor«, stellte sie leise fest. »Der Senator von Massachusetts.«
»Getroffen.«
Seufzend erhob sich Shelby. »Das ist sehr, sehr schade. Ich muss jetzt leider gehen.«
Alan hielt ihre Hand fest und stand auch auf. Sie waren jetzt einander so nahe, dass sich ihre Körper berührten, nahe genug, um sich der gegenseitigen Attraktion bewusst zu werden.
»Was meinen Sie damit?«
»Vielleicht hätte ich dem Zorn meines Großvaters getrotzt«, sagte Shelby und wunderte sich, wie heftig ihr Herz klopfte. »Ja, ich glaube, das hätte ich gewagt.« Nachdenklich blickte sie in Alans Augen. »Aber ich verabrede mich nie mit einem Politiker.«
»Tatsächlich?« Alan konnte sich nicht an ihrem Mund sattsehen. Eigentlich hatte er doch noch gar nicht um ein Wiedersehen gebeten, und Frauen, die so direkt waren, lagen ihm sonst in keiner Weise. Aber Shelby gehörte zu einer besonderen Art, und es passte zu ihr. »Ist das eine von Shelbys Regeln?«
»Ja, eine der wenigen.«
Sie benutzte keinen Lippenstift, sicher wäre sie einem Kuss nicht ausgewichen. Aber statt sein Glück zu versuchen, zog Alan nur wieder ihre Hand an seinen Mund. Forschend schaute er sie an. »Das Beste an den Gesetzen«, zitierte er, »sind die unzähligen Möglichkeiten, sich drum herum zu schlängeln.«
»Gefangen in der eigenen Schlinge«, gab Shelby zögernd zu und entzog ihm ihre Hand. Es erschreckte sie, wie ihre Nerven auf diesen Alan MacGregor reagierten. Der Ausdruck in seinen dunkelbraunen Augen zeigte deutlich, dass es ihm ähnlich erging.
»Gut, Senator«, verabschiedete sie sich mit fester Stimme. »Es war nett, Sie kennenzulernen. Aber nun wird’s Zeit, dass ich mich wieder bei den anderen Gästen sehen lasse.«
Alan wartete, bis Shelby fast die Tür erreicht hatte, dann erst antwortete er: »Wir sehen uns wieder, Shelby Campbell.«
Sie blieb stehen und schaute über die Schulter zurück. »Das liegt im Bereich der Möglichkeiten.«
»Nein, es ist ganz sicher.«
Dort stand er im Mondlicht – groß, geheimnisvoll und sprungbereit. Sein Gesicht verriet nichts, aber Shelby hatte das Gefühl, dass sie ihm nicht den kleinen Finger reichen dürfte, ohne Gefahr zu laufen, mit Haut und Haaren verschlungen zu werden. Es reizte sie ungemein, das auszuprobieren. Lässig warf sie den Kopf mit dem störenden Pony zur Seite.