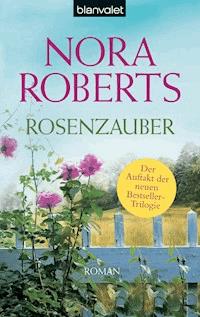4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die MacGregor-Serie
- Sprache: Deutsch
Familie, Liebe, Leidenschaft: Der faszinierende MacGregor-Clan.
Für die Dorfbewohner ist Grant Campbell, der zurückgezogen in einem Leuchtturm wohnt, ein Sonderling. Und unfreundlich dazu. Doch als er in einer stürmischen Nacht der Malerin Genevieve Grandeau die Tür öffnet, ist sie in seinen Bann geschlagen. Wild wie die tosende See sind die Liebesnächte, die sie miteinander verbringen. Unter seinem attraktiven, rauen Äußeren ist er intelligent und sensibel, aber auch verletzt. Für Gennie heißt Lieben jedoch Teilen. Kann er das letzte Hindernis für ihre Liebe überwinden?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Nora Roberts
Die MacGregors 4
Bei Tag und bei Nacht
Roman
Aus dem Amerikanischenvon Patrick Hansen
WILHELM HEYNE VERLAG MÜNCHEN
1. KAPITEL
Gennie wusste sofort, dass sie endlich gefunden hatte, was sie suchte, als sie die ersten schindelgedeckten Häuser von Windy Point erblickte.
Dieser Ort entsprach ganz ihrer Vorstellung von einem urwüchsigen, verträumten Fischerdorf an der Küste von Maine. Andere Gegenden, durch die sie gefahren war, mochten reizvoller, malerischer und vollkommener sein und aufs Haar den bunten Ansichtskarten gleichen, aber vielleicht hatte gerade ihre Perfektion Gennie gestört.
Der Wunsch, ihr Talent auf einem neuen Gebiet zu prüfen, war die treibende Kraft gewesen, sich zu einem Arbeitsurlaub zu entschließen. Gennies bisherige Bilder waren geprägt von Fantasie und Mystifikation. Doch jetzt sollte die Vorstellungskraft der Realität weichen, ohne Rücksicht darauf, wie sich diese darstellte. Im Kofferraum ihres Wagens stapelten sich schon Skizzen von schroffen Klippen und bewegter See, doch Gennie spürte noch immer das nagende Gefühl der Unzufriedenheit in sich.
Windy Point schien die Antwort auf alle Fragen zu sein. Statt schattenspendender Laubbäume sah man verkümmerte Kiefern und Fichten, knorrig und verwittert. Rechts und links von der mit Schlaglöchern übersäten Straße standen einzelne Häuser, die durch die Sonne und den salzigen Wind alt und verblasst wirkten. An den Fenstern und Türen splitterte die Farbe ab, doch das alles machte keinen ärmlichen oder vernachlässigten Eindruck, sondern schien zäh und widerstandsfähig.
Gennie erkannte die zweckmäßige Schönheit. Es gab keine unrationellen Gebäude oder Schnörkel. Jedes Haus hatte seinen Sinn: ein Kurzwarengeschäft, die Poststelle und die Apotheke. Der Grundriss der Wohnbungalows war einfach und praktisch. Überall umgab ein Garten die weit herabreichenden Schindeldächer. Ihr simples Grau stand in fröhlichem Kontrast zu der bunten Blumenpracht. Der hintere Teil der Gärten bestand aus sehr gepflegten Gemüsebeeten. Die Petunien durften vielleicht ein wenig wild durcheinanderwachsen, doch zwischen den Zwiebeln und Karotten gab es kein einziges Unkrautpflänzchen.
Durch das offene Wagenfenster drang der typische Geruch des Dorfes herein. Es roch ganz eindeutig nach Fisch.
Gennie fuhr bis zum Ende der Siedlung, denn sie wollte einen kompletten Gesamteindruck bekommen. Erst beim Kirchhof hielt sie an. Hier wehte hohes Gras sanft zwischen mächtigen Granitgrabsteinen. Als sie den Wagen wendete, fand sie die alte, holprige Straße erstaunlich geräumig. Man trat hier seinem Nachbarn nicht ohne Weiteres auf die Füße, es sei denn, mit voller Absicht.
Höchst zufrieden parkte Gennie ihren Wagen vor dem Kurzwarenladen. Es war zu erwarten, dass sich hier der Mittelpunkt von Windy Points Mitteilungs- und Nachrichtenwesen befand.
In einem alten, hölzernen Schaukelstuhl saß ein Mann. Natürlich war ihm Gennies Fahrt durch den Ort und wieder hierher zurück keinesfalls entgangen. Aber er tat, als interessierte sie ihn nicht. Ohne die gleichmäßigen Schwingbewegungen zu unterbrechen, reparierte er geschickt einen defekten Hummerfangkorb. Er wandte sein von Sonne und Wind gebräuntes Gesicht keine Sekunde von der Arbeit in den rauen, kräftigen Händen ab.
Gennie nahm sich fest vor, ihn genauso zu zeichnen, wie er jetzt vor ihr saß. Sie stieg aus dem Wagen und klemmte ihre Handtasche unter den Arm. Dann trat sie auf den Mann zu.
»Hallo!«
Der alte Mann nickte nur, ohne sich stören zu lassen. »Brauchen Sie Hilfe?«
»Ja.« Gennie lächelte. Seine bedächtige Art zu sprechen gefiel ihr. »Vielleicht können Sie mir sagen, wo ich ein Zimmer oder ein Häuschen für ein paar Wochen mieten kann.«
Der Ladenbesitzer schaukelte weiter, aber jetzt betrachtete er Gennie prüfend mit schlauen, leicht trüben Augen. Sie kommt aus der Stadt, vermutete er etwas geringschätzig. Wahrscheinlich aus dem Süden. Alles, was weiter entfernt war als Boston, fiel unter diesen Sammelbegriff. Sie sah sauber und hübsch aus, obwohl ihr dunkler Teint mit den hellen Augen fast fremdländisch wirkte. Aber das gehörte wohl dazu, wenn eine aus dem Süden stammte.
Gennie störte ihn nicht, während er nachdachte. Sie strich ihr langes schwarzes Haar zurück und atmete tief die würzige Seeluft ein. Sie hatte in den vergangenen Wochen gelernt, dass die Leute hier in New England zwar im Allgemeinen recht freundlich und großzügig waren, aber alles seine Zeit brauchte.
Wie eine Touristin wirkt sie nicht, dachte er, sie gleicht eher den Märchenwesen in den Bilderbüchern der Enkelkinder. Das schmale Gesicht mit der festen Kinnlinie und den betonten Wangenknochen macht einen guten Eindruck. Wenn sie lächelt, dann strahlen die blaugrünen Augen wie das Meer in der Sonne. »Hierher kommen nicht viele Feriengäste«, entgegnete er schließlich, »und schon gar nicht zu dieser Jahreszeit.«
Gennie wusste, dass er bestimmt keine neugierigen Fragen stellen würde. Doch wenn es ihr nützlich erschien, dann konnte sie mitteilsam sein.
Sie sah ihm direkt in die Augen. »Da haben Sie wohl recht. Ich glaube nicht«, sagte sie ruhig, »dass ich als Feriengast zu bezeichnen bin, Mr. …«
»Fairfield – Joshua Fairfield.«
»Genevieve Grandeau.« Sie reichte ihm die Hand zu einem angenehm festen Händedruck, wie er zufrieden bemerkte.
»Ich bin Künstlerin und möchte eine Zeit lang hier malen.«
Eine Künstlerin also! Er überlegte weiter. Gegen Bilder hatte er nichts einzuwenden. Als Hobby ließ er die Malerei gelten, aber er bezweifelte, dass man sich damit tatsächlich den Lebensunterhalt verdienen könnte. Trotzdem – die junge Dame hatte ein sehr gewinnendes Lächeln, und sie hielt sich stolz und aufrecht.
»Möglicherweise weiß ich ein kleines Haus«, meinte er. »Es liegt aber ungefähr zwei Meilen außerhalb der Ortschaft.«
Der Schaukelstuhl ächzte, als er sich schneller vor- und rückwärts bewegte. »Die Witwe Lawrence hat’s noch nicht verkauft. Vielleicht vermietet sie es Ihnen.«
»Das klingt vielversprechend. Wo kann ich sie erreichen?«
»Gehen Sie einfach über die Straße in die Poststelle.« Er deutete mit dem Finger in die Richtung. Nach einigem Zögern fügte er hinzu: »Sagen Sie ihr, dass ich Sie geschickt habe.«
Gennie lächelte ihm zu. »Vielen Dank, Mr. Fairfield.«
Im Postbüro sah Gennie eine Frau in dunklem Baumwollkleid hinter dem Tresen stehen und Briefe sortieren.
Das muss die Witwe Lawrence sein, dachte Gennie mit Vergnügen und bestaunte die sorgsam aufgesteckten Zöpfe am Hinterkopf der Frau, die sich durch ihr Eintreten nicht stören ließ.
»Entschuldigen Sie bitte! Sind Sie Mrs. Lawrence?«
Die Angesprochene unterbrach ihre Tätigkeit und drehte sich um. Ihr Blick wanderte prüfend über Gennies Gestalt. »Kann ich Ihnen behilflich sein?« Sie trat näher.
»Ich hoffe es. Mr. Fairfield sagte mir, dass Sie vielleicht ein Häuschen zu vermieten hätten.«
Die Frau hob erstaunt eine Augenbraue. »Das Haus steht zum Verkauf.«
»Ja, das weiß ich.« Gennie versuchte es wieder mit ihrem allerschönsten Lächeln. Sie wollte hierbleiben, und die zwei Meilen Entfernung vom Ort erschienen ihr geradezu ideal. »Besteht die Möglichkeit, dass Sie es mir für ein paar Wochen vermieten? Ich kann Ihnen Referenzen geben, wenn Sie Wert darauf legen.«
Mrs. Lawrence studierte Gennie mit kühlem Blick. Sie bildete sich lieber ihr eigenes Urteil. »Wie lange wollen Sie bleiben?«
»Einen Monat, vielleicht sechs Wochen.«
Jetzt betrachtete sie Gennies Hände. Ein schlichter goldener Ring blitzte an der linken Hand auf.
»Sind Sie allein?«, forschte sie.
»Ja.« Gennie lächelte wieder. »Ich bin nicht verheiratet, Mrs. Lawrence. Ich reise für mehrere Monate durch New England und male. Hier in Windy Point möchte ich eine Weile arbeiten.«
»Sie malen?« Die Witwe unterzog Gennie erneut einer kritischen Prüfung.
»Ja.«
Mrs. Lawrence hatte inzwischen festgestellt, dass sie Gennie leiden mochte. Die Fremde redete nicht andauernd und blieb bei der Sache. Dazu kam, dass ein leeres Haus nichts taugte. »Es ist sauber dort, und die Installation funktioniert.« Offensichtlich war die Entscheidung zu Gennies Gunsten gefallen. »Vor zwei Jahren wurde das Dach neu gedeckt, allerdings hat der Ofen seine Launen. Von den zwei Schlafzimmern ist eines unmöbliert.«
Gennie spürte, dass die Beschreibung Mrs. Lawrence nicht leichtfiel, obwohl ihre Stimme fest blieb.
Sie dachte sicher an all die Jahre, die sie dort gelebt hatte.
»Nachbarn gibt es keine«, fuhr Mrs. Lawrence fort, »und das Telefon ist nicht mehr angeschlossen. Doch das ließe sich machen, wenn Sie es wünschen.«
»Das alles klingt wundervoll, Mrs. Lawrence.«
Aus Gennies Ton klang Mitgefühl und Sympathie. Die ältere Frau räusperte sich. Dann nannte sie eine Summe als monatliche Miete. Der Betrag war wesentlich geringer, als Gennie erwartet hatte. Nun zögerte sie keinen Moment länger.
»Ich nehme es.«
Erstaunen lag in Mrs. Lawrences Blick. »Sie wollen es nicht erst ansehen?«
»Das ist nicht nötig.« Gennie zog ihr Scheckbuch aus der Tasche und schrieb die Summe aus.
Mrs. Lawrence studierte Gennies Unterschrift.
»Genevieve heißt das«, half Gennie, »nach meiner französischen Großmutter. Mich nennt aber fast jeder Gennie.«
Eine Stunde später klapperten die Schlüssel in Gennies Tasche. Zwei Kartons mit Lebensmitteln standen auf dem Rücksitz des Wagens, und sie ließ die Häuser des Ortes hinter sich. Amüsiert dachte sie an den bewundernden Ausdruck im sommersprossigen Gesicht des Ladenhelfers, der gewiss in seinem jungen Leben noch keine leibhaftige Malerin erblickt hatte.
Es wurde schnell dunkler. Die Wolken zogen tief und machten keinen freundlichen Eindruck. Der Wind frischte zusehends auf, und Gennie spürte einen Hauch von Abenteuer. Erwartungsvoll fuhr sie an der Küste entlang und versuchte, den Schlaglöchern so gut wie möglich auszuweichen.
Die Vorliebe für Abenteuer lag ihr im Blut. Wahrscheinlich war sie von ihrem Ur-Urgroßvater vererbt worden, der ein harter, kompromissloser Seeräuber gewesen war. Ohne Gewissensbisse nahm er sich, was er haben wollte. Zu Gennies gehüteten Schätzen gehörte das alte Logbuch, in das Philippe Grandeau seine Untaten ehrlich und mit feinem Sinn für Ironie wahrheitsgetreu niedergeschrieben hatte.
Gennies praktischer Sinn für Ordnung stammte möglicherweise von ihren aristokratischen Vorfahren mütterlicherseits. Aber sie gestand sich offen ein, dass sie ohne Zögern sofort mit dem Piraten Philippe davongesegelt wäre und jede aufregende Minute genossen hätte.
Der Wagen sprang von einem Loch ins andere, doch das machte Gennie nichts aus. Begeistert betrachtete sie die raue, urwüchsige Landschaft, die sich von ihrer Heimatstadt New Orleans so sehr unterschied, als wäre es ein anderer Planet. Das hier war kein Ort für Müßiggang und süßes Leben. In dieser felsigen, stürmischen Natur musste man immer hellwach sein, der kleinste Fehler konnte fatal werden.
Gennie erkannte, wie Land und Wasser einander bekämpften. An jedem Tag rückte das Meer eine Winzigkeit vor. Diese Stimmung musste sie unbedingt in ihren Bildern festhalten.
Obwohl die Schatten länger wurden und der Abend näher rückte, stoppte sie den Wagen und stieg aus, um ein paar Schritte näher an die auflaufenden Wellen zu treten. Der Geruch nach Fisch und Tang war hier viel intensiver, doch das beachtete Gennie ebenso wenig wie den Sturm, der aufzuziehen schien. Es erwartete sie ja niemand, und das Gefühl absoluter Freiheit war herrlich. Mit Skizzenblock und Stift in der Hand suchte Gennie sich einen Platz auf den Felsen. Von dieser wohltuenden Einsamkeit würde sie zu Hause noch oft träumen!
Gennie begann zu zeichnen und war sofort ganz in ihre Arbeit vertieft. Windy Point war ein Glücksfall für ihre Arbeit, und das kleine Haus der Witwe Lawrence bildete die ideale Ergänzung. Erst als sie den Block sinken ließ, merkte Gennie, wie dunkel es inzwischen geworden war, und ging zum Wagen zurück.
Noch viele herrliche Tage lagen vor ihr, niemand würde sie stören oder ablenken. Lächelnd drehte Gennie den Zündschlüssel um und betätigte den Anlasser.
Die einzige Reaktion war ein heiseres Schnarren. Sie probierte es noch einmal, mit dem gleichen Ergebnis. Schon in Bath hatte ihr Auto diese Tücken gezeigt, aber dort war eine Werkstatt in der Nähe gewesen, und man hatte den Schaden angeblich repariert.
So ein Pech! Gennies Kenntnisse von Motor und Elektrik waren äußerst gering, und es würde zu nichts führen, wenn sie die Motorhaube öffnete und an diesem oder jenem Draht zöge. Außerdem war die einzige Lichtquelle eine kleine Taschenlampe aus dem Handschuhfach.
Wie lange war sie gefahren? Sollte sie die Strecke zu Fuß fortsetzen oder in den Ort zurückkehren? Vielleicht hatte sie Glück und begegnete einem Fahrzeug. Doch vorläufig war es weit und breit stockdunkel. Wahrscheinlich hatte sie schon über die Hälfte des Weges hinter sich gebracht und könnte das Haus in einer Viertelstunde erreichen.
Gennie ergab sich in ihr Schicksal, zuckte mit den Schultern und marschierte los.
Im schwachen Licht der Lampe konnte Gennie fast nichts sehen. Sie kam nur langsam voran und stolperte häufig über Wurzeln oder Steine.
Obwohl es inzwischen Nacht geworden war, wurde es keineswegs ruhig und leise. Der Sturm zerrte an Gennies Haar, pfiff und heulte und trieb immer dickere Nebelschwaden vor sich her. Hoffentlich würde sie bald am Ziel sein.
Normalerweise hätte ihr ein kräftiger Regenguss nicht viel ausgemacht, aber jetzt wurde Gennies Abenteuerlust auf eine harte Probe gestellt. Es schüttete wie aus Kannen, das Wasser peitschte in ihr Gesicht, und die nackten Füße glitschten in den vollkommen durchnässten, leichten Sommersandalen schmerzhaft hin und her.
Langsam wurde Unbehagen zu Beschwerlichkeit, und Gennie bekam Angst. Grelles Wetterleuchten ließ die Bäume und Büsche am Rand der Straße wie bizarre Gestalten erscheinen. Saßen hässliche Kobolde hinter den Felsen und lachten sie aus? Gennie summte irgendein albernes Lied und konzentrierte sich auf den winzigen Lichtkegel ihrer Lampe.
Ich bin nass bis auf die Haut, sagte sie sich und strich das Haar aus dem Gesicht, aber daran werde ich nicht sterben. Das Haus muss ganz in der Nähe sein.
Die Schwierigkeit bestand darin, bei Sturm, Nebel und Donner die Kate von Mrs. Lawrence zu finden, die wahrscheinlich ein wenig abseits der Straße lag. Vielleicht war sie schon längst daran vorbeigelaufen. Das fehlte noch! Dann müsste sie wieder zurück zum Wagen gehen. Es wäre tatsächlich ein kleines Wunder, wenn sie bei diesem Wetter das unbewohnte Haus fände.
Ich war dumm, schalt Gennie sich und verschränkte zitternd die Arme. Die einzige Möglichkeit, die ihr jetzt blieb, war, den Rückmarsch anzutreten und im Auto auf das Ende des Sturmes zu warten.
Ein Umherirren im Gewitter erschien ihr wesentlich schlimmer, als eine unbequeme Nacht im Auto zu verbringen. Außerdem befand sich in einem Karton auf dem Rücksitz eine Packung mit Keksen.
Aufseufzend ließ Gennie nochmals den Schein der Taschenlampe kreisen und starrte dann in die Dunkelheit, die nun noch schwärzer wirkte. Sie drehte sich um und wollte zurückgehen, als sie plötzlich ein Licht sah. Gennie blinzelte und wischte den Regen aus den Augen. Es war keine Täuschung. Das bedeutete Schutz, Wärme und menschliche Gesellschaft. Ohne Zögern eilte sie auf den hellen Punkt zu.
Ungefähr eine Meile war Gennie gegangen. Der Wind heulte, und der Weg wurde immer schlechter. Feurige Blitze zuckten über den Himmel. Gennie musste sich auf jeden Schritt konzentrieren, um nicht hinzufallen, und kam nur sehr langsam voran. Würde sie jemals wieder trocken und warm werden?
Allmählich rückte das Licht näher. Das Tosen der Brandung klang böse und unheimlich. Gennies Herz klopfte, am liebsten wäre sie kopflos in die Dunkelheit gerannt. Doch sie bekämpfte ihre Angst und prüfte genau, wohin sie die Füße setzte. Als endlich die Umrisse eines Gebäudes durch den Regen schimmerten, lachte und weinte sie zugleich.
Es war ein alter Leuchtturm, ein steinerner Beweis dafür, dass Menschen einander halfen. Der Lichtschein kam jedoch nicht von der Turmspitze aus starken, sich drehenden Lampen, sondern aus einem erhellten Fenster. Also wohnte hier jemand. Gennie zögerte nicht lange und lief, so schnell sie nur konnte, auf den hohen Turm zu.
Wahrscheinlich saß dort ein knurriger alter Mann, der früher zur See gefahren war. Sicherlich würde er ihr Rum und heißen Tee anbieten. In diesem Moment zuckte ein besonders greller Blitz über den nächtlichen Himmel, und Gennies Sympathie für den Leuchtturmwärter stieg ins Unermessliche.
Mithilfe ihrer kleinen Taschenlampe suchte sie die Mauer nach dem Eingang ab. Das erleuchtete Fenster lag weit oben, ungefähr auf dem dritten Treppenabsatz.
Der Sturm heulte laut und übertönte beinahe Gennies Klopfen an der dicken, harten Holztür, obwohl sie mit der Kraft ihrer Verzweiflung dagegentrommelte. War sie gezwungen, so dicht vor dem Ziel zu kapitulieren? Nein – wer immer hier drinnen war, er musste sie einlassen! Irgendwann würde er den Lärm von hier unten wahrnehmen.
Erschöpft lehnte sich Gennie an das nasse, raue Holz. Ihre Fäuste schmerzten, und die Schläge wurden schwächer. Als sich die Tür plötzlich öffnete, verlor sie das Gleichgewicht und stolperte in den dahinterliegenden Flur. Sie wäre unweigerlich gefallen, hätte nicht jemand mit festem, sicherem Griff ihren Arm gepackt.
»Dem Himmel sei Dank!«, stammelte Gennie. »Ich fürchtete schon, dass Sie mich nie mehr hören würden!« Mit ihrer freien Hand strich sie das tropfnasse Haar aus der Stirn und schaute zu der Person auf, die sie als ihren Lebensretter betrachtete.
Erstaunt erkannte Gennie, dass der Mann weder alt noch knorrig, sondern jung und schlank war. Seine gebräunten, wettergegerbten Züge erinnerten an einen Seefahrer. Er hatte dichtes, dunkles Haar, das vom Sturm zerzaust und achtlos zurückgestrichen war. Der ausdrucksvolle Mund wirkte sinnlich, und die aristokratische Nase passte nicht ganz in das zerklüftete Gesicht.
Gennie stellte fest, dass seine tiefbraunen Augen sie keineswegs neugierig oder gar freundlich musterten. Der Fremde war offensichtlich ärgerlich über die Störung.
»Wie zum Teufel sind Sie hierhergekommen?«
Die Frage entsprach nicht ganz dem Empfang, den Gennie in einer solchen Situation erwartet hatte, aber der furchterregende Marsch durch das Unwetter saß ihr noch in den Gliedern. »Ich bin gelaufen«, sagte sie deshalb einfach.
»Gelaufen?«, wiederholte er ungläubig. »In diesem Wetter? Von woher?«
»Ein paar Meilen von hier entfernt ist mein Wagen stehen geblieben.« Gennie zitterte, einerseits vor Kälte und andererseits, weil sie sich ärgerte. Der Mann hielt sie noch immer fest, und vor Erschöpfung ließ Gennie es geschehen.
»Weshalb sind Sie in einer solchen Nacht unterwegs gewesen?«
»Ich … ich habe das Haus von Mrs. Lawrence gemietet. Als mein Wagen streikte, bin ich zu Fuß weitergegangen. Aber ich muss wohl die Abzweigung in der Dunkelheit verfehlt haben. Dann sah ich Ihr Licht.« Gennie seufzte und spürte plötzlich, dass sie auf sehr zittrigen Beinen stand. »Darf ich mich setzen?«
Er starrte sie eine Minute lang an, murmelte eine unverständliche Antwort und deutete auf das Sofa im Hintergrund. Gennie sank darauf nieder, lehnte ihren Kopf gegen die Lehne und bemühte sich um Fassung.
Was soll ich nur mit ihr machen? fragte sich Grant. Mit gerunzelter Stirn sah er auf Gennie herab. Das wirre Haar klebte an ihrem Kopf, es war schwarz wie die Nacht, und die Spitzen lockten sich ein wenig. Ihr Gesicht erschien nicht besonders zart oder fein, aber es war schön und erinnerte an die königlichen Damen auf mittelalterlichen Gemälden. Die nasse Kleidung klebte an ihrem Körper und verhüllte wenig von den festen, schlanken Formen.
Normalerweise hätten schon Gesicht und Figur Grant beeindruckt. Was ihn jedoch für einen Moment total verwirrt hatte, waren ihre Augen gewesen: seegrün, unglaublich groß und etwas schräg stehend. Nixenaugen, dachte er. Einen Herzschlag lang – oder einen halben nur – überlegte Grant, ob er es vielleicht mit einem mythischen Wesen zu tun hätte, das vom Sturm ans Ufer geschleudert worden war.
Ihre Stimme klang sanft. Obwohl Grant den Tonfall der Südstaatler erkannte, wirkte ihre Sprache fast fremdländisch im Vergleich zu dem harten Dialekt der Küstenbevölkerung, an den er sich gewöhnt hatte. Grant gehörte aber ganz und gar nicht zu den Männern, die es ausnutzten, wenn der Zufall ihnen leichtes Spiel machte. Als Gennie ihre Augen wieder aufschlug und ihm zulächelte, wünschte er inbrünstig, niemals seine Haustür geöffnet zu haben.
»Es tut mir leid«, begann Gennie, »ich bin ein wenig durcheinander gewesen, nicht wahr? Möglich, dass ich kaum länger als eine Stunde draußen war. Aber es schien mir wie eine Ewigkeit. Ich heiße Gennie.«
Grant hakte die Daumen in seine Hosentaschen und runzelte wieder die Stirn. »Campbell«, erwiderte er, »Grant Campbell.« Das war alles, und sein Blick wurde auch nicht freundlicher.
Gennie versuchte nun, das Gespräch neu zu beginnen. »Mr. Campbell – ich kann Ihnen gar nicht beschreiben, wie erleichtert ich war, als ich in der Dunkelheit ein erleuchtetes Fenster entdeckte.«
Grant betrachtete Gennie genau und überlegte, warum ihr Gesicht ihm bekannt erschien. »Die Abzweigung zum Lawrence’schen Grundstück liegt mehr als eine Meile zurück.«
Erstaunt über den Ton seiner Worte zog Gennie eine Augenbraue hoch. Sollte das tatsächlich heißen, dass er sie in die Nacht zurückschicken wollte? Im Allgemeinen war sie stolz auf ihre Ruhe und Beherrschung, aber jetzt fror sie in den nassen Kleidern, und Grants finstere Miene gab ihr den Rest. »Hören Sie, ich möchte Ihnen eine Tasse Kaffee abkaufen und für den Rest der Nacht dieses Sofa benutzen.«
»Ich nehme keine Pensionsgäste.«
»Und wahrscheinlich würden Sie einem kranken Hund noch einen Tritt verpassen, wenn er Ihnen über den Weg liefe!«, entfuhr es Gennie. »Aber ich denke nicht daran, jetzt wieder hinauszugehen in das Unwetter, und ich möchte Ihnen nicht raten, mich mit Gewalt vor die Tür zu setzen.«
Ihre Worte belustigten Grant, doch sein Gesicht blieb unbewegt. Er wehrte sich nicht gegen Gennies falsche Beschuldigung. Niemals wäre es ihm in den Sinn gekommen, sie zurück in den Sturm zu schicken. Er hatte nur seinem Unbehagen Ausdruck verliehen und feststellen wollen, dass er ihr Geld nicht nehmen würde. Normalerweise – und wenn er nicht so verärgert über diese Störung gewesen wäre – hätte ihm die Haltung des durchnässten, blassen Mädchens sehr imponiert.
Wortlos ging er auf einen großen, altertümlichen Eichenschrank zu und wühlte darin herum. Gennie zwang sich, nicht hinzusehen, obwohl sie hörte, dass er etwas einschenkte.
»Sie brauchen Brandy jetzt nötiger als Kaffee«, meinte er und hielt ihr ein Glas unter die Nase.
»Danke!«, sagte Gennie in dem eisigen Tonfall, den die Frauen aus den Südstaaten weltmeisterlich beherrschten. Sie nippte nicht, sondern trank das Glas in einem Zug aus. Durch den plötzlichen Wärmeschock wurde ihr wohler, und ihr Kreislauf stabilisierte sich.
Grant konnte ein Lächeln nur schwer unterdrücken. »Möchten Sie noch einen?«
»Nein«, erwiderte Gennie kühl, »danke.« Reserviert höflich gab sie das Glas zurück.
Sie hat mich gekonnt zurechtgewiesen, musste Grant sich eingestehen.
Was ist nun zu tun? überlegte Grant. Durch die dicken Wände des Leuchtturmes war das Heulen und Peitschen des Sturmes deutlich zu vernehmen. Sogar die kurze Fahrt zum Haus der Witwe Lawrence könnte ungemütlich, wenn nicht gefährlich werden. Die Fremde hier unterzubringen machte weniger Mühe. Mit einer Verwünschung, die eher resigniert als bösartig klang, wandte er sich von Gennie ab.
»Na gut, dann kommen Sie mit«, befahl er, ohne sich noch einmal nach ihr umzusehen. »So können Sie nicht den Rest der Nacht sitzen bleiben und frieren.«
Gennie überlegte ernsthaft, ob sie mit ihrer Tasche nach ihm werfen sollte.
Der gewendelte Treppenlauf entzückte sie. Fast wäre ihr eine begeisterte Bemerkung entschlüpft, aber sie hielt sich noch rechtzeitig zurück. Die eisernen Stufen liefen rund um eine aufstrebende Säule höher und höher hinauf, ohne dass ein Ende erkennbar war. Grant stieg bis zum zweiten Absatz, der gut zwanzig Fuß über dem ersten liegen mochte. Er bewegte sich im Dunkeln mit der Sicherheit einer Katze, während Gennie sich am Geländer festhielt und wartete, bis er das Licht anknipste. Besonders hell wurde es auch dann nicht, und lange Schatten fielen auf den hölzernen Fußboden.
Durch eine Tür trat Grant in einen Raum, der offensichtlich als Schlafzimmer diente. Nicht sehr groß, auch nicht besonders ordentlich, doch mit einem breiten, antiken Messingbett in der Mitte, in das Gennie sich sofort verliebte.
Er kramte ungeduldig in einer alten Kommode und zog schließlich einen verwaschenen Bademantel hervor.
»Die Dusche befindet sich auf der anderen Seite vom Treppenhaus«, erklärte er kurz und drückte ihr das Kleidungsstück in die Hand. Dann drehte er sich um und verschwand.
»Vielen Dank«, murmelte Gennie. Aber Grants Schritte klapperten bereits wieder die Stufen hinunter. Mit stolz erhobenem Haupt und glänzenden Augen ging Gennie in die angegebene Richtung.
Das Bad war zauberhaft! Zu schneeweißem Porzellan glänzten Armaturen und Ständer aus Messing, die von Grant offensichtlich regelmäßig poliert wurden. Auch dieser Raum war nicht groß, aber irgendwann hatte jemand sich die Mühe gemacht, die Wände mit gelacktem Zedernholz zu verkleiden. Ein Waschbecken stand auf zierlichen Beinen, darüber hing ein hübscher schmaler Kristallspiegel. Das Licht kam von der Decke, man musste an einer langen Seidenkordel ziehen.
Endlich konnte Gennie ihre unangenehm feuchten Kleider ausziehen. Sie kletterte in die Wanne und zog den Vorhang zu. Wundervoll heißes Wasser strömte aus der Dusche, und langsam kehrten Wärme und Wohlbehagen in ihren Körper zurück. Gennie war sicher, dass es im Paradies nicht schöner sein könnte, auch dann nicht, wenn ein Teufel Wache hielt.
Grant stand inzwischen in der Küche und brühte frischen Kaffee auf. Nach kurzem Nachdenken öffnete er eine Dose mit Suppe. Schließlich musste er seinem Gast etwas anbieten. In diesem Raum, an der Rückseite des Turmes, war die tobende See lauter zu vernehmen. Im Allgemeinen beachtete Grant solche Geräusche nicht mehr, denn er hatte sich daran gewöhnt. Heute aber klang der Sturm besonders stark und böse. Von seiner Arbeit hätte er Grant allerdings nicht abhalten können.
Musste ausgerechnet er ein durchnässtes Mädchen, das sich verlaufen hatte, vor seiner Haustür finden? Die Zeit, die sie ihm stahl, würde er später nachholen müssen. Doch der erste Ärger war vorüber, und Grant hatte sich damit abgefunden. Eine heiße Mahlzeit und ein schützendes Dach musste er ihr anbieten, aber dabei sollte es bleiben.
Wie sie ausgesehen hatte, als sie nass und zitternd auf dem alten Sofa kauerte. Er musste lächeln. Diese Lady war kein Schwächling – glücklicherweise! Denn für solche hatte Grant sehr wenig übrig.
Wenn er Gesellschaft suchte, dann bevorzugte er das Zusammensein mit Menschen, die ihre eigene Meinung sagten und auch dazu standen. Dadurch war erst kürzlich sein selbst auferlegter Zeitplan durcheinandergeraten.
Vor knapp einer Woche war er aus Hyannis Port wiedergekommen. Dort hatte seine Schwester Shelby geheiratet. Grant hatte sie dem Bräutigam Alan MacGregor bei der Zeremonie übergeben. Zu seinem unbehaglichen Erstaunen waren diese Feierlichkeiten ihm mehr als erwartet unter die Haut gegangen. Die MacGregors gefielen ihm, sie hatten keine Mühe, ihn zu überreden, ein paar Tage länger bei ihnen zu bleiben. Besonders der polternde, mächtige Daniel MacGregor war als Familienoberhaupt sehr beeindruckend gewesen. Dabei schloss Grant sich wirklich nicht so leicht an jemanden an. Schon seit seiner Kindheit war er in dieser Beziehung sehr zurückhaltend. Die Familie MacGregor jedoch erwies sich als einfach unwiderstehlich.
Natürlich wäre es die Aufgabe seines Vater gewesen, Shelby dem Ehemann zuzuführen. Aber er war tot, und Grant musste seinen Platz einnehmen. So mischten sich schmerzliche Erinnerungen mit der glücklichen Gegenwart. Das Zusammensein mit den MacGregors lenkte Grant wohltuend von trüben Gedanken ab, und er kehrte entspannt nach Windy Point zurück. Sogar Daniels neugieriges Eindringen in seine geheiligte Privatsphäre hatte Grant amüsiert geduldet. Er war selbst überrascht, wie sehr er sich über eine Einladung zum Wiederkommen freute.
Grants Arbeit war dadurch allerdings liegen geblieben, doch das würde sich trotz dieser erneuten kurzen Unterbrechung aufholen lassen. Für den Rest der Nacht konnte der ungebetene Besuch im Gästezimmer untergebracht werden. Morgen würde Grant sich des Mädchens, so schnell es ging, entledigen.
Trotz des Sturmes und dem Brausen der Wellen hörte Grant Gennie kommen. Er drehte sich um und wollte sie mit einer nichtssagenden Bemerkung begrüßen, aber ihr Anblick wirkte wie ein Schlag unter die Gürtellinie.
Verdammt, diese Frau war schön! Zu schön für sein seelisches Gleichgewicht. Ihre zierliche Gestalt versank beinahe in seinem großen Bademantel, die Ärmel hatte sie fast bis zu den Ellbogen aufgerollt. Das verblichene Blau betonte den honiggelben Schimmer ihrer Haut, und feuchtes, streng zurückgebürstetes Haar umrahmte ihr Gesicht, nur an den Schläfen kringelten sich ein paar widerspenstige Locken. Die blassgrünen Augen hinter tiefschwarzen Wimpern erinnerten ihn wieder an eine Meerjungfrau.
»Setzen Sie sich!«, sagte er barsch. Er war wütend auf sich selbst, weil er Gennie so begehrenswert fand. »Sie können einen Teller Suppe essen.«
Gennie zögerte und musterte die ihr zugekehrte Rückenansicht, doch dann setzte sie sich. »Besten Dank.«
Unverständliches Gemurmel war die Antwort, und ein Teller mit dampfender Suppe landete unsanft vor ihr auf dem einfachen Holztisch. Gennies Hunger siegte über ihren Stolz, und sie griff nach dem Löffel. Erstaunlicherweise nahm Grant ihr gegenüber Platz und aß ebenfalls.
In der kleinen, hell erleuchteten Küche war es sehr ruhig. Nur das Getöse der aufgebrachten Naturgewalten unterbrach gelegentlich die Stille. Zunächst hielt Gennie ihren Blick trotzig auf den Teller gerichtet, doch dann sah sie sich um. Jeder Winkel hier wurde vortrefflich genutzt, eingepasste Hängeschränke aus Eichenholz boten reichlich Platz für Geschirr und Töpfe. Die Arbeitsfläche war aus dem gleichen Material, jedoch glatt gehobelt und poliert. Eine Kaffeemaschine und ein Toaster sorgten für modernen Komfort.
In seiner Küche hielt Grant offensichtlich mehr Ordnung als in den übrigen Räumen. In der Spüle standen weder schmutzige Tassen, noch bemerkte Gennie Staub oder Flecken auf dem Boden. Es roch appetitlich nach Suppe und Kaffee. Nachdem der größte Hunger gestillt war, verflog ihr Ärger.
Schließlich war sie ziemlich unvermittelt in sein Privatleben eingedrungen. Und einen Fremden mit offenen Armen zu empfangen und ihm Gastfreundschaft zu gewähren war eben nicht jedermanns Sache. Er hatte es zwar ungern getan, aber er hatte sie aufgenommen. Der Bademantel war trocken und warm, und Gennie genoss die heiße Suppe. Langsam beruhigte sich ihr verletzter Stolz.
Mit einem kleinen Seufzer ließ Gennie den Blick über den Tisch wandern, bis er an Grants Händen haften blieb. Gütiger Himmel, dachte sie erstaunt, was hat er für schöne Hände! Die schlanken Gelenke wirkten nicht etwa zerbrechlich, sondern rassig, kraftvoll und stark. Die sonnengebräunten Handrücken und die langen Finger erschienen Gennie maskulin und ausdrucksstark.
Einen Augenblick lang vergaß sie den Rest ihres Gegenübers vor Begeisterung angesichts seiner Hände. Und weil sie erstaunt über ihre eigenen Empfindungen war, fühlte sie eine Regung, unterdrückte sie aber. Wahrscheinlich würde sich jede Frau bei diesem Anblick fragen, wie sich das Streicheln der geschmeidigen Finger auf der nackten Haut anfühlte. Ungeduldige Hände – Hände, die einer Frau die Kleider vom Leib reißen oder sie sehr behutsam ausziehen konnten, noch ehe sie sich dessen bewusst war.
Als Gennie merkte, dass ein Prickeln ihr über den Rücken lief, riss sie sich zusammen.
Da sie sich ihrer Erregung bewusst war, hob sie leicht verlegen den Blick. Grant hatte Gennie kühl und sachlich wie ein Wissenschaftler beobachtet. Es war ihm nicht entgangen, dass sie bei der Betrachtung seiner Hände das Essen unterbrochen hatte. Leider verbargen die langen Wimpern den Ausdruck ihrer grünen Augen. Grant wartete geduldig. Er wusste, dass sie früher oder später aufschauen würde. Er war auf eisigen, ablehnenden Zorn oder frostige Höflichkeit in ihren Augen gefasst. Die Benommenheit in ihren Zügen verwirrte ihn, besser gesagt, sie machte ihn neugierig. Das beinahe schmerzhafte Verlangen nach ihr wurde durch die deutliche Verwundbarkeit noch stärker. Als sie vorhin in sein Haus gestolpert war – nass und erschöpft –, war sie ihm nicht so wehrlos erschienen. Was könnte sie wohl tun, wenn er sie jetzt an sich reißen würde? Wie zum Teufel kam er auf solche Gedanken?
Sie starrten einander an. Jeder kämpfte mit höchst unerwünschten Gefühlen. Währenddessen trieb der Sturm den Regen klatschend gegen die Fenster und schirmte ihre Welt gegen die übrige Zivilisation ab. Grant dachte wieder, dass sie wie eine dem Meer entstiegene Versuchung ausschaute. Gennie war sicher, dass er es mit ihrem seeräuberischen Vorfahren hätte aufnehmen können.
Die Stuhlbeine kratzten gegen den Fußboden, als Grant sich erhob. Gennie schreckte zusammen.
»Das Gästezimmer liegt auf dem zweiten Absatz.« Der Ausdruck seiner Augen war hart und verhalten vor Ärger über sich selbst.
Gennie fühlte, dass ihre Hände vor Nervosität feucht waren, und das machte sie wütend.
»Das Sofa reicht mir absolut«, entgegnete sie kühl.
Er zuckte mit den Schultern. »Wie Sie wünschen.« Ohne ein weiteres Wort verließ er die Küche.
Gennie wartete, bis Grants Schritte auf der Treppe verklangen. Wenn ich noch einmal im Dunkeln ein Licht sehe, schwor sie sich, dann lauf ich, so schnell ich nur kann, in die entgegengesetzte Richtung!
2. KAPITEL
Grant hasste es, wenn man ihn störte. Er tolerierte Verwünschungen, Drohungen und Missachtung, aber er verabscheute jede Art der Unterbrechung. Solange er denken konnte, hatte sein Vater sich um die Gunst anderer Menschen bemühen müssen, weil dies eine Notwendigkeit für die Karriere eines Senators war, dessen Ziel darin bestand, das höchste Amt des Landes zu bekleiden.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: