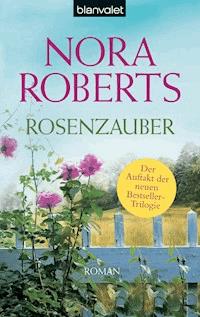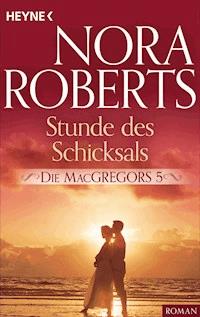
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die MacGregor-Serie
- Sprache: Deutsch
Familie, Liebe, Leidenschaft: Der faszinierende MacGregor-Clan.
Daniel MacGregor hat das beste Leben, das man sich wünschen kann. Ihm fehlt nur eines: Die perfekte Frau. Er weiß, dass er sie in Anna Whitfield gefunden hat, der selbstbewussten Medizinstudentin. Sie weiß, was sie will. Und was sie nicht will: Einen etwas zu dominanten Mann wie Daniel. Der muss sich etwas einfallen lassen, um die Meinung der wunderbarsten Frau zu ändern, die er je kennenlernen durfte. Und mit ihr eine Ehe einzugehen, die vierzig Jahre überdauern wird und die Wurzeln für eine große, beeindruckende Familiendynastie bildet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Nora Roberts
Die MacGregors 5
Stunde des Schicksals
Roman
Aus dem Amerikanischenvon Patrick Hansen
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
PROLOG
»Mutter!«
Anna MacGregor nahm die Hände ihres Sohnes, als er sich vor sie hockte. Panik, Angst und Trauer wallten in ihr auf und trafen auf eine unerschütterliche Mauer aus Willenskraft. Sie würde jetzt nicht die Beherrschung verlieren. Ihre Kinder waren da.
»Caine.« Ihre Finger waren eiskalt, aber sie zitterten nicht. Ihr Gesicht hatte durch die Anspannung der letzten Stunden alle Farbe verloren, ihre Augen blickten dunkel. Dunkel, jung und voller Angst. Caine hatte seine Mutter nicht ein Mal verängstigt erlebt. Noch nie.
»Ist alles in Ordnung mit dir?«
»Natürlich.« Sie wusste, was er brauchte, und küsste ihn leicht auf die Wange. »Mir geht es schon besser, jetzt, da du hier bist.« Mit der Rechten ergriff sie die Hände ihrer Schwiegertochter Diana, als diese sich neben sie setzte. Einige letzte Schneeflocken glitzerten noch auf Dianas langem dunklen Haar sowie an ihrem Mantel. Anna holte tief Luft und sah Caine an. »Ihr seid schnell gekommen.«
»Wir haben ein Flugzeug gechartert.« In dem erfolgreichen Anwalt und jungen Vater steckte im Grunde ein kleiner Junge, der dies alles nicht fassen konnte. Sein Vater war der MacGregor. Sein Vater war unbesiegbar und konnte unmöglich bewusstlos im Krankenhaus liegen. »Wie schlimm ist es?«
Anna war Ärztin und hätte ihm alles genau erklären können – die Rippenbrüche, die Gehirnerschütterung und die inneren Blutungen, die ihre Kollegen gerade zu stillen versuchten. Aber sie war auch Mutter. »Er ist noch im OP.« Sie drückte seine Hand und brachte beinahe ein Lächeln zustande. »Er ist stark, Caine. Und Dr. Feinstein ist der beste Chirurg, den wir hier haben. Wo ist Laura?«
»Bei Lucy Robinson«, antwortete Diana leise. »Mach dir keine Sorgen.«
Diesmal gelang Anna ein mattes Lächeln. »Nein, aber du kennst Daniel. Laura ist seine erste Enkelin. Wenn er aufwacht, wird er sofort nach ihr fragen.« Und aufwachen wird er, dachte sie. Bei Gott, er würde aufwachen.
»Anna.« Diana legte den Arm um ihre Schwiegermutter. Sie wirkte so schmal und zerbrechlich. »Hast du etwas gegessen?«
»Wie?« Anna schüttelte den Kopf und stand auf. Drei Stunden. Seit drei Stunden war er jetzt im OP. Wie oft war sie selbst dort gewesen, um ein Leben zu retten, während die Angehörigen des Patienten hier draußen warteten? Sie war Ärztin geworden, um Leid zu lindern. Aber jetzt, wo ihr Ehemann in Lebensgefahr schwebte, konnte sie nichts tun. Nur warten. Wie jede andere Frau. Nein, das stimmte nicht. Sie kannte den OP, die Geräusche, die Gerüche. Sie kannte die Instrumente, die Maschinen und den Schweiß nur zu gut. Sie wollte schreien. Sie verschränkte die Hände ineinander und trat ans Fenster.
Hinter diesen dunklen, ruhigen Augen lag ein eiserner Wille verborgen. Jetzt brauchte sie ihn für sich selbst, für ihre Kinder, aber am meisten für Daniel. Wäre es möglich, ihn durch reine Willenskraft zurückzubringen, sie würde es tun. Sie wusste, zum Heilen gehörte mehr als nur Medizin und ärztliches Können.
Der Schnee fiel inzwischen nur noch spärlich. Als es begonnen hatte zu schneien, waren die Straßen überfroren, und das Schneetreiben hatte einem jungen Mann die Sicht genommen. Sein Auto war ins Schleudern geraten und frontal mit diesem albernen kleinen Zweisitzer ihres Mannes zusammengestoßen. Anna ballte die Fäuste.
Warum hast du nicht die Limousine genommen, du alter Kerl? Was wolltest du mit diesem angeberischen roten Spielzeug beweisen? Immer prahlen, immer großtun, immer … Ihre Gedanken schweiften ab, wanderten zurück in die Vergangenheit. Hatte sie sich nicht auch gerade deshalb in ihn verliebt? War das nicht einer der Gründe, weshalb sie ihn seit fast vierzig Jahren liebte und mit ihm lebte? Verdammt, Daniel MacGregor, nie lässt du dir etwas sagen. Anna presste die Finger auf ihre Augen und hätte fast aufgelacht. Wie oft hatte er sich das von ihr anhören müssen. Und wie sehr bewunderte sie ihn genau deswegen.
Als hinter ihr Schritte erklangen, fuhr sie herum. Alan, ihr ältester Sohn, hatte den Warteraum betreten. Noch vor der Geburt ihres ersten Kindes hatte Daniel sich geschworen, dass eines Tages einer seiner Nachkommen im Weißen Haus amtieren würde. Und auch wenn Alan jetzt kurz davorstand, seinem Vater diesen Wunsch zu erfüllen, so war er doch das einzige ihrer Kinder, das mehr nach seiner Mutter als nach seinem Vater kam. Die Gene der MacGregors waren stark. Jetzt ließ sie sich von ihm in den Arm nehmen.
»Er wird sich freuen, dich zu sehen«, sagte sie ruhig, auch wenn sie am liebsten endlos geweint hätte. »Aber er wird dir den Kopf waschen, weil du deine Frau in ihrem Zustand mitgebracht hast«, fügte sie hinzu und lächelte Shelby an. Ihre Schwiegertochter mit dem Haar wie Feuer und den warmen Augen war hochschwanger. »Du solltest dich setzen.«
»Nur wenn du es auch tust.« Ohne Annas Antwort abzuwarten, führte Shelby sie zu einem Sessel. Als Anna sich setzte, reichte Caine ihr einen Kaffee.
»Danke«, murmelte sie und nippte daran. Der Kaffee war heiß und stark, verbrannte ihr fast die Zunge, aber sie schmeckte nichts. Anna hörte das Klingeln von elektronischen Beepern, das Knirschen von Gummisohlen auf Linoleum. Krankenhäuser. Hier war sie genauso zu Hause wie in der Burg, die Daniel für sie beide gebaut hatte. Sie hatte sich immer wohl in Krankenhäusern gefühlt, zuversichtlich in den keimfreien Räumen. Jetzt fühlte sie sich hilflos.
Caine ging unruhig auf und ab. Es war seine Natur – das ständige In-Bewegung-Sein, das scharfe Beobachten. Wie stolz waren sie und Daniel gewesen, als er seinen ersten Fall gewann. Alan saß neben ihr, still, schweigsam, abwartend. So wie er immer war. Er litt. Sie sah, wie Shelby seine Hand nahm, und sie war beruhigt. Ihre Söhne hatten gut gewählt. Unsere Söhne, sagte sie in Gedanken, als versuche sie mit Daniel zu kommunizieren. Caine seine ruhige, starke Diana, Alan die quirlige, unkonventionelle Shelby. Ein Gegengewicht, ein Ausgleich war ebenso unerlässlich für eine gute Beziehung wie Liebe und Leidenschaft. Sie hatte das in ihrem Leben gefunden. Ihre Söhne hatten es gefunden. Und ihre Tochter …
»Rena!« Caine eilte zu seiner Schwester, zog sie in seine Arme.
Wie ähnlich sie sich doch waren. So schlank, so stolz. Serena war diejenige, die am meisten vom Temperament und dem Dickkopf ihres Vaters mitbekommen hatte. Und jetzt war ihre Tochter selbst Mutter. Anna spürte die ruhige Stärke, die Alan neben ihr ausstrahlte. Sie alle waren erwachsen geworden. Wann war das eigentlich passiert? Wir haben es gut gemacht, Daniel … Anna schloss die Augen. Nur einen Moment. Einen Moment durfte sie sich das erlauben. Du würdest mich doch nicht ganz allein diese Freude genießen lassen …
»Dad?« In einer Hand hielt Serena die Finger ihres Bruders, mit der anderen fasste sie nach ihrem Mann.
»Er ist noch im OP.« Caines Stimme war rau vor Sorge, als er Justin ansah. »Ich bin froh, dass ihr kommen konntet. Mom braucht uns alle.«
»Mom.« Serena kniete vor ihrer Mutter, wie sie es immer getan hatte, wenn sie Trost und Zuspruch brauchte. »Er wird es schaffen. Er ist stur, und er ist stark.«
Aber Anna erkannte den flehenden Blick in den Augen ihrer Tochter. »Natürlich wird er es schaffen.« Sie sah zu dem Mann ihrer Tochter hin. Justin war ein Spieler. Wie Daniel. Leicht berührte sie Serenas Wange. »Meinst du etwa, er würde sich ein solches Familientreffen entgehen lassen?«
Serena lächelte mit zitternden Lippen. »Genau das hat Justin auch gesagt.« Er hatte schon den Arm um seine Schwester gelegt. Serena stand auf und drückte sie an sich. »Diana. Wie geht es Laura?«
»Sie ist ein echter Schatz. Sie hat gerade ihren zweiten Zahn bekommen. Und Robert?«
»Ein Wildfang. Eben ein MacGregor.« Serena dachte an ihren Sohn, der seinen Großvater schon jetzt verehrte. »Shelby, wie fühlst du dich?«
»Dick«, erwiderte die schwangere Frau lächelnd und verschwieg, dass die Wehen bereits vor über einer Stunde eingesetzt hatten. »Ich habe meinen Bruder angerufen.« Sie wandte sich zu Anna. »Grant und Gennie kommen auch. Ich hoffe, das ist in Ordnung.«
»Natürlich.« Anna tätschelte ihre Hand. »Die beiden gehören doch zur Familie.«
»Dad wird begeistert sein.« Serena schluckte. »Dieser ganze Wirbel um ihn … Und dann möchten Justin und ich noch etwas verkünden.« Sie sah ihn an. »Justin und ich werden ein zweites Kind bekommen. Wir wollen doch sichergehen, dass die Familie weitergeführt wird. Mom …« Ihre Stimme wurde brüchig, als sie sich wieder hinkniete. »Dad wird sich darüber freuen, nicht wahr?«
»Ja.« Anna küsste Serena auf beide Wangen. Sie dachte an die Enkel, die sie hatte, und an die, die sie noch haben würde. Familie, Fortbestand, Unsterblichkeit. Daniel. Immer wieder Daniel. »Er wird natürlich behaupten, dass ihm allein die Ehre dafür zukommt.«
Die Zeit zog sich dahin. Anna stellte ihren Kaffee ab, kalt und ungetrunken. Vier Stunden und zwanzig Minuten. Es dauerte zu lange. Neben ihr zuckte Shelby zusammen und begann tief durchzuatmen. Automatisch legte Anna eine Hand auf den gewölbten Bauch ihrer Schwiegertochter.
»Wie ist der Abstand?«, erkundigte sie sich.
»Etwas unter fünf Minuten.«
»Seit wann?«
»Ein paar Stunden.« Shelbys Blick verriet ein wenig Aufregung, ein wenig Angst. »Etwas über drei, um genau zu sein. Ich wünschte, ich hätte die Zeit besser abgepasst.«
»Du hast es perfekt getimt. Möchtest du, dass ich dich begleite?«
»Nein.« Shelby lehnte sich an Annas Schulter. »Es wird schon gut gehen. Es wird alles gut gehen. Alan …« Sie streckte ihrem Mann beide Hände entgegen. »Ich werde das Baby nicht im Georgetown Hospital bekommen.«
Behutsam zog er sie hoch. »Nein?«
»Ich werde es hier bekommen. Und zwar bald.« Sie lachte, als er argwöhnisch die Augen zusammenkniff. »Bei einem Baby solltest du es erst gar nicht mit Logik versuchen, Alan. Ich glaube, es ist gleich so weit.«
Der ganze Clan drängte sich um sie, bot Hilfe, Rat und Aufmunterung an. In gewohnt ruhiger Art rief Anna eine Krankenschwester und verlangte nach einem Rollstuhl. Entschlossen drückte sie Shelby hinein. »Ich werde nach dir sehen.«
»Uns geht es gut.« Shelby griff nach Alans Hand. »Uns allen. Sag Dad, dass es ein Junge wird. Dafür werde ich sorgen.«
Anna sah den beiden nach, bis die Fahrstuhltür sich hinter ihnen schloss. Sekunden später erschien Dr. Feinstein auf dem Korridor. »Sam«, rief Anna und eilte zu ihm.
In der Tür des Warteraums hielt Justin Caine zurück. »Lass ihr eine Minute«, murmelte er.
»Anna.« Der Chirurg legte eine Hand auf ihre Schulter. Jetzt war sie nicht nur eine Kollegin, die er respektierte. Sie war auch die Frau eines Patienten. »Er ist ein kräftiger Mann.«
Sie spürte Hoffnung in sich aufsteigen. »Kräftig genug?«
»Er hat viel Blut verloren, Anna, und er ist nicht mehr jung. Aber wir haben die Blutungen stoppen können.« Er zögerte, doch er respektierte sie zu sehr, um auszuweichen. »Wir hatten ihn schon verloren, aber er hat sich zurück ins Leben gekämpft. Wenn der Lebenswille zählt, Anna, hat er eine verdammt gute Chance.«
Sie schlang die Arme eng um sich. Ihr war plötzlich eiskalt. »Wann kann ich ihn sehen?«
»Er wird gerade auf die Intensivstation gebracht.« Seine Hände schmerzten von der langen Operation, aber er hielt ihre Schultern mit festem Griff. »Anna, ich muss dir nicht erklären, was die nächsten vierundzwanzig Stunden bedeuten können.«
Leben oder Tod. »Nein, das musst du nicht. Danke, Sam, du hast Großes geleistet. Ich werde mit meinen Kindern sprechen. Dann komme ich nach oben.«
Sie drehte sich um und ging davon. Eine kleine, anmutige Frau, in deren schwarzes Haar sich erste silberne Fäden gewoben hatten. Ihr Gesicht war fein geschnitten, die Haut noch so zart wie in ihrer Jugend. Sie hatte drei Kinder aufgezogen, in ihrem Beruf Karriere gemacht und über die Hälfte ihres Lebens einen einzigen Mann geliebt.
»Er ist aus dem OP«, verkündete sie ruhig. »Sie bringen ihn gerade auf die Intensivstation. Die Blutungen sind unter Kontrolle.«
»Wann können wir zu ihm?«, fragten gleich mehrere.
»Sobald er aufwacht.« Ihre Stimme klang fest. »Ich werde heute Nacht hierbleiben.« Sie sah auf die Uhr. »Er soll wissen, dass ich bei ihm bin. Aber vor morgen früh wird er nicht sprechen können.« Mehr Hoffnung konnte sie ihnen nicht machen. »Ich möchte, dass ihr auf die Entbindungsstation geht und nach Shelby seht. Dann fahrt nach Hause und wartet. Ich rufe an, sobald sich sein Zustand verändert.«
»Mutter …«
Mit einem Blick brachte sie Caine zum Schweigen. »Tut bitte, was ich euch sage. Ich möchte, dass ihr frisch und ausgeruht seid, wenn euer Vater euch sieht.« Sie strich ihrem Sohn über die Wange. »Tut es für mich.«
Mit diesen Worten drehte sie sich um und ging zu ihrem Mann.
Er träumte. Trotz der Medikamente wusste Daniel, dass er träumte. Es war eine Welt aus weichgezeichneten Bildern, durchzogen von Erinnerungen. Trotzdem ließ er sich nicht darin treiben, sondern kämpfte sich an die Oberfläche. Als er die Augen öffnete, sah er Anna. Er brauchte nichts anderes mehr. Sie war wunderschön. Wie immer. Die starke, energische, intelligente Frau, die er erst bewundert, dann geliebt und schließlich respektiert hatte. Er versuchte sie zu berühren, aber seine Hand gehorchte ihm nicht. Wütend über seine Schwäche versuchte er es ein zweites Mal, bis er Annas sanfte Stimme hörte.
»Beweg dich nicht, Liebling. Ich gehe nicht weg. Ich bleibe hier und warte auf dich.« Ihm war, als würde er ihre Lippen an seinem Handrücken spüren. »Oh, ich liebe dich so sehr, Daniel MacGregor.«
Seine Lippen zuckten. Dann fielen ihm die Augen wieder zu.
1. KAPITEL
Ein Imperium. Als er fünfzehn wurde, schwor Daniel MacGregor sich, dass er eines Tages eines errichten und regieren würde. Und er hielt immer Wort.
Jetzt war er dreißig und arbeitete an seiner zweiten Million. Mit derselben Energie, die ihm die erste eingebracht hatte. Dafür setzte er entweder seine Muskelkraft, seinen Kopf oder auch List und Tücke ein, je nachdem, was nötig war. Als er vor fünf Jahren nach Amerika gekommen war, hatte er ein wenig Geld in der Tasche gehabt. Er hatte es gespart, während er sich vom Minenarbeiter zum Chefbuchhalter hocharbeitete. Zudem hatte er einen messerscharfen Verstand und brennenden Ehrgeiz mitgebracht.
Er hätte gut als Regent durchgehen können. Hochgewachsen und breitschultrig war er, eine eindrucksvolle Gestalt. Seine Größe hatte ihn vor vielen Schlägereien bewahrt, war aber auch für manche Männer eine Herausforderung gewesen, sich mit ihm zu messen. Daniel machte beides nichts aus. Ihm eilte der Ruf voraus, aufbrausend und unbeherrscht zu sein, dabei betrachtete er sich selbst eigentlich als ruhigen und ausgeglichenen Menschen. Nein, in seiner Sturm-und-Drang-Zeit hatte er nicht mehr Nasen gebrochen als nötig. Gut aussehend fand er sich nicht unbedingt. Sein Kinn war kräftig und hart, von den Schläfen bis zur Wange verlief eine Narbe, die von einem eingebrochenen Stützbalken stammte, der ihn im Stollen getroffen hatte. Als Teenager hatte er sich aus Eitelkeit den ersten Flaum stehen lassen, der mit den Jahren zu einem tiefroten, gepflegten Vollbart gewachsen war. Das volle Haar war zu lang, um der Mode zu entsprechen. Es ließ ihn wild und erhaben zugleich aussehen, eine Kombination, die ihm gefiel. Als Gegensatz zu den hohen Wangenknochen wirkte sein Mund erstaunlich weich. Die Augen, strahlend blau, blitzten voller Humor, wenn er lachte und es auch meinte. Genauso wie sie eiskalt wurden, wenn er lächelte und es nicht so meinte.
Imposant. So wurde er beschrieben. Und verwegen. Daniel war es egal, wie man ihn nannte, solange man ihn wahrnahm. Er war ein Spieler, der kein Risiko scheute. Immobilien waren sein Rouletterad, Aktien sein Kartentisch. Wenn Daniel spielte, dann um zu gewinnen. Die Risiken, die er eingegangen war, hatten sich gelohnt. Den Gewinn hatte er wieder eingesetzt. Er war kein Mensch, der auf Nummer sicher ging. Mit der Sicherheit kam unweigerlich auch die Langeweile.
Obwohl arm geboren, betete Daniel MacGregor das Geld nicht an. Er benutzte es, setzte es ein, spielte damit. Geld war Macht, und Macht war eine Waffe.
Amerika war eine großartige Arena für Handel und Geschäfte. Das schnelllebige New York mit seinen lebenshungrigen Menschen. Das schillernde Los Angeles mit den hohen Einsätzen. Ein Mann mit Ideen konnte hier ein Imperium aufbauen. Daniel hatte in beiden Städten Zeit verbracht, aber er entschied sich schließlich für Boston als seine Heimat. Geld und Macht allein genügten ihm nicht, er suchte auch Stil. Diese Stadt an der Ostküste mit ihrem snobistischen Charme der Alten Welt und der unverbrüchlichen Würde war ideal für Daniel.
Er entstammte einem alten Geschlecht von Kriegern, und sein Stolz auf seine Herkunft war gewaltig. Ebenso gewaltig wie sein Ehrgeiz. Daniel war fest entschlossen, die Linie in starken Söhnen und Töchtern weiterleben zu lassen. Seine Kinder und Enkelkinder würden fortsetzen, was er begonnen hatte. Ein Imperium war sinnlos, wenn man keine Familie besaß, um es an sie weiterzugeben. Und dazu brauchte er als Erstes eine Frau. Sie zu finden und zu erobern war für Daniel eine Herausforderung wie die, eine begehrte Immobilie zu bekommen. Hinter beidem war er her, als er auf dem Sommerball der Donahues erschien.
Er hasste den steifen Kragen und die enge Krawatte, die ihn fast erwürgte. Wenn ein Mann wie ein Baum gebaut war, musste er frei atmen können. Sein Maßanzug war an der Newbury Street in Boston geschneidert worden, zum einen wegen der Größe, zum anderen vor allem aber, weil das Prestige es verlangte. Jeder andere Mann hätte darin elegant ausgesehen, Daniel jedoch wirkte, ob nun in schwarzem Smoking oder in schottischem Kilt, außergewöhnlich, und ihm gefiel das auch.
Cathleen, Maxwell Donahues ältester Tochter, gefiel sein Anblick ebenfalls.
»Mr. MacGregor.« Cathleen kam frisch aus einem exklusiven Internat in der Schweiz und wusste, wie man Tee servierte, Seide bestickte und elegant flirtete. »Ich hoffe, Sie genießen unsere kleine Party.«
Sie hatte ein Gesicht wie aus Porzellan und Haar wie Flachs. Schade nur, dass ihre Schultern so schmal waren. Aber auch Daniel verstand es zu flirten. »Jetzt sogar noch mehr, Miss Donahue.«
Wohlwissend, dass albernes Kichern die meisten Männer vergraulte, lachte Cathleen tief und leise. Ihr Taftrock raschelte, als sie sich zu ihm an das lange Büfett gesellte. Jetzt würde jeder, der die Trüffel- oder Lachsmousse probieren wollte, sie zusammen sehen. Wenn sie den Kopf nur ein wenig drehte, erhaschte sie das Bild in dem großen Wandspiegel, wie sie nebeneinanderstanden. Ihr gefiel, was sie sah.
»Mein Vater hat mir erzählt, dass Sie sich für ein Stück Klippe interessieren, das ihm auf Hyannis Port gehört.« Sie lächelte hinreißend. »Ich hoffe, Sie sind nicht hier, um geschäftliche Dinge zu besprechen.«
Daniel nahm zwei Gläser von dem Tablett, das ein Kellner ihm hinhielt. Er hätte dem Champagner einen Scotch vorgezogen, aber manchmal musste auch er sich anpassen. Während er daran nippte, musterte er Cathleen. Er wusste, dass Maxwell Donahue niemals mit seiner Tochter über Geschäfte gesprochen hätte, aber er nahm ihr die kleine Lüge nicht übel. Im Gegenteil, er bewunderte ihren Versuch, ihn auszuhorchen. Doch gerade deshalb kam sie für ihn nicht infrage. Seine Frau würde zu beschäftigt damit sein, Kinder großzuziehen, um Zeit zu haben, sich in Geschäfte einzumischen.
»Das Geschäftliche steht immer hinter einer schönen Frau. Waren Sie schon einmal dort?«
»Natürlich.« Sie neigte den Kopf, sodass die Brillanten an ihren Ohren das Licht einfingen. »Aber ich lebe lieber in der Stadt. Werden Sie nächste Woche zu der Party der Ditmeyers gehen?«
»Wenn ich in Boston bin.«
»Sie reisen viel.« Cathleen nahm einen Schluck Champagner. Ein Ehemann, der selten zu Hause war, wäre ideal. »Das muss sehr aufregend sein.«
»Nur geschäftlich. Sie sind doch selbst gerade erst aus Paris zurückgekehrt«, entgegnete er.
Dass er ihre Abwesenheit bemerkt hatte, schmeichelte ihr, und fast hätte sie gestrahlt. »Drei Wochen waren einfach nicht genug. Allein die Einkäufe haben so viel Zeit gekostet. Sie glauben nicht, wie viele Stunden ich nur für dieses Kleid bei Anproben verbracht habe.«
Wie sie erwartet hatte, ließ er seinen Blick an ihr hinabgleiten. »Es hat sich gelohnt.«
»Danke.« Als sie aufstand, um zu posieren, wurde sein Blick abwesend. Sicher, Frauen sollten sich hauptsächlich um Mode und Frisuren Gedanken machen, aber er hätte eine anregendere Konversation bevorzugt.
Da sie merkte, dass ihr seine Aufmerksamkeit entglitt, berührte sie hastig seinen Arm. »Waren Sie schon einmal in Paris, Mr. MacGregor?«
Er war in Paris gewesen und hatte die Schrecken des Krieges gesehen. Die hübsche Blondine, die ihn da anlächelte, würde nie wissen, was Krieg bedeutete. Warum auch? Trotzdem nagte eine gewisse Unzufriedenheit an ihm. »Vor einigen Jahren«, antwortete er beiläufig und nippte an dem perlenden Champagner. Er sah sich um. Überall funkelten Juwelen, glitzerte Kristall. Der Raum duftete nach teurem Parfum. In fünf Jahren hatte er sich daran gewöhnt, aber er hatte nicht vergessen, wie Kohlenstaub roch. Er würde es nie vergessen. »Mir gefällt es in Amerika besser. Ihr Vater versteht es, Feste zu geben.«
»Ich bin froh, dass es Ihnen gefällt. Mögen Sie die Musik?«
Er vermisste den Klang der Dudelsäcke noch immer. Das zwölfköpfige Orchester in weißen Smokings war nicht nach seinem Geschmack, aber er lächelte trotzdem. »Sehr.«
Sie warf ihm einen vielsagenden Blick zu. »Aber Sie tanzen nicht.«
Daniel nahm Cathleen das Glas aus der Hand und stellte es zusammen mit seinem ab. »Oh doch, Miss Donahue«, widersprach er und führte sie galant auf die Tanzfläche.
»Cathleen Donahue kennt wirklich keine Zurückhaltung.« Myra Lornbridge knabberte an einem Kanapee und rümpfte die Nase.
»Zieh deine Krallen wieder ein, Myra.« Es war eine leise, von Natur aus sanfte Stimme.
»Es stört mich nicht, wenn jemand unhöflich oder berechnend oder sogar ein wenig dumm ist.« Seufzend schob Myra den letzten Bissen Leberpastete in den Mund. »Aber ich hasse es, wenn jemand sich aufdrängt.«
»Myra.«
»Schon gut, schon gut.« Myra schob den Löffel in die Lachscreme auf ihrem Teller. »Übrigens, Anna, dein Kleid ist sehr schön.«
Anna warf einen Blick auf die rosafarbene Seide. »Du hast es doch ausgesucht.«
Myra lächelte selbstzufrieden. »Wenn du dich nur halb so viel um deine Garderobe kümmern würdest wie um deine Bücher, hätte Cathleen Donahue nicht die geringste Chance gegen dich.«
Anna schaute lächelnd den Tänzern zu. »Cathleen interessiert mich nicht.«
»Stimmt, sie ist auch nicht sehr interessant. Und der Mann, mit dem sie tanzt?«
»Der rothaarige Hüne?«
»Er ist dir also aufgefallen?«
»Ich bin nicht blind.« Anna fragte sich, wann sie gehen konnte, ohne unhöflich zu sein. Sie würde jetzt viel lieber zu Hause sitzen und die medizinische Zeitschrift lesen, die Dr. Hewitt ihr zugeschickt hatte.
»Kennst du ihn?«
»Wen?«
»Anna …« Geduld war eine Tugend, die Myra nur ihren engsten Freunden angedeihen ließ.
Anna lachte. »Also gut, wer ist das?«
»Daniel Duncan MacGregor.« Myra machte eine Kunstpause, um die Neugier ihrer Freundin zu wecken. Mit vierundzwanzig Jahren war Myra reich und attraktiv. Schön. Nein, nicht schön. Selbst an ihren besten Tagen, dessen war Myra sich bewusst, würde sie nicht schön sein. Schönheit war eine Möglichkeit, um an Macht zu gelangen. Verstand eine andere. Myra benutzte ihren Verstand. »Er ist Bostons neueste Koryphäe. Wenn du dich mehr für unsere Kreise interessieren würdest, wüsstest du es.«
Die feine Gesellschaft mit ihren Regeln und Ritualen interessierte Anna nicht im Geringsten. »Wozu? Du wirst es mir bestimmt gleich sagen.«
»Würde dir recht geschehen, wenn ich es dir nicht verrate.«
Aber Anna lächelte nur still und trank von ihrem Glas.
»Na schön, ich sag’s dir.« Klatsch war eine der Versuchungen, denen Myra nie widerstehen konnte. »Bei seinem Namen und Aussehen wird es dich wahrscheinlich nicht erstaunen, dass er Schotte ist. Du müsstest ihn mal reden hören. Dieser Akzent …«
In diesem Moment lachte Daniel so dröhnend, dass Anna unwillkürlich die Augenbrauen hochzog. »Sein Lachen ist auch nicht ohne.«
»Er ist ein wenig ungehobelt, aber manche Leute …«, Myra warf einen vielsagenden Blick auf Cathleen Donahue, »… meinen, dass eine Million Dollar oder mehr alles erträglich machen.«
»Hoffentlich weiß er, mit wem er gerade tanzt«, murmelte Anna.
»Dumm ist er nicht. Vor sechs Monaten hat er ›Old Line Savings and Loan‹ gekauft, eine traditionsreiche Bank und eine ausgezeichnete Investition.«
»Wirklich?« Geld interessierte Anna nur, wenn es half, ein Krankenhaus zu betreiben. Als von links zwei Männer zu ihnen traten, wandte sie sich lächelnd ihnen zu. Es waren Herbert Ditmeyer und ein Gast, den sie nicht kannte. »Hallo.«
»Ich freue mich, Sie zu sehen.« Herbert war kaum größer als Anna, hatte das typisch schmale, hagere Gesicht eines Gelehrten und dunkles Haar, das in wenigen Jahren schütter werden würde. Um den Mund lag jedoch ein entschlossener Zug, und sein Blick verriet eine nicht zu unterschätzende Intelligenz.
»Sie sehen bezaubernd aus.« Er deutete auf den Mann neben ihm. »Mein Cousin Mark. Anna Whitfield und Myra Lornbridge.« Herberts Blick ruhte auf Myra, doch als das Orchester wieder einsetzte, schien sein Mut ihn zu verlassen, und er nahm Annas Arm. »Sie sollten tanzen.«
Anna passte sich seinen Schritten an. Sie liebte es zu tanzen und tat es lieber mit jemandem, den sie kannte. Herbert war ihr vertraut. »Wie ich höre, muss man Ihnen gratulieren.« Sie lächelte ihn an. »Dem neuen Bezirksstaatsanwalt.«
Er strahlte. Er war ausgesprochen jung für das Amt, wollte noch höher hinaus und hätte Anna gern von seinen ehrgeizigen Plänen erzählt, aber das tat man in diesen Kreisen nicht. »Ich war nicht sicher, ob die Neuigkeit bis nach Connecticut vorgedrungen ist.«
Anna lachte, während sie an einem anderen Paar vorbeiwirbelten. »Aber ja. Sie müssen sehr stolz sein.«
»Es ist ein Anfang«, erwiderte er mit gespielter Bescheidenheit. »Und Sie? Noch ein Jahr, und wir werden Sie mit Doktor Whitfield anreden müssen.«
»Ein Jahr«, murmelte Anna. »Manchmal kommt es mir vor wie eine Ewigkeit.«
»Ungeduldig, Anna? Das ist doch sonst nicht Ihre Art.«
Doch, das war es, aber bisher hatte sie es immer erfolgreich zu verheimlichen gewusst. »Ich will, dass es offiziell bekannt ist. Meine Eltern sind nicht gerade begeistert.«
»Nein? Aber Ihre Mutter erzählt überall, dass Sie seit drei Jahren zu den Besten Ihres Studienjahrgangs gehören.«
»Wirklich?«, fragte Anna überrascht. Bislang hatte ihre Mutter eher ihre Frisur gelobt als ihre Noten. »Ich glaube, sie hofft noch immer, dass der richtige Mann vorbeikommt und mich Operationssäle und Bettpfannen vergessen lässt.«
Noch während sie das sagte, drehte Herbert sie im Tanz, und unvermittelt sah sie direkt in Daniel MacGregors Augen. Sie spürte, wie sich in ihr etwas anspannte. Die Nerven? Unsinn. Sie fühlte, wie sie fröstelte. Angst? Welch absurder Gedanke.
Obwohl er noch immer mit Cathleen tanzte, starrte er Anna an. Auf eine Weise, die jede junge Frau zum Erröten gebracht hätte. Annas Herz schlug plötzlich wie wild, aber ihr Blick hielt kühl dem seinen stand. Wahrscheinlich ein Fehler, denn er lächelte langsam, als würde er eine Herausforderung annehmen.
Anna entging nicht, wie er unauffällig zu einem Mann am Rande der Tanzfläche hinüberschaute und fast unmerklich nickte. Sekunden später fand Cathleen sich in den Armen des anderen wieder. Gegen ihren Willen bewunderte Anna Daniel dafür, wie geschickt er seinen nächsten Schritt eingeleitet hatte. Sie war gespannt, was er wohl als Nächstes tun würde.
Routiniert wand er sich zwischen den Tänzern hindurch. Er hatte Anna bemerkt, kaum dass sie die Tanzfläche betreten hatte. Bemerkt, beobachtet und überlegt. Sobald sie seinen Blick kühl erwidert hatte, war er fasziniert gewesen. Sie war kleiner und zarter als Cathleen. Ihr Haar war dunkel und wirkte so weich und warm wie ein edler Pelz. Die Augen passten dazu. Das rosafarbene Kleid brachte ihre makellose Haut und ihre runden Schultern zur Geltung. Sie sah aus wie eine Frau, die perfekt in die Arme eines Mannes passen würde.
Mit jener Zuversicht, die ihn nie verließ, tippte er Herbert auf die Schulter. »Sie gestatten?«
Herbert hatte Anna kaum losgelassen, da hielt Daniel sie schon in den Armen und setzte mit ihr den Tanz fort. »Das war sehr geschickt, Mr. MacGregor«, stellte sie ein wenig atemlos fest.
Dass sie seinen Namen kannte, gefiel ihm. Und dass sie sich so gut in seine Arme schmiegte, wie er es geahnt hatte. »Danke, Miss …?«
»Whitfield, Anna Whitfield. Und es war äußerst unhöflich.«
Verblüfft starrte er sie an, denn die strenge Stimme passte nicht zu ihrer anmutigen Erscheinung. Und da er gute Überraschungen liebte, lachte er, bis andere Paare die Köpfe wandten. »Aye, aber Hauptsache, es hat funktioniert. Ich glaube, wir sind uns noch nie begegnet, Miss Anna Whitfield, aber ich kenne Ihre Eltern.«
»Das ist gut möglich.« Die Hand, die ihre hielt, war riesig, fest und unglaublich sanft. Ihre Handfläche begann zu kribbeln. »Sie sind neu in Boston, Mr. MacGregor?«
»Ja. Ich lebe erst seit zwei Jahren hier, nicht seit zwei Generationen.«
Sie legte den Kopf in den Nacken, um ihm ins Gesicht sehen zu können. »Um nicht neu zu sein, brauchen Sie mindestens drei Generationen.«
»Oder einen hellen Kopf.« Er wirbelte sie dreimal herum.
Dass er für seine Größe unerwartet leichtfüßig war, überraschte sie angenehm. »Wie man mir erzählt hat, haben Sie den«, versetzte sie.
»Das werden Sie wohl noch öfter zu hören bekommen.« Er bemühte sich erst gar nicht, leise zu sprechen, auch wenn die Tanzfläche voll war. Macht war seine Stärke, nicht Bescheidenheit.
»Meinen Sie?« Anna hob eine Augenbraue. »Das wäre ungewöhnlich.«
»Nur, wenn Sie das System nicht verstehen«, korrigierte er unbeeindruckt. »Wenn einem die Herkunft fehlt, braucht man Geld.«
Obwohl sie wusste, wie wahr das war, verachtete sie beide Formen dieses Snobismus. »Wie schön für Sie, dass die feine Gesellschaft so flexibel ist.«
Ihr trockener, beiläufiger Ton ließ ihn lächeln. Anna Whitfield war weder dumm noch ein in Seide gehüllter Raubfisch wie Cathleen Donahue. »Sie haben ein Gesicht wie das einer Kamee, die meine Großmutter am Hals trug.«
Fast hätte sie gelächelt. Eine Miene, die ihm noch einmal klarmachte, dass er lediglich die Wahrheit gesagt hatte. »Danke, Mr. MacGregor, aber heben Sie sich Ihre Schmeicheleien für Cathleen auf. Sie ist dafür empfänglicher.«
Er legte die Stirn in Falten. Sein Blick verfinsterte sich, aber seine bedrohliche Miene erhellte sich rasch, bevor Anna ihre schnippische Bemerkung bereuen konnte. »Sie haben eine spitze Zunge. Ich bewundere Frauen, die offen aussprechen, was sie denken … bis zu einem gewissen Punkt.«
Aus einem unerklärlichen Grund fühlte Anna sich gereizt. Sie wich seinem Blick nicht aus. »Und welcher Punkt wäre das, Mr. MacGregor?«
»Der, an dem es unweiblich wird.«
Bevor sie es sich versah, hatte er sie durch die Terrassentür geschwungen. Erst jetzt wurde ihr bewusst, wie warm und stickig es im Ballsaal geworden war. Trotzdem wäre sie bei jedem anderen Mann, den sie nicht kannte, mit einer knappen, aber entschlossenen Entschuldigung wieder ins Haus zurückgegangen. Jetzt jedoch blieb sie, wo sie war. In Daniels Armen, im Mondschein und umgeben von duftenden Rosen.
»Sicher haben Sie Ihre eigene Auffassung von Weiblichkeit, Mr. MacGregor, aber ich frage mich, ob Ihnen bewusst ist, dass wir bereits im zwanzigsten Jahrhundert leben.«
Es gefiel ihm, wie sie da in seine Arme geschmiegt stand und ihn mehr oder weniger hintergründig beleidigte. »Weiblichkeit, Miss Whitfield, ist für mich etwas, das sich nicht mit den Jahren oder mit jeder Mode wandelt.«
»Aha.« Sie löste sich aus seiner Umarmung und ging nachdenklich an den Rand der Terrasse, näher zum Garten. Die Luft war süßer hier, das Mondlicht schwächer, die Musik klang durch die Entfernung romantischer.
Ihr wurde bewusst, dass sie mit einem Mann, dem sie gerade erst begegnet war, eine intime Unterhaltung führte, noch dazu eine, die gut zu einem Streit führen könnte. Dennoch verspürte sie kein Bedürfnis, es abzubrechen. Sie hatte lernen müssen, sich in der Gesellschaft von Männern nicht unwohl zu fühlen. Als einzige Frau ihres Studienjahrgangs hatte Anna Erfahrung damit, mit Männern auf gleicher Ebene umzugehen, ohne sich ständig an deren Ego zu reiben. Sie hatte die Kritik und Anspielungen im ersten Studienjahr überlebt, indem sie ruhig geblieben war und sich nur auf das Studium konzentriert hatte. Jetzt stand sie vor ihrem Abschlussjahr und hatte es sogar geschafft, sich den Respekt ihrer zukünftigen Arztkollegen zu erwerben. Dennoch war ihr klar, was sie als frischgebackene Assistenzärztin im Krankenhaus erwartete. Als unweiblich bezeichnet zu werden tat zwar noch weh, aber sie hatte sich längst damit abgefunden.
»Ihre Ansichten über Weiblichkeit sind gewiss faszinierend, Mr. MacGregor.« Der lange Rock umwehte ihre Beine, als sie sich umdrehte. »Aber ich glaube nicht, dass ich mit Ihnen darüber diskutieren möchte. Was genau tun Sie in Boston?«, wechselte sie abrupt das Thema.
Er hatte sie nicht gehört. Seit sie sich umgedreht hatte, hatte er überhaupt nichts mehr gehört. Das Haar fiel ihr auf die weißen Schultern. In der hauchzarten rosafarbenen Seide sah sie aus wie eine zerbrechliche Porzellanfigur. Der Mond schien ihr ins Gesicht, ihre makellose Haut schimmerte wie Marmor, und die Augen waren dunkel wie die Nacht. Ein Mann, der vom Blitz getroffen wurde, hörte nichts außer dem Donner.
»Mr. MacGregor?« Zum ersten Mal, seit sie im Freien war, wurde Anna nervös. Er war riesig, ein Fremder, und er sah sie an, als wäre er nicht bei Sinnen. Sie straffte die Schultern und erinnerte sich daran, dass sie jede Situation meistern konnte. »Mr. MacGregor!«
»Ja?« Daniel riss sich aus seinen Fantasien und trat auf sie zu. Seltsamerweise entspannte Anna sich augenblicklich. Jetzt, da er neben ihr stand, wirkte er nicht mehr so bedrohlich. Und seine Augen waren hinreißend. Sicher, es gab einen einfachen genetischen Grund für diese Farbe, sie hätte eine Arbeit über Vererbungslehre schreiben können. Was nichts daran geändert hätte, dass diese Augen faszinierend waren.
»Sie arbeiten in Boston, nicht wahr?«
»Ja.« Vielleicht hatte es am Licht gelegen, dass sie ihm so perfekt, so geheimnisvoll, so verführerisch erschienen war. »Ich kaufe.« Als wollte er sich davon überzeugen, dass es sie wirklich gab, nahm er ihre Hand. »Und verkaufe.«
Seine Hand war so warm und sanft wie beim Tanzen. Anna zog ihre daraus hervor. »Wie interessant. Was kaufen Sie?«
»Was immer ich will.« Lächelnd trat er noch näher an sie heran.
Ihr Puls ging schneller, ihre Haut erglühte. Anna wusste, dass es dafür sowohl emotionale als auch rein körperliche Gründe gab. Auch wenn sie ihr im Moment nicht einfallen wollten, wich sie nicht zurück. »Das muss sehr befriedigend sein. Wobei sich der Gedanke aufdrängt, dass Sie also was auch immer verkaufen, wenn Ihnen nichts mehr daran liegt.«
»Sie haben es erkannt, Miss Whitfield. Und zwar mit Gewinn.«
Eingebildeter Esel, dachte sie und legte den Kopf leicht schief. »Manche Menschen könnten das für äußerst arrogant halten, Mr. MacGregor.«
Ihre kühle, gelassene Stimme begeisterte ihn ebenso sehr wie der kühle, gelassene Blick, in dessen Tiefen er einen Hauch von Leidenschaft entdeckte. Das war eine Frau, die einen Mann dazu bringen konnte, mit Blumen und Pralinen auf der Treppe vor ihrer Haustür zu warten. »Wenn ein armer Mann arrogant ist, wirkt es ungehobelt, Miss Whitfield. Bei einem wohlhabenden Mann nennt man es Stil. Ich war beides.«
Es lag ein wahrer Kern in seinen Worten, aber sie war nicht bereit, auch nur einen Zentimeter nachzugeben. »Seltsam, ich dachte nicht, dass sich Arroganz mit den Jahren oder jeder Mode wandelt«, erwiderte sie.
Ohne sie aus den Augen zu lassen, holte er eine Zigarre heraus. »Der Punkt geht an Sie.« Sein Feuerzeug flammte auf und ließ seine Augen blitzen. In diesem Moment wurde Anna bewusst, dass er doch bedrohlich war.
»Dann sollten wir uns vielleicht auf ein Unentschieden einigen.« Der Stolz hinderte sie daran, zurückzuweichen. Der Anstand ließ es nicht zu, dass sie fortsetzte, was sie – entgegen aller Vernunft – interessant zu finden begann. »Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, Mr. MacGregor. Ich muss wieder zurück.«
Mit einer abrupten, besitzergreifenden Geste nahm er ihren Arm. Anna zuckte nicht zurück, erstarrte auch nicht, sondern bedachte ihn mit einem Blick, den eine Fürstin einem übel riechenden Untertan zuwerfen würde. Die meisten Männer hätten sich davon einschüchtern lassen und um Verzeihung gebeten. Aber nicht Daniel. Er grinste. Das ist ein Mädchen, dachte er, bei dem einem Mann die Knie weich werden können. »Wir sehen uns wieder, Miss Anna Whitfield.«
»Vielleicht.«
»Wir sehen uns wieder.« Er hob ihre Hand an den Mund, und sie spürte seinen erstaunlich weichen Bart an ihrem Handrücken. Eine Sekunde lang flackerte die Leidenschaft auf, die er in ihren Augen hatte glimmen sehen. »Ganz sicher.«
»Das bezweifle ich, da ich nur noch zwei Monate in Boston sein werde. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen …«
»Warum?«
Er ließ ihre Hand nicht los, was sie mehr beunruhigte, als sie sich anmerken ließ. »Warum was, Mr. MacGregor?«
»Warum werden Sie nur noch zwei Monate in Boston sein?« Wenn sie abreiste, um irgendwo zu heiraten, änderte das natürlich einiges. Daniel sah ihr ins Gesicht und entschied, dass selbst das nichts ändern würde.
»Ich werde Ende August in Connecticut das letzte Jahr meines Medizinstudiums beginnen.«
»Medizinstudium?« Er zog die Brauen zusammen. »Ich hatte gedacht, Sie werden Krankenschwester.« In seiner Stimme schwang das Erstaunen eines Mannes mit, der kein Verständnis und nur wenig Toleranz für Frauen hatte, die einen Beruf anstrebten.
»Nein. Ich werde Chirurgin. Danke für den Tanz.«
Bevor sie an der Tür war, ergriff er ihren Arm erneut. »Sie wollen Menschen aufschneiden?« Er lachte. »Sie scherzen.«
Auch wenn sie innerlich kochte, ließ sie sich ihre Verärgerung nicht anmerken und gab sich einfach nur gelangweilt. »Glauben Sie mir, wenn ich scherze, bin ich wesentlich amüsanter. Gute Nacht, Mr. MacGregor.«
»Arzt zu sein ist ein Männerberuf.«
»Zufällig bin ich der Ansicht, dass es so etwas wie einen Männerberuf nicht gibt, wenn eine Frau ihn ebenso gut ausführen kann.«
Er schnaubte und zog an seiner Zigarre. »Blödsinn.«